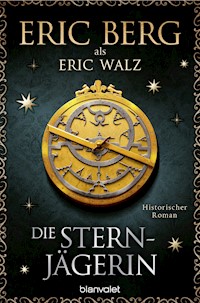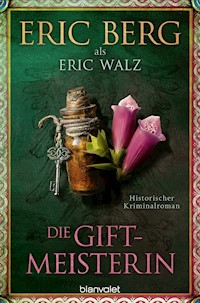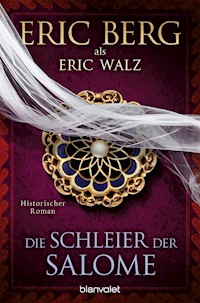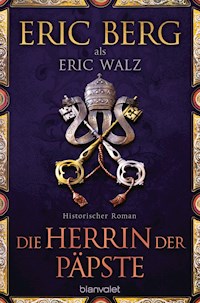3,99 €
Mehr erfahren.
Eine abgelegene Insel. Eine verschworene Gemeinschaft. Eine gemeinsame Vergangenheit, die sie verbindet.
Zum ersten Mal nach 23 Jahren kehrt Lea in ihr winziges Heimatdorf auf der Insel Poel zurück. Doch der Besuch endet in einem schrecklichen Unglück. Bei einem rätselhaften Unfall kommt Leas Schwester ums Leben, Lea selbst wird schwer verletzt und leidet seither an Amnesie.
Vier Monate nach dem Unfall reist Lea gegen den ausdrücklichen Rat ihrer Ärztin erneut nach Poel. Sie will herausfinden, was sie im Mai auf die Insel führte und wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sie selbst kann sich an diese Zeit auf Poel nicht erinnern und ist auf die Hilfe ihrer alten Freunde angewiesen – doch deren Berichte widersprechen sich. Die Jugendfreunde scheinen ein Geheimnis vor Lea zu verbergen, das weit in ihre gemeinsame Vergangenheit reicht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ERIC BERG
DasKüstengrab
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Das Zitat von Khalil Gibran stammt aus Khalil Gibran, Sämtliche Werke. Hrsg. von Ursula und S. Yussuf Assaf © Patmos Verlagder Schwabenverlag AG, Ostfildern 2003www.verlagsgruppe-patmos.de
Copyright © 2014 by Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-14330-5V003www.limes-verlag.de
Für meine WunderBar-Familieauf Gran CanariaIch umarme euch
Die Wölfe überfallen das Lamm im Dunkel der Nacht, doch die Blutspuren haften auf den Steinen im Tal, und das Verbrechen wird für alle sichtbar, wenn die Sonne aufgeht.
Khalil Gibran
Prolog
Voller Gedanken an die Zukunft machte sich der Achtzehnjährige an diesem Abend auf den Weg.
Es war der 31. August in jenem seltsamen Jahr 1990, in der Zeit zwischen den Zeiten, als in Ostdeutschland das Alte noch nicht ganz fort und das Neue noch nicht ganz da war. Alle Leute waren mit dem Kommenden beschäftigt, und auch er hatte ein paar wichtige Entscheidungen getroffen.
Allein spazierte er über die Wiesen der Insel Poel vor der mecklenburgischen Küste. Er liebte den Nebel, der knapp über dem Boden entlangkroch. Ebenso liebte er es, wenn die Strahlen der sinkenden Sonne wie Scheinwerfer zwischen den Wolkenlücken aufs Meer stürzten und es zum Erleuchten brachten, ehe sie wieder verschwanden, um anderswo in einer anderen Farbnuance zu erscheinen.
Am Ende des Weges lag die einsame, abgelegene Klosterruine, die ihm vertrauter war als sein Elternhaus. Das Innere des stark verfallenen Klosters, das er und seine Freunde seit frühen Kindertagen »Palast« nannten, war verschachtelt. Ein Hof ging in den anderen über. Räume gab es keine, weil es keine Decken mehr gab. Durch die bröckelnden Spitzbogenfenster, an denen seit fünfhundert Jahren der Seewind fraß, sah man zur einen Seite auf das Meer, zur anderen Seite auf die Wiesen. Das winzige Dorf, in dem er lebte, war einen Kilometer entfernt hinter einer Allee versteckt.
Mit ausgestreckter Hand, wobei er die Finger über die Mauern streichen ließ, schlenderte er im Halbdunkel herum. An einem der spätgotischen Fenster blieb er stehen und blickte über das Dünengras hinweg auf das weite Meer, das sich still und bleiern vor ihm erstreckte. Als er Schritte zu hören glaubte, wandte er sich um, runzelte die Stirn und rief: »Margrethe?«
Wieso er ausgerechnet ihren Namen rief, konnte er sich selbst nicht erklären. Es war unwahrscheinlich, dass sie noch einmal das Gespräch mit ihm suchen würde.
Er hatte sich geirrt. Der Wind und die bröckelnde Ruine spielten einem solche Streiche. Die spärlichen Konturen verschwanden nach und nach, Mauern und Bogen formten sich zu Ungetümen. Das Unheimliche und die Abgeschiedenheit hatten stets zu diesem Ort gehört wie alles andere auch, wie die Möwen, die bei Tag schreiend darüber kreisten, wie der Klee, der den Boden bedeckte, wie die Disteln in den Mauerritzen und wie die Freunde, die ihn vor zehn Jahren für sich entdeckt hatten: Lea, Mike, Jacqueline, Margrethe, Harry, Pierre und Julian. Ein schönes Jahrzehnt war das gewesen …
Wind kam auf, und wieder raschelte es, löste sich irgendwo ein Stein aus dem Mauerwerk und ließ den Verfall ein winziges Stück voranschreiten.
An diesem besonderen Platz seines bisherigen Lebens nahm er Abschied von seiner Kindheit und dem, was sie ausgemacht hatte. Von den vielen mit Freunden verbrachten Stunden im Palast, von den Gesprächen, den Spielen, dem Lachen, den gelegentlichen Streitigkeiten, von Zigaretten, Lagerfeuern, pubertären Träumen …
Wie fast jede Kindheit hatte auch die seine sich irgendwann still und heimlich davongeschlichen. Seit einigen Jahren schon hatte es kleinere Anzeichen gegeben, auf die niemand geachtet hatte – zum Beispiel hatten einige aus der Clique eine Ausbildung oder geregelte Arbeit begonnen –, dennoch waren sie die ganze Zeit über in Kontakt geblieben und hatten sich freitagabends oder sonntags im Palast zusammengefunden. Jemand brachte Stullen oder Schokolade, Bier oder Glühwein mit, und dann saßen sie zusammen, redeten und rauchten. Selbst wenn einige von ihnen fortgehen sollten, um im Westen zu studieren, die Welt zu erkunden oder eine Ausbildung in der Ferne zu machen, würde der Palast sie doch immer im Geiste verbinden. Keiner würde ihn je vergessen, und jeder würde von Zeit zu Zeit dorthin zurückkehren.
Diese romantische Vorstellung hatte er bis vor Kurzem gehabt. Zum Sommeranfang war diese Welt noch intakt gewesen, doch jetzt, am Ende der warmen Jahreszeit, lag sie in Trümmern, genauso wie die ins Dunkel getauchte Ruine.
»Lea, bist du das?«
Er hoffte noch immer, dass sie sein Angebot annehmen und ihn begleiten würde, dass sie Poel verlassen und mit ihm um die Welt reisen würde. Die Trennung von ihr fiel ihm am schwersten, und in seinen Tagträumen stand sie immer um die nächste Ecke und überraschte ihn mit einem spontanen: »Ja, ich komme mit.« Tatsächlich stand sie nie da. Inzwischen war es so dunkel, dass er kaum sah, wohin er trat. Seufzend holte er die Taschenlampe aus seiner Jackentasche und richtete den Lichtkegel auf den Weg, der ins Dorf führte. Im nächsten Augenblick erschrak er, zuckte zusammen und stieß einen Laut aus, der halb Seufzer und halb Schrei war.
Eine Sekunde später traf ihn ein harter Gegenstand am Kopf.
September 2013
Ich starrte auf das Foto im DIN-A4-Format. Der Unfallwagen war nur noch ein Klumpen silbriges Blech, als hätte ein Monster darauf eingeschlagen und ihm die Eingeweide herausgerissen. Das Blitzlicht des Fotoapparats spiegelte sich in den mit Rissen und Brüchen überzogenen Fensterscheiben und warf seine zersplitterte Helligkeit bis auf den nassen Straßengraben, den Baum, die phosphoreszierenden Uniformen der Sanitäter sowie ein paar Zweige mit zartem Frühlingslaub. Und auf die Leiche.
Ich wusste, dass auch ich in jenem Wrack auf der Ostseeinsel Poel gesessen hatte, allerdings nur, weil man es mir erzählt hatte. Rechts unten stand das Datum, an dem das Foto gemacht worden war: 21. Mai 2013, 23:46 Uhr.
Nun?, fragten mich die dunklen, strahlenden Augen der Schweriner Klinikpsychologin, die mich in den vergangenen vier Monaten betreut hatte. Sie war wie ich um die vierzig, vielleicht ein paar Jahre jünger. Ich mochte ihre warme Stimme, die viel Ruhe ausstrahlte, und ihre schlanken, unberingten Hände.
»Nichts«, sagte ich.
Dieses Wort traf es am besten, denn ich erinnerte mich weder an den Unfall noch an die Stunden davor. Poel hatte ich vor dreiundzwanzig Jahren verlassen. Meines Wissens war ich nie zurückgekehrt, und es kam mir gespenstisch vor, dass man mich halbtot aus einem Straßengraben der Insel gefischt hatte.
So wie das Auto, auf dessen Beifahrersitz ich gesessen hatte, war auch der Fundus meiner Erinnerungen in Stücke geschlagen. Gewiss, vieles war erhalten geblieben, darunter das Wichtigste: wer ich war und welches Leben ich gelebt hatte.
Das große Ganze jedoch würde nie wieder so sein wie früher. In unzähligen Operationen hatten die Ärzte mein Äußeres, von einigen wenigen Narben abgesehen, annähernd wiederhergestellt. Mit meinem Gedächtnis verhielt es sich anders. Wie bei einem unvollständigen Mosaik gab es kleinere und größere Löcher, die sich trotz der Geduld meiner Psychologin nur zögerlich oder gar nicht schlossen.
»Ich habe Ihnen das Foto bisher nicht gezeigt, weil es besonders intensiv ist, besonders … grausam.«
Das war es tatsächlich. Vor allem der leblose, entstellte, noch nicht abgedeckte Körper war schlimm anzusehen.
Trotzdem hatte ich kein Verhältnis dazu. Man hätte mir auch das Foto von einem Verkehrsunfall in China zeigen können, ich wäre nicht mehr und nicht weniger betroffen gewesen. Und damit meine ich das Wort in seiner doppelten Bedeutung. Wie gerne hätte ich viel mehr empfunden als diese abstrakte Traurigkeit über ein tragisches, aber scheinbar fernes Ereignis. Da ich mich des Unfalls nicht erinnerte, hatte ich ihn gewissermaßen nicht erlebt. Die körperlichen Wunden, die ich davongetragen hatte, waren zwar leidvolle Andenken, jedoch konnte mir mein Gedächtnis dafür keine Erklärung liefern.
»Wie Sie wissen, ist heute unsere letzte Sitzung«, sagte Ina Bartholdy nach einer Weile, während der wir geschwiegen hatten. Die dunkle Note in ihrer Stimme verriet mir, dass sie gleich etwas Beunruhigendes hinzufügen würde.
Ihr Blick fiel auf einen Digitalprojektor, das einzige technische Gerät in einem Raum, der ansonsten wenig Blickfänge bot: vier identische Sessel, ein langer Tisch, bilderlose cremefarbene Wände sowie ein dicker lavendelblauer Veloursteppich, der den Trittschall dämmte. Ein sanftes Plätschern war zu hören, obwohl es keinen Zimmerbrunnen gab.
Aus der Tasche ihres Blousons holte die Psychologin eine kleine Fernbedienung hervor, doch sie zögerte, bevor sie sie benutzte.
»Haben Sie schon eine Entscheidung getroffen, Lea? Wohin werden Sie gehen, wenn Sie im Anschluss hieran die Klinik verlassen? Zurück nach Argentinien?«
Das wäre das Naheliegendste, dachte ich. Buenos Aires war seit fast einem Vierteljahrhundert mein Zuhause. Zwar hatte ich dort keine Familie, aber neben zahlreichen guten Bekannten auch einige Freundinnen – von denen mich allerdings nicht eine einzige seit meinem Unfall besucht hatte. Sie würden sich zweifellos freuen, mich wiederzusehen. Trotzdem würde ich in ihrer Gegenwart wohl niemals mehr den schalen Beigeschmack loswerden, dass ich keiner von ihnen eine Flugreise über den Atlantik wert gewesen war, obwohl Geld keine Rolle bei ihnen spielte und sie wussten, wie sehr ich litt.
Mir fiel der Vorschlag wieder ein, den meine Ärztin mir vor einigen Wochen gemacht hatte.
»Sie hatten mir geraten, für kurze Zeit dorthin zurückzukehren, wo ich die Tage vor dem Unfall verbracht habe. Sie sagten, das sei eine gängige Heilungsmethode bei Erinnerungsverlust.«
Ina Bartholdy nickte, zog jedoch ein Gesicht, als habe sie einem Herzpatienten leichtsinnigerweise geraten, gleich nach der Entlassung zum Bungee-Jumping zu gehen. Bevor ich sie etwas fragen konnte, schaltete sie mit der Fernbedienung den Projektor an, der gehorsam piepte und ein Bild an die Wand warf, das mir bereits von früheren Sitzungen vertraut war. Es war eine farblich präparierte Aufnahme meines Gehirns. Die grau und schwarz markierten Areale zeigten die weniger oder mehr beschädigten Bereiche.
Wann immer ich diese zweiwöchentlich aktualisierten Aufnahmen sah, durchzuckte mich Entsetzen wie ein Stromschlag, weit stärker und nachhaltiger als alle anderen Informationen, die sie mir gaben, und gar nicht vergleichbar beispielsweise mit dem Foto des Crashs. Mein Gehirn sah auf den präparierten Bildern aus, als wäre es von einer bösartigen Krankheit befallen, die langsam voranschritt. Ich blickte auf die schwarzen Punkte, Metastasen gleich, längliche Schatten wie die Fraßgänge von Maden, unförmige Gebilde wie Bakterienkulturen unter einem Mikroskop.
Doch der Eindruck einer langsam voranschreitenden Krankheit täuschte. Die Zerstörung, das Vergessen, war mit der Unmittelbarkeit des Todes gekommen, von einer Sekunde zur nächsten. Tatsächlich hatte mich vor vier Monaten auf gewisse Weise der Tod erfasst und mit sich gerissen. Es war, als hätte ich zu manchen Zeiten überhaupt nicht gelebt. Warum war ich nach Poel zurückgekehrt? Was hatte ich dort gemacht? Wieso war ich am Tag meiner Ankunft in dieses Auto gestiegen, das ganz sicher nicht meines war? Und warum war es verunglückt, auf trockener, fast gerader Strecke?
»Es gibt mehrere Arten von Amnesie, ebenso mehrere Ursachen«, erläuterte Ina Bartholdy.
»Ich weiß, Ina. Ich habe Ihnen immer aufmerksam zugehört, wenn Sie mir etwas erklärt haben.«
»Ganz sicher haben Sie das«, sagte sie wie zum Trost für das, was sie mir gleich mitteilen würde. »Bisher sind wir … also meine Kollegen und ich … davon ausgegangen, dass Ihre Amnesie auf die physischen Verletzungen Ihres Gehirns zurückzuführen ist.« Sie hob die Hände, wie um einen möglichen Einwand abzuwehren. »So ist es ja auch. Die wahllosen Lücken in Ihrem Langzeitgedächtnis lassen gar keinen anderen Schluss zu.«
Wahllos, beliebig, zufällig …
Ich wusste noch, dass mich mein damaliger Ehemann Carlos betrogen hatte, woraufhin ich ihn ebenfalls betrogen hatte, mit Ian, einem Iren. Aber ich hatte kein Bild mehr von Ian vor Augen, obwohl die Affäre gerade mal fünf Jahre zurücklag und zwei Monate gedauert hatte. Zwar wusste ich auch noch, dass meine Lieblingsfriseurin in Buenos Aires Angela Lopez hieß, erinnerte mich aber weder an die Straße, in der sie ihren Salon betrieb, noch an ihr Gesicht. Manche Informationen waren jedoch in den letzten Wochen zurückgekehrt, beispielsweise die Namen meiner Wohnungsnachbarn sowie diverse Telefonnummern, einschließlich meiner eigenen, sowie weitere Belanglosigkeiten. Kleinere offene Rechnungen. Dass mir einige Wochen vor meinem Abflug nach Europa eine Sandalette kaputtgegangen war. Welche Bücher ich im Laufe meines Lebens lieben gelernt hatte. Solche Dinge.
»Physisch verursachte Amnesie heilt oftmals leichter. Damit erklären sich jedenfalls viele Ihrer neu gewonnenen Erinnerungen, und es werden mit jeder Woche mehr werden. Meines Erachtens wird Ihr Langzeitgedächtnis in einigen Monaten so gut wie keine Lücken mehr aufweisen. Allerdings … Es gibt da einen Zeitraum, der nach wie vor völlig im Dunkeln liegt.«
»Sie meinen die Zeit unmittelbar vor dem Unfall. Die Stunden auf Poel.«
»Ja, genau. Daran haben Sie nach wie vor überhaupt keine Erinnerung mehr, so als wären Sie vor vier Monaten gar nicht dort gewesen. Meine Kollegen und ich glauben daher übereinstimmend, dass die Amnesie, die sich auf diesen Zeitraum bezieht, psychischer Natur ist.«
Psychischer Natur, hallte es in mir nach. Psychischer Natur.
»Dazu würde auch passen, dass sich Ihre Stimme Ihrer Aussage nach im Vergleich zu früher verändert hat.«
Ich nickte. Meine Stimme war tatsächlich deutlich leiser und sanfter geworden, irgendwie belegt, oboenhaft …
»Organische, bakterielle und andere mögliche Ursachen haben wir ausgeschlossen. Offenbar liegt bei Ihnen eine psychogene Stimmstörung vor, wie es bei unverarbeiteten Erlebnissen manchmal der Fall ist. Alles deutet demnach darauf hin …« Ina Bartholdy unterbrach sich, atmete tief durch, ließ einige Sekunden verstreichen. »Etwas ist vorgefallen«, sagte sie schließlich mit einem Ernst, bei dem es mir eiskalt über den Rücken lief. »Auf Poel muss Ihnen vor dem Unfall noch etwas anderes widerfahren sein, Lea, irgendetwas Traumatisches. Oder Sie haben etwas zutiefst Schockierendes herausgefunden, das Sie verdrängen.«
Sie verschränkte die Hände schief ineinander. »Offen gestanden … ich weiß nicht, ob ich Ihnen unter diesen Voraussetzungen raten soll, ein weiteres Mal nach Poel zu fahren. Ich bin geneigt, Sie zu bitten, es nicht zu tun.«
Ich wusste nicht, ob ich mich besser vor meinen Erinnerungen oder vor dem partiellen Vergessen fürchten sollte, das mich befallen hatte. In meinem Klinikzimmer saß ich auf dem Bett und überlegte, was ich alles einpacken wollte, noch bevor ich wusste, wohin ich zurückkehren würde. Nach Argentinien, um einen Strich unter ein düsteres Kapitel meines Lebens zu ziehen, oder – ein zweites Mal – nach Poel. Es war Dienstag, der 3. September 2013, fast genau einhundert Tage waren seit dem Unfall vergangen, und ich musste zum ersten Mal seit Langem eine Entscheidung treffen.
Jeden einzelnen Gegenstand nahm ich prüfend in die Hand. Brauchte ich dieses komische, von der Klinik gestellte Deodorant noch? Würde ich die verbliebenen fünf Pralinen aus der Schachtel noch essen? Besonders lange zögerte ich bei dem riesigen Diagramm über dem Bett. Ich hatte einige Wochen zuvor etliche ausgedruckte Seiten nebeneinander an die Wand gepinnt, sie von meiner Geburt bis zur Gegenwart mit Jahreszahlen versehen und dann so gut es ging dazugeschrieben, was ich wann wo gemacht hatte. Die Fotoreihe »Russische Taiga und Tundra« im Jahr 2012, die Scheidung von Carlos 2011, die Ausstellung »Quer durch Peru« 2008 in New York … die Fehlgeburt 2002, im Jahr 1997 der erfolgreiche Fotoband-Erstling »Das Ende der Schönheit«, in dem ich Naturparadiese unmittelbar vor ihrer Zerstörung abgelichtet hatte.
Seit jener Zeit war ich viel herumgekommen. Ich war auf dem Gelben Fluss gefahren, hatte den Fudschijama und den Ätna umrundet, war auf den Spuren von Cézanne und Gauguin gewandelt, hatte die Wanderung der Gnus begleitet und den Schaftrieb in Neuseeland miterlebt. Abertausende von Fotos waren dabei entstanden.
Dennoch beantwortete das Diagramm die wichtigsten Fragen nicht. Der Blitz, der vor vier Monaten in meine Existenz eingeschlagen hatte, hatte mir zwar mein Langzeitgedächtnis und damit das Wissen um die Vergangenheit größtenteils gelassen, das Gefühl für die Vergangenheit jedoch fast komplett genommen. Obwohl ich inzwischen wieder mehr als neunzig Prozent meines Lebens überblickte, fehlte mir irgendwie der Bezug zu der Frau, die dieses Leben gelebt hatte. Wie hatte ich mich nach meiner Scheidung gefühlt? Warum war ich eigentlich nie wählen gegangen? Mochte ich Lakritze? Einundvierzig Jahre auf zwei Metern Papier, auf die ich blickte wie auf die Biografie eines mir nahestehenden Menschen. Ich schien meine eigene Vergangenheit miterlebt zu haben, statt erlebt.
Zum ersten Mal war mir dies vor drei Monaten aufgefallen, als mich zwei Beamte der Wismarer Polizei in der Klinik aufgesucht und mir einige Fragen zu dem Unfall gestellt hatten. Es war ein seltsames Treffen gewesen, das keinen von uns zufriedenstellte. Weder hatte ich den Ermittlern helfen können – ich erinnerte mich im Zusammenhang mit dem Unfall an rein gar nichts, nicht an den Grund meines Besuchs auf Poel und noch nicht einmal daran, dass ich überhaupt dorthin gefahren war – noch hatten sie mir erklären können, wie es zu dem Unfall gekommen war.
Im Blut der Fahrerin, meiner Schwester Sabina, hatte man keinen Alkohol gefunden, es gab keine Bremsspuren und auch keinen Hinweis auf andere Unfallbeteiligte. Vor allem wegen Letzterem hatten die Polizisten schnell das Interesse an einer intensiveren Befragung meiner Person verloren, da die Unfallverursacherin noch an Ort und Stelle gestorben war.
Die Polizisten waren keine halbe Stunde geblieben, hatten mich aber unabsichtlich mit etwas konfrontiert, das mich seitdem nicht mehr losließ: mit der Fremdheit mir selbst gegenüber. Denn während ich ihre Fragen zu meiner Person beantwortete, hatte ich das Gefühl, über jemand anders zu sprechen, über den ich zwar sehr viel wusste, dessen Gedanken ich jedoch nicht lesen konnte. Lea Hérnandez, geborene Mahler, war eine Frau, die ich noch einmal neu kennenlernen musste.
Blatt um Blatt, Jahr um Jahr hängte ich mein Leben von der Wand über meinem Klinikbett ab und verstaute es rasch in einer Klarsichthülle. Das Jahr 1990 betrachtete ich länger. Ein ganz besonderes Jahr. Im März war ich volljährig geworden, im April hatte ich mich von meiner Jugendliebe Julian getrennt, im Mai waren meine Eltern tödlich verunglückt, im September hatte ich mich mit Carlos verlobt und war ihm nach Argentinien gefolgt, wo ich ihn noch im Dezember heiratete. Fluchtartig hatte ich meine Kindheit verlassen – die Heimat Poel, die Freunde, meine ungeliebte Schwester Sabina, die Liebe …
Ich steckte die Klarsichthülle in meine Handtasche, und als ich dabei meine Hände betrachtete, fiel mir zum ersten Mal auf, dass sie mir genauso fremd waren wie meine Vergangenheit. Ich hatte mich während der vier Monate in der Klinik viel mit meinem verwundeten Körper beschäftigt, mit gebrochenen Knochen und gequetschten Organen, mit der aufgerissenen Bauchdecke und den Narben auf meinem Kopf. Man hatte mir die Beine geschient und mich dreimal am Rücken operiert. Drei Wochen lang hatte ich in einem Streckbett gelegen. Meine Schreie von damals hallten noch immer in mir nach, manchmal erwachte ich sogar davon. Doch nur zur Hälfte waren sie meinem verwundeten Körper geschuldet, die andere Hälfte galt dem zum Zeitpunkt des Unfalls sechs Wochen alten winzigen Wesen, das in mir gestorben war.
Erst im Krankenhaus, nach seinem Tod, hatte ich von ihm erfahren. Seit meiner Fehlgeburt im Jahr 2002 hatte ich mir ein weiteres Kind gewünscht, und nun war es gekommen und gegangen, ohne dass ich die Möglichkeit gehabt hatte, es zu spüren oder mit ihm zu sprechen. Ina Bartholdy und ich hatten lange über dieses Kind gesprochen, das wie ein Geist in mein Leben getreten und wieder daraus verschwunden war, ein körperloses, namenloses Geschöpf, das ich nicht hatte festhalten können. Bildhauern gleich hatten plastische Chirurgen mein Gesicht aus einem unförmigen Klumpen in ein ansehnliches Antlitz verwandelt, das ich im Spiegel glücklich wiedererkannte. Meinen Gefühlen, meiner Seele war es weniger gut ergangen. Sie blieben verletzt, verformt, fremd.
Ich ließ mich auf das Kissen sinken und starrte an die Decke. Fing so die Depression an, vor der man mich gewarnt hatte? Damit, dass ich mir dumm wie Postgut vorkam, das keine Ahnung davon hat, woher es kommt, wo es ist, wohin die Reise geht, wer es abgeschickt hat und wer darauf wartet? Damit, dass mir die Gewissheiten abhandengekommen waren, angefangen mit der Erkenntnis, dass ich nicht wusste, ob mir Lakritze schmeckte oder nicht, bis dahin, dass ich keinen Traum mehr hatte, keine Vorstellung von der Zukunft? Sogar die mir vertraute Stimme hatte ich verloren. Alles, was ich noch uneingeschränkt besaß, war die unmittelbare Gegenwart. Und die verbrachte ich vor Panik wie gelähmt auf dem Bett.
Es klopfte, und die nette junge sommersprossige Krankenschwester trat ein. »Alles in Ordnung, Frau Mahler-Hérnandez?«
»Ich heiße nur noch Mahler«, sagte ich und richtete mich sehr langsam auf, als wolle ich mich vergewissern, dass ich es noch beherrschte.
»Ach, seit wann?«
»Seit heute. Das ist mein Mädchenname.«
»Hérnandez hört sich aufregend an. Es klingt so schön nach weiter Welt.«
Für mich klang der Name nach Betrug, Entfremdung, Scheidung. Aber ich wollte dem sympathischen jungen Ding nicht die Träume nehmen.
»Sie sehen ein bisschen mitgenommen aus«, sagte sie.
Ich antwortete augenzwinkernd: »Wenn ich nach einem Unfall, bei dem ich mit einhundert Stundenkilometern gegen einen Baum geprallt bin, nach vierzehn Operationen und gefühlten eintausend Stunden Psychotherapie nur ein bisschen mitgenommen aussehe, ist das doch gar nicht so schlecht, oder?«
Sie lächelte, ich lächelte.
»Mögen Sie Pralinen?«, fragte ich und redete weiter, ohne die Antwort abzuwarten. »Das hier ist für Ihre Kaffeekasse.« Ich legte einen Zwanzig-Euro-Schein neben die Pralinenschachtel. »Was soll mit den vielen Büchern geschehen, die ich in den letzten Monaten gelesen habe? Sie lesen genauso gerne wie ich, nicht wahr? Bitte bedienen Sie sich. Es ist fast alles dabei, von der schottischen Schmonzettenkönigin bis zum chinesischen Nobelpreisträger.«
»Das ist supernett.«
»Sie und Ihre Kolleginnen waren supernett zu mir.«
Ich schloss den Koffer und nahm meine Handtasche, dann gab ich dem sommersprossigen Engel in Weiß die Hand und wünschte ihr alles Gute. Das alles brachte ich einigermaßen souverän über die Bühne, ja, als ich zur Tür hinausging, glaubte ich sogar Wind unter den Flügeln zu spüren.
Doch schon auf dem Klinikparkplatz landete ich unsanft auf dem Boden. Eine halbe Stunde saß ich in dem Mietwagen, den ich mir einen Tag zuvor in Schwerin besorgt hatte, und wusste weder ein noch aus. Das Fahren hatte ich nicht verlernt, das Fortbewegen schon.
Noch einmal ging ich alle Optionen durch. In Buenos Aires wartete ein Apartment auf mich, ein paar Freundinnen und mein Beruf als Fotografin. Musste ich nicht auch mit dem Vater meines verlorenen Kindes sprechen? Unsere Beziehung hatte nur wenige Wochen gehalten.
Schließlich drückte ich auf einen Knopf.
»Bitte geben Sie Ihr Fahrziel ein«, forderte mich die weibliche Computerstimme auf.
Ich gab Poel ein.
»Bitte spezifizieren Sie.«
Ich spezifizierte: Brandenhusen.
»Nach fünfzig Metern links abbiegen.«
Ich fuhr fünfzig Meter und setzte den Blinker, ohne jedoch links abzubiegen. Stattdessen tat ich gar nichts.
»Bitte links abbiegen.«
Ich hatte einen Unfall überlebt – meine Schwester hatte weniger Glück gehabt, sie war unmittelbar neben mir gestorben. Meine rätselhafte Rückkehr hatte in einem Desaster geendet. Stand die erneute Rückkehr damit nicht zwangsläufig unter einem schlechten Stern?
»Bitte links abbiegen.«
Ich war auf der Suche nach Licht in der Dunkelheit, nach Erkenntnis, letzten Endes nach Wahrheit. Lauter edle Ziele. Inzwischen weiß ich, dass man für die Wahrheit einen zu hohen Preis zahlen kann.
Mehrere Menschen würden noch leben, wenn ich an jenem Septembertag vor vielen Jahren rechts abgebogen wäre.
»Bitte links abbiegen.«
Zum ersten Mal seit dreiundzwanzig Jahren überquerte ich wieder den Damm, der vom Festland nach Poel führte. Vier Monate zuvor war ich dieselbe Strecke wohl schon einmal gefahren, doch das musste eine andere, mir unbekannte Frau gewesen sein und nicht ich. Angestrengt suchte ich nach Gedächtnisfetzen, schaltete Radio und Navi aus, ließ die Seitenfenster herunter, um das vereinigte Rauschen von Wind und Meer wahrzunehmen, und betrachtete im Vorbeifahren die ersten Häuser.
Die Erinnerung an meinen Besuch im Mai kehrte nicht zurück und sollte sich auch in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten nicht wieder einstellen. Dafür erscheinen bis heute vor meinem inneren Auge einzelne Bilder, wie Fotos, Flashs, blitzlichtartige Momentaufnahmen, die erst dann einen Sinn ergeben, wenn man die ganze Story kennt.
Obwohl ich mit der alten Heimat fremdelte, genoss ich das Wiedersehen mit ihr. Endlose Weiden. Horizont, wohin man blickte. Die Natur bot kaum Fixpunkte, keine Hügel, keine großen Wälder. Der Mensch hatte sich dieser Vorgabe angepasst: nur gelegentlich ein Kirchturm, verstreute Häuser und Scheunen, mit Kühen und Traktoren gesprenkelte Wiesen, dazwischen Rapsfelder. Die Küste war an vielen Stellen von Schilf gesäumt. Flach ragte die Insel aus dem Meer, als hätte ihr Schöpfer einst eine Teigrolle benutzt.
Mein Volkswagen durchquerte ein paar Nebelfelder, die behäbig über das Eiland zogen. Die fast durchgehend schnurgerade Strecke führte mich zunächst nach Kirchdorf und von dort weiter nach Einhusen, wo die Landstraße so eng wurde, dass zwei Autos gerade noch aneinander vorbeipassten. Weiter ging’s nach Weitendorf und schließlich nach Brandenhusen, ein winziges Dorf, in dem jeder jeden mit Name, Geburtsdatum und Schuhgröße kannte. Irgendwann ging die Landstraße in einen asphaltierten, von Hecken und Bäumen gesäumten Fahrweg über. Er führte in eine Siedlung, die noch viel winziger war als das ohnehin schon winzige Brandenhusen: Kaltenhusen. Eine Art Ortsteil vom Ortsteil. Auf Straßenkarten lediglich ein Pünktchen ohne jede Bezeichnung. Ganze sechs Häuser. Das Ende der Straße. Und das gefühlte Ende der Welt.
Hundert Meter vor der Siedlung hielt ich an, stellte den Motor ab und stieg aus.
Es kam mir vor, als wäre die Zeit stehen geblieben. Dieselben Nebelfelder über dem Boden wie damals, dieselben Salzwiesen, dieselben Seeschwalben am Himmel, Kiebitze in den Hecken, dieselben Häuser. Und dieselbe Stille.
Wie sehr ich das alles als Teenager, als junge Frau geliebt hatte! Ich suchte und fand jene alten Gefühle, allerdings wurden sie von dreiundzwanzig Jahren Abwesenheit gemildert. Dreiundzwanzig dünne Schleier, die nur noch einen vagen Eindruck von Glück vermittelten – und nur einen schwachen, entfernten Schmerz zuließen, wenn ich an den Grund dachte, der mich von Poel hatte fliehen lassen. Ich war einundvierzig Jahre alt und hatte mehr Zeit fern von Kaltenhusen verbracht als vor Ort.
Warum war ich vor vier Monaten schon einmal nach Poel gefahren? Ich weiß nur noch, dass ich in der Normandie an einer Fotostrecke gearbeitet hatte. Im Mai blühten die Apfelbäume, aus deren Früchten der berühmte Cidre und der noch berühmtere Calvados gemacht wurden. Ich war in der Nähe der Kreidefelsen von Étretat gewesen. Das Bild stand mir noch immer vor Augen, das Blau des Meeres, das Weiß der Felsen, dazwischen der Badeort, und dann plötzlich »Morning Has Broken« von Cat Stevens, seit Jahren der Klingelton meines Handys. An dem Punkt riss der Erinnerungsfaden ab, dessen zweites Ende seither verschollen war.
Zusammen mit meinem Kurzzeitgedächtnis war auch mein Handy in dem Unfallwagen zertrümmert worden, was es mir nicht nur unmöglich machte, den damaligen Anrufer zu ermitteln, sondern mich außerdem vor ein praktisches Problem stellte. Mit wem hatte ich auf Poel in Kontakt gestanden? Meine sechs Jahre ältere Schwester Sabina hatte in Berlin gelebt, sie war alleinstehend gewesen, und auch sie war offensichtlich erst im Mai auf die Insel gefahren – die sie übrigens, im Gegensatz zu mir, immer leidenschaftlich gehasst hatte. Wir hatten uns nie gut verstanden, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Familientreffen der Grund für unsere Zusammenkunft gewesen war. Einen ganzen Tag lang war ich in meiner alten Heimat gewesen, das ließ sich zurückverfolgen. Doch wo hatte ich gewohnt, mit wem telefoniert? Ich hatte keinerlei Daten, keinen einzigen Anhaltspunkt.
Mit meinem neuen Smartphone versuchte ich ein paar Kaltenhusener Telefonnummern herauszubekommen, was sich als schwierig herausstellte. Zuerst versuchte ich es mit Morgenroth, Julians Familienname, weil ich mit ihm den engsten Kontakt gehabt hatte. Nicht nur das, er war meine erste Liebe gewesen, und obwohl unsere Beziehung weniger als ein Jahr gehalten hatte und traurig zu Ende gegangen war, drängte es mich am meisten, ihn wiederzusehen. Doch nichts, kein Eintrag. Auch über Harry und Margrethe, die Geschwister Petersen, bekam ich nichts heraus. Mike Nickel, ebenfalls nichts. Anfangs glaubte ich, sie wären alle weggezogen. Wie ich später erfuhr, besaßen Margrethe und ihr Bruder Harry nur Handys, keinen Festnetzanschluss. Mike hatte eine Geheimnummer, der Name Morgenroth war in Poel tatsächlich erloschen, und der alte Balthus, Jacquelines Vater, hatte überhaupt kein Telefon.
Keine Ahnung, wieso ich nach Pierre als Letztes suchte. Klar, irgendwer muss ganz unten auf der Liste stehen, aber ich hatte das Gefühl, dass es kein Zufall war. Vielleicht lag es daran, dass ich mit ihm von allen in der Clique von damals am wenigsten zu tun gehabt hatte. Er war immer sehr ruhig gewesen, ein Mitläufer, der nie die Initiative ergriffen hatte.
Ich fand seine Nummer ruck, zuck und staunte ein bisschen, denn der Eintrag lautete: »Dr. med. Pierre Feldt, Arzt für Allgemeinmedizin, Kinderarzt.«
Offen gestanden hätte ich ihm einen akademischen Grad gar nicht zugetraut. Margrethe hatte ihn damals immer abfällig »den schönen Pierre« genannt, weil sein gutes Aussehen seine einzige hervorstechende Qualität zu sein schien. Ich hatte Mühe, ihn mir im Arztkittel vorzustellen. Trotzdem empfand ich es als sehr beruhigend, dass ich wenigstens einen meiner alten Freunde hatte ausfindig machen können. Pierre würde mir hoffentlich meine drängendsten Fragen beantworten.
Ich rief in seiner Praxis an und erkundigte mich bei der Arzthelferin nach dem Ende der Sprechstunde.
»Mahler ist Ihr Name, sagten Sie? Lea Mahler? Der Herr Doktor wird froh sein, Sie zu sehen. Ja, ganz bestimmt. Bis nachher dann.«
Die Tatsache, dass Pierre – dass jemand, irgendjemand – sich freuen würde, mich zu sehen, erfüllte mich mit einem geradezu kindischen Glücksgefühl. Noch bevor ich Pierre getroffen hatte, wusste ich, dass ich mich an ihn hängen würde. Ich brauchte dringend jemanden zum Dranhängen, jemanden, der mich an der Hand nahm und durch den Irrgarten der völlig im Dunkeln liegenden Vergangenheit führte. Der mir Peinlichkeiten ersparen konnte. Der mich vor den Minenfeldern warnte, die es zweifellos gab. Nicht nur ich hatte Fragen, man würde auch Fragen an mich haben, Fragen, auf die ich keine Antwort geben konnte. Wer wäre geeigneter, mich vor überzogenen Erwartungen und eventuell sogar Vorwürfen zu schützen, als ein Arzt?
Wer weiß, ohne Pierre wäre ich vielleicht zum nächsten Flughafen gefahren und in die erstbeste Maschine nach Buenos Aires gestiegen.
In der Ferne rauschte das Meer. Harry saß in einem Fenster der Klosterruine, den Rücken bequem an das Mauerwerk gelehnt, die Füße auf dem Sims. Er tat nichts, außer den zerflatterten Wolken zuzusehen, die über die spätsommerlichen Felder hinwegeilten. Gelegentlich führte er wie in Zeitlupe die Hand zum Mund und zog an der Zigarette. Kaum fünf Züge machte er pro Glimmstängel, aber dafür jeden einzelnen Zug so intensiv, als handele es sich um das letzte Nikotin seines Lebens. Nachdem er den Stummel sorgsam ausgedrückt hatte, verstaute er ihn in einem kleinen Beutel in seiner Jackentasche und zündete die nächste Zigarette an. So ging das eine Stunde lang, vielleicht noch länger. Er sah dabei nie auf die Uhr. Die Zeit hatte hier, im Palast, keine Bedeutung. Das war immer schon so gewesen. Als Junge war Harry gleich nach den Hausaufgaben mit dem Fahrrad zur Ruine gefahren – manchmal hatte er die Aufgaben sogar dort gemacht – und hatte ungeduldig dem Eintreffen seiner Freunde entgegengefiebert.
Das hatte sich geändert. Heute wäre Harry enttäuscht, wenn irgendjemand die Ruhe der Ruine stören würde, in der auch er Ruhe suchte. Zum Glück kam das so gut wie nie vor. Zum einen war das Bauwerk in den Reiseführern nicht erwähnt, zum anderen lag es abseits der Straße, und nur ein schlecht ausgebauter Feldweg führte hin. Ein paarmal war es vorgekommen, dass Jugendliche in einem der Höfe campten und kifften und die Mauern mit schlecht gemachten Graffitis besprühten. Harry räumte ihre Hinterlassenschaften stets weg und bearbeitete die Graffitis so lange mit Lauge, bis sie nur noch blasse Schatten waren und wirkten, als wären sie von der Mauer aufgesogen, von den Jahrhunderten absorbiert worden.
Plötzlich wurde Harry unruhig. Ohne sich zu bewegen, spannte er seinen Körper. Mit den Augen suchte er das vom Nebel gewobene Netz über den Weiden ab, dieses diffuse Gemisch von Grau und Grün, das sich mit der Dämmerung verband.
Nichts. Fast nichts. Nur schwarze Krähen, die über den Feldern kreisten, und weiße Aasfresser, Möwen. Doch er spürte, dass sich jemand auf dem Weg näherte.
Aus dem Dunst schälte sich eine Gestalt, ein Mann. Er trug einen hellen Trenchcoat, die Hände in den Manteltaschen verborgen. Trotz der Entfernung erkannte Harry ihn sofort. Schweiß trat auf seine Stirn, seine Handflächen wurden feucht. Die Kippe entglitt ihm, fiel zu Boden.
Harry stieg vom Sims herunter. Es war keine bewusste Entscheidung, es passierte einfach. In seinem Kopf lief ein Film ab über das, was gleich geschehen würde, was gleich geschehen müsste. Er war nicht der Regisseur des Films, sondern nur ein Darsteller. Langsam ging er die paar Schritte zu seinem Auto, einem uralten Ford, und stieg ein. Das Tuckern des Motors erinnerte an einen röchelnden Traktor und schien mehrmals zu verstummen, lebte aber jedes Mal wieder auf.
Ohne den Blick von Mike zu nehmen, legte Harry die rechte Hand auf den Knauf der Gangschaltung und drückte die Kupplung durch. Mike war nur noch etwa fünfzig Meter entfernt, seine Gesichtszüge wurden erkennbar, die kleinen, fokussierten Augen, die überlegen lächelnden Lippen. Seine Art zu gehen verhieß Erfolg: zielstrebig und raumgreifend.
Harry presste den rechten Fuß aufs Gaspedal. Der Ford heulte auf, zuckte, rührte sich jedoch nicht von der Stelle. An dieser Stelle wich der Film in Harrys Kopf von der Realität ab. Irritiert blickte er nach unten. Die Handbremse war noch angezogen. Sein Arm zitterte, als er den schlanken Hebel ergriff und die Bremse löste. Ein Schweißtropfen floss ihm zwischen den Augenbrauen hindurch auf die Nase. Just in dem Moment, als Harry ein Ächzen ausstieß, trat er das Gaspedal erneut durch, und dieses Mal schoss der Wagen mit gewaltigem Schub voran und raste direkt auf Mike zu. Harry schloss die Augen.
Es ging alles sehr schnell. Ein dumpfes Geräusch vorn, dann ein Kratzen auf dem Autodach, schließlich ein zweites dumpfes Geräusch, diesmal hinten.
Vollbremsung. Stillstand. Der Motor röchelte, tuckerte.
Harry brauchte eine Minute, bis er den Zündschlüssel abzog, und eine weitere Minute, bis er sich zitternd eine Zigarette ansteckte.
Aus demselben graugrünen Dunst, aus dem Mike aufgetaucht war, traten nun zwei Jugendliche, die nebeneinander ihre Fahrräder schoben. Die Teenager waren ungefähr gleich groß, einer hatte schwarzes, der andere hellbraunes Haar, und sie trugen Jeans, Turnschuhe und Anoraks. Sie waren ungefähr achtzehn, neunzehn Jahre alt.
Harry stieg aus. Keiner von den beiden sah ihn an. Die Jungen unterhielten sich und gingen achtlos an ihm und dem Auto vorüber, als wäre er Luft. Spätestens jetzt hätten sie den überfahrenen Mann auf dem Weg bemerken müssen. Doch da lag kein Toter, auch kein Verletzter, und der Weg war nur ein Weg. Links und rechts leere Weiden, beinahe endlos. Nur die Abdrücke von durchdrehenden Reifen sowie eine Bremsspur waren nicht zu übersehen.
Harry beobachtete die Jungen dabei, wie sie ihre Fahrräder vor der Ruine abstellten und im Palast verschwanden. Erst dann folgte er ihnen. Er entdeckte sie an eine der Wände gelehnt. In der Dämmerung hatte es den Anschein, als wären sie in die Mauern gegossen, ein Teil des Dekors einer fernen Vergangenheit, genauso verwaschen wie die Graffitis. Der eine hatte Mikes Gesicht, der andere Harrys.
Es war das Frühjahr 1990, und sie redeten über ihre gemeinsamen Zukunftspläne.
Plötzlich stieß Harry einen Schrei aus und rannte zum Auto.
Er sieht aus wie ein moderner gekreuzigter Jesus, dachte Pierre, als der gleichaltrige Mann ihm in der Praxis gegenübersaß: schulterlanges, dünnes Haar, verhärmtes Gesicht, rotblonder Sechstagebart … Immer wenn er Harry begegnete, musste Pierre unwillkürlich an Märtyrer denken, an griechische Tragödien, an den Tod. Prompt fielen ihm dann auch jedes Mal die Spritze und der kleine Flakon mit der klaren Flüssigkeit wieder ein, die er seit Jahren griffbereit in einer Schublade aufbewahrte.
»Darf ich r-rauchen?«
Pierre öffnete das Fenster, kühle Mailuft strömte herein. Normalerweise gestattete er niemandem, im Behandlungsraum zur Zigarette zu greifen, aber Harry sah wirklich krank aus – was in einer Arztpraxis nicht selbstverständlich war. Er hatte von dem Erlebnis von vor einer Stunde in der Klosterruine erzählt und wirkte wie jemand, der unlängst dem achten Kreis der Hölle entkommen war. Doch das war er nicht. Er steckte noch immer mittendrin, war in seinem selbst geschaffenen privaten Inferno gefangen. Das Stottern, unter dem er seit der Pubertät litt, war stärker als sonst.
»Beruhige dich«, sagte Pierre. »Du hast Mike nicht überfahren. Er hat vor einer halben Stunde hier angerufen und …«
»W-warum?«
»Das geht nur Arzt und Patient etwas an.«
»Ich h-hoffe, er hat die P-p-pest.«
»Das hoffe ich nicht, denn in drei Tagen hätten wir sie dann alle. Ich habe dir das nur gesagt, damit du nicht länger glaubst …«
»L-lass den Scheiß, ich bin j-ja nicht blöd, ich weiß s-s-selber, dass ich nur ein T-trugbild überfahren habe«, fauchte Harry.
Pierre nahm es gelassen.
Harrys Aggressivität war seiner Meinung nach harmlos, ein aufgeblasenes Plastikmonster mit einem kleinen Loch. In ein paar Minuten würde er mitsamt seinem Gehabe in sich zusammenfallen. Er war kein übler Kerl, nur eben seit zwanzig Jahren schlecht gelaunt. Sie nannten Harry auf der Insel längst den Don Quixote de La Poel. Seit zwanzig Jahren – oder siebentausend Tagen – kämpfte er gegen Mike, hauptsächlich gegen ihn. Er hatte nicht nur versucht, den Bau von Mikes Fischverarbeitungsfabrik zu verhindern, sondern auch die von Mike vorangetriebene Erweiterung des Hafens, die Errichtung von Kühlhallen, die Lockerung der Umweltauflagen, den Ausbau eines Logistikzentrums … Harry hatte sich dafür wechselnde Verbündete gesucht, mal waren es Umweltschützer, mal Landwirte, mal Hoteliers. Er hatte Pierre vor einigen Jahren schon anvertraut, dass kein Tag vergehe, an dem er nicht wenigstens ein Dutzend Mal an seinen ärgsten Feind dachte, der einmal sein bester Freund gewesen war.
Ausnahmslos alle Schlachten hatte er verloren. Und im wahrsten Sinne des Wortes teuer für die Niederlagen bezahlt, denn die vielen Prozesse hatten Unsummen verschlungen. Vielleicht waren sogar seine beiden Ehen daran zerbrochen. Da er zudem als junger Mann einige Konsumkredite aufgenommen hatte, die er samt Zinsen vermutlich bis in alle Ewigkeit abbezahlte, war er chronisch pleite. Auch beruflich kam er nicht voran, hatte in sieben oder acht verschiedenen Jobs gearbeitet. Zuerst als Fischer, wie sein Vater, der auf dem Meer umkam, als Harry noch ein Säugling war. Dann als Gärtner, als Mechaniker von Traktoren, als Stallknecht, Lagerist und Waldarbeiter. Neuerdings war er bei einem Wismarer Anzeigenblättchen angestellt, wo er von Hausmeisterpflichten bis hin zum Schreiben kleiner Artikel über regionale Nichtigkeiten das gesamte Spektrum einer Drei-Angestellten-Zeitung abdeckte. Ganz nebenbei war er seit geraumer Zeit auch der Totengräber von Poel.
»Ich h-hab dir n-n-noch nicht alles erz-zählt«, berichtete Harry weiter. »Nachdem ich Mike überfahren hatte, s-sind zwei junge Männer an mir vorb-bei in den Palast gegangen. Das waren Mike und ich m-mit neunzehn. An dem Tag hat er mich überzeugt, dass wir für eine w-westdeutsche V-vermögensberatung Versicherungen in der Noch-DDR verkaufen sollten. Ich w-war mit ihm im P-palast und …«
Pierre fiel ihm ins Wort. »Er hat damals gesagt, dass man vomFischen nicht reich wird und dass die Mauer nicht gefallen ist, damit ihr euch nun endlich theoretisch alles kaufen könntet, praktisch aber nicht das Geld dafür habt. Dann hat er die Versicherungssache erwähnt und dass es dreitägige Kompaktkurse für Geldanlageberatung und Verkaufsstrategie gibt …«
»W-woher …?«
»Ich war dabei.«
»Ehrlich? D-daran erinnere ich mich g-gar nicht. Aber ja, es k-k-könnte sein.«
Pierre war daran gewöhnt, dass die anderen sich nur selten an seine Anwesenheit bei bestimmten Anlässen erinnerten. In der Hierarchie der Clique, angeführt vom bulligen, tonangebenden Mike, hatte er den letzten Platz eingenommen, noch hinter den Mädchen und dem verträumten Julian. Auf Rang zwei hatte Harry gestanden, einfach nur weil er Mikes bester Freund war. Danach waren Margrethe und Lea gekommen, weil Mike vor Ersterer großen Respekt hatte und für Letztere große Zuneigung empfand. Die bezaubernd aussehende Jacqueline und Julian, der immerhin Gitarre spielen konnte, folgten auf den hinteren Plätzen. Pierre hatte damals keine besonderen Fähigkeiten vorzuweisen, er konnte nicht mal die Klappe aufreißen, und dass alle Erwachsenen ihn als bildhübschen Jungen bezeichneten, hatte ihm bei Mike nur weitere Minuspunkte eingebracht – und damit auch bei Harry. Der hatte nämlich alles übernommen und mitgemacht, was Mike vorgab. Wenn Mike Pierre ignorierte, dann zeigte auch Harry ihm die kalte Schulter, und wenn Mike ihn ärgerte, stand Harry kichernd daneben.
Jetzt, Jahrzehnte später, war es für Pierre eine kleine Genugtuung, dass Harry, der sich in seiner Kindheit von seinem besten Freund Mike nicht hatte emanzipieren wollen, nun nicht in der Lage war, sich von seinem besten Feind Mike zu emanzipieren.
»So geht das nicht weiter«, sagte er, wieder ganz der Arzt, und griff nach einem Formular. »Ich werde dir einen speziellen Kuraufenthalt besorgen.«
»B-bist du verrückt?«, brauste Harry auf.
Pierre lächelte. Und diese Worte aus dem Munde eines Mannes, der gerade einen Geist überfahren hatte!
»Du brauchst dringend Abstand und einen Psychotherapeuten.«
»Nein, keinen Ps-sycho-Heini.«
»Harry, du halluzinierst. Du bringst Gespenster um, und das nicht zum ersten Mal. Wie oft habe ich dir schon geraten, die Ruine zu meiden.«
»Den P-palast«, korrigierte Harry.
»Aber du fährst immer noch hin, fast jeden Tag.«
»J-jeden Tag«, korrigierte er erneut.
»Allein das ist zwanghaft.«
»Meine S-seele kommt dort zu-ur Ruhe«, erwiderte Harry überraschend poetisch, und seine Augen glitzerten verwaschen.
Wenn er in diesem Zustand war, fiel es Pierre ungeheuer schwer, streng mit ihm zu sein, so als müsste er jemandem möglichst schonend beibringen, dass er sich von einem geliebten Wesen, ob Mensch oder Tier, trennen müsse, weil es schädlich für ihn ist. Die gelegentlichen Gewaltfantasien, in denen Mike stets das Opfer war, wurden häufiger. Pierre glaubte, dass Harrys Fixierung auf die Klosterruine diesen Prozess unterstützte, vielleicht sogar hervorrief. Ein Gedanke, den sein Gegenüber als geradezu ketzerisch empfand.
»Hast du kein-nen Ort, Pierre, an dem du ganz du selbst sein kannst? Ein wirkliches Z-zuhause, wo du träumst und …«
»In meinen Träumen bringe ich niemanden um.«
Harrys Gesichtsausdruck veränderte sich. Seine eben noch weichen Augen bekamen einen gehässigen Ausdruck. »Ich w-weiß, du träumst nu-ur davon, Frauen fl-lachzulegen, und dein Zuhause ist da, w-wo dein Sch-schwanz sich zu Hause fühlt.«
»In Ordnung, das genügt. Das war’s für heute.« Wieder wechselte Harrys Mimik, diesmal ins Flehende. Seine Stimmungsschwankungen und die Fantasien bereiteten Pierre Sorgen. Der Patient wollte nicht auf ihn hören, allerdings war das kein Verbrechen, und da Harrys Fantasien niemandem schadeten außer ihm selbst, waren Pierre die Hände gebunden. Er unterlag der Verschwiegenheitspflicht und konnte nichts tun, außer weiterhin so gut es ging auf Harry einzuwirken.
»Sch-schick mich nicht weg«, bat Harry. »Außer mit d-dir kann ich mit niemandem reden, seit …«
»Seit?«
»Ist egal.«
»Seit Sabina?«
»Ist eg-gal, habe ich g-gesagt.«
»Ich dachte, du willst reden.«
Harrys Lippen wurden schmal. »Darüber nicht.«
»Wie du meinst«, seufzte Pierre. »Aber mit dieser Art von Miteinanderreden kommen wir nicht weiter. Immerhin hast du in deiner Fantasie gerade Kleinholz aus Mike gemacht. Ich hätte es wissen müssen. Man heilt Psychosen nicht mit vernünftigen Argumenten, sonst könnten alle psychiatrischen Anstalten von heute auf morgen dichtmachen.«
»Klugsch-scheißer.« Harry sprang so heftig auf, dass der Stuhl umkippte. »Du b-bist nicht besser als die a-anderen, du verstehst mich genauso wenig, kümmerst dich nicht um den P-palast, um die Insel. Mike lässt Fabriken bauen, Lagerh-hallen, Parkplätze für Lkw … Stück für Stück wird unsere H-heimat von diesem unersättlichen Gierschlund verändert, diesem Verräter an a-allem, was uns mal heilig war. Und jetzt der alte Balthus – er will tatsächlich Ernst machen und auf dem Gelände vom P-palast Ferienhäuser errichten lassen. Du sagst, ich soll Abstand nehmen, aber du meinst kap-p-pitulieren. Mal wieder typisch für dich, Pierre. Du bist ein Feigling, ein kriecherischer Schleimer. Das warst du immer schon. Ich dagegen, ich bin in der heißen E-endphase meiner Entwicklung angelangt.«
Derlei hatte Pierre im Laufe der Jahre schon ein halbes Dutzend Mal gehört, und es erschien ihm einfach nur idiotisch, dass jemand nach gut zwanzig Jahren Feindschaft und Kampf von einer heißen Phase faselte.
Harry ballte die Fäuste, doch Pierre blieb ruhig und stellte ein Rezept aus. »Ein Sedativum, vielleicht hilft es ja. Nimm es oder lass es, ganz wie du willst.«
»Ich habe kein G-geld für die Apo-potheke«, erwiderte Harry kleinlaut, während er die Fäuste senkte und die schweißnassen Handflächen an der Hose abtrocknete.
Pierre ging zum Vorratsschrank und nahm eine Schachtel heraus, die er Harry reichte: »Dreimal täglich eine davon zu den Mahlzeiten. Gegen Geister helfen sie allerdings nicht.«
Als Harry schon halb zur Tür hinaus war, sagte Pierre, während er die Patientenakte im Computer vervollständigte: »Übrigens, Lea hat angerufen. Sie ist wieder gesund und kommt heute auf die Insel zurück.«
Harry blieb mit der Türklinke in der Hand stehen, drei, fünf, zehn Sekunden lang. »W-wieso sagst du mir das?«
Pierre sah ihn an. »Einfach nur so. Ich dachte, es sei besser, dich vorzubereiten.«
Es war kein Zufall, dass Mike sich ausgerechnet für diesen Tag einen Termin bei Pierre hatte geben lassen, gleich nachdem er von seiner Kontaktperson in der Schweriner Reha-Klinik von Leas Entlassung erfahren hatte. Er kam nur äußerst selten und widerwillig in Pierres Praxis, vor allem weil es ihm gegen den Strich ging, dass jemand, den er in seiner Jugend herumkommandiert hatte, nun ihm gegenüber im Vorteil war, und sei es nur auf medizinischem Gebiet. Dass Pierre etwas über Mikes Körper und damit sein Intimstes wusste, war ein überaus ärgerlicher Umstand, den Mike ausglich, indem er die Ratschläge und Mahnungen des Arztes demonstrativ ignorierte.
Nachdem er die Untersuchung über sich hatte ergehen lassen, fragte er gleichgültig: »Und? Bin ich herzinfarktgefährdet?«
»Jeder, der ein Herz hat, ist herzinfarktgefährdet.«
»Dann hältst du die Gefährdung bei mir also für gering?«
»Du kannst dich wieder anziehen, wir sind fertig.«
Mike knöpfte sein Hemd zu, während er Pierre dabei beobachtete, wie er das EKG studierte. Tatsächlich interessierte sich Mike nicht im Geringsten für die Ergebnisse, und ihm war klar, dass Pierre das ebenfalls wusste. Trotzdem taten sie alle beide so, als wäre Mikes Gesundheit der Hauptanlass für dieses Treffen.
Das war keineswegs ungewöhnlich. In den vielen Jahren, in denen die ehemalige Clique sich nun kannte – im Grunde ihr ganzes Leben –, war es zum Normalzustand geworden, um die Dinge herumzureden. Wenn man sich so gut kannte wie sie, wenn man so nah beieinander wohnte und so viel voneinander wusste, gab es nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen: absolute Offenheit oder Maskerade. Letzteres hatte sich irgendwann durchgesetzt und war seither von keinem in Frage gestellt worden. Mit jedem Jahr manifestierte sich dieser spezielle Umgang miteinander ein wenig mehr und hielt ihre Freundschaft, trotz einiger Rivalitäten, in einem gewissen Gleichgewicht.
Lea war durchaus in der Lage, dieses Gleichgewicht zu stören.
»Hat sie schon bei dir angerufen?«, fragte Mike in beiläufigem Tonfall. Er konnte sich darauf verlassen, dass Pierre wusste, von wem die Rede war.
»Das war vorherzusehen.«
»Nicht vorherzusehen war, dass sie überhaupt noch mal zurückkehrt. Du hast sie nicht ermutigt, oder? Wir waren uns doch einig, dass …«
Pierre warf die Untersuchungsergebnisse quer über den Tisch und blickte Mike unumwunden an.
»Ich habe sie nicht besucht, obwohl mir vier Monate lang jeden Tag danach war«, sagte er mit unterdrückter Heftigkeit. »Ich habe sie auch nicht angerufen, habe ihr keine Karte geschrieben, keine Blumen geschickt … Dass sie nach Poel kommt, hat nicht das Geringste mit mir zu tun, aber ich sage dir eins: Jetzt, da es so ist, bin ich froh darüber.«
Mike grinste. »Ts, ts, wie sich der kleine Pierre aufregen kann … Noch dazu völlig grundlos. Ich habe dir nur eine simple Frage gestellt.«
Pierre atmete tief durch. »Die Antwort lautet nein.«
»Na also, es geht doch auch ohne dein Zwergengeschrei.«
Dass sich Pierre, der sonst nie die Stimme erhob, schon gar nicht gegen ihn, plötzlich so aufregte, bestätigte Mikes Befürchtungen. Noch bevor Lea überhaupt eingetroffen war, sorgte sie bereits für Unruhe. Obwohl er sie mochte, hätte er sie lieber in Argentinien gewusst. Aber es half ja nichts.
»Nach allem, was ich gehört habe, leidet sie noch immer unter Amnesie«, sagte er. »Guck nicht so erstaunt, ich habe bisher jedes Mal erfahren, was ich wissen wollte. Krankenschwestern werden nun mal schlecht bezahlt.«
Er verfolgte, wie Pierre verärgert ein paar Utensilien wegräumte, allerdings war ihm die Gemütsverfassung seines Gegenübers herzlich egal. Er hatte andere Sorgen. Sollte Leas Zustand anhalten, würde das vieles vereinfachen. Andernfalls …
Als Mike aufstand, um sein Hemd in die Hose zu stecken, schwankte er leicht.
Pierre fragte: »Wie viele Whisky hattest du heute schon?«
»Keine Ahnung, drei oder vier.«
»Liter oder Gläser?«
»Bist du Kellner oder Arzt?«
»Orakel. Nicht ich werde dir eines Tages die Quittung bringen.«
»Sondern wer?«
»Dein ach so großes Herz.«
Mike lachte und ging zur Tür. »Ich mag Sarkasmus, Pierre. Vor allem die Schwachen benutzen ihn, weil er sie so schön tapfer erscheinen lässt.«
Pierres Landarztpraxis in Kirchdorf, der mit eintausendzweihundert Einwohnern größten Gemeinde der Insel, war entsprechend überschaubar: enge Flure, ziemlich verwinkelt, ein kleines Wartezimmer, sechs Stühle, drei Rentner, zwei Reproduktionen von Franz Marcs blauen Pferden sowie eine sehr bemühte Arzthelferin älteren Semesters. Verschwörerisch murmelte sie mir zu, dass sie mich gleich »zwischenrein schmuggeln« werde, was sie dann auch tat.
»Lea. Endlich.«
Pierre kam im Behandlungsraum lächelnd auf mich zu und umarmte mich innig. Im ersten Moment verkrampfte ich leicht und starrte ihn wohl ziemlich verdattert an, denn er sagte schnell: »Entschuldige, ich … ich habe mit einem Arzt in der Reha-Klinik telefoniert, der mich darüber unterrichtet hat, dass du noch immer unter Amnesie leidest. Aber für einen Moment habe ich nicht mehr daran gedacht. Du kannst dich tatsächlich nicht an deinen ersten Besuch erinnern? An gar nichts?«
Hilflos sah ich ihn an.
»Verstehe«, sagte er. »Das heißt also, ich bin im Grunde ein Fremder für dich. Du hast mich zuletzt neunzehnhundertneunzig gesehen, und ich falle dir einfach so um den Hals.«
Er war mir sofort sympathisch, zugegeben auch wegen seines guten Aussehens. Volles schwarzes Haar, Mittelscheitel, schwarze Augen und eine sportliche Figur. Sein Lächeln war gewinnend, seine Ausstrahlung jungenhaft. Von der Schüchternheit seiner Jugend war nur wenig übrig geblieben, etwa dass er verlegen die Hände in die Hosentaschen schob, als er sich bei mir für die überschwängliche Begrüßung entschuldigte.
»Du siehst fabelhaft aus, Lea.«
»Oh, danke«, antwortete ich und blickte unsicher an mir herunter. Ich hatte mich am Morgen für ein etwas sportlicheres Outfit entschieden, so als wollte ich auf Fotosafari gehen. Irgendwie schien mir dieser Look für Poel angemessen. Nur die eleganten Schuhe passten nicht so recht dazu.
Pierre lachte. »Ich meinte eigentlich dein Gesicht. Die Chirurgen haben ganze Arbeit geleistet. Man sieht so gut wie keine Narben. Es wäre auch zu schade gewesen, wenn du deine Audrey-Hepburn-Ausstrahlung verloren hättest.«
»Audrey Hepburn? Ich?«
»Das habe ich früher schon so empfunden. Die Art, wie du gelacht hast, wie du binnen Sekunden von fröhlich auf traurig umschalten konntest, deine spezielle Nachdenklichkeit, die Gesten … Das war Holly Golightly pur.«
»Ach, du meine Güte. Das hast du mir nie gesagt.«
»Stimmt.«
Pierre vergrub die Hände erneut in den Hosentaschen. Ich machte es ihm leicht und baute ihm eine Brücke, wenn auch nicht ganz uneigennützig
»Ich habe vor, ein paar Tage zu bleiben. Meine Therapeutin hält das für eine gute Idee«, log ich.
Pierre nickte fachmännisch. »Das Gästezimmer steht dir zur freien Verfügung.«
»So war das nicht gemeint. Ich …«
»Keine Widerrede. Ich würde mich riesig freuen.«
»Na dann … Vielen Dank. Hast du bald Feierabend?«, sagte ich abschließend.
Hatte er nicht. Doch er bot mir an, dass wir uns zwei Stunden später im Petersen-Haus treffen könnten, bei Margrethe.
»Sie wohnt noch in Kaltenhusen?«, fragte ich erstaunt.
»Wir wohnen alle noch dort«, erwiderte er und fügte beiläufig hinzu: »Na ja, fast alle.«
»Bin ich dort überhaupt willkommen?«
Ich achtete auf winzige Verzögerungen bei Pierres Antwort, auf Stirnfalten, Augenbrauen und Mundwinkel, konnte jedoch nichts entdecken, das mich argwöhnisch gemacht hätte.
»Sicher«, sagte er. »Warum nicht?«
Fast im Schritttempo fuhr ich in die Siedlung Kaltenhusen, die sich trotz der geringen Bebauung über einen ganzen Quadratkilometer erstreckte, da einige größere Wiesengrundstücke zwischen den Anwesen lagen. Es erstaunte mich, dass drei der sechs Häuser hergerichtet waren, eines davon war sogar neu konzipiert, erweitert und modernisiert worden. Die übrigen drei waren ziemlich heruntergekommen, der graubraune Putz an den Wänden stammte noch aus DDR-Zeiten. Vor einem dieser Häuser, dem meiner Familie, stieg ich aus.
Das Gebäude, in dem ich groß geworden war, hatte seine besten Tage lange hinter sich. Der Putz war abgeblättert, die Fenster waren ein Jammer, die Regenrinne stand von der Wand ab, der Garten war hoffnungslos verwildert, der Zaun von Wicken überwuchert … Zwischen den wilden Schlehen und allerlei Unkraut lag ein verrosteter Briefkasten, auf dem unter anderem mein Name stand.
Soweit ich wusste, hatte Sabina schon vor Jahrzehnten ein Maklerbüro mit dem Verkauf beauftragt, allerdings hatte sich bisher nichts ergeben. Die meisten Menschen, die Ruhe und Einsamkeit suchen, tun dies in aller Regel nur für drei Wochen im Jahr. Wer dagegen dieses Haus erwarb, der musste hier leben und arbeiten können. Kaltenhusen war wie eine kleine Insel auf der Insel, eine Art Hallig inmitten eines grünen Ozeans von Wiesen. Wer sich dort nicht mit den Nachbarn verstand …
Ich zuckte zusammen. Ein Stück entfernt, hinter einem großen Hoftor, ertönte eine Kreissäge. Das schrille, unangenehm laute Geräusch erinnerte an einen menschlichen Schrei.
Ich nahm meine Handtasche aus dem Auto und ging zum Haus der Petersens, das nur zwei Steinwürfe entfernt lag. Es war ebenfalls in schlechtem Zustand.
»Was wollen Sie?«, murrte es unmittelbar nach dem Klingeln von der anderen Seite der braunen, leicht morbiden Holztür. »Ich kaufe nichts, schon gar nicht von Ihnen.«
Margrethes tiefe Stimme löste einen Wiedererkennungseffekt bei mir aus, denn sie hatte sich als Kind schon leicht mürrisch und maskulin angehört. Im ersten Moment wollte ich mich zu erkennen geben, aber dann überkam mich die Lust auf einen kleinen Streich. Ich hatte viel zu wenig gelacht in den letzten Monaten, konnte mich gar nicht mehr an das letzte Mal erinnern.
»Aber Sie kennen mich doch gar nicht«, säuselte ich, wobei ich mich darauf verlassen konnte, dass sie meine veränderte Stimme nicht wiedererkennen würde. Sehen konnte sie mich ja nicht.
»Muss ich auch nicht. Hab Ihre Stöckelschuhe bis rein gehört. Von Ihrer Sorte hat sich schon lange niemand mehr hierherverirrt. Sie wollen mir wohl einen Platz im Himmel andrehen. Oder einen Staubsauger, was für Leute wie Sie irgendwie das Gleiche zu sein scheint. Vielleicht auch die ewige Jugend oder das Neueste aus der Beauty-Forschung. Sind Sie beim Plündern des Regenwalds auf eine Wunderblume gestoßen, die Sie jetzt in Ihre unverschämt teuren Pasten einrühren?«
»Was, wenn es so wäre?«
»Gute Frau, damit Sie’s wissen: Ich kaufe meine Cremes im Discounter, halte Parfüm für eine Mischung aus Walfischscheiße und Ochsenpisse, und als ich vor sechs Jahren zuletzt einen Eyeliner benutzt habe, bin ich gefragt worden, ob ich heimlich Opium rauche. So, damit wissen Sie, was ich von Kosmetik halte. Sie lachen? Schön, dass ich zu Ihrer Belustigung beitragen konnte. Leben Sie wohl.«
»Für jemanden, auf dessen Fußmatte ›Welcome‹ steht, sind Sie ziemlich abweisend«, sagte ich, wobei ich das Lachen mühsam unterdrücken musste. So sehr hatte ich mich seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr amüsiert.
»Jetzt hab ich aber die Schnauze voll«, sagte Margrethe und riss die Tür auf.
Mir gegenüber stand eine Frau mittleren Alters, die ihre groben Arbeitshände an einem Spülhandtuch abtrocknete. Sie hatte eine fast weiße Haut, dunkelrot gefärbte, kurze Haare und grüne Augen. Ihre stämmige Figur, der Gesichtsausdruck und die dunkle, leicht genervte Stimme waren unübersehbare Warnschilder: Betreten auf eigene Gefahr.
Sie fiel aus allen Wolken. »Lea«, murmelte sie und starrte mich an wie ein Gespenst.
In der Küche, in der ich seit ein paar Minuten mit Margrethe saß, hatten wir beide und die anderen aus der Clique früher ständig rumgehockt. Mit Vorliebe hatten wir die großen Stücke von Edith Petersens leckerem Kuchen gegessen, die wir mit Trinkfix-Kakao herunterspülten. Selig lächelnd hatte Margrethes Mutter uns dabei zugesehen, und ich wünschte mir in diesem Moment nichts sehnlicher als einen Gugelhupf samt Trinkfix auf dem Tisch.
Überall war die Vergangenheit präsent. Die gusseiserne Backform, die Edith Petersen seit jeher benutzte, stand auf ihrem alten Platz auf dem schiefen Küchenschrank. Dazu der Gasherd aus den Sechzigern und die Reproduktion eines naiven Gemäldes, das einen Fischkutter im Sonnenuntergang zeigte. Nur wenig hatte sich geändert. Die alten Dielen waren unter einem modernen hässlichen PVC-Belag verschwunden, durch den sie ihre knarzenden Geräusche schickten. Der monumentale Kühlschrank war zwar nach der Wende die erste West-Anschaffung der Petersens gewesen, war aber anscheinend seither nicht ersetzt worden, weshalb er inzwischen fast genauso ergraut aussah wie damals der altmodische DDR-Kühlschrank.
Margrethe stellte zwei Becher Kaffee auf den Tisch, scheußliches Instantzeug, das sie in großen Schlucken trank. Nur durch ein kleines Fenster über der Spüle fiel ein wenig Licht zu uns herein, und die Stimmung zwischen Margrethe und mir war ähnlich trübselig. Verflogen war der kleine Spaß vom Eingang, über den sowieso nur ich hatte lachen können. Ich hatte Margrethe gebeten, es mit Humor zu nehmen, doch ebenso gut hätte ich einen Toten bitten können aufzustehen. Ihre Mundwinkel verzogen sich noch nicht einmal andeutungsweise zu einem Lächeln.
»Hätte nicht gedacht, dass du noch mal herkommst«, sagte sie. »Pierre hat irgendwann mal erzählt, du hättest Gedächtnisschwund. Hast uns Pappnasen wohl vergessen? Na, wenn das alles ist, was vom Unfall zurückgeblieben ist … Hast Schwein gehabt, sehr viel Schwein.«
»Der Unfall hat schon ein paar Wunden und Veränderungen nach sich gezogen«, schränkte ich ihr Urteil ein.
»Ja, deine Stimme klingt anders.«
»Organisch bedingt«, log ich.
»Das Weiche darin passt viel besser zu dir als dieses Klare, Helle von früher. Was du früher von dir gegeben hast, hat sich ja immer angehört, als hättest du vorher stundenlang in einem Gedichtband geblättert. Nur deine Pipi-Langstrumpf-Stimme hat nicht dazu gepasst, die war immer so quietschig. Hab gehört, dass du ’ne Knipse geworden bist.«
»Eine was?«
»Fotografin«, übersetzte sie.
»Stimmt. Habe ich bei meinem Besuch im Mai nicht darüber gesprochen?«
»Wir haben nicht viel miteinander geredet«, sagte sie, und ich war mir nicht sicher, ob ihr Unterton verbittert oder enttäuscht war – oder ob es gar keinen Unterton gab. »Außerdem warst du ja bloß einen Nachmittag und einen Abend hier.«
»Ja, angeblich … Ich kann mich wie gesagt leider nicht daran erinnern.«
»Na, dann will ich dir mal ein bisschen was über mich erzählen, geht ohnehin schnell.« Margrethe zuckte mit den Schultern. »Ledig, keine Kinder«, berichtete sie, als wäre damit ihr Leben am besten beschrieben. »Aber Harry hat zwei … zwei Kinder und zwei Exfrauen. Zahlt sich dumm und dämlich, mein Bruder. Hat’s vermasselt. Seit ein paar Jahren lebt er wieder bei uns.«
»Uns?«
»Mama ist oben. Sie hatte vor sechs Jahren einen Schlaganfall und ist seither bettlägerig. Oder sind es schon sieben? Weiß nicht mehr.«
»Oh, das tut mir leid. Sie war immer so fit.« Das war keine Floskel von mir. Tatsächlich war Edith Petersen in meiner Jugend für mich mehr gewesen als nur die Mutter meiner Freunde Harry und Margrethe, eine Art Lieblingstante.
»Sie ist schon sehr lange krank, eigentlich seit sie in Frührente gegangen ist. Hat von da an immer irgendwas gehabt: Krebs, Magengeschwüre, Rheuma …«
Margrethes Blick fiel auf die leere Tasse, die sie mit beiden Händen umklammerte, während ich nach dem abgerissenen Gesprächsfaden suchte, den ich jedoch auf die Schnelle nicht fand. Dreiundzwanzig Jahre waren in ein paar Minuten gepresst worden, in fünf, sechs Sätze, und damit schien alles über die Vergangenheit gesagt. Die Gegenwart war beklemmend. Da war dieses schläfrige, morbide Häuschen, eine Küche im grauen Dämmerlicht, ein Geschwisterpaar um die vierzig, das bei der kranken Mutter lebte, eine trübe Brühe, die den Namen Kaffee nicht verdiente. Da waren Stille und Stillstand, trotz der tickenden Küchenuhr.
Mir fiel nichts Tröstliches ein, das ich hätte sagen können, daher versuchte ich es erst gar nicht.
»Sag mal, Margrethe, weißt du, warum Sabina und ich im Mai nach Poel gekommen sind? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir hier ein nostalgisches Familientreffen veranstaltet haben.«
»Nee, bestimmt nicht«, lachte sie auf. »Ihr wart doch immer wie Hund und Katze.«
»Eben.«
Sabina und ich hatten dreiundzwanzig Jahre keinen Kontakt gehabt, sah man mal von den Weihnachtskarten ab, die wir uns geschickt hatten – sie regelmäßig, ich eher unregelmäßig. Wir hatten Adressen ausgetauscht, sonst nichts. Wir besuchten uns nicht, schrieben uns keine E-Mails und telefonierten in all der Zeit nur ein einziges Mal, als sie mich zwanzig Jahre nach meiner Abreise nach Argentinien anrief und wissen wollte, ob ich einverstanden sei, dass das Grab unserer Eltern auf Poel aufgelöst würde. Da ich nichts dagegen hatte, dauerte das Gespräch keine drei Minuten.