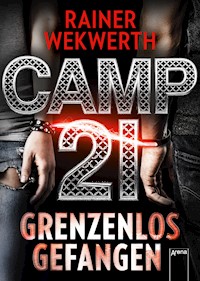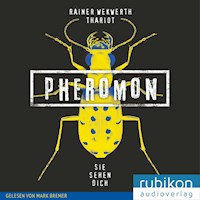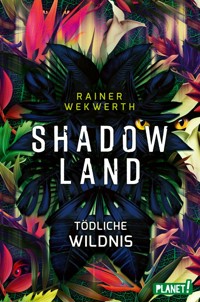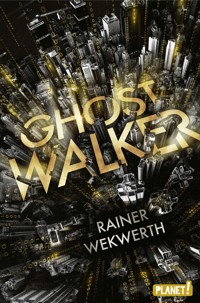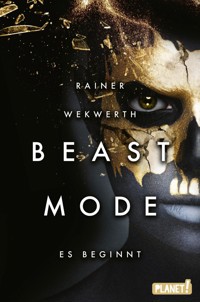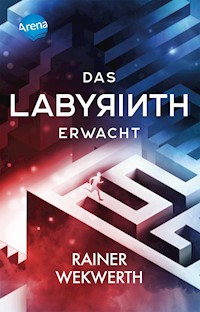
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Labyrinth-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein Mystery-Thriller der Extraklasse Es sind sieben Jugendliche, aber nur sechs Tore führen in die Freiheit. Und das Labyrinth, das sie gefangen hält, denkt. Es ist bösartig. Sie wissen nicht, wer sie einmal waren. Aber das Labyrinth kennt sie. Jagt sie. Es gibt nur eine einzige Botschaft: Sie haben zweiundsiebzig Stunden Zeit, das nächste Tor zu erreichen, oder sie sterben. Ein tödlicher Kampf um die Tore entbrennt - aber sie sind dort nicht allein. Ausgezeichnet mit den Leserpreisen "Segeberger Feder" und "Ulmer Unke". Nominiert für die Leserpreise "Buxtehuder Bulle" und "Goldene Leslie". "Aus dem Labyrinth gibt es kein Entkommen, es hat mir den Schlaf geraubt. Spannender geht's nicht." Ursula Poznanski Alle Bände der Labyrinth-Tetralogie: Das Labyrinth erwacht (1) Das Labyrinth jagt dich (2) Das Labyrinth ist ohne Gnade (3) Das Labyrinth vergisst nicht (4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Autor
Rainer Wekwerth,1959 in Esslingen am Neckar geboren, schreibt aus Leidenschaft.Er ist Autor erfolgreicher Bücher, die er teilweise unter Pseudonym veröffentlichtund für die er Preise gewonnen hat. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter.Der Autor lebt im Stuttgarter Raum.Weitere Bücher von Rainer Wekwerth im Arena Verlag:Damian. Die Stadt der gefallenen EngelDamian. Die Wiederkehr des gefallenen Engels
Titel
Rainer Wekwerth
Das Labyrinth erwacht
Widmung
Für Thomas
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2013© 2013 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenCover: Frauke SchneiderISBN 978-3-401-80192-6www.wekwerth-labyrinth.dewww.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
1. Buch
1.
Als Jenna erwachte, sah sie als Erstes den blauen Himmel, der sich majestätisch über ihr erstreckte. Ein leichter Wind trieb zerfledderte Wolken vor sich her und hoch am Zenit zog einsam ein Raubvogel seine Kreise.
Jenna beobachtete eine Weile, wie er die Kraft des Aufwindes nutzte, um sich noch höher tragen zu lassen.
Was ist das für ein Vogel, warum weiß ich das nicht?, fragte sie sich. Plötzlich wurden die Konturen des Vogels undeutlich, verschwammen mit dem Blau des Himmels, dann war er verschwunden.
Unruhe überkam sie.
Wo bin ich?
Sie lag auf dem Rücken. Auf weichem Gras. Als sie den Kopf drehte, sah sie, dass sich neben ihr lange gelbe Halme im Wind wiegten. Ein sanfter Hauch strich über ihr Gesicht. Dann spürte sie auch die Wärme der Sonne.
Es ist schön hier, aber wo bin ich?
Das Gesicht der Sonne zugewandt, die Augen geschlossen, blieb Jenna noch eine Weile auf der Wiese liegen.
Auf einmal fiel ein Schatten auf sie.
Sie öffnete die Augen.
Ein junger Mann beugte sich über sie. Sein jugendliches Gesicht mit ebenmäßigen Zügen wurde von markanten Linien dominiert. Hohe Wangenknochen, eine gerade Nase, wie aus Stein gemeißelt, darunter ein ausdrucksstarker Mund mit einer kleinen Narbe am Mundwinkel. Der Wind fuhr durch sein langes schwarzes Haar, offenbarte nur kurz sein Gesicht und verbarg es dann wieder.
Braune Augen blickten aufmerksam zu ihr herab. Er lächelte nicht, trotzdem fühlte sich Jenna in seiner Gegenwart augenblicklich wohl.
»Ich bin Jeb«, sagte er, als erkläre das alles.
Jenna wollte ihm antworten, sich ebenfalls vorstellen. Sie zögerte, stutzte.
Wer bin ich?
Jeb legte eine Hand sanft über ihr Gesicht, um das Licht von ihr abzuschirmen.
»Schließ deine Augen«, sagte er ruhig.
Jenna gehorchte, obwohl sie nicht wusste, warum. Es lag etwas in seiner Stimme, dem sie vertraute und dem sie sich nicht entziehen konnte. Der Klang der Worte beruhigte sie.
»Atme tief ein und wieder aus.«
Sie holte tief Luft und stieß sie wieder aus. Seine Hände rochen nach Gras und Erde.
»Nun versuch es noch einmal.«
Und da wusste sie es. Sie war so glücklich darüber, dass sie ihm beinahe um den Hals gefallen wäre.
»Ich bin Jenna«, rief sie.
Alles würde gut werden. Sie war nicht krank oder verrückt. Nein, sie hatte einen Namen und sie kannte ihn.
Jenna.
Sie blickte in Jebs beinahe bronzefarbenes Gesicht, das offen wirkte wie der Himmel über ihr. Doch plötzlich runzelte der Junge die Stirn.
»Jenna, du musst jetzt aufstehen«, sagte er eindringlich.
Seine Stimme war nicht mehr warm und sanft. Im Gegenteil, sie klang wie zersplitterndes Glas, als müsste er sich zwingen, die Worte auszusprechen.
Jenna spürte Angst in sich aufsteigen. Woher der plötzliche Wandel? Was hatte sie getan?
»Was ist denn?«, fragte sie vorsichtig.
»Wir müssen los, uns bleibt keine Zeit.«
Jenna verstand nicht. Warum drängte die Zeit? Sie war noch immer verwirrt, als Jeb ihr eine Hand reichte, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Desorientiert drehte sich Jenna einmal um die eigene Achse. Auf ihre Schultern fielen lange blonde Haare hinab, die der Farbe des hellen gelben Grases glichen, in dem sie gerade gelegen hatte. Sie wusste immer noch nicht, wo sie war.
Ich war hier noch nie.
Alles fühlte sich fremd an. Grashalme, so weit das Auge reichte. In der Ferne ein düster wirkender Wald und am Horizont hohe Berge, deren Gipfel von Schnee bedeckt waren. Gerade verdeckte eine der Wolken die Sonne. Sie fröstelte und schlang die Arme um sich.
Da erst merkte sie, dass sie nackt war.
Sie versuchte, sich mit den Händen zu bedecken und überlegte fieberhaft, ob es in Ordnung war, nackt in Gegenwart eines anderen zu sein. Erneut machte sich Unruhe in ihr breit. Warum hatte ihr Jeb nicht gesagt, dass sie nackt war?
Auch diesmal schien er ihre Gedanken zu erraten, denn er reichte ihr einen braunen Rucksack aus einem glatten Material mit schwarzen Verschlüssen.
»Darin findest du Kleidung«, sagte er. »Sie wird dir passen. Ich denke, sie passt immer.«
Woher weiß er das?
Sie betrachtete ihr Gegenüber. Unbefangen, als wäre es das Normalste der Welt, stand er vor ihr, sah nicht weg, starrte sie aber auch nicht an. Es lag etwas Vertrautes in der Art, wie er dastand und darauf wartete, dass sie sich ankleidete. Jeb selbst trug Jeans, feste Wanderstiefel, ein warmes Baumfällerhemd und eine regenfeste Jacke.
Ohne Probleme fielen Jenna die Worte ein, die diese Kleidungsstücke bezeichneten.
Sie griff nach dem Rucksack und wandte sich ab.
Eigentlich unnötig, er hat dich die ganze Zeit nackt gesehen. Er weiß, wie du aussiehst.
Mit fliegenden Fingern zog sie die Kleidung an, die in allen Details Jebs Sachen ähnelte, nur dass ihr Hemd blau kariert war, während bei ihm Rot dominierte.
»Bitte beeil dich.«
Jenna schloss den obersten Knopf ihrer Jeans und schlüpfte in die Jacke. Alles passte wie angegossen.
Seltsam.
»Ich habe dich doch gerade erst gefunden. Warum müssen wir uns beeilen?«, fragte sie.
»Ich habe dich gefunden, oder nicht?«
Dabei habe ich das Gefühl, dass ich auf der Suche nach dir war.
Jebs Gesicht war zu einer düsteren Maske geworden. Er streckte den rechten Arm aus und deutete zum Horizont, zu dem Wald in der Ferne. Ein paar Wolken hingen über den weißen Spitzen des Bergmassivs. Auf der Ebene davor, sah Jenna, waren vereinzelte trockene Sträucher und Büsche die einzige Abwechslung in der ansonsten öden Steppenlandschaft.
»Dort müssen wir hin, bevor es dunkel wird. Wir können nicht hierbleiben.«
»Ich verstehe das alles nicht. Warum müssen wir zum Wald? Wo sind wir? Und woher weißt du das überhaupt?«
»Später! Lass uns erst mal aufbrechen.«
Jenna zögerte. Ihr gefiel nicht, wie Jeb sie herumkommandierte, ohne auch nur den Hauch einer Erklärung für sein merkwürdiges Verhalten zu liefern.
»Nein, du erklärst es mir jetzt. Vorher mache ich keinen Schritt. Ich muss wissen, wo wir sind«, sagte sie mit fester Stimme.
Jeb sah sie nachdenklich an. Er wirkte gelassen, keinesfalls verärgert, doch sein nächster Satz traf sie völlig unvorbereitet. »Wir sind in Gefahr.«
Sie sah sich hektisch um, aber da war nichts. Keine Menschen. Keine Tiere. Noch immer herrschte eine fast unheimliche Stille.
Ihr Blick flog über das Land, das eben noch freundlich gewirkt hatte.
»Es könnte tödlich für uns werden, wenn wir nicht sofort aufbrechen«, fügte er hinzu.
Es war die Ruhe in seiner Stimme, die ihr klarmachte, dass Jeb von einer konkreten Bedrohung sprach. Er klang überzeugt von dieser Sache. Aber Jenna wollte sich keine Angst einjagen lassen.
»Tödlich? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich kann keine Gefahr erkennen. Sag mir, was los ist.« Sie schaute sich um. Die weite Steppe lag friedlich zu ihren Füßen.
Er schüttelte den Kopf. »Dafür ist jetzt keine Zeit.« Mit diesen Worten wandte er sich ab und ging los. Jenna blieb verblüfft zurück. Was sollte sie jetzt tun? Ihm hinterhergehen oder an Ort und Stelle bleiben? War es nicht besser, hier zu warten? Vielleicht würden ihre Erinnerungen zurückkehren und sie wüsste, wie sie hierhergekommen und was zu tun war.
Wer ist denn eigentlich Jeb?
»Jeb?«, rief sie. »Jeb! Du kannst mich doch nicht einfach…« Doch Jeb drehte sich nicht zu ihr um, sondern ging unverwandt weiter. Jennas Kehle schnürte sich zu. Er war der einzige Mensch weit und breit und der Abstand zu ihm wurde stetig größer. Der Gedanke, in dieser Weite zurückgelassen zu werden, machte sie fast verrückt.
Sie atmete einmal tief durch, dann nahm sie den Rucksack, der ohne Kleidung gleich viel leichter war, und lief Jeb hinterher.
Nachdem sie ihn eingeholt hatte, gingen sie eine Weile schweigend nebeneinanderher. Dunkle Wolken waren am Horizont über dem Gebirge aufgezogen, in dessen Richtung sie marschierten. Vereinzelte Blitze zuckten zur Erde hinab, aber das Gewitter war noch zu weit weg, als dass man den Donner hören konnte. In der Luft lag der dumpfe Geruch von Erde und es wurde merklich kühler. Jenna fröstelte und zog den Reißverschluss ihrer Jacke hoch.
Sie hatte Hunger und Durst, wagte aber nicht, Jeb jetzt schon nach einer Pause zu fragen. Im Abstand von zwei Metern ging er neben ihr her und sie spähte aus den Augenwinkeln zu ihm hinüber. Er war gut einen Kopf größer als sie. Unter der Kleidung zeichnete sich ein sportlicher Körper ab. Er bewegte sich sicher, fast geschmeidig, das war ihr sofort aufgefallen. Seine Miene wirkte verschlossen, konzentriert. Er hatte die Augen zu schmalen Schlitzen geschlossen und starrte unablässig auf den Wald in der Ferne.
»Jeb? Wo sind wir?«
Er sah zu ihr hinüber, verlangsamte aber sein Tempo nicht.
Er zögerte. »Ich weiß es nicht genau.«
»Du weißt es nicht?« Sie war wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Jeb sich hier auskannte. Er wusste schließlich von den Gefahren an diesem Ort und anscheinend auch einen Platz, an dem sie in Sicherheit waren. Warum sonst marschierte er so zügig auf den Horizont zu?
»Ich bin nicht sicher.« Plötzlich wirkte er viel jünger als gerade eben. Und verletzlich. »Ich bin vor einem Tag in dieser Umgebung aufgewacht. Genau wie du. Ich kannte meinen Namen, aber sonst war da nichts.«
Jenna konnte das gut nachfühlen: Auch ihr Kopf war eben noch wie ein leerer Raum gewesen, dessen Wände weiß gestrichen waren und in dem es keine Möbel, Bilder oder Teppiche gab. Nichts. Nur Fragen, auf die sie keine Antwort wusste.
Wie komme ich hierher? Ich kenne diese Umgebung nicht, also bin ich fremd hier, aber wie kann es sein, dass ich an einem unbekannten Ort erwache, ohne zu wissen, wie ich dorthin gekommen bin?
Warum war ich nackt? Woher kommt die Kleidung? Warum passt sie mir, als wäre sie meine?
Mit jeder Minute, die sie weiter darüber nachgrübelte, wurde Jenna verwirrter.
»Genau wie du habe ich den Rucksack mit Kleidung, Essen und einer Trinkflasche mit Wasser gefunden«, sprach Jeb weiter.
Jennas Magen knurrte bei diesen Worten, aber wenigstens wusste sie jetzt, dass sich etwas zu essen in ihrem Rucksack befand.
»Zunächst geschah gar nichts.« Er fasste sich ans Kinn, rieb mit der Hand über seine glatten Wangen. »Ich… ich erinnere mich nicht an viele Dinge aus meinem Leben, aber das, woran ich mich erinnere, gibt es hier nicht.«
»Zum Beispiel?«
»Ein Motorrad. Eine schwarz lackierte alte Harley Davidson Indian. Wuchtig, mit einem verblichenen braunen Ledersattel. Ich glaube, sie hat mir gehört.« Er wandte sich zu ihr um, ging aber ohne Pause weiter. »Weißt du, was ein Motorrad ist?«
»Ja.« Plötzlich hatte Jenna ein Bild vor Augen. Ja, sie erinnerte sich daran, wie ein Motorrad aussah. Sie schöpfte etwas Hoffnung. Den Gedanken, dass alles nur ein Traum sein könnte, hatte sie längst verworfen. Niemand, der träumte, spürte die Wanderstiefel so deutlich an der Ferse scheuern. Nein, das hier war anders. Kein Traum. Wie auch immer sie hierher geraten war, sie musste einen Weg zurück nach Hause finden, wo immer das auch sein mochte. Bei dem Gedanken wurde ihr beinahe schwindlig.
Jeb streckte einen Arm nach vorn. »Siehst du hier irgendwo eine Straße, ein Haus oder sonst etwas?«
»Nein«, gab sie zu. Straße. Haus. Das waren neue Bilder. »Also, wenn es keine Straßen gibt, warum zum Teufel braucht man dann ein Motorrad?«, fragte er wütend.
Jenna war froh, dass Jeb zum ersten Mal seine Gefühle nicht vollständig unter Kontrolle hatte und es ihm offensichtlich genauso ging wie ihr selbst.
»Erinnerst du dich noch, wo du dieses Motorrad gesehen hast?«
»Nein, ich weiß nur, dass es woanders war. Aber da ist noch etwas, weswegen ich glaube, dass wir uns in einer fremden Welt befinden.«
Eine fremde Welt? Was sollte das sein?
Nun hatte er ihre volle Aufmerksamkeit. »Warum glaubst du das?«
»Die Botschaft.«
»Welche Botschaft?«, wiederholte Jenna. »Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.«
»Als ich hier aufgewacht bin, habe ich auch diesen Zettel gefunden.«
»Ein Zettel?!« Jenna wollte laut auflachen. Das wurde ja immer besser!
»Mit einer Nachricht. An uns. Darin stand, was mit uns passiert.«
Jenna wollte gerade einen bissigen Kommentar machen, als sie Jebs ernsten Gesichtsausdruck bemerkte.
Wovon redete er da? Erst die Andeutungen, dass sie in irgendeiner Gefahr schwebten, und nun, dass es eine Botschaft für sie gab. Oh Mann. Das war doch alles Unsinn. Sie liefen vor etwas weg, das es nicht gab, und offensichtlich war Jeb nicht mehr ganz richtig im Kopf. Sie musste diesem Wahnsinn ein Ende bereiten, damit sie nach Hause gehen konnte.
»Ach«, Jenna konnte sich einen amüsierten Unterton nun doch nicht länger verkneifen. »Und was stand da so auf diesem Zettel?«
Seltsamerweise sah er sie nur gelassen an. »Mir war klar, dass du so reagieren würdest.«
»Wie hätte ich denn sonst reagieren sollen?«
»Du hättest mir eine Frage stellen können. Eigentlich wundert es mich, dass du mich noch nicht gefragt hast.«
»Was denn für eine Frage?«
Wurde das Ganze jetzt auch noch ein albernes Quiz?
Eine dunkle Wolke hatte sich vor die Sonne geschoben, sodass die Umgebung im Zwielicht beinahe gespenstisch wirkte. Jeb blickte ihr nun unverwandt ins Gesicht. Dann antwortete er: »Du hättest mich fragen müssen, wie ich dich gefunden habe.«
Jebs Worte wirbelten durch Jennas Kopf. Sie blieb stehen. Blickte sich erneut um. Steppe, so weit das Auge reichte. Sie versuchte, den Ort auszumachen, wo sie im hohen Gras gelegen hatte. Unmöglich. Diese Landschaft war wie ein großer grüngelber Ozean, in dem man sich verlieren konnte.
Es ist unvorstellbar, dass er mich bloß durch Zufall gefunden hat.
Sie räusperte sich heiser. »Du hast gewusst, wo du mich finden würdest?«, rief sie ihm hinterher, denn Jeb war unverdrossen weitergelaufen.
»Ja. Das war Teil der Botschaft. Komm jetzt, wir müssen uns beeilen. Dass ich dich tatsächlich gefunden habe, bestätigt mir, dass alles stimmen muss, was die Botschaft vorgibt.«
Jenna schloss wieder zu ihm auf und sah ihn ernst an. Sosehr sie Angst vor seiner Antwort hatte, sie musste die nächste Frage stellen, ob sie wollte oder nicht. »Stand darin auch, wovor wir davonrennen?«
Er zögerte, warf einen Blick in Richtung des Waldes, der noch immer weit entfernt am Horizont lag. Jenna merkte, dass Jeb zu einer Erklärung ansetzen wollte.
Plötzlich erklang in der Ferne ein lang gezogener Schrei. Er schien von weit her zu kommen, drang anfangs nur schwach heran, übertönte dann aber deutlich das Rauschen des Windes im Gras. Jenna zuckte zusammen. Es klang fürchterlich, Angst einflößend und vor allem – überhaupt nicht menschlich.
»Hast du das auch gehört?« Jeb war erstarrt, sämtliches Leben schien aus ihm gewichen zu sein.
»Ja, unheimlich. Was war das?« Jenna blickte in die Richtung, aus der der unmenschliche Schrei gekommen war, konnte aber nichts entdecken. Jeb stand noch immer reglos und sie berührte ihn vorsichtig am Arm: »Jeb?«
»Lass uns schnell weitergehen, die Sonne wird gleich ganz verschwunden sein. In der Botschaft stand, dass wir in Gefahr sind, wenn die Sonne nicht scheint.« Jeb sah sie ernst mit seinen klaren braunen Augen an. »Auf dem Zettel steht noch mehr, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Etwas ist anscheinend da draußen und verfolgt uns. Es hat mit unserer Angst zu tun. Wir sollten vorsichtig sein, zumindest, bis wir mehr über die Sache herausgefunden haben. Jetzt müssen wir weiter.«
Jemand verfolgte sie? Wer und warum?
Jenna hatte verstanden, dass sie im Moment keine Antworten von ihm bekommen würde. Stattdessen deutete sie zum Himmel, wo sich große Gewitterwolken hinter den Bergspitzen auftürmten. Sie liefen direkt darauf zu. »Ist es dann schlau, direkt auf den Wald zuzusteuern?«
Jeb nickte. »Dort gibt es Holz und wir können ein Feuer machen. Hier draußen in der Steppe brennt entweder gar nichts oder alles.«
Das war logisch, doch der Gedanke beruhigte Jenna nicht. Im Gegenteil. Der Wald war immer noch zu weit entfernt, als dass sie ihn vor dem Gewitter erreichen würden. Das schien auch Jeb zu denken, denn er schaute sie fragend an: »Meinst du, wir können ein Stück rennen?«
Als ob er spürte, wie viele Fragen ihr noch auf den Lippen brannten, brach es hastig aus ihm heraus: »Wir reden weiter, wenn wir die anderen gefunden haben.«
»Die anderen?«, keuchte Jenna im Lauf. »Welche anderen?« Aus irgendeinem Grund hatte sie die ganze Zeit gedacht, allein mit Jeb zu sein.
»Wir müssen zu ihnen. Vielleicht wissen sie, was hier los ist. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir diese Antworten.«
Die anderen.
Sie waren nicht allein.
Gott sei Dank! Menschen bedeuten Schutz und Sicherheit.
Erneut ertönte ein Schrei. Diesmal klang es eher wie ein Kreischen, das Jenna einen eisigen Schauer über den Rücken jagte. Und das Echo war jetzt schon wesentlich näher.
Es bedeutete mehr Kraft zur Verteidigung, falls sie tatsächlich verfolgt wurden.
2.
Sie jagten ihn seit dem Augenblick, als er erwacht war. Verwirrt, in einer fremden Welt, ohne Erinnerung. Nackt. Er schlüpfte gerade in die festen Wanderschuhe, als er die Schreie zum ersten Mal hörte. Sie waren nah. Und es waren mehrere.
Er spürte die Gefahr augenblicklich. Seine Nackenhaare richteten sich auf und ein Zucken durchlief seinen Körper.
Was immer das war, es war gefährlich. Instinktiv wusste er, dass er fliehen musste.
Als er sich aufrichtete, stieß ihn etwas mit unglaublicher Wucht zu Boden. Es war, als wäre er mit voller Kraft gegen eine massive Wand gelaufen, eine Wand aus frostigem Eis. Aus den Augenwinkeln erkannte er, dass dieses Etwas eine menschenähnliche Gestalt hatte. Augenblicklich spürte er die Kälte in seinem linken Arm, dort wo ihn die Gestalt berührt hatte. Er wich auf dem Boden krabbelnd zurück, seinen linken Arm, wo ihn das Wesen gestreift hatte, zog er nutzlos und steif hinter sich her. Es gelang ihm in der kurzen Zeit und in seiner unglücklichen Position nicht, sich ein Bild seines Gegners zu machen. Er wusste nur, dass er so schnell wie möglich verschwinden musste. Er warf sich herum, drückte sich mit seinem gesunden Arm vom Boden hoch. Mit einem Satz war er auf den Beinen. Dann rannte er. Er rannte, so schnell er konnte. In seinem Rücken ertönte aufgeregtes Rufen, lang gezogenes heiseres Heulen, das sich in seinem Kopf festzusetzen schien und dem bald andere Schreie antworteten. Was immer ihn da angegriffen hatte, es war nicht allein. Es gab andere, die jetzt ebenfalls Jagd auf ihn machten. Warum griffen sie ihn an? Die unmenschlichen Laute dröhnten in seinen Ohren. Er erhöhte das Tempo. Sein Atem ging keuchend und er versuchte, den lähmenden Schmerz in seinem linken Arm zu ignorieren. Er sah nicht zurück, wollte gar nicht wissen, wie viele ihn jagten, aus Angst, seine Beine könnten bei ihrem Anblick versagen.
Der Rucksack schlug schmerzhaft gegen seinen Rücken, die Wasserflasche darin drückte durch den Stoff. Aber er war froh, die Sachen noch zu haben. Im Laufen zog er die Riemen straff.
Besser, dachte er. So ist es besser. Bloß nicht stolpern, wenn du stolperst, haben sie dich.
Er glaubte, den Atem seiner Verfolger im Nacken zu spüren, die Kälte in seinem Arm zog bis in die Fingerspitzen. Beinahe konnte er sie nicht mehr spüren, und als er versuchte, sie zu bewegen, krampften seine Finger. Es war, als würde das Blut in seinen Adern gefrieren. Er stöhnte auf, doch er biss die Zähne zusammen und forderte das Letzte aus seinem Körper heraus.
Etwas hinter ihm erschütterte den Boden und raste in einer Druckwelle heran. Was war das? Eine Explosion? In letzter Sekunde warf sich Mischa nach vorn, ein heller Schmerz durchzuckte seinen Nacken, als er auf seine Schulter stürzte. Für einen kurzen Moment war alles um ihn wie im Nebel. Wieder hörte er Rufe und Schreie hinter sich. Sie klangen allerdings weiter entfernt als zuvor. Er hatte sie nicht abgehängt, aber sich einen Vorsprung verschafft.
Mischa rappelte sich mühsam hoch und warf hastige Blicke über seine Schulter zurück.
Im unheimlichen Zwielicht konnte er mehrere dunkle Umrisse ausmachen, die sich schleppend auf ihn zubewegten. Sie waren ungefähr so groß wie er. Einzelne Gesichter schälten sich aus der dunklen Masse heraus, immer wieder blitzten helle Haare daraus hervor. Er kam auf diese Weise nicht schnell genug voran, aber er wollte wissen, was da hinter ihm herjagte. Aber jedes Mal, wenn er eine der Gestalten in den Blick bekommen hatte, verschwamm alles vor seinen Augen, er konnte sie nicht fixieren. Das Bild schien zu flackern. Er gab auf.
Wie weit sind sie weg?
Einige Hundert Meter, mindestens.
Vornübergebeugt, versuchte er, sich zu erholen. Der Brustkorb pumpte hektisch, bei jedem Atemzug stach es in der Lunge. Sein mittlerweile komplett steifer Arm krampfte. Irgendetwas pulsierte schmerzend an der Hüfte, aber er ignorierte es. Er zog die Wasserflasche aus dem Rucksack und trank sie in hastigen Schlucken leer. Über neues Wasser konnte er sich später Gedanken machen.
Jetzt musste er weiter. Er wusste, dass er noch lange nicht in Sicherheit war. Seine Verfolger kamen näher, unerbittlich. Es war sinnlos, einfach weiterzurennen, bis er vor Erschöpfung zusammenbrach. Er musste es schaffen, seine Spur zu verwischen, ihre Sinne zu täuschen. Aber wie?
Sein Blick schweifte umher. Ein Blitz erhellte den Himmel für einen Sekundenbruchteil.
Da. Gar nicht so weit entfernt, zeichnete sich ein Wald vor dem dunklen Horizont ab. Dort wäre er nicht so leichte Beute. Sie würden ihn nicht so schnell finden können, vielleicht sogar seine Spur verlieren. Er entblößte die Zähne zu einem entschlossenen Grinsen.
Ich werde diese verfluchten Biester abhängen.
3.
León hatte sich aufgerichtet und blickte sich um. Gras, so weit das Auge reichte, lediglich in einer Richtung zeichnete sich ein dunkler Wald ab.
Qué pasa? Wie bin ich hierhergekommen?
Er blickte an seinem nackten Körper hinab. Blauschwarze Figuren mit Flügeln, Totenschädel, jede Menge Buchstaben, die er nicht lesen konnte, Verzierungen, geometrische Formen. Seine Arme, Beine, der ganze Oberkörper, alles war von diesen mysteriösen Zeichen bedeckt. Er spuckte auf den Arm und versuchte, eines der Bilder abzureiben. Vergeblich. Die Dinger waren in seine Haut eingestochen.
Ob mein Gesicht ebenfalls voll damit ist?
Es gab keine Möglichkeit, das zu überprüfen.
Mierda! Ist das jetzt gut oder schlecht für mich?
Da die Bilder schon teilweise verblasst waren, konnten sie nichts Schlimmes bedeuten. Außerdem schmerzten und juckten sie nicht, wahrscheinlich trug er sie schon lange. Er fuhr sich mit der Hand über Nase und Wangen, dann über seinen Kopf. Seine Haut war völlig glatt. Unversehrt.
Er schaute erneut an sich herab und grinste. Na wenigstens eine Stelle war nicht von diesen… Tätowierungen!!!… bedeckt.
Ein kalter Windhauch erfasste ihn. In der Ferne braute sich ein gewaltiges Gewitter zusammen und er stand splitternackt an einem unbekannten Ort.
Plötzlich durchbrach ein Lichtstrahl die Wolkendecke und ließ etwas im Gras schimmern. Neugierig ging León darauf zu.
Ein Rucksack mit Kleidung, die er sofort anzog. Ein Schlafsack. Er fand ein großes Klappmesser, dessen Klinge unglaublich scharf war, nachdem er herausgefunden hatte, wie man es öffnete.
Gut, dachte er, wenigstens bin ich nicht wehrlos.
Er schob gerade das Messer in die Hosentasche, als ein Geräusch ihn herumfahren ließ.
Nicht weit von ihm entfernt standen ein Junge und ein Mädchen und blickten ihn an. Sie trugen ähnliche Kleidung wie er. Der Junge war fast einen Kopf größer als er selbst. León ließ seinen Blick an ihm hinabgleiten. Der Junge strahlte Kraft und Ruhe aus, auch wenn er im Moment gehetzt wirkte. León erkannte instinktiv, dass er es mit jemandem zu tun hatte, den man nicht unterschätzen durfte.
Das Mädchen hatte ein hübsches Gesicht und Lippen, die wie geschaffen für ein strahlendes Lächeln waren. Aber im Moment lächelte das Mädchen nicht. Ihr schlanker Körper war genauso angespannt wie ihre Mimik und plötzlich verstand León auch, warum die beiden ihn misstrauisch anstarrten und nicht näher kamen.
Ich bin also auch im Gesicht tätowiert.Wahrscheinlich sehe ich für sie wie ein Monster aus.
León fluchte innerlich, dann streckte er beide Arme aus, drehte die Handflächen nach oben und zeigte ihnen, dass er unbewaffnet war und nichts Böses im Sinn hatte. Er ging ihnen ein paar Schritte entgegen.
Das Mädchen zögerte, aber der fremde Junge machte ebenfalls ein paar Schritte auf ihn zu. Er lächelte nicht, wirkte aber freundlich. Er hob die Hand zum Gruß.
»Ich bin Jeb. Das ist Jenna.«
»Mein Name ist León.«
Er wusste zwar nicht, wo er war, aber er musste nicht darüber nachdenken, wer er war. Umso überraschender waren für ihn Jebs nächste Worte.
»Wir haben dich gesucht.«
Jeb hatte sich neben León ins Gras gesetzt. Jenna gab León schüchtern die Hand, bevor sie ihren Rucksack auf dem Boden ablegte. Sie hatten seit geraumer Zeit nichts mehr von dem, das sie verfolgte, gehört. Dies war eine gute Gelegenheit, kurz Kraft zu schöpfen.
Jeb hatte die Beine im Schneidersitz überkreuzt. Interessiert sah er León an. An den nackten Knöcheln des anderen – er trug keine Socken – schlängelten sich Bilder entlang, wuchsen aus den Ärmeln seines Hemdes heraus und zogen sich bis über den Schädel. Die Bilder sahen beängstigend aus, abschreckend – und auch faszinierend. Was sie wohl bedeuteten?
Jeb räusperte sich. »Du hast keine Haare und ehrlich gesagt, siehst du ein wenig merkwürdig aus, mit all den Bildern im Gesicht und auf deinem Schädel.«
León grinste ihn an. »Das sind Tätowierungen, mein ganzer Körper ist voll davon.«
Jeb dachte über das neue Wort nach. »Was bedeuten sie?«
»Ich kann mein Gesicht nicht sehen, wie sieht es denn aus?«
»Du weißt nicht, wie dein Gesicht aussieht?«, fragte Jeb verblüfft. Erst jetzt bemerkte er, dass er eine genaue Vorstellung davon hatte, wie er selbst aussah.
»Nein, keine Ahnung.« León wirkte verärgert. Seine Körperhaltung drückte Anspannung aus. Er hatte die Mundwinkel zurückgezogen, die Zähne fest aufeinandergepresst.
»Hey«, meinte Jeb beschwichtigend. »Cool bleiben. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen. Ich war nur ein wenig überrascht. Jede Information könnte wichtig sein, wenn wir hier überleben wollen.«
León entspannte sich wieder, aber sein Tonfall blieb hart. »Was quatschst du da, compadre?«
Jeb ließ sich von León nicht verunsichern und erwiderte ruhig: »Weißt du, wo du bist? Was dich hierher verschlagen hat? Warum du da bist? Weißt du, wie du wieder nach Hause kommst?« Er machte eine kurze Pause, dann sprach er weiter. »Kennst du dein früheres Leben? Die Gefahren, die hier auf dich lauern? Willst…«
»Ist ja gut«, unterbrach ihn León. »Ich kapiere, was du mir sagen willst. Und die Antwort ist Nein. Nein, ich habe keine Ahnung, wo ich bin oder wie ich hierhergekommen bin. Ich habe auch keine beschissene Vorstellung davon, wer ich eigentlich bin, aber du siehst so aus, als ob du mich darüber aufklären kannst, was das alles hier bedeutet. Also, warum habt ihr mich gesucht?«
Jeb warf einen Blick zum immer finsterer werdenden Horizont, dann spähte er über die Grasebene hinter ihnen. Im Moment war nichts zu hören, aber das musste nicht bedeuten, dass nicht etwas da draußen auf sie lauerte. Sie mussten weitergehen. Abrupt stand er auf.
»Das werde ich dir unterwegs erklären.«
Der tätowierte Junge starrte ihn misstrauisch an.
»Unterwegs?«, wiederholte er.
»Ja, wir müssen weiter. Hier sind wir nicht sicher – etwas ist hinter uns her«, setzte Jeb vorsichtig nach. Bei diesen Worten erhob sich auch Jenna.
León blieb sitzen und blickte sich gelassen um. »Wer jagt uns und warum?«
Jeb spürte, wie er unruhig wurde. Wie sich die Haut über seinen Wangen spannte. Sie vertrödelten hier kostbare Zeit – wie vorhin schon.
»Es ist, wie es ist. Du kannst uns glauben oder es lassen, das ist mir scheißegal«, knurrte er und wandte sich um. Angespannt betrachtete er den Horizont. »Wir gehen jetzt weiter, mach, was du willst.«
»Wie hast du vorhin so schön gesagt? Cool bleiben! Ihr erzählt mir eine Haufen merkwürdiger Dinge und seid dann überrascht, wenn ich nicht gleich alles schlucke und euch brav hinterherlaufe?« León erhob sich geschmeidig, ließ seine Wasserflasche liegen und spuckte neben sich ins Gras. »Mann, ich bin gerade aufgewacht. Splitterfasernackt. An einem Ort, an dem ich noch nie war, und kann mich nicht daran erinnern, wer ich bin. Ja, ich weiß nicht einmal, wie ich aussehe, dann kommt ihr zwei dahermarschiert. Euch kenne ich auch nicht und ihr erzählt mir irgendetwas von einer Verfolgung. – Meinetwegen glaube ich euch. ABER ich habe auch jede Menge Fragen.«
»Die wir dir unterwegs beantworten. Wir müssen jetzt los und die anderen finden.«
»Es gibt noch mehr Loser, die es in diese unwirtliche Gegend verschlagen hat?«
»Ja.«
»Von wie viel Leuten sprechen wir?«
»Vier.«
»Und du weißt, wo sie zu finden sind.«
»Ja.«
»Aber du sagst mir nicht, woher du das weißt?«
Jetzt schaute auch Jenna ihn erwartungsvoll an. In der Ferne zuckten Blitze über den nachtschwarzen Himmel am Horizont. »Uns bleibt nicht mehr viel Zeit«, drängte Jeb.
»Okay – Jeb. Sieht so aus, als hättest du einen Plan. Ich schnapp mir meinen Rucksack und dann erzählst du mir unterwegs alles ganz in Ruhe.«
León ging einige Schritte zur Seite, bückte sich, dann fluchte er plötzlich laut.
»Hijo de puta!«
Jeb wandte sich um. Der tätowierte Junge durchpflügte mit weit ausholenden Armen das Gras, sein Blick wanderte hektisch über den Boden.
»Was ist los?« Jenna, die sorgenvoll den Himmel betrachtet hatte, drehte sich um, während Jeb dem tätowierten Jungen gefolgt war.
Leóns Rucksack war verschwunden.
4.
Als er aufgewacht war, hatte er entfernte Rufe gehört, die aber sofort wieder verstummt waren. Nun wusste er nicht, aus welcher Richtung die Stimme gekommen war. War es überhaupt eine Stimme gewesen?
Die Ebene, die sich vor seinen Augen erstreckte, jagte ihm Angst ein. Schweiß brach auf seiner Stirn aus. Irgendetwas war ganz falsch. Er gehörte nicht hierher.
Sein Kopf war leer, alles darin wie ausgewischt. Diese Leere nahm ihm den Atem. Hektisch blickte er sich um. Weite, unendliche Weite. Er bekam keine Luft mehr, seine Brust zog sich schmerzhaft zusammen. Panisch rang er nach Atem. Vornübergebeugt kauerte er sich zusammen. Doch sosehr er auch versuchte, sich das Gegenteil einzureden, nichts, gar nichts war in Ordnung. Er war nackt, er wusste nicht, wo er war. Er keuchte mühsam auf, beim Versuch, sich zu erinnern, vergrub er beide Hände in seinen Haaren, die auf der einen Seite kurz geschnitten und auf der anderen Seite schulterlang waren.
Erschrocken zog er seine Hand zurück. Etwas schimmerte in seinem Augenwinkel, instinktiv griff er danach und hielt eine Haarsträhne in der Hand, sie war blau.
Und da erinnerte er sich.
Ich heiße Tian.
Seinen Namen zu kennen, hatte augenblicklich etwas Tröstendes, war ein Anker in dieser fremden Welt. Erschöpft ließ sich Tian auf die Seite fallen und sog gierig Luft ein.
Der Wind fuhr durch seine übrigen Haare, sie waren schwarz wie die Nacht, aber diese eine ungefähr zwei Zentimeter breite Strähne glänzte in einem fantastischen Blau. Tian betrachtete sie und wusste, dass sie gefärbt war. Er wollte gerade darüber nachdenken, wieso er das wusste, als der Wind die Rufe erneut herantrug. Dieses Mal konnte er die Richtung ausmachen, aus der sie kamen.
»Hallo!«, rief er laut. Dann noch einmal. Niemand antwortete.
»Ist da jemand?«
Das Gras war hoch. Er konnte niemanden entdecken. Er war sich plötzlich unsicher, ob diese Schreie Hilfe oder Gefahr verhießen. Er drehte sich einmal im Kreis, dann zuckte Tian mit den Achseln. Er würde schon herausfinden, wer da war und ob jemand seine Hilfe brauchte.
Nachdem er vielleicht einen Kilometer weit gegangen war, stolperte er im hohen Gras über etwas. Tian versuchte vergeblich, das Gleichgewicht zu halten, er fiel und landete schwer auf etwas Weichem.
Erneut packte ihn die Panik, ohne Ziel tasteten seine Hände umher, sein Hirn hatte ausgesetzt, als auf einmal eine Stimme unter ihm fluchte. Auch wenn er nicht alles begriff, kehrte sein Verstand zurück und ihm waren zwei Dinge sofort klar: Die Stimme beschimpfte ihn auf übelste Art und Weise und sie gehörte einem Mädchen.
Erschrocken und erleichtert zugleich versuchte er aufzustehen, stützte sich dabei auf den Beinen des Mädchens ab, die vor Schmerzen aufjaulte.
Tian schaffte es endlich, sich aufzurichten. Er wollte sich entschuldigen, aber der Anblick verschlug ihm die Sprache. Vor ihm im Gras lag ein Mädchen in seinem Alter. Rote Haare breiteten sich wie ein loderndes Feuer um ihren Kopf aus. Das Gesicht war herzförmig, mit klaren grünen Augen, die ihn wütend anfunkelten, einer Stupsnase und Lippen, so rot wie Blut. Der Körper des Mädchens war makellos, braun gebrannt, mit kleinen festen Brüsten und schlanken Beinen. In der Mitte ihres Körpers…
... eine schmale Hand schob sich davor und eine wütende Stimme zischte: »Was glotzt du mich so an, du Idiot?«
»Äh… ich habe nicht…«
»Ich hab doch gesehen, wie du gegafft hast.«
»Ja, nein, ich wollte dich doch nicht… ich war nur überrascht.« Tian brauchte eine Weile, bis er seine Stimme wiederfand. »Entschuldigung, ich wollte dir nicht wehtun.«
Das Mädchen kam zum Sitzen und umschlang mit den Armen ihre Beine, sodass sie nicht mehr ganz entblößt vor ihm war. Aber dieser Umstand schien sie nicht weniger wütend zu machen.
»Na, toll. Mir tut trotzdem alles weh. Was machst du überhaupt hier?«
»Ich habe deine Rufe gehört und dachte, du brauchst Hilfe.«
»Ich habe nicht gerufen.«
»Aber ich habe doch die Rufe gehört und bin ihnen gefolgt. So habe ich dich gefunden.«
»Und wieso habe ich nichts an? Ist das alles ein blöder Witz oder was?«
Er zögerte. »Tian, ich heiße Tian«, sagte er dann.
Das Mädchen kniff die Augen zusammen. »Hab ich dich danach gefragt?«
»Nein, aber ich dachte…«
»Du denkst zu viel. Sag mir lieber, wo du die Klamotten herhast.«
»Die waren in einem Rucksack.«
»Schau, dort hinten steht ein noch einer, der ist wahrscheinlich für dich.«
»Was? Wo?« Sie drehte den Oberkörper, hielt dann aber inne und sah Tian eindringlich an. »Wenn du mich jetzt wieder so anglotzt, dann…«
»Was… äh, nein.«
»Dreh dich um.«
»Wie?«
»Du sollst dich umdrehen, verdammt noch mal! Bist du schwer von Begriff? Ich will aufstehen und zum Rucksack gehen, ohne dass du mir auf den nackten Arsch starrst.«
»Ach so, okay.«
Tian wandte sich verlegen ab. Er konnte doch nicht ahnen, dass er über ein nacktes Mädchen…
»Du glotzt schon wieder, oder?«
»Ich GLOTZE nicht.« Das Mädchen ging ihm langsam, aber sicher auf die Nerven. Was bildete die sich eigentlich ein?
»Ich bin übrigens Kathy.«
Ihre Stimme klang plötzlich wie Honig. Tian schüttelte verwirrt den Kopf. Hinter seinem Rücken raschelte es.
»Du guckst immer noch nicht, oder?«
»Nein, verdammt!« Er starrte zum Horizont. Dunkle Wolken zogen auf, schienen das Land und die Berge in der Ferne verschlucken zu wollen. Er grübelte darüber nach, ob er diese Landschaft irgendwoher kannte.
»Es wird bald regnen«, sagte er.
»Woher willst du das wissen?«
»Da, diese Wolken, es sieht nach einem Gewitter aus. Wenn das losbricht, wird’s echt heftig. Wir sollten uns schnell einen Unterschlupf suchen.«
Ein hämisches Lachen erklang. »Du bist echt ’ne Leuchte. Hier ist doch nur dämliches Gras, so weit das Auge reicht.«
»Dort hinten ist ein Wald.«
Kurz war Ruhe, wahrscheinlich blickte Kathy sich um, dann spürte er ihren warmen Atem an seinem Ohr, erschrocken machte er einen Satz nach vorn. »Du kannst dich wieder umdrehen, warst ein braver Junge.«
Sein Herz pochte wild. Er spürte, dass er rot wurde, und das machte ihn wütend. »Was soll das?«
Kathy lachte glockenhell und hob beschwichtigend die Hände. »Oh. Hab ich dich erschreckt? Das tut mir leid!«
Tian reichte es langsam. Er trat vor sie und reckte sein Gesicht vor, bis er ihrem ganz nahe war.
»Was ist dein Problem?«, knurrte er mit zusammengebissenen Zähnen. »Seit ich dich gefunden habe, beleidigst du mich.«
»Du hast…«
»Ich habe geglotzt, ja, verdammt. Du hättest auch gestarrt, wenn es umgekehrt gewesen wäre.« Er hob warnend den Zeigefinger. »Und sag jetzt nicht, dass das nicht stimmt. Ich bin hierhergekommen, weil ich dachte, du brauchst Hilfe, und was machst du? Du hast nichts anderes zu tun, als mich zu beleidigen.«
»Gott, bist du…«
»Sag jetzt nichts. Wenn du mich noch einmal beschimpfst…«
»Kann ich mitkommen?«
Tian sah sie eindringlich an. »Willst du das überhaupt?«
Sie nickte.
Dann gingen sie los.
5.
Jeb hatte León die Führung überlassen und schritt nun hinter ihm und Jenna her. Sie marschierten schweigend. Er grübelte noch immer über das Verschwinden von Leóns Rucksack nach. Doch auch nachdem sie zu dritt das Gras abgesucht hatten, blieb er wie vom Erdboden verschluckt. Schließlich war es León gewesen, der zähneknirschend seine Wasserflasche genommen und die Suche abgeblasen hatte. Jeb wusste, dass sie ihre Essensrationen nun knapper einteilen mussten, auch wenn er den Gedanken an die nächsten Stunden verdrängte. Zunächst würden sie die anderen finden und den Wald erreichen müssen.
Ab und zu wandte sich Jenna um und zwinkerte ihm zu. Ihre Freundlichkeit tat ihm gut. Er beobachtete, wie sie mit kräftigen Schritten marschierte, und bewunderte ihre Sportlichkeit. Jenna schien ausdauernd zu sein. Ihr Atem ging ruhig. Sie waren nun schon so lange unterwegs, und während er bereits ein Ziehen in den Oberschenkeln verspürte, war Jenna die Anstrengung nicht anzumerken. Sie schien nicht einmal sonderlich zu schwitzen. Ihm dagegen rann der Schweiß die Stirn hinab.
Jeb sah in die Ferne. Die dunkle Wolkenwand rückte bedrohlich näher, aber zum Wald war es noch ein ganzes Stück. Er hatte das Gefühl, sie entfernten sich eher von ihrem Ziel, als dass sie es erreichten. Blitze zuckten über den Himmel.
Als die ersten Regentropfen sie trafen, drehte sich Jenna nach ihm um, blickte seufzend nach oben und ließ sich zurückfallen, bis sie auf gleicher Höhe mit ihm war.
»Ich bin froh, dass du mich gefunden hast.«
Er lächelte verlegen.
»Das hier ist noch längst nicht alles, oder?«
Er nickte.
»Aber du sprichst nicht darüber. Nicht jetzt.« Es war eine Feststellung, keine Frage.
»Später, wenn wir die anderen gefunden haben, werde ich euch alles sagen, was ich weiß.«
»Ist es so schlimm?«
Jeb ging nicht auf die Frage ein. Er sah zu León, der unverdrossen im inzwischen strömenden Regen im Abstand von einigen Metern unter dem immer wieder hell aufleuchtenden Himmel voranging.
»Was hältst du von ihm?«, fragte er Jenna.
»Er hat etwas Wildes. Ungezähmtes.« Sie wirkte ernst, als sie die Worte aussprach.
Ja, sie hat recht. Ungezähmt ist das richtige Wort.
»Ehrlich gesagt«, seufzte sie, »machen mir diese Zeichnungen auf Körper und Gesicht Angst. Hast du sie dir mal genau angesehen?«
Jeb nickte. »Leóns ganzes Aussehen sendet eine Botschaft aus, die ich nicht verstehe.«
Jetzt krachten immer wieder laute Donnerschläge über die Steppe. León reagierte gar nicht darauf. Jeb und Jenna versuchten, das Gewitter ebenfalls zu ignorieren, und setzten ihre Unterhaltung fort.
»Auf mich wirkt das Ganze wie eine Warnung.«
»An wen?«, fragte Jeb.
»Weiß ich nicht, aber diese Bilder sollen Angst einjagen.«
»Merkst du was? Du hast eben jede Menge Wörter verwendet, die ich sofort verstanden habe.«
Jenna lächelte verhalten.
»Ungezähmt, Warnung, Bilder, Angst. Bis zu diesem Augenblick hätte ich die Dinge so nicht benennen können, aber als du es gesagt hast, wusste ich sofort etwas damit anzufangen.«
Jenna sah ihn nachdenklich an. »Stimmt, ich habe gar nicht darüber nachgedacht… sie waren einfach da.«
»So war es vorhin auch, mit dem Motorrad.«
Jeb sah, wie Jenna die Lippen aufeinanderpresste. Die Luft schien kurz zu vibrieren, dann fuhr ein lauter Donnerschlag über die Ebene. Jenna wechselte das Thema.
»Die vier Menschen, die wir suchen, wer sind sie?«
»Ich glaube, es sind junge Leute wie wir.«
»Das alles ist ganz schön merkwürdig, oder?«
»Ja, ziemlich. Ich frage mich, warum ich so ruhig bei dem Gedanken bin, allein in dieser fremden Umgebung gelandet zu sein.«
Jenna sah zu ihm auf. »Du bist nicht allein.«
»Du weißt, was ich meine. Warum renne ich nicht schreiend durch die Gegend oder werfe mich auf den Boden und raufe mir vor Verzweiflung die Haare?«
»Weil du keine Wahl hast und weil du leben willst. Du hoffst, dass es besser wird.«
»Und wenn es nicht besser wird?«
»Es wird besser, glaub mir. Es muss besser werden.« Sie seufzte.
Und wenn es doch nicht besser wird – werden wir sterben. Er sprach es nicht aus, war sich aber sicher, dass Jenna es in seinem Gesicht lesen konnte.
Plötzlich zerriss ein schrilles Kreischen die Stille. Jeb packte Jenna am Arm und rannte mit ihr zu León vor. In Jennas Gesicht spiegelte sich Angst, während Leóns Gesichtszüge zu einer Maske erstarrt waren.
Da erst bemerkte er, dass León ein gefährlich aussehendes Messer in der Hand hatte. Er hielt es locker und entspannt, als ob er den Umgang mit einem Messer gewohnt sei.
»War es das, was ihr meintet?«, fragte der tätowierte Junge.
Jeb nickte nur. »Wo hast du das Messer her?«
»Es war in meinem Rucksack, in einer der Seitentaschen. Immerhin etwas, das ich noch mitnehmen konnte.«
Erneut erklang ein bedrohlicher Schrei, ein heiseres Heulen, das in den Ohren schmerzte und von dem man unmöglich sagen konnte, ob es von Mensch oder Tier stammte. Aber diesmal schien es weiter entfernt. Gewitter und Regen hatten sich verzogen. León blickte sich um.
»Was auch immer da draußen ist, es klingt nicht so, als ob es näher kommt. Es scheint sich parallel von uns zu bewegen.«
Jeb starrte ihn an. »Du weißt, was das bedeutet?«
»Die Tiere jagen jemand anderen und diese anderen sind wahrscheinlich die vier, die wir suchen.«
»Keine Tiere, ganz bestimmt keine Tiere«, flüsterte Jeb. »Wir müssen etwas tun!«
León kniff die Augen zusammen. »Keine Chance. Wir wissen nicht, wo sich die Jagd abspielt, kennen weder die Anzahl der Jäger noch die Beute. Wir haben nur ein Messer. Außerdem: besser sie als wir.«
Jeb starrte ihn sprachlos an. »Ist das dein Ernst?«
León erwiderte ungerührt seinen Blick. »Was denn? Was regst du dich auf? Ist es nicht besser, es erwischt jemand anderen und nicht uns? Oder bist du etwa scharf drauf, ein Opfer zu werden?«
Jeb schluckte schwer. Er konnte so viel Gefühlskälte nicht fassen. Wut wollte in ihm aufsteigen, doch er drängte sie zurück.
»Wir müssen es wenigstens versuchen«, sagte Jeb gepresst.
León ließ sich nicht beeindrucken. »Sie sind zu weit weg. Egal, ob die Verfolger sie einholen oder sie entkommen, bis wir dort sind, ist alles längst entschieden.«
»Aber…«
Jenna trat vor Jeb. Sie legte ihm beide Hände auf die Schultern und sah ihm in die Augen.
»León hat recht, wir können nichts tun. Wir können ihnen nicht helfen. Wir müssen weitergehen. Wer auch immer da von wem auch immer gejagt wird, vielleicht hat er Glück.«
Jeb blickte zu León hinüber. Der tätowierte Junge wirkte ruhig, fast unbeteiligt. León erwiderte ungerührt seinen Blick. Ein Frösteln lief über Jebs Körper.
In diesem Moment wurde Jeb klar, dass León dem Tod schon öfter begegnet war. Und all diese furchtbaren Bilder und Muster auf Gesicht und Körper erzählten davon.
Während León ihn abwartend musterte, versuchte Jeb, sich seine Beunruhigung nicht anmerken zu lassen. Er spürte, wie sein linkes Auge zu zucken begann, und sah an Leóns verächtlichem Lächeln, dass er es ebenfalls bemerkt hatte.
6.
León sah sie als Erster. Er gab Jeb und Jenna ein Zeichen mit der Hand und sie ließen sich zu Boden sinken.
»Was ist?«, fragte Jeb.
»Schschschscht!« León legte einen Finger auf die Lippen. »Da kommt jemand auf uns zu«, flüsterte er.
»Jemand? Ich höre kein Kreischen. Sind es Menschen?«
»Kann ich nicht richtig erkennen. Es sind mehrere, sie reden miteinander. Ich verstehe kein Wort, aber sie klingen menschlich.«
Als Jeb den Kopf heben wollte, machte León einen ärgerlichen zischenden Laut.
»Wir wissen nicht, ob das diejenigen sind, die wir suchen. Lass sie näher herankommen, damit wir sehen, ob sie uns gefährlich sind.«
Es drängte Jeb danach, aufzuspringen und die anderen zu begrüßen, aber León hatte recht, es konnten auch Feinde sein. Bisher hatten sie ja schließlich diese Gestalten, die Jagd auf sie machten, noch nicht gesehen. Wer wusste schon, wie sie aussahen? Er wandte den Kopf zu Jenna. Sie wirkte wachsam, aber nicht ängstlich. Zu seiner Überraschung streckte sie einen Arm nach ihm aus und drückte seine Hand. Er erwiderte sanft den Druck. Dieses goldene Lächeln, es schien ihm so… und dann spürte er Wärme in sich, wurde zuversichtlich, als könne ihm nichts geschehen, solange es dieses Lächeln gab.
Dann wandte er sich an León.
»Und jetzt? Kannst du sie sehen?«
»Ja«, zischte der tätowierte Junge. »Sie sind zu dritt. Hattest du nicht gesagt, es sind vier? Zwei Mädchen und ein Junge. Ehrlich gesagt, sehen sie genauso verloren aus wie wir und außerdem tragen sie ähnliche Kleidung und Rucksäcke.«
»Dann lass uns aufstehen.«
Sie tauchten nur knapp zehn Meter von den anderen entfernt aus dem Gras auf. Die drei anderen wichen erschrocken zurück.
Jeb hob die Hand. »Keine Sorge, wir wollen euch nichts tun.«
Doch die Worte verfehlten ihre Wirkung, ganz im Gegenteil, die Fremden machten noch einige Schritte mehr rückwärts.
»Alles okay, Leute«, sagte Jenna mit sanfter Stimme.
»Wer seid ihr?«, wagte der asiatisch aussehende Junge aus der anderen Gruppe zu fragen. »Und wieso ist einer von euch so schrecklich bemalt?« Seine Hand deutete auf León.
Jeb warf einen Blick zu ihm hinüber. Leóns breites Grinsen ließ ihn gefährlicher aussehen, als er ohnehin schon wirkte.
»Das ist León. Er trägt Tätowierungen. Mein Name ist Jeb. Neben mir steht Jenna. Vermutlich wisst ihr ebenso wenig wie wir, was das alles zu bedeuten hat. Ich werde euch davon erzählen, aber wir müssen weiter, denn wir sind in Gefahr. Wir werden verfolgt.«
»Von wem?«, fragte das rothaarige Mädchen.
Jeb betrachtete sie eingehend. Sie war ohne Zweifel hübsch, ihre Lippen hatte sie zu einer schmalen Linie zusammengepresst. Irgendwie wirkte sie wie jemand, der permanent wütend und zornig ist.
»Ich verspreche euch, dass ich alles erkläre, sobald wir einigermaßen Schutz gefunden haben. Es ist hier nicht sicherfür uns, glaubt mir.«
»Was ist mit dem Vierten?«, warf León ein. »Du hast gesagt, da wären noch vier außer uns.«
»Ja, keine Ahnung, was passiert ist.« Jeb wandte sich an den Jungen aus der anderen Gruppe. »Habt ihr unterwegs jemanden gesehen?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich heiße übrigens Tian. Das hier sind Mary und…«
»Danke, ich kann allein reden.« Kathy trat einen Schritt auf Jeb und die anderen zu und warf ihre Haare über die Schulter. »Ich bin Kathy. Warum glaubt ihr, es gibt noch jemanden außer uns?«, fragte Kathy misstrauisch.
Plötzlich redeten alle wild durcheinander.
»Das sage ich euch später.«
»Wo kommt ihr denn her?«
»Wer verfolgt uns, sag schon!«
»Woher kommen die Rucksäcke?«
»ICH WILL ES JETZT WISSEN.« Kathy brachte die aufgeregte Gruppe zum Schweigen.
Jeb sah sie an. Das Mädchen erwiderte ungerührt seinen Blick, funkelte ihn aus grünen Augen an. Jeb ahnte, dass sie Schwierigkeiten machen würde.
»Wir müssen weiter. Sofort«, sagte er gleichgültig. »Kommt ihr mit?«
»Wo geht ihr hin?«, fragte Tian, der erleichtert wirkte, die Führung seiner Gruppe abzugeben.
»Zum Wald. Dort können wir zum Schutz ein Feuer machen.«
Er blickte zu León hinüber, um zu sehen, ob er etwas einzuwenden hatte, aber der tätowierte Junge starrte schweigend über die Grasebene.
»Okay, wenn die anderen einverstanden sind.« Tian blickte Kathy und Mary an, die ergeben nickten.
Der Wind war stärker geworden. Die Haare der Mädchen wurden von den kräftigen Böen durcheinandergewirbelt. Jeb marschierte als Erster voran, ließ sich aber bald an den Schluss der Gruppe zurückfallen. Er brauchte ein wenig Zeit, um alle nacheinander zu betrachten.
Mary wirkte wie jemand, der gerade aus einem langen Traum erwacht war und Probleme damit hatte, sich zurechtzufinden. Jenna glich mit ihren blonden Haaren und dem sanften Lächeln einem Engel. Und Kathy? Sie sah aus, als wollte sie mit ihrer bloßen Willenskraft den Sturm zähmen. Sie schien es gewohnt zu sein, dass alles nach ihrem Willen ging.
Jeb schüttelte unwillkürlich den Kopf und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Und der neue Junge, Tian? Er machte einen freundlichen, gutmütigen Eindruck, hatte aber etwas an sich, dass ihn beunruhigte. Etwas Verstörendes, er konnte es nicht genau sagen. Es war nur so ein Gefühl, dass sich hinter diesem Gesicht Dinge verbargen, die man auf den ersten Blick nicht sehen konnte.
Und dann war da noch León.
Der Monsterjunge, wie er ihn im Stillen nannte.
Sein Aussehen war furchterregend, aber er wirkte entschlossen und zäh. León hatte schnell deutlich gemacht, dass er seine eigenen Interessen über die der Gruppe stellen würde. Wenn es um sein Überleben ging, würde er keine Rücksicht nehmen, er würde dafür buchstäblich über Leichen gehen.
Was mache ich mit dir? Wir haben nur eine Chance, wenn wir zusammenhalten. Aber du wirst, wenn es drauf ankommt, deinen eigenen Weg gehen – ohne uns.
Auf dem Zettel hatte noch mehr gestanden, als er Jenna verraten hatte. Bald würde er diese Informationen mit den anderen teilen müssen. Dann würde sich vieles entscheiden.
Wie werden sie reagieren, wenn sie erfahren, dass einer von uns zum Sterben verdammt ist? Würden sie ihm überhaupt glauben? Woran glaubte er selbst?
Noch einmal warf er einen Blick auf die Gruppe. Seine Augen blieben an León hängen, der misstrauisch zu ihm nach hinten blickte.
Was wirst du tun?, dachte Jeb.
7.
Bei Einbruch der Dämmerung erreichten sie völlig durchnässt und geschwächt den Wald. Das Gewitter war erneut losgebrochen, Sturm und Regen waren sie auf der offenen Ebene schutzlos ausgeliefert, ihre Kleidung war vom Regen vollgesogen und pitschnass. Erst zwischen den Bäumen waren sie vor der Witterung geschützt. Erschöpft und in der stark abgekühlten Luft zitternd schlugen sich die sechs Jugendlichen durch das dichte Unterholz. Mächtige Baumstämme erhoben sich rechts und links, teilweise reichte ihnen das Buschwerk bis zu den Schultern. Groß gewachsene Farne versperrten ihnen den Weg, den Jeb und León immer wieder mit Stöcken freischlugen. Jeb trieb die Gruppe unermüdlich an.
»Tiefer in den Wald«, sagte er. »Wir müssen tiefer in den Wald. Sucht nach Bäumen, deren Äste breit ausgestreckt sind, darunter bleiben wir hoffentlich trocken und wir finden vielleicht trockenes Holz. Dann können wir ein Feuer machen und uns aufwärmen.«
Schweigend marschierten sie hinter ihm her. Nicht einmal León oder Kathy widersprachen, sondern ergaben sich Jebs Führung. Hier und jetzt war er der Anführer, aber so würde es nicht bleiben, das wusste er.
Tief im Wald war der Regen nicht mehr so dicht, dafür die Wassertropfen umso schwerer, wenn sie aus dem Blätterdach der großen Nadel- und Laubbäume herabfielen, ihre Haare durchnässten und ihre Kragen aufweichten. Wenigstens die Schuhe waren dicht. Sie froren.
Das Licht war düster geworden. Man musste die Augen zusammenkneifen, wenn man dem schmalen Pfad folgen wollte, auf dem sie sich durch den Wald kämpften. Die Luft war schwer und schwül, roch süßlich nach verrottendem Laub. Es war kein unangenehmer Geruch, aber er legte sich wie ein feuchtes Tuch über ihre Gesichter. Außer ihren Schritten auf dem Waldboden, den Geräuschen des raschelnden Laubes unter ihren Füßen und dem Knacken der morschen Äste, die sie zertraten, war nichts zu hören. Fast schien es, als gäbe es kein Leben in diesem Wald voller wild wuchernder Pflanzen. Und doch war hier im Gegensatz zu der weiten Ebene so viel Leben überall um sie herum vorhanden, aber es schwieg, während der Regen unablässig vom Himmel fiel.
Schließlich blieb Jeb stehen. Er deutete auf einen mächtigen Baumriesen, durch dessen Krone weit oben Nebelfetzen zogen. Starke, knorrige Äste hatten ein Dach geschaffen, unter dem es tatsächlich trocken war. Es gab genug Platz für sie alle. Erschöpft ließen sie sich auf die weichen Nadeln darunter sinken. Keiner legte seinen Rucksack ab, zunächst mussten sie wieder zu Atem kommen.
Es war Jeb, der als Erster sprach.
»Wir müssen ein Feuer machen, die Sachen trocknen, sonst frieren wir die ganze Nacht.«
»Es regnet«, stellte Kathy spöttisch fest. »Wo willst du hier trockenes Holz für ein Feuer finden?«
Jeb ärgerte sich über Kathy, sagte dann aber ruhig: »Seht euch um. So ein alter Baum verliert viel Holz. Äste, die der Wind abbricht, Tannenzapfen, trockene Nadeln. Hier gibt es bestimmt etwas, das wir anzünden können. Ich werde ein Stück hochklettern und versuchen, trockene Äste abzubrechen.«
»Und wie willst du dann bitte schön Feuer machen? Wir haben nichts, um das Holz anzuzünden.« Kathy stemmte die Hände in die Hüften.
»Doch, haben wir.« Jeb streifte endlich seinen Rucksack ab. Er öffnete eine der Seitentaschen und zog ein Metallding hervor, das im trüben Licht seltsam matt glänzte. »Schaut her, ich habe ein Feuerzeug.«
Sie alle starrten das Metallding an und erkannten den Gegenstand. Feuerzeug. Sie wussten, was das war und wie es funktionierte.
Tian erhob sich als Erster. Seine Haare waren unter der Kapuze weitgehend trocken geblieben, lediglich die blaue Strähne schimmerte feucht in der Dämmerung.
Nachdem er seinen Rucksack sorgsam auf dem Boden abgelegt hatte, begann er, Äste und trockene Zapfen zu sammeln und zu einem kleinen Haufen zu stapeln. León beobachtete ihn einen Moment und half ihm dann.
Jenna stand nun ebenfalls auf, sah sich um und brach schließlich an einem Nachbarbaum einen tief hängenden Ast mit dichtem Blätterwerk ab. Jeb sah sie erstaunt an, als sie damit den Boden unter dem Baum fegte und so von Holzstückchen und Steinen befreite. Anerkennend nickte er ihr zu und einen Moment verfingen sich ihre Blicke ineinander.
Noch war nichts wirklich gut, aber es wurde besser. Jeb fasste nach einem starken Ast und zog sich hoch. Obwohl auch er erschöpft war, fiel ihm die Kletterei nicht schwer. Er musste das schon öfter gemacht haben, denn die Geschicklichkeit, mit der er den Baumriesen bestieg, schien auf Erfahrung zu beruhen. Unterwegs brach er Äste ab und warf sie von Warnrufen begleitet nach unten. Wie er vermutet hatte, gab es an diesem alten Baum ausreichend morsches Holz. Sie würden ein ordentliches Feuer machen können, und das mussten sie auch, wenn sie die Nacht überleben wollten. Schon seit Stunden waren keine Schreie und keine Rufe mehr zu hören gewesen, aber Jeb war sich sicher, dass es oder sie weiterhin lauerten. Die Sonne war bereits untergegangen und er wusste nicht, was dann passieren würde.
Da fiel ihm ein, dass sie noch immer nur zu sechst waren, nicht zu siebt, wie es in der Botschaft geheißen hatte. War einer von ihnen etwa den Verfolgern bereits zum Opfer gefallen? Aber bedeutete es auch, dass diese Wesen, Jäger – was auch immer – sie dann verschonen würden diese Nacht? Bei diesem Gedanke wurde ihm fast schlecht und er versuchte, ihn so schnell wie möglich zu verdrängen. Jetzt mussten sie ein Feuer machen.