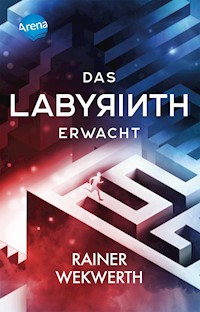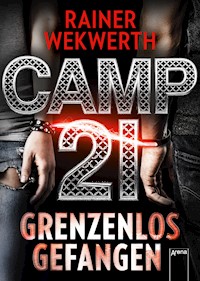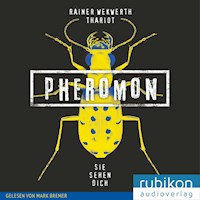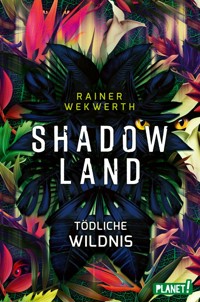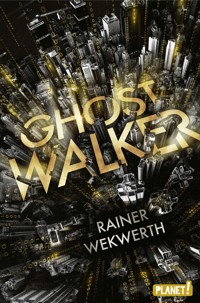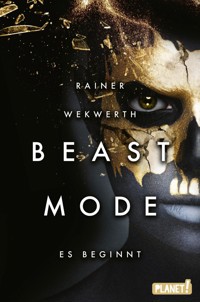4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Labyrinth-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Mary ist ins Labyrinth zurückgekehrt, um ihre Freunde zu retten. Tief unter der Erde, in einem gigantischen Gefängnis, kämpfen die sieben Jugendlichen erneut ums Überleben, doch sie erinnern sich weder aneinander noch an das, was mit ihnen geschehen ist. Und dieses Mal ist nicht nur die Zeit ihr erbitterter Gegner. Ein übermächtiger Feind agiert nun unsichtbar hinter den Kulissen und will nicht weniger als ihren Tod. Während Mary noch gegen das Vergessen ankämpft und um die Liebe ihres Lebens ringt, muss sie sich gemeinsam mit den anderen den Gefahren stellen, die das Labyrinth für sie bereithält. Ein Mystery-Thriller der Extraklasse! Band 1 der Labyrinth-Reihe "Das Labyrinth erwacht" wurde mit den Leserpreisen "Segeberger Feder", "Ulmer Unke" und "Goldene Leslie" für das beste deutschsprachige Jugendbuch ausgezeichnet. Band 3 "Das Labyrinth ist ohne Gnade" schaffte es auf die Spiegelbestsellerliste. Alle Bände der Labyrinth-Tetralogie: Das Labyrinth erwacht (1) Das Labyrinth jagt dich (2) Das Labyrinth ist ohne Gnade (3) Das Labyrinth vergisst nicht (4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Weitere Bücher von Rainer Wekwerth im Arena Verlag:
Das Labyrinth erwacht
Das Labyrinth jagt dich
Das Labyrinth ist ohne Gnade
Damian. Die Stadt der gefallenen Engel
Blink of Time
Camp 21
Der 1.Band der Reihe, Das Labyrinth erwacht, wurde mit der
Bad Segeberger Feder, der Ulmer Unke und der goldenen Leslie ausgezeichnet.
Rainer Wekwerth,
1959 in Esslingen am Neckar geboren, schreibt aus Leidenschaft.
Er ist Autor erfolgreicher Bücher, die er teilweise unter Pseudonym veröffentlicht
und für die er Preise gewonnen hat. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter.
Der Autor lebt im Stuttgarter Raum.
www.wekwerth.com
Rainer Wekwerth
Das Labyrinthvergisst nicht
Neuauflage als Arena-Taschenbuch 2021
Rottendorfer Straße 16, 97074 Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Dieser Roman erschien erstmals in anderer Ausstattung 2019
im Buchheim Verlag, Grimma.
Covergestaltung: Alexander Kopainski
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock
(© Dario Sabljak, wacomka, ARTYuSTUDIO, ANAID studio, oorka, Michal Sanca)
ISSN 0518-4002
E-Book ISBN 978-3-401-80973-1
Besuche den Arena-Verlag im Netz:
www.arena-verlag.de
1.
Das grelle Licht schmerzte in Leóns Augen, als sie seinen Kopf von dem schwarzen Sack befreiten. Er kniff die Lider zusammen und versuchte, die Umgebung zu erkennen. Es roch nach nassem Asphalt und verfaulendem Gras. Wo immer sie ihn auch hingebracht hatten, es war kein schöner Ort.
Ein düsteres Betongebäude mit hohem Eingangstor erstreckte sich vor ihm. Wenigstens ein Dutzend bewaffnete Männer in schwarzen Uniformen patrouillierte auf hohen Mauern. Regen peitschte León ins Gesicht, lief ihm an der Stirn und den Wangen hinab. Er fröstelte.
Wo bin ich? Was mache ich hier?
Sein Blick fiel auf die beiden Cops, die ihn flankierten. Sie trugen Regenponchos und schauten finster. Der eine schien ein Latino zu sein, klein, schlank, mit dem lauernden Blick einer Ratte. Der andere war groß und schwer, eine wulstige Narbe verunstaltete seine Stirn.
Etwas klirrte, als León sich umdrehte. Er starrte seine Hände an. Handschellen lagen darum, die über eine Kette mit Fußfesseln verbunden waren. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er einen grauen Overall anhatte.
Was ist geschehen?
León versuchte, Ordnung in seine Gedanken zu bringen, aber es war ein einziges Durcheinander. Krampfhaft wühlte er in seiner Erinnerung und versuchte herauszufinden, warum er sich gefesselt wie ein wildes Tier in einer ihm vollkommen fremden Umgebung befand.
Er war hier irgendwo auf dem flachen Land. In der Ferne konnte er eine Hügelkette erkennen, deren Umrisse vom Regen verwischt wurden. Bäume streckten ihre grünen Finger zum Himmel empor, über den zerfledderte graue Wolken trieben.
Da war keine Stadt.
Plötzlich erinnerte sich León wieder, dass er in einer Stadt lebte, und als die Erkenntnis kam, wusste er auch ihren Namen.
Los Angeles.
Das hier war jedoch nicht die Stadt der Engel. Wo immer er sich gerade befand: Es war Niemandsland. Keine Häuser, außer dem Komplex vor ihm. Kein Autohupen. Keine Sirenen. Keine spanischen Wortfetzen aus irgendwelchen Wohnungen, in denen Menschen lebten und sich stritten. Und keine Latinomusik.
»Wo bin ich hier und warum?«, fragte er den Typen rechts neben ihm.
Der Cop lachte meckernd, dabei entblößte er kleine Zähne, die von gelben Flecken bedeckt waren. Atem, der nach kaltem Rauch roch, strich über Leóns Gesicht.
»Weißt du das nicht mehr, Muchacho? Haben die drogas dein Gehirn zerfressen?«
»Sag es mir einfach.«
»Fünfundzwanzig Jahre. Du hast fünfundzwanzig Jahre bekommen.«
»Wofür?«
»Raubüberfall. Versuchter Mord. Und der Drogenscheiß.«
»Wann soll das gewesen sein? Und wann war die Verhandlung?«
»Kannst du dich nicht erinnern? Was ist los mit dir?«
Der Typ klopfte mit den Fingerknöcheln gegen seine Stirn. León zuckte zurück.
Ein unwirkliches Gefühl machte sich in ihm breit. Was der Cop da sagte, konnte nicht stimmen. Und doch spürte er, dass der Mann nicht log. Was war hier los?
»Alles weg? Hä? Aber mach dir keinen Kopf. Wo du jetzt hingehst, spielt das alles keine Rolle mehr.«
»Wohin bringt ihr mich?«
»Hell’s Kitchen. Alter, von dort kommt niemand zurück.« Rattengesicht grinste.
»Hell’s Kitchen? Was soll das bedeuten? Wo ist meine Familie?« Leóns Hände begannen zu zittern.
»Halt’s Maul!«, mischte sich der Dicke ein und stieß León grob in den Rücken. »Vorwärts.« Zu seinem Kollegen gewandt meinte er: »Rede nicht mit ihm. Das ist ein toter Mann. Sprich nicht mit den Toten.«
León wurde schwindlig. Die Umgebung begann sich zu drehen. Ein merkwürdiges Schwächegefühl erfasste seine Glieder und ließ ihn zittern. Er taumelte, aber Rattengesicht packte ihn am Arm.
»Was ist los, Hermano?«
Und dann kam die Erinnerung.
Die Knarre in meiner Hand. Um mich herum tiefste Nacht, aber keine Stille und es gibt auch keine Dunkelheit. Im fahlen Licht einer Straßenlaterne überprüfen wir unsere Waffen. Wir müssen vorbereitet sein. Nichts darf schiefgehen.
Nesto erklärt den Plan. Wir sollen ein paar feindliche Drogendealer ausschalten. Sie haben ihr Hauptquartier im Erdgeschoss eines leer stehenden Hauses eingerichtet. Das Gebäude steht abseits der Straße, ein Maschendrahtzaun zieht sich um das Anwesen und sie haben Hunde, die frei herumlaufen. Dobermänner, die alles zerfetzen, was sich zu nahe an das Haus wagt.
Aber das kümmert uns nicht. Wir werden mit dem Auto den Zaun durchbrechen, die Scheißköter einfach über den Haufen fahren, den Eingang rammen und auf alles ballern, was sich bewegt.
Diese verdammten Arschlöcher glauben, sie könnten einfach hierherkommen und uns das Revier streitig machen. Sie verticken ihr kolumbianisches Kokain zum Sonderpreis, um den Markt anzuheizen, aber damit ist jetzt Schluss. Heute noch. In dieser Nacht. Wir werden sie alle umlegen, uns das Koks greifen und den ganzen Laden in die Luft jagen.
Es ist weit mehr als eine Strafe. Es ist eine Warnung an alle anderen, die denken, wir wären zu schwach, um unser Gebiet zu verteidigen.
Wir sind zu viert. Nesto, Pedro, Loco der Verrückte und ich. Zwei von uns haben Maschinenpistolen, Loco und ich Pistolen. Niemand würde dem Verrückten eine automatische Waffe in die Hand drücken, die Gefahr wäre zu groß, dass er einen von uns oder sich selbst erschießt, wenn das Gefecht losgeht. Loco ist ein Wahnsinniger, der bei Anspannung durchdreht und keine Grenzen mehr kennt. Der nur noch brüllt und ballert. Aber es ist ein gutes Gefühl, ihn dabeizuhaben, denn seine Furchtlosigkeit wird uns vorantreiben.
Die anderen sind für mich hermanos, Brüder, die ich niemals hatte. Sie sind meine Familie, haben mich beschützt, nachdem mein Vater durch eine Kugel von der Straße gefegt worden war. Ich liebe sie alle.
Trotzdem wäre ich heute besser nicht dabei. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Irgendetwas stimmt nicht.
Keine Wachen? Nur Hunde?
Wahrscheinlich bunkern die da drin Koks im Wert von Millionen – und es soll so einfach sein, es ihnen abzunehmen?
Pedro war dort, hat die Lage ausgekundschaftet, mehrere Nächte hintereinander. Er sagt, die Typen fühlen sich sicher, weil das Haus nicht in unserem Gebiet liegt. So recht daran glauben kann ich nicht, aber ich widerspreche nicht, will nicht dastehen wie ein Feigling. Wir werden das Ding durchziehen.
Heute Nacht.
Was ist in dieser Nacht geschehen? Haben wir die Typen tatsächlich überfallen? Was ist schiefgegangen? Bin ich erwischt und verurteilt worden? Warum konnte er sich an nichts nach dieser Nacht erinnern?
Ein heiserer Schrei erregte Leóns Aufmerksamkeit. Er hob den Blick zum Himmel. Ein einsamer Raubvogel zog dort seine Kreise.
Plötzlich wurden die Konturen des Vogels undeutlich, verschwammen mit dem Grau des Himmels, dann war er verschwunden.
»Los jetzt!«, knurrte der Dicke. Er deutete auf das schwere, eiserne Tor, das unheilvoll vor León aufragte. »Wir müssen dich bis zehn Uhr abliefern oder es gibt Ärger. Also beweg deinen Arsch.«
Ungelenk stolperte León nach vorn. Die Fußfesseln ließen nur kleine Schritte zu und die Handschellen verhinderten, dass er mit den Armen sein Gewicht ausbalancierte. Es war eine Mischung aus Hoppeln und Schlurfen. Demütigend. León spürte Tränen in seine Augen steigen, aber er blinzelte sie weg. Niemand würde ihn weinen sehen.
Rattengesicht neben ihm kicherte, dann summte er ein Kinderlied. Irgendwas von Schatten in der Nacht, die kamen, um diejenigen zu holen, die nicht brav waren. Was für ein Arschloch.
Vor dem Tor blieben sie stehen. Eine quäkende Stimme meldete sich aus dem kleinen, eingelassenen Lautsprecher. Surrend richteten sich die Überwachungskameras auf sie.
Der Dicke wedelte mit einem Stück Papier herum.
»Officers Hanson und Rodrigues mit dem Gefangenen 12466 zur Übergabe in das California State Prison für jugendliche Straftäter.«
»So schön hat das schon lange niemand mehr gesagt.« Die Stimme drang aus der Box. »Das hier ist Hell’s Kitchen, das verdammte Ende der Welt. Was hat der Penner ausgefressen? Zeig mir mal den Überstellungsschein.«
Der Polizist hob die Hand und hielt das Formular noch näher an das Auge der Kamera. »So ziemlich alles. Das Übliche.«
»Okay, bringt ihn rein.«
Irgendetwas klackte, dann öffnete sich knarrend und quietschend das Metalltor. Dahinter erschienen fünf schwer bewaffnete Männer in voller Einsatzmontur mit Helmen und Sturmhauben über den Gesichtern. Automatische Waffen wurden auf León gerichtet. Ein Mann in Zivil stand plötzlich vor ihm.
»Ich bin John Hancock, Chief Director«, stellte er sich vor. Er streckte die Hand aus. »Her mit dem Wisch.«
Der Dicke gab ihm den Zettel.
»Die Scheiße kann man ja kaum entziffern. Okay, wir übernehmen ihn. Ihr könnt gehen.«
»Sie müssen den Empfang bestätigen.«
»Sicher.« Der Direktor zog einen Stift hervor und kritzelte etwas aufs Papier.
»Wie wäre es mit einem Kaffee?«, fragte Rattengesicht.
Hancock lächelte verächtlich. »Sieht das hier wie ein verdammter Starbucks aus? Zieht Leine, bevor wir euch mit ihm in die Tiefe schicken.«
In die Tiefe? Was meint er damit?
Die beiden Beamten, die León hergebracht hatten, wandten sich um und gingen wortlos.
»Bringt ihn nach unten!«
2.
Das Mädchen hatte feuerrote Haare und so grüne Augen wie eine Katze; und genauso geschmeidig bewegte sie sich. Mit langsamen Schritten kam sie näher.
Mary drehte den Kopf, so weit es die Haltegurte an Brust und Handgelenken zuließen, und schaute sie an. Das Mädchen war unglaublich schön, sehr sexy, aber in ihrem Blick lag etwas Irres. Ist ja auch kein Wunder, dachte sie. Immerhin befinden wir uns in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie. Sie lag in ihrem Bett und kämpfte gegen die Wirkung des Medikaments an, das ihr Dr. Mercan vor zehn Minuten verabreicht hatte.
»Ich bin Kathy.«
»Hi.«
»Wie heißt du?«
»Mary.«
»Du wirkst nicht gerade fit und wurdest auch noch fixiert. Was haben sie dir gegeben?«
Mary schluckte. »Ich … ich weiß nicht.«
»Deine Augen glänzen. Ich tippe auf Haldol, aber das finden wir gleich heraus.« Sie griff nach dem Klemmbrett, das am Bettende befestigt war. »Da steht es doch: Haloperidol. Ist das Gleiche. Zwanzig Milligramm.« Kathy pfiff durch die Zähne. »Ganz schön hoch dosiert. Was ist? Wolltest du dich umbringen? Hast du Wahnvorstellungen? Schizophrene Anfälle?«
»Ich … ich weiß nicht«, quetschte Mary mühsam heraus. Sie spürte, wie das Mittel zu wirken begann. Mit jeder Minute wurde sie müder und hatte zunehmend Mühe, sich zu konzentrieren.
»Du weißt es nicht?« Kathy riss die Augen auf. »Hast du keine Ahnung, warum du hier bist?«
»Nein.«
»Weißt du gar nichts?«
»Nein.«
»Also mich haben sie eingewiesen, weil ich mit dem Verlobten meiner Schwester gevögelt habe, der zufällig der Sohn des reichsten Mannes in Australien ist. Okay, das war vielleicht nicht in Ordnung, schon gar nicht so kurz vor der Hochzeit, aber der Typ hat mich ständig angemacht und eines Tages ist es dann passiert. So what? Das ist doch menschlich.«
Mary glotzte auf den schönen roten Mund, aus dem unablässig Worte strömten. Sie waren wie die Wellen des Meeres, die gegen den Rumpf des Schiffes schlugen.
Schiff?
Welches Schiff?
In ihrem umnebelten Hirn kristallisierte sich das Bild eines Frachters heraus. Nicht übermäßig groß, aber mit separatem Führerhaus und beladen mit Containern. Mary spürte, dass dieses Schiff etwas mit ihrer Vergangenheit zu tun hatte, aber sie wusste nicht, was.
»Dann haben sie mich zum Psychiater geschleift. Die eigene Familie, das muss man sich mal vorstellen. Und der hat bei mir eine psychische Störung festgestellt. Hey Baby, ich bin genauso normal wie alle da draußen. Mehr als das. Ich bin eine erfolgreiche Surferin, die jede Menge nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen hat, und jetzt kommen die mir mit so einem Scheiß. Die Wahrheit ist: Die wollten mich loswerden, damit ich nicht weiter das junge Glück störe. Wahrscheinlich lassen sie mich hier erst wieder raus, wenn der Prinz und die Prinzessin die ersten Enkel bekommen haben. Aber nicht mit mir. Nicht mit Kathy.« Sie beugte sich nach vorn und strich sanft über Marys Wange. »Mach dir keine Sorgen, kleine Mary. Ich hole uns hier raus.«
Sie fasste in die Tasche ihrer Jogginghose und zog ein billiges Einwegfeuerzeug hervor. Kathy drehte am Rädchen und eine Flamme erschien.
»Habe ich Mike geklaut. Kennst du Mike?«
Mary schüttelte langsam den Kopf.
»So ein großer Kerl, gut gebaut. Überall. Er geht gern mit mir in den Medikamentenraum. Sehr gern geht er mit mir da hin. Seine Frau ist schwanger und hat derzeit keinen Bock auf ihn. Was soll er da machen? Auch Männer haben Bedürfnisse und ich … Na gut, lassen wir das. Du weißt, was ich meine. Jedenfalls habe ich jetzt dieses Feuerzeug und bald, sehr bald, wird in der Klinik ein Feuer ausbrechen. Dann werden die Alarmsirenen angehen, alle rennen durcheinander und in dem ganzen Gewusel verschwinden du und ich.«
»Du bist verrückt«, ächzte Mary.
»Ja, deswegen bin ich ja hier.« Kathy lächelte charmant. »Aber ich bin auch clever.« Das rothaarige Mädchen warf ihr eine Kusshand zu, dann drehte sie sich um und tänzelte ein Lied summend aus dem Raum.
Mary schloss die Augen.
Als León vor dem Lastenaufzug stand, befanden sich bereits zwei andere Jugendliche mit drei weiteren Wächtern darin. An der hinteren Wand stand ein asiatischer Junge. Eine Strähne seiner dunklen Haare war leuchtend blau gefärbt. Er war schlank und mittelgroß, in seinen weit aufgerissenen Augen spiegelte sich nackte Angst.
Der andere lehnte lässig an der Kabinenwand des alten Fahrstuhls, der früher wohl zum Transport schwerer Maschinen benutzt worden war. Nun war das Metall verrostet und die Holzplanken auf dem Boden wirkten abgenutzt.
Dieser Junge hatte weizenblondes Haar, ein ebenmäßiges Gesicht und Augen so blau wie der Sommerhimmel.
Als León von den Wärtern hineingeschubst wurde, gab der Blonde seine entspannte Position auf und nahm eine lauernde Haltung ein. León konnte sehen, wie er die Lippen aufeinanderpresste und mit den Kiefern zu mahlen begann.
Was ist mit dem Typen los? Was glotzt er mich so an?
Noch bevor er dem Gedanken weiter nachgehen konnte, wurde das schwere Metallgitter des Aufzugs zugeschoben und der Fahrstuhl setzte sich rumpelnd in Bewegung.
Durch die Metallstangen konnte León dunkelgraues, grob behauenes Felsgestein sehen. Ein mulmiges Gefühl erfasste ihn, als er erkannte, dass sie in einer Art steinerner Röhre nach unten fuhren.
Eine Minute verging, dann wagte er zu fragen: »Wo bringen Sie mich hin?«
Einer der Wächter wandte den Kopf. Es war ein Mann mit gutmütigem Gesicht und einer großporigen Nase, die von regelmäßigem Alkoholgenuss zeugte. Blassblaue Augen richteten sich auf ihn. »Weißt du das nicht?«
»Nein, Sir.«
»Hell’s Kitchen liegt unter der Erde. In dreitausendachthundertvierzehn Metern Tiefe. Es ist das größte Jugendgefängnis der Welt …« Er räusperte sich. »Und das sicherste. Von da ist noch keiner abgehauen.«
Es war wie ein Schlag in die Magengrube. Man brachte ihn für die nächsten fünfundzwanzig Jahre unter die Erde. So tief, dass darunter nur noch die Hölle kam? Aber vielleicht war das ja auch genau der Ort, an den man ihn verschleppte.
Was habe ich bloß gemacht, dass man mir das antut?
Verzweiflung übermannte León. Die Situation, in der er sich befand, war schlimm, aber viel schlimmer war der Umstand, dass er einfach nicht wusste, was geschehen war. Warum konnte er sich nicht erinnern? Hatte es einen Unfall gegeben, bei dem er sein Gedächtnis verloren hatte?
Nein, er spürte, dass alles mit ihm in Ordnung war. Zumindest körperlich, aber sein Kopf funktionierte nicht richtig. Merkwürdig war auch, dass er das, was er sah, benennen konnte. Den Fahrstuhl, den Overall, den er trug. Die weißen Turnschuhe an seinen Füßen. Die Ausrüstung der Wächter – nichts bereitete ihm Probleme, aber jedes Mal, wenn er versuchte, an seine Vergangenheit zu denken, stieß er gegen eine Mauer.
Und was war mit dem blonden Jungen los? Noch immer starrte ihn der Typ an, als sähe er einen Geist. León senkte den Kopf. Er konnte jetzt keinen Stress gebrauchen. Nicht schon am ersten Tag. Zunächst musste er irgendwie mit seiner Situation klarkommen, die neue Lage akzeptieren und sich zurechtfinden. Scheiße, die schlossen ihn so lange weg, dass er ein alter Mann sein würde, wenn er wieder an die Oberfläche kam.
Dieser Gedanke führte zu einem weiteren. Gab es jemanden, der ihn vermisste?
Bis jetzt konnte er sich nur an Loco und die anderen Spinner aus seiner Gang erinnern, aber da mussten doch auch andere Personen sein, die eine Rolle in seinem Leben spielten.
Verdammt, ich bekomme Kopfschmerzen von der Grübelei.
Noch immer ging es ruckelnd in die Tiefe. Ein Gefühl von Beengtheit, von Eingeschlossensein legte sich auf Leóns Brust, machte ihm das Atmen schwer.
Der asiatische Junge war auf den Boden gesackt, hatte sich zusammengekauert und umschlang seine Knie mit den Armen. Die Wächter ließen ihn gewähren. León betrachtete ihn heimlich.
Der Typ sah harmlos aus. Was hatte er getan, das ihn hierhergebracht hatte? Und was war mit dem Blonden? Er hatte einen Fünfzig-Dollar-Haarschnitt, gepflegte Fingernägel und das Gesicht eines Models. Wie kam der in den Knast?
Die ganze Sache wurde immer rätselhafter, aber obwohl ihm unzählige Fragen auf den Lippen brannten, schwieg León. Stattdessen starrte er auf seine nackten Arme, die von blauschwarzen Tätowierungen bedeckt waren. Über ihren Sinn musste er nicht nachdenken. Gangzeichen, die seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe signalisieren sollten.
Hijos. Söhne.
»Ich bin Mischa«, sagte der Blonde. »Das ist Tian.« Er nickte zu dem Jungen auf dem Boden. »Wie heißt du?«
»León.«
»Was …«
»Ruhe jetzt! Kein Gequatsche. Dafür habt ihr noch genug Zeit. Wir sind da!«, ging der Wachmann dazwischen.
3.
Der Fahrstuhl hielt rumpelnd. Das schwere Gitter wurde aufgeschoben und León hinausgestoßen. Was er sah, verschlug ihm den Atem.
Unzählige Scheinwerfer beleuchteten eine gigantische Höhle, deren kuppelartige Decke sich in mindestens einhundert Metern Höhe über ihm erstreckte. An den Felswänden waren Schienen befestigt, die in alle Richtungen verliefen, sich kreuzten und überlagerten. Riesige Baukräne breiteten ihre Ausleger aus wie die Flügel prähistorischer Vögel.
Es herrschte ohrenbetäubender Lärm, der von großen Metallkäfigen erzeugt wurde, die sich unablässig über das Schienengewirr bewegten. Ein Lufthauch strich über Leóns Gesicht. Es roch nach Rost, Eisen und … Schweiß. Erst jetzt bemerkte er, dass die Käfige nicht leer waren. In jedem von ihnen befanden sich junge Männer. Manche hockten stumpfsinnig vor sich hin glotzend auf dem Boden ihrer Zellen, andere umklammerten die Gitterstäbe, brüllten zornige Verwünschungen und Flüche heraus.
Immer wieder schwangen die Ausleger der Kräne herum, hoben einen der Käfige hoch und setzten ihn auf einem anderen Schienensystem wieder ab. Der Krach war kaum auszuhalten. Das tiefe Brummen der von Elektromotoren betriebenen Baukräne vibrierte in Leóns Körper, brachte alles in ihm zum Schwingen. Übelkeit stieg in ihm auf und er erbrach sich auf den nackten Felsboden.
Einer der Wärter lachte meckernd. Der Typ mit dem gutmütigen Gesicht meinte: »Fast jeder, der das zum ersten Mal sieht, kotzt.«
Was in ihrem Fall nicht stimmte, denn weder Mischa noch der schwächlich aussehende Tian mussten sich übergeben, obwohl beide kreidebleich geworden waren. León sah, dass der Asiat zitterte. Krampfhaft knetete der Junge seine Hände, als könnte er damit einen bösen Fluch vertreiben.
Mischa hatte inzwischen seine Lippen so fest zusammengepresst, dass es aussah, als hätte jemand eine Linie quer über sein Gesicht geschnitten.
»Okay, raus jetzt!«, brüllte einer der Wächter gegen den Lärm an. Er deutete nach vorn. Dort saßen zwei Männer in Arztkitteln an einem Tisch.
León und die beiden anderen Gefangenen wurden untersucht und nach Vorerkrankungen befragt. Es gab keine Blutabnahme, dafür trat einer der Ärzte nach vorn. Er hielt ein merkwürdiges Gerät in der Hand, das wie eine Druckluftpistole aussah.
»Jeder von euch bekommt jetzt einen Chip eingepflanzt, der all eure Daten enthält. Dieser Chip öffnet euch zu bestimmten Zeiten Zugänge, andere werden durch ihn verweigert. Wenn ihr die Zelle verlasst, speichert er das ab und sorgt dafür, dass die gleiche Zelle bei eurer Rückkehr wieder bereitsteht. Der Sensor an der Tür registriert eure Anwesenheit. Die Tür schließt sich erst, wenn ihr alle drei in der Zelle seid. Jeder Versuch, das System zu manipulieren oder es auszutricksen, wird hart bestraft. Habt ihr das verstanden?«
Mischa, Tian und León nickten stumm.
»Gefangener, deine Inhaftierungsnummer ist 1912.«
Der Arzt presste die Mündung des Gerätes an Leóns Hals. Kurz durchzuckte ihn ein Schmerz, nicht schlimmer als ein Wespenstich, dann war es vorbei. Der andere Arzt kam heran und hielt ein kleines Kästchen an Leóns Hals. Etwas summte.
»Aktiviert!«, sagte der Mann.
Der Arzt winkte Tian heran. »Gefangener, deine Inhaftierungsnummer ist 1913.«
Die Prozedur wiederholte sich.
Dann war Mischa an der Reihe. »Gefangener, deine Inhaftierungsnummer ist 1914.«
Als alle gechippt waren, deutete der erste Arzt auf eine Rampe mit Schienen, auf denen gerade ein unbesetzter Käfig heranruckelte. »Da rein! Miller, nehmen Sie ihnen die Fesseln ab.«
Ein Wärter kam und befreite León und die beiden anderen, dann wurden sie vorangetrieben. León stolperte in die Zelle. Als alle drei drin waren, hob der Wärter eine Hand und die Gittertür schloss sich automatisch.
León schaute sich um. Ihre Zelle war etwa zwölf Meter lang, drei Meter breit und drei Meter hoch. An den Wänden waren ausklappbare Pritschen befestigt. Es gab ein Metallklo und ein Stahlwaschbecken, ferner einen im Boden verschraubten Tisch mit vier ebenso verschraubten Hockern. Oben an der Decke lief ein vergitterter Rotor, der wohl für die Luftumwälzung sorgen sollte.
Kaum hatte León sich orientiert, ertönte ein heulendes Signal und die Zelle setzte sich ruckelnd in Bewegung. Er musste sich festhalten, während der Container auf eine der Höhlenwände zusteuerte. Mehrere Minuten glitten sie über Schienen, dann wurden sie von einem gigantischen Kran, der an der Höhlendecke befestigt war, angehoben und etwas später wieder abgesetzt. Schließlich kam der Käfig mit einer Erschütterung zum Stehen. Die Gittertür öffnete sich und ein Metallgebilde, das wie Flechtwerk aussah, dockte an. Von einer unerreichbaren Rampe über ihnen blickte ein Wächter auf sie herab.
»Raustreten!«
Vor León entfaltete sich ein unglaublicher Anblick.
Hunderte von Käfigen, die aufeinandergestapelt oder durch vergitterte Drahtröhren miteinander verbunden waren, auf deren Oberseiten schwer bewaffnete Wärter patrouillierten. Durch das Gitternetz unter seinen Füßen starrte León in eine bodenlose, schwarze Tiefe.
»Vorwärts!«
León stolperte nach vorn und erreichte eine Kreuzung, dann befand er sich in einem weitläufigen Käfig, auf dessen Boden meterlange Metalltische und Metallbänke verschraubt waren.
Essenszeit.
»In einer Reihe anstellen!«
Die drei folgten dem Befehl wortlos. Aus allen Richtungen drängten Jugendliche heran, die in den Käfig strömten, um Essen zu fassen.
Über Leóns Kopf kreisten weitere Container, die herabgesenkt und durch bewegliche Gitterröhren mit dem Speisesaal verbunden wurden. Zum kreischenden Lärm der Container gesellte sich nun auch das Gemurmel der Gefangenen. Alle Hautfarben und Rassen waren vertreten. Ein breites Spektrum der Gesellschaft, aber niemand schien jünger als vierzehn Jahre zu sein und keiner wirkte älter als achtzehn. Zudem waren es alles Jungs.
Als León sich in der Reihe vor der Essenausgabe anstellte, warf er vorsichtige Blicke in die Runde. Die meisten Insassen sahen wie ganz normale Jugendliche aus, die man jederzeit in einem Club oder auf dem Schulhof treffen könnte, aber es gab auch ein paar finstere Gestalten, deren Blicke ihn trafen. Insbesondere die ebenfalls im Gesicht und am Körper tätowierten Jugendlichen, die Gangzeichen wie er trugen, starrten ihn hasserfüllt an. Zwei Latinos hatten ihn ins Auge gefasst. Ihre Tattoos wiesen sie als Mitglieder der muerte negras aus. Einer Gang, die einen Großteil der Straßen von Los Angeles kontrollierte und mit den hijos verfeindet war.
Na toll, das geht ja gut los.
León wandte den Blick ab und versuchte, entspannt zu wirken, während in ihm das Adrenalin tobte. Er war noch keine fünf Minuten im Saal und wusste bereits jetzt, dass es bald Probleme geben würde. Vielleicht nicht heute, denn die negras würden erst einmal abchecken, ob er Verbündete auf seiner Seite hatte und mit wie vielen Gegnern sie rechnen mussten, aber irgendwann würden sie ihn attackieren, da war er sich sicher.
Die beiden Latinos hatten inzwischen die Ausgabe erreicht, ihr Essen abgeholt und kamen nun direkt auf ihn zu. Einer von ihnen fuhr sich beim Vorbeigehen mit dem Finger über die Kehle, der andere lächelte hochmütig.
»Freunde von dir?«, fragte Mischa.
»Nicht direkt.«
»Konnte man sehen. Ich denke, da wartet Ärger auf dich.«
León zuckte mit den Schultern. Er deutete auf Tian, der etwas abseitsstand. Seine ganze Haltung drückte Kummer aus. Immer wieder fingerte er an seiner blauen Haarsträhne herum.
»Kennt ihr euch schon länger?«
Mischa schüttelte den Kopf. »Seit sechs Stunden, davon hat er fünf geflennt. Tian sagt, er komme aus China. Er versteht nicht, warum er hier ist und was er verbrochen hat. Faselt nur immer davon, dass seine kleine Schwester verschwunden ist, als er auf sie aufpassen sollte.«
Mischa sprach leise, aber León konnte sehen, wie der asiatische Junge mit den Augen zuckte, als er seinen Namen hörte.
»Was hast du ausgefressen?«, fragte Mischa.
»Man wirft mir versuchten Mord vor. Anscheinend habe ich fünfundzwanzig Jahre bekommen.«
»Anscheinend?«
»Ich kann mich nicht an die Verhandlung erinnern. Vielleicht hatte ich einen Unfall. Und du?«
»Ich bin Russe …«
»Echt jetzt? Hört man nicht.«
»Danke. Ich habe einen Anschlag auf meinen Vater überlebt, danach wurde ich hierhergebracht. Niemand hat mit mir gesprochen, aber ich denke, es ist eine Maßnahme zu meiner Sicherheit.«
»Du bist zur Sicherheit im Gefängnis? Hier, mit all den Kriminellen? Schlägern und Mördern?«
»Merkwürdig, nicht wahr?«
»Klingt, als hättest du ebenfalls Probleme mit dem Erinnerungsvermögen.«
»Du meinst, sie haben uns Drogen verabreicht?«
»Wäre doch möglich. Vielleicht damit wir vergessen, wer wir sind, und gefügig werden.«
Mischa blickte sich vielsagend um. »Wer so etwas unterirdisch baut, um Tausende junger Menschen von der Gesellschaft fernzuhalten, dem ist alles zuzutrauen.«
»Mann, die haben uns echt weggesperrt. Hier unten bekommt niemand mit, was mit uns passiert. Was weißt du über diesen Ort?«
Zu Leóns Überraschung mischte sich der asiatische Junge ein. In fast akzentfreiem Englisch sagte er: »Ich habe gehört, wie sich die Wächter darüber unterhalten haben. Wahrscheinlich dachten sie, ich verstünde kein Wort.« Er deutete zur Höhlendecke. »Das ist ein ehemaliges Bergwerk, in dem in früherer Zeit seltene Metalle abgebaut wurden. Als die Sache unrentabel wurde, haben sie das Bergwerk geschlossen und die schweren Maschinen abtransportiert. Der Staat hat den Laden übernommen und ein Gefängnis daraus gemacht. Das sicherste Gefängnis der Welt. Hier kommt keiner weg. Nun lassen sie die Jugendlichen in den Stollen schuften. Sechs Tage die Woche, acht Stunden am Tag. Mit Hacken müssen wir Brocken aus dem Fels hauen, die später eingeschmolzen werden, aber das geschieht an der Oberfläche.«
»Hast du nicht gesagt, das Bergwerk wäre unergiebig?«, merkte León an.
»Für Abbau im großen Stil schon, da ist es unrentabel. Um jugendliche Straftäter zu beschäftigen und müde zu machen, reicht es noch.«
»Fuck«, stieß León hervor. »Ich habe keinen Bock auf Schufterei und Staublunge.«
»Beschwer dich beim Direktor«, meinte Tian trocken.
Inzwischen war die Reihe so weit vorgerückt, dass León vor der Essenausgabe stand. Er griff sich ein Tablett und einen Plastiklöffel. Messer und Gabel waren nicht vorhanden. Ein schmächtiger blasser Junge reichte ihm einen Teller mit Kartoffelbrei, irgendwelchen Fleischklumpen und Gemüsematsch.
»Das soll ich essen?«, fragte León.
»Ihr seid neu hier. Die Löffel sind abgezählt«, sagte der Junge. »Wenn ihr den Teller in die Abgabe stellt, muss er darauf liegen. Das wird kontrolliert. Sollte ein Löffel fehlen, verlässt niemand den Saal, bis er gefunden wurde. Was passiert, wenn ihr versucht, einen zu klauen, könnt ihr euch denken.«
»Nein, was geschieht dann?«, fragte Mischa.
»Dann geht’s ab in die Vogelkäfige«, sagte der andere grinsend.
»Was …«
»Schnauze!«, brüllte jemand hinten. »Quatscht nicht rum und geht weiter. Andere Leute haben auch Hunger.«
Mischa wandte sich nicht einmal um, sondern hob nur den Mittelfinger. León nahm sein Tablett und suchte nach einem Platz.
Zu seiner Erleichterung war sogar ein ganzer Tisch frei. León steuerte rasch darauf zu und setzte sich auf einen der am Boden festgeschraubten Hocker, der ebenso aus Stahl war wie der Tisch. Er stellte sein Tablett auf der verkratzten und stumpf gewordenen Oberfläche ab. Kurz darauf kamen auch Tian und Mischa.
»Meint ihr, das Zeug ist essbar?«, fragte der Russe.
»Riecht ganz okay. Hauptsache, man wird satt«, meinte Tian.
»Und ich dachte immer, Chinesen wären Feinschmecker.«
»Sind sie auch, aber vor allem denken sie praktisch. Du hast Hunger – das ist Nahrung. Ende. Aus.«
»Na, wenn du es einem so schmackhaft machst, wie soll man da widerstehen?« Mischa probierte etwas von dem Kartoffelbrei. »Schmeckt wie Dachpappe.«
»Versuch das Fleisch«, sagte León. »Ich glaube, die züchten hier unten Ratten.«
»Hast du schon mal Ratte probiert?«, fragte Tian.
»Nein, natürlich nicht.«
»Woher willst du dann wissen, wie sie schmecken?«
»Leck mich doch.«
»Heute nicht«, erwiderte Tian lachend.
León stimmte in sein Lachen ein. Zum ersten Mal an diesem beschissenen Tag begann er sich zu entspannen.
Während sie aßen, erklang über Lautsprecher die Stimme eines Mannes. Zunächst dachte León, es handele sich um eine Ansage des Direktors, dann entdeckte er jedoch das Abbild des Sprechers an der Höhlenwand, die offenbar als Projektionsfläche genutzt wurde.
In Schwarz-Weiß sprach da ein Mann mit leidenschaftlicher Stimme vom Dienst an der Gesellschaft und dem friedlichen Miteinander. Das Bild war mindestens fünfzig Meter hoch und das hagere Gesicht des Mannes blickte streng auf die Gefangenen herab, aber León erkannte sofort, dass es nur eine Aufzeichnung war, die da abgespielt wurde.
Sein Name war eingeblendet.
Richard Westman.
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
León zuckte zusammen. Das sollte der Präsident sein? Der Führer seines Landes? Er kannte den Mann nicht, und das stürzte ihn in tiefe Verwirrung. Wie konnte es sein, dass er sich nicht an ihn erinnerte? Die Sorge, dass er länger krank gewesen oder ernsthaft verletzt worden war, machte sich in ihm breit. Irgendetwas stimmte mit seinem Kopf nicht.
»Was ist mit dir?«, fragte Tian.
»Ich … ich weiß nicht.« Er deutete auf das Bild. »Kennst du den Typen?«
Tian schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht von hier.«
»Und du?«
Mischa verzog den Mund. »Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen, aber beschwören kann ich es nicht. Seit dem Tod meines Vaters ist alles durcheinander.« Er sah León intensiv an. »Versteh das, was ich jetzt sage, bitte nicht falsch, aber ich habe schon mehrfach von dir geträumt.«
León riss die Augen auf. »Was? Wir kannten uns bis heute doch gar nicht.«
»Eben. Das ist ja das Seltsame. Trotzdem bist du mir im Traum erschienen.«
»Erzähl mal.« Tian ließ seinen Löffel sinken.
»Wir waren an einem merkwürdigen Ort. In einer Art Steppe. Gras, so weit das Auge reichte. Hüfthoch, wie ein grüner Ozean. Wir waren nicht allein dort, aber ich konnte die Gesichter der anderen nicht erkennen. Sie waren irgendwie verschwommen, genau wie die Gestalten, die uns hetzten und jagten. Ihre furchtbaren Schreie, ihr Heulen verfolgte uns und dann war da überall Feuer. Es raste durch die Steppe. Eine Feuersbrunst. Wir flohen davor. Dann bin ich aufgewacht.«
»Was habe ich gemacht? Habe ich mit dir gesprochen?«, fragte León.
»Mit uns allen. ›Lauft! Lauft um euer Leben.‹«
»Und du bist sicher, dass ich es war?«
»So wie du aussiehst, bist du nur schwer zu verwechseln.«
»Echt crazy«, meinte Tian. »Dass du von ihm träumst, obwohl du ihn noch gar nicht kanntest.«
Danach sprach keiner von ihnen mehr. Stumm schaufelten sie ihr Essen und León fragte sich erneut, was das alles zu bedeuten hatte.
4.
Nach dem Essen waren sie zurück in die Zelle geschickt worden, die sich noch an derselben Stelle befand.
Mischa klappte eine der Schlafpritschen herunter und legte sich darauf, während Tian die an einer Längsseite befestigten Schränke inspizierte.
»Ich weiß nicht, ob das tagsüber erlaubt ist«, meinte er und nickte Mischa zu.
»Tagsüber? Siehst du hier irgendwo die Sonne?«
»Ich meine, wenn nicht konkret Schlafenszeit ist.«
»Woher willst du so etwas wissen?«
»Fernsehen.«
»O Mann.«
»Ich denke nicht, dass es jemanden interessiert«, sagte León. »Was ist in den Schränken?«
»Bettwäsche. Handtücher. Zahnbürsten. Plastikbecher. Zahnpasta und Klopapier.«
Mischa warf einen Blick zu dem festgeschraubten Stahlklo, das einen minimalen Sichtschutz aufwies. »Ich weiß nicht, ob ich da draufgehen kann.«
»Ein Waschbecken gibt es nicht. Wahrscheinlich werden wir einmal täglich zu Duschräumen geführt.«
»Wie machen die das mit dem Abwasser?«, fragte León. »Die Käfige werden doch ständig bewegt.«
»Ich habe gesehen, wie sich ein flexibles Rohr automatisch andockt, wenn die Zelle in ihrer endgültigen Position einrastet«, sagte Mischa.
»Was soll das überhaupt? Dieses ganze Verschieben macht doch keinen Sinn.«
»O doch. So wird verhindert, dass sich Gruppen bilden, Gangs entstehen. Heute bist du hier, morgen ganz woanders«, sagte Tian. »Ich hab darüber nachgedacht. Die Sache ist ziemlich clever und ich bin mir sicher, dass da noch mehr ist. Wenn hier unten Tausende von Gefangenen sind, dann muss es weitere Speisesäle geben, denn selbst bei einem vierundzwanzigstündigen Schichtbetrieb könnten nicht alle in einem einzigen Raum versorgt werden. Wir sollten auch davon ausgehen, dass eine Krankenstation vorhanden ist. Räume, in denen das Werkzeug für die Bergarbeit aufbewahrt wird. Irgendwo müssen die Wachen wohnen und schlafen. Es sei denn, nachts ist hier unten nur eine kleine Truppe für den Wachdienst und die Männer von der Tagesschicht werden jeden Morgen heruntergebracht.« Er seufzte. »Ich denke, wir haben bisher erst einen kleinen Teil der gesamten Anlage gesehen.«
»Was hat der Junge bei der Essenausgabe mit Vogelkäfige gemeint?«, fragte León.
»Ehrlich, das will ich gar nicht wissen. Allein bei der Art, wie er das Wort ausgesprochen hat, habe ich eine Gänsehaut bekommen.«
»Sind in den Schränken auch Kissen?« León sah zu Tian hinüber.
»Ja.«
»Wirf mir mal bitte eins rüber. Ich glaube, ich lege mich auch auf die Pritsche.«
»Müde?«
»Nein, ich muss nachdenken.«
»Dafür hast du hier jede Menge Zeit.« Es klang bitter.
»Ja, und genau darüber muss ich nachdenken.«
Mary war in einer anderen Welt, die nur in ihrem Kopf existierte. In einer Welt aus Schatten, die zur Tür hereinfielen und das Zimmer eroberten, bevor ihnen der wahre Schrecken folgte.
Aber sie war nicht allein. Im Zimmer nebenan wimmerte leise ihr kleiner Bruder David.
Das Plätschern der Wellen gegen den Bootsrumpf verstummte und sie hörte die Schritte. SEINE Schritte. Wie er vor der Tür auf und ab ging, so als dächte er nach, als bereute er, aber das waren nur Augenblicke, denn es geschah immer wieder. Es gab keine wahrhafte Reue, nur seinen schweren Atem, wenn er ihr ins Ohr flüsterte, dass sie Papas kleines Mädchen sei.
Mary hörte, wie die Tür zum Zimmer ihres Bruders aufschwang, ein kaum vernehmbares Ächzen der Scharniere. Dann die flüsternde Stimme ihres Vaters.
Jetzt sagte er vermutlich, dass David schlafen solle, alles in Ordnung sei, aber nichts war in Ordnung. Niemals wieder. Nicht für David und auch nicht für sie.
Die Tür ächzte erneut, dann verklangen die Schritte.
Zurück blieb Einsamkeit.
Tränen.
Und das Gefühl unendlicher Demütigung.
Leise schob sie die Bettdecke zurück und erhob sich.
Der Boden war kalt unter ihren Füßen und sie fröstelte. Unsicher stand sie da. Sie musste zu David. Ihn in den Arm nehmen, halten und trösten. Ihm vorlügen, alles würde gut werden.
In der Nacht schlief León unruhig. Nicht nur die merkwürdige Umgebung sorgte dafür, dass er sich unruhig von einer Seite auf die andere wälzte, es war auch das Stimmengemurmel der Gefangenen, das wie das Summen eines Bienenschwarms durch die Höhle zog. Dazu das permanente Husten und das Fluchen, das ihn immer wieder aufschreckte.
All das wurde in der Nacht von Klopfgeräuschen überdeckt. Zunächst verstand León die Ursache des Klopfens nicht, aber mit der Zeit begriff er, dass es sich dabei um ein ausgefeiltes System zur Nachrichtenübertragung handelte. Ähnlich dem Morsealphabet, nur dass anscheinend keine Buchstaben, sondern ganze Wörter übermittelt wurden.
»Hörst du das auch?«, fragte Tian in der Dunkelheit, die immer nur kurz erleuchtet wurde, wenn das Licht eines der Scheinwerfer darüber hinwegstrich.
León nickte, aber dann fiel ihm ein, dass der andere es ja nicht sehen konnte. »Klingt, als würden sie sich etwas mitteilen«, meinte er.
»Da bin ich mir sicher«, sagte Mischa. »Ich denke, so bleiben Freunde und Gefährten in Kontakt, die getrennt wurden. Bei den Distanzen hier dürfte Rufen ziemlich sinnlos sein.«
León kratzte sich am Kopf. Das klang logisch. Und ihm fiel etwas auf: Die Gefangenen klopften nicht wild durcheinander. Jede Nachricht begann mit drei Klopfzeichen und endete mit vier Zeichen, erst danach wurden andere Botschaften gesandt. Nur wie sprachen sich die Gesprächspartner an? Gab es Zeichen für Namen? Er wusste zwar nicht, mit wem er Nachrichten austauschen sollte, aber die Sache interessierte ihn. Er würde versuchen, die Klopfsprache zu lernen.
Die Zelle hatte sich seit dem Abendessen, das sie in einem anderen Saal eingenommen hatten, nicht mehr bewegt. Zu Leóns großer Erleichterung waren sie den beiden negras nicht noch einmal begegnet. Das System zur Verhinderung von Gangbildung hatte also auch Vorteile.
Nach dem Essen hatte sie ein Wärter zu einer Doppelzelle geführt, die als Kleiderkammer diente. Man hatte ihnen Ersatzkleidung und jedem drei kleine Plastikflaschen Wasser ausgehändigt.
Der Wärter hatte ihnen auch das Nötigste zum kommenden Tagesablauf erklärt. Er war dabei ziemlich knapp geblieben und so wussten sie nun, dass sie am nächsten Tag zur Arbeit in die Stollen gebracht werden würden. Was sie dort erwartete, hatte er ihnen nicht verraten.
Entgegen Leóns Hoffnung hatte man sie danach nicht zu den Duschräumen, sondern sofort wieder zurück in die Zelle geführt. Da es kein Waschbecken gab, hatte er sich über der Toilette die Zähne geputzt und mit dem Trinkwasser den Mund ausgespült. Mischa und Tian hatten es ebenso gemacht.
Kurz darauf waren die Lichter an der Höhlendecke erloschen und nur noch die Scheinwerfer strichen mit ihren bleichen Fingern über die Käfige.
Seitdem lag León mehr oder weniger wach auf seiner Pritsche. Wenn überhaupt, nickte er nur kurz ein, um gleich darauf wieder aufzuschrecken. Er dachte an seine Tätowierungen, die zeigten, dass er ein harter Kerl gewesen war, der bestimmt keiner Auseinandersetzung aus dem Weg ging, aber hier, an diesem merkwürdigen, bizarren Ort, fühlte er sich schwach und verloren.
Die fehlenden Erinnerungen setzten ihm ebenso zu wie der Gedanke, die nächsten fünfundzwanzig Jahre in einem verlassenen Bergwerk zu verbringen. Er würde ein Mann in mittleren Jahren sein, wenn er das nächste Mal den Himmel sah, den Duft einer Blume roch oder ein Mädchen küsste. Neben ihm begann Tian leise zu schnarchen. León gönnte ihm die Auszeit, aber gleichzeitig beneidete er ihn darum, dass er diesem Ort für ein paar Momente entfliehen konnte, und sei es nur in seinen Träumen.
Tian und Mischa schien es ähnlich wie ihm selbst zu ergehen. Beide behaupteten seltsame Sachen über sich, ohne Erklärungen dafür zu haben, wie sie nach Hell’s Kitchen gekommen waren. Im Gegensatz zu ihm schienen sie sich jedoch nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, aber vielleicht täuschte das auch.