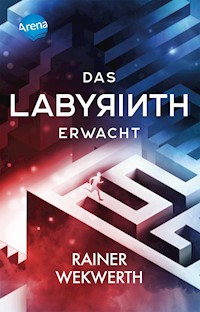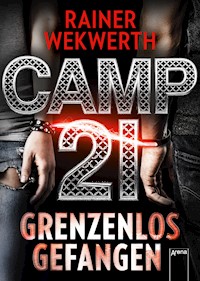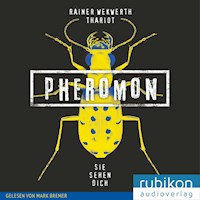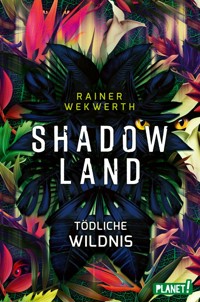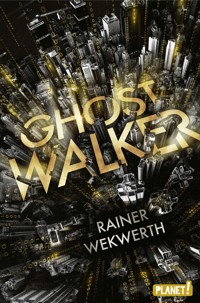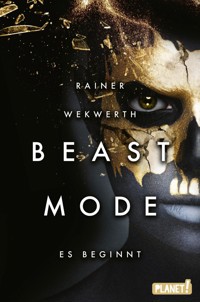4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Labyrinth-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Fünf Jugendliche. Sie haben gekämpft, sich gequält und zwei Welten durchquert, um die rettenden Tore zu erreichen. Wieder stellt sie das Labyrinth vor unmenschliche Herausforderungen. Sie sind allein mit ihrer Vergangenheit, ihren Ängsten, ihren Albträumen. Letztendlich entpuppt sich etwas Unerwartetes als ihr größtes Hindernis: die Liebe. Jeder von ihnen ist bereit, durch die Hölle zu gehen, doch wer würde das eigene Leben für seine Liebe opfern? "Aus dem Labyrinth gibt es kein Entkommen, es hat mir den Schlaf geraubt. Spannender geht's nicht." Ursula Poznanski "Das Labyrinth erwacht" (Band 1 der Trilogie) wurde ausgezeichnet mit den Leserpreisen "Segeberger Feder" und "Ulmer Unke". Nominiert für die Leserpreise "Buxtehuder Bulle" und "Goldene Leslie". Alle Bände der Labyrinth-Tetralogie: Das Labyrinth erwacht (1) Das Labyrinth jagt dich (2) Das Labyrinth ist ohne Gnade (3) Das Labyrinth vergisst nicht (4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Rainer Wekwerth
Das Labyrinthjagt dich
Rainer Wekwerth, 1959 in Esslingen am Neckar geboren, schreibt aus Leidenschaft. Er ist Autor erfolgreicher Bücher, die er teilweise unter Pseudonym veröffentlicht und für die er Preise gewonnen hat. Er ist verheiratet und Vater einer Tochter. Der Autor lebt im Stuttgarter Raum. www.wekwerth.com
Weitere Bücher von Rainer Wekwerth im Arena Verlag: Das Labyrinth erwacht Damian. Die Stadt der gefallenen Engel Damian. Die Wiederkehr des gefallenen Engels
Für Achim
2. Auflage 2013 © 2013 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Ein Projekt der AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur (www.ava-international.de) Cover: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80193-3
www.wekwerth-labyrinth.dewww.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
1. Buch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
2. Buch
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Epilog
Danksagung
1. Buch
León ging zwei Schritte und prallte gegen eine Wand. Verdutzt hielt er sich die Stelle an der Stirn, mit der er gegen die Begrenzung gestoßen war. Ein dumpf pochender Schmerz breitete sich in seinem Kopf aus.
Mist. Das gibt eine ordentliche Beule.
Er war auf vieles gefasst gewesen, nachdem er die eisige Stadt verlassen hatte, aber auf einen geschlossenen Raum war er nicht vorbereitet. Langsam ließ León die Hand sinken und blickte sich um. Er befand sich in einem ungefähr vier mal vier Meter großen, fensterlosen Raum ohne Möbel. Eine nackte Leere umgab ihn: nichts als perfekte weiße Wände, glatt und ohne Fugen.
Obwohl keine Lichtquelle erkennbar war, herrschte keine Dunkelheit. Der Raum war in weiches weißes Licht getaucht, das von der Decke und dem Fußboden auszugehen schien. León schloss die Augen und atmete tief ein.
Es war still hier drin. Absolut still. Nur sein Atem durchbrach diese Stille, als gehöre er nicht hierhin. Wo bin ich?
León schlug die Augen wieder auf und betrachtete verwundert die Zahlenreihen, die über die nackten Wände liefen. Sie ergaben keinen Sinn, darum beachtete er sie nicht weiter. Er legte beide Handflächen auf die Wand vor ihm und strich darüber. Es waren keine Unebenheiten zu spüren. León tastete die Wände der Reihe nach ab. Klopfte mit den Fingerknöcheln gegen das unnatürlich glatte Mauerwerk. Nichts. Das Echo war stets gleich. Dumpf und massiv verriet es ihm, dass es keine versteckten Türen oder irgendwelche Hohlräume dahinter gab.
Drängender als die Frage, wo er war, wurde die Frage, wie er hier rauskommen sollte. Und wo die anderen waren. Jenna, Jeb, Mary und Mischa.
León rief ihre Namen. Zunächst zurückhaltend, dann immer lauter, schließlich brüllte er sie heraus. Zwischendurch hielt er immer wieder inne und lauschte. Aber da war nichts.
Keine Antworten. Nur der Klang seiner eigenen Stimme, die von den kahlen, leeren Wänden zurückgeworfen wurde.
Schließlich gab er auf.
León setzte sich in der Mitte des Raumes auf den nackten Boden, kreuzte die Beine zum Schneidersitz, presste die Hände gegen seine Schläfen und dachte nach.
Vor wenigen Tagen war er in einer fremden Welt erwacht. Zunächst war er allein gewesen, aber dann hatten ihn andere Jugendliche gefunden, die sich in der gleichen Situation wie er befanden. Am schlimmsten war für ihn der Moment gewesen, als Tian beim Überqueren der Schlucht in die Tiefe gestürzt war. Tian war tot, ermordet von Kathy, die sichergehen wollte, dass es für sie ein freies Tor in die nächste Welt gab. Kathy, diese Bitch, die sich dann so plötzlich und unerwartet für Mary eingesetzt hatte. Aus Kathy wurde er einfach nicht schlau. Am Ende war sie in der Eiswelt zurückgeblieben. Tot, erfroren, verrückt geworden. Er knirschte geräuschvoll mit den Zähnen. Was auch immer ihr zugestoßen war, diese puta hatte nichts anderes verdient.
Nun waren sie noch zu fünft. León wusste nicht, ob die anderen ebenfalls hier aufgetaucht waren, en la nada. Im Nichts. Und er hatte keine Ahnung, wie er sie erreichen sollte, falls sie in der Nähe waren.
Mierda, was für eine Scheiße ist das wieder?
Wenn die anderen nicht hier erschienen waren, gut. Gut für ihn, denn dann würde es keinen Kampf um freie Tore geben. In jeder kommenden Welt würde ein weiteres Tor auf ihn warten und er würde früher oder später heimkehren. Zumindest hoffte er das, denn was auch immer sein Zuhause war, er hatte keine genaue Erinnerung daran. Aber das Problem, dem er momentan gegenüberstand, war einfach. Er befand sich in einem fensterlosen Raum, aus dem keine Tür hinausführte. Ganz zu schweigen von irgendwelchen Portalen, die ihn von hier wegbringen konnten.
Im Augenblick konnte er nichts tun. León spürte, dass dieser Raum ein Geheimnis barg, und er würde es lüften. Niemand sperrte ihn wie ein Tier ein. Niemand.
León hatte die Jacke ausgezogen und zur Seite gelegt. Hier drin herrschte eine gleichmäßige Temperatur. Es war weder warm noch kalt, er würde die Jacke nicht mehr brauchen. Die Füße untergeschlagen, starrte er an die gegenüberliegende Wand. Irgendwann würde sich etwas ändern. Er war bereit.
Während er seinen Blick gegen die leeren Wände richtete, überkam ihn langsam die Erschöpfung. Die Augen fielen ihm zu und sein Kinn sackte auf die Brust. Entschlossen riss er den Kopf hoch. Er musste wach bleiben. Wachsam.
Doch bald forderte sein Körper den Tribut für die Anstrengungen, noch am Leben zu sein.
Jenna war außer sich vor Wut. Wild hämmerte sie mit den Fäusten gegen die nackten weißen Wände. So glatt und makellos wie sie auch waren, bald schon bluteten Jennas Knöchel und hinterließen rote Schlieren auf der makellosen Fläche.
Sie war gefangen, aber schlimmer noch, allein. Wo war Jeb? Der Junge, der sich in dieser kurzen Zeit so tief in ihr Herz geschlichen hatte, dass es sich anfühlte, als müsste sie ihn schon viel länger kennen. Jeb, der sein Leben riskiert hatte, um sie in der ersten Welt zu retten. Jeb, den sie brauchte und ohne dessen schiefes Lächeln sie nicht mehr leben wollte.
»Warum tut ihr mir das an?«, brüllte sie in die weiße Leere des Raumes. »Habe ich nicht schon genug gelitten, ihr verdammten Arschlöcher? Macht es euch Spaß zuzusehen, wie ich noch mehr leide?«
Ihr Gesicht glühte vor Zorn. Sie trat zwei Schritte zurück und warf sich mit ihrem gesamten Körpergewicht gegen die Wand. Noch mal und noch mal. Sie rief Jebs Namen, doch nur die Stille schrie zurück.
Erschöpft und atemlos vor Wut ließ sie sich zu Boden sinken und weinte. Blöderweise verschluckte sie sich an ihren eigenen Tränen und fing an zu husten. Das brachte sie wieder zur Besinnung und sie versuchte, ihre Situation zu beurteilen.
Sie war eingesperrt und musste raus, um Jeb zu suchen. Wer auch immer dafür gesorgt hatte, dass sie hier gelandet war, wollte sie sicher nicht in einem nackten Raum verhungern oder verdursten lassen. Das ergab keinen Sinn. Ihren Tod, den Tod aller hätte er schon früher haben können. Oder, wenn dieser Jemand die Tore einfach hätte verschwinden lassen, dann wäre keiner von ihnen je lebend in der nächsten Welt gelandet. Nein, nein, nein, dies alles diente nicht dazu, sie alle einfach zu töten, so viel war Jenna klar. Das wäre zu simpel.
Fuck you, dachte sie. Wer immer sich diesen höllischen Spaß ausgedacht hatte, sie würde sich nicht unterkriegen lassen.
Ich komme aus diesem Raum raus, finde Jeb, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue.
Die blinde Wut war verflogen, hatte einem berechnenden Zorn Platz gemacht, der Jenna half, sich zu konzentrieren.
Such den Raum ab, irgendwo gibt es einen versteckten Mechanismus, der eine nicht sichtbare Tür öffnet.
Sie klammerte sich an dem Gedanken fest, dass es hier und jetzt nicht vorbei sein konnte. Etwas anderes ergab keinen Sinn, es musste weitergehen, sie musste weiterkämpfen. Darauf allein kam es jetzt an: dass sie nicht aufgab. Vielleicht hatte sie etwas übersehen. Zuversicht keimte in ihr auf und sie blickte sich noch einmal aufs Neue um.
Dann wurde es plötzlich vollkommen dunkel.
Mary kauerte in der äußersten Ecke des Raumes, so weit wie möglich entfernt von der Tür, die einen Spalt offen stand, durch den ein Lichtschein in das finstere Zimmer fiel.
Alle Empfindungen, all ihr Denken war fortgespült, davongetragen von der Angst, IHM ausgeliefert zu sein.
Irgendwo da draußen war er. Sie konnte seine Schritte hören.
Die Tür würde sich etwas weiter öffnen, nicht ganz, nein, das nicht. Sein lang gezogener Schatten würde sich über den Boden ausbreiten und mit der Dunkelheit des Zimmers verschmelzen.
Ihre Mutter ahnte von alldem nichts, oder wollte sie nicht wissen, was nachts in diesem Zimmer geschah?
»Du bist eine verwöhnte Göre, die nicht weiß, was sich gehört«, schimpfte sie oft. »Immer muss man dir alles hinterhertragen, weil du zu faul bist.«
Aber das stimmte nicht, ihr Vater nahm ihr, ohne zu fragen, alles ab. Immer war er zur Stelle, trug ihr den Schulranzen, hob ihre Bücher auf, wenn sie auf den Boden fielen, so als wolle er wiedergutmachen, was er in der Nacht zuvor verbrochen hatte.
All die Bilder und Erinnerungen, von denen sie gehofft hatte, sie könne sie vergessen oder verdrängen, waren mit einem Schlag zurück. Alles war weg. An nichts sonst konnte sie sich aus ihrem früheren Leben erinnern, nur daran.
Plötzlich stoppten die Schritte. Doch er kam nicht herein. Dafür hörte Mary etwas anderes. Ein leises Schluchzen. Ganz schwach, als hätte die Angst, die darin lag, keine Flügel.
»Papa, bitte nicht. Bitte.«
Mary begann, unkontrolliert zu zittern. David. Das war seine Stimme. Ihr Körper bäumte sich auf, sie zuckte zusammen, als stünde sie unter Strom. Ein Würgen stieg ihr in den Hals und der Ekel, den sie empfand, erbrach sich auf den nackten Boden. Sie keuchte, bitterer Speichel rann aus ihrem Mundwinkel. Hinter ihren geschlossenen Lidern tanzten blutrote Flecken und mit einem Mal wurde ihr schwindelig.
»Bitte.«
Nur ein Wort. Ein Flehen, in dem pure Angst lag.
Mary wischte sich mit dem Ärmel ihrer Jacke über den Mund. Langsam stand sie auf. Ihre Beine waren zittrig, weigerten sich, auf den Lichtschein zuzugehen, der von draußen hereinfiel, doch sie zwang ihre Füße, einen Schritt zu gehen.
Dann noch einen.
Ihr Herz klopfte bis zum Hals, aber sie zögerte nicht mehr.
Es war an der Zeit, dem allem ein Ende zu setzen.
Mischa starrte an die Wand vor ihm. Er sah nichts. Eben war es noch hell gewesen, nun hockte er in vollständiger Finsternis. Der Raum machte ihm keine Angst. Alles war klar und übersichtlich und ihm drohte keine unmittelbare Gefahr. Es herrschte weder glühende Hitze noch eisige Kälte, er hatte keine Schmerzen, keinen Hunger und keinen brennenden Durst. Das alles war eine simple geometrische Form, deren Rätsel er lösen würde.
Während er abwartete, wurde es wieder heller im Raum. Langsam wurde aus dem undurchdringlichen Schwarz ein trübes Grau, dann ein fahles Weiß. Woher das Licht kam, konnte er nicht ausmachen, aber viel interessanter war der Umstand, dass die Wände nicht mehr einfach nur weiß waren. Nun wanderten in scheinbar ungeordneten Bahnen Zahlen in blasser grauer Schrift darüber. Von links nach rechts und umgekehrt, von unten nach oben und andersherum.
Kleine Zahlen, große Zahlen.
Mischa blickte geradeaus auf die Wände und da erinnerte er sich. Zahlen und Formen, das war seine Vergangenheit. Sein Leben vor dem Labyrinth. Zahlen hatten darin eine große Rolle gespielt. Er liebte Zahlen, die Mathematik. Sein Herz machte einen Sprung. War er wieder heimgekehrt?
Nein. Mit dieser Umgebung verband er keine Erinnerungen. Alles hier fühlte sich fremd an. Kalt. Aber die Zahlen waren ihm vertraut.
Und dann begriff er. Dies alles war ein Rätsel und seine Lösung verbarg sich in den wandernden Zahlen. Wenn er sich auf das Spiel einließ und das Rätsel löste, würde er aus diesem Raum herauskommen und die anderen finden.
Irgendwo hinter diesen weißen Wänden befanden sich Portale, die ihn weiterführen würden, ihn seinem wahren Leben ein Stück näher brachten.
Die Zahlen! Was war an ihnen besonders?
Mischa beobachtete, wie sie über die Wände glitten, ihr Geheimnis aber gaben sie nicht preis. Sie waren unterschiedlich lang, hatten mal zwölf Stellen, mal nur vier oder jede Anzahl dazwischen, aber ihnen allen war etwas gemeinsam, das er nicht fassen konnte.
Ruhig und beständig wie das Meer, das Wellen an Land spült, bewegten sich die Zahlen über die Wände.
Mischa war verwirrt.
Er wusste, dass er des Rätsels Lösung in sich trug. Er musste sich nur erinnern. Erinnern an den, der er gewesen war vor dem Labyrinth, der er vielleicht immer noch war. Immer mehr Zahlen erschienen vor ihm und nun wirkten die Zahlen plötzlich nicht mehr vertraut, sondern bedrohlich. Unvermittelt tauchte eine neue Zahl auf, größer als die anderen, in roter Schrift. Sie erschien in der Mitte jeder Wand. Diese Zahl blieb dort regungslos stehen, die anderen glitten darum, so als wichen sie ihr aus.
24:00
Die Zahl blinkte langsam auf, wie eine Aufforderung, aber wozu? Dann veränderte sie sich. Mischa beobachtete sie beharrlich.
23:5923:5823:57
Dann verstand Mischa. Hier wurde ein Countdown angezeigt. Zeit wurde gemessen. Zeit, die verstrich. Irgendetwas würde geschehen, wenn der Zähler die Null erreicht hatte, und es würde nichts Gutes sein. Er knirschte mit den Zähnen.
Vierundzwanzig?
Vierundzwanzig Stunden.
Zeit, die ihm verblieb, um was zu tun?
Er musste nicht darüber nachdenken.
Vierundzwanzig Stunden Zeit, um aus diesem Raum herauszukommen und die Tore zu finden, die ihn in die nächste Welt brachten.
Verdammt!
Wo waren die anderen?
Jeb bekam keine Luft. Seine Kehle war zugeschnürt, seit er in dem Raum gelandet war. Er presste die Fäuste abwechselnd gegen den Brustkorb und auf seinen Mund, schnappte nach Luft, pumpte Sauerstoff durch die Lungen, mehr, immer mehr, und trotzdem hatte er das Gefühl zu ersticken.
Die Enge. Keine Fenster, keine Türen. Eingeschlossen zu sein, hatte seinen Tatendrang erstickt. Woher diese Angst gekommen war, wusste er nicht, aber während er zitternd auf dem Boden hockte, überwältigten ihn Bilder der Vergangenheit. In rasend schneller Abfolge tauchten Erinnerungsfetzen vor seinem inneren Auge auf.
Sein Vater, der betrunken seine Mutter beschimpfte. Die Enge des kleinen Hauses, in dem sie lebten. Freiheit fand er nur in den umliegenden Wäldern, zu Hause hüllte er sich in stille Verzweiflung, die jede Ritze seiner Kindheit auszufüllen schien.
Das Bild seiner Mutter tauchte in seinem Geist auf. Das ehemals glänzende schwarze Haar nun so grau und stumpf wie der Blick in ihren Augen. Er sah die Hoffnungslosigkeit darin, wenn sie nach vierzehn Stunden harter Arbeit heimkehrte und die leeren Schnapsflaschen hinaus in den Mülleimer trug. Gebeugt von der Last ihres Lebens bezahlte sie den Preis dafür, sich in diesen Mann verliebt zu haben.
Warum gehst du nicht?, hatte er sie jeden Tag stumm angeschrien. Warum verlässt du ihn nicht?
Sie war geblieben, seinetwegen. All die Jahre. Und nun war es zu spät, um noch einmal von vorn anzufangen.
Ich habe so viele Fragen an dich, Mutter, und jetzt fühle ich mich, wie du dich jeden Tag gefühlt haben musst. Ist das hier meine Strafe, dass ich dich im Stich gelassen habe?
Jebs Atem ging stockend. Er fühlte, wie sich seine Lunge verkrampfte, sich sein Brustkorb scheinbar zusammenzog. Heiser röchelte er. Mit den Händen umklammerte er seinen Hals, so als könne er ihn zwingen, sich zu öffnen.
Dann wurde es um ihn herum plötzlich dunkel. Schlagartig verengte sich seine Kehle. Keuchend versuchte er in der Finsternis, Luft zu holen, doch sosehr er auch verzweifelt seinen Brustkorb heben wollte, um erlösenden Sauerstoff in seine Lunge zu lassen … es fehlte ihm jede Kraft. Es war, als ob sein Körper gegen ihn selbst rebellierte, als ob er Jeb ersticken wollte. Er hätte gern geschrien, brachte aber keinen Ton heraus.
Als es wenig später wieder heller wurde, lag Jeb reglos am Boden.
Er sah nicht die Buchstaben und Zahlen, die nun über die Wände wanderten. Er nahm den auftauchenden Countdown nicht wahr, seine verkrampften Finger hatten versucht, sich in den nackten Boden zu krallen. Er rührte sich nicht.
Plötzlich veränderte sich das Licht zum zweiten Mal und ein rotes Leuchten erfasste die Wände. Ein jaulender Ton erklang. Jeb zuckte zusammen, er hob den Kopf, seine Lippen formten beständig stumme Worte. Sein Blick war verschwommen, doch er spürte, was geschah.
Langsam versanken lautlos die Wände um ihn herum im Boden. In jede Richtung breitete sich eine scheinbar endlose, leere Fläche aus, über der ein helles Licht zu schweben schien. Jeb spürte, wie Sauerstoff in seine Lungen drang, sein Kopf war leer, er war unfähig zu denken. Über allem lag das Rauschen des Blutes in seinen Adern. Aber etwas trieb ihn an, sich zu bewegen, aus diesem Gefängnis zu fliehen. Mühsam und ächzend schob er seinen Körper ein Stück vorwärts. Wie ein verletztes Tier kroch er dem Licht entgegen.
León erwachte. Ein seltsamer Ton hatte ihn geweckt. Als die Wände sich bewegten, sprang er blitzschnell auf die Füße und stellte sich in der Mitte des Raumes auf. Er drehte sich um seine eigene Achse, mit den Augen suchte er instinktiv alle Richtungen nach Feinden oder Gefahren ab. Doch da war nur Leere, eine weiße Fläche. Er machte einen Schritt vorwärts, und als nichts geschah, ging er zu der Stelle, an der eine der Wände im Boden verschwunden war. Er bückte sich, fuhr mit den Fingern über den glatten, fast makellosen Fußboden. Es war nichts zu spüren. Es war, als hätten ihn nie Wände umgeben.
León richtete sich wieder auf und sah sich langsam und sorgfältig um.
Eine leere Fläche, die sich in alle Richtungen vor ihm ausbreitete. Es schien keinen Horizont zu geben oder eine Wand jenseits dieser Fläche. La nada. Nein, das hier war mehr als nichts. El infierno blanco.
Leóns Gedanken drehten sich im Kreis. Was hatte diese leere Fläche zu bedeuten? War sie schon immer da gewesen, hinter den Mauern seines Raumes? Oder gab es vielleicht sogar noch mehr Räume, die er jetzt nur nicht sehen konnte, weil ihre Wände fehlten?
Während er sich ratlos um die eigene Achse drehte, entdeckte er in der Ferne eine Bewegung. Eigentlich war es mehr ein Schatten, der ein winziges Stück von rechts nach links gewandert war, aber instinktiv wusste León, dass dort in der Ferne ein Mensch war. Vielleicht sogar jemand aus der Gruppe? León legte beide Hände um den Mund und rief, so laut er konnte. »Hallo!«
Keine Reaktion.
Er brüllte noch einmal aus vollem Hals.
Sinnlos, so würde er nicht weiterkommen. León rannte los. Er jagte auf den Schemen zu.
Woher willst du wissen, dass dieser Schatten kein Feind ist? León schüttelte den Gedanken ab, während er Meter um Meter zurücklegte. Einer ihrer Jäger, seiner Feinde. Wie hatte Mary sie einmal genannt, Seelentrinker? Nein, die Verfolger aus der Steppe waren ihnen nicht in die letzte Welt gefolgt, warum sollten sie plötzlich hier in dieser seltsamen Umgebung erscheinen?
Es musste jemand aus der Gruppe sein. León hoffte, dass es jemand aus der Gruppe war.
Es kam ihm so vor, als ob er schon hundert Meter und mehr zurückgelegt hatte, aber dem Schatten kam er nicht näher. Er warf einen Blick über die Schulter, um festzustellen, ob er überhaupt vorwärtskam. Doch er wusste nicht mehr, von wo aus er losgelaufen war. Er versuchte, Einzelheiten vor sich auszumachen, aber das Bild zitterte durch seine Bewegungen und wurde einfach nicht deutlich. Sein Atem kam inzwischen stoßweise und sein Puls raste vor Anstrengung. Schweiß lief ihm in die Augen und machte es noch schwieriger, etwas zu erkennen.
Aber dann …
… bewegte sich die Gestalt.
León brüllte, so laut er konnte, und der Schatten wandte sich um, schien ihm entgegenzusehen.
Diese verhuschte Art, diese sanfte Bewegung … das ist Mary. Es muss Mary sein.
Er rief ihren Namen, da ertönte erneut der seltsam klagende Laut, der das Verschwinden der Wände angekündigt hatte.
León ahnte, was das zu bedeuten hatte. Er rannte schneller. Wo würden die Wände diesmal entstehen? Wände ohne Fenster und Türen: sein Gefängnis. Aber er konnte nichts dagegen tun, wusste nicht, was er machen sollte, also blieb er keuchend stehen und schaute sich um. Tatsächlich, aus dem Boden erhoben sich neue Mauern, sie strebten unaufhaltsam nach oben, unzählige Mauern in unterschiedlichsten Abständen und Winkeln.
Keine Zeit für Überlegungen, nur Zeit zu reagieren. León sprang über eine Mauer, die ihm bereits bis zu den Knien reichte, und stellte sich in die Mitte des neu entstehenden Raumes. Fasziniert und gleichzeitig fassungslos sah er zu, wie sich zu allen Seiten die Wände erhoben und mit einer Raumdecke vereinigten, die plötzlich am oberen Ende einer Wand erschien, sich herausschob und kurz darauf mit allen Wänden einen abgeschlossenen, hellen Raum bildete. Sein Gefängnis.
Er fluchte. Die Scheiße, in der er steckte, war dabei, über seinen Kopf zu schwappen und er hatte nicht die leiseste Ahnung, was hier ablief.
Aber er hatte Mary entdeckt und er wusste, die Wände seines Gefängnisses konnten verschwinden. Dieser Umstand beruhigte ihn ein wenig. Aber er hatte keinerlei Kontrolle über das, was mit ihm hier drin geschah. Und er hasste dieses Gefühl. Dieses Ausgeliefertsein. Das Gefangensein.
Was sollte er tun, wenn das nächste Mal die Wände verschwanden? Falls sie das überhaupt taten, würde er Mary wiederfinden? Wann würden diese verfluchten Mauern das nächste Mal im Boden versinken? Wo waren Jeb, Mischa und Jenna? Er hatte sie nicht gesehen, obwohl er weit in jede Richtung hatte sehen können.
León seufzte und sah sich zum ersten Mal richtig in dem neuen Raum um. Er unterschied sich kein bisschen von dem vorherigen. Es fühlte sich fast so an, als hätte er sich keinen Millimeter von der Stelle bewegt. Schweiß tropfte von seiner Stirn, seine Lippen schmeckten salzig und erinnerten ihn daran, dass er schon lange nicht mehr getrunken hatte. Seine Oberschenkel zitterten. Er grinste. Ich war schon mal besser in Form.
León stellte sich in der Mitte des neuen Raumes auf. Beim nächsten Mal wäre er bereit, so viel war sicher. Sein Kampfgeist war ungebrochen.
Ich komme hier raus. Nichts und niemand wird mich aufhalten.
Er legte den Kopf in den Nacken und brüllte seinen Zorn hinaus: »Wer immer mir das antut, ich werde dich finden, cabrón, das schwöre ich!«
Plötzlich spürte er eine Bewegung in seinem Rücken. León wirbelte herum. Kampfbereit hob er die Fäuste.
»Wen willst du finden, alter Rebell?«, lachte Mischa und betrat durch eine Öffnung den Raum. Eine Öffnung wie eine Tür. Eine Tür, die vorher noch nicht da gewesen war, das hätte León schwören können. Doch da war er, Mischa, und er kam durch diese Tür in seinen Raum.
León spürte, wie ein Lächeln über sein Gesicht glitt.
Zuerst wusste Mischa nicht, wie er reagieren sollte, aber dann ließ er sich Leóns Umarmung gefallen und genoss seine Nähe. Nicht in den kühnsten Träumen hatte er sich ausgemalt, diesen unnahbaren Jungen zu berühren, ihn fest im Arm zu halten.
Diese Umarmung kam so unerwartet und Mischa hielt den Atem an, um den Moment nicht zu stören, er spürte Leóns Arme, die fest und kraftvoll um seine Schultern lagen, während seine Hände einmal kurz über dessen Rücken strichen.
León trat einen Schritt zurück und strahlte. »Mann, tut das gut, dich zu sehen«
»Gleichfalls.«
Nur widerstrebend hatte Mischa ihn losgelassen. Obwohl er noch Leóns Berührung auf seinem Körper spürte, sehnte er sich bereits wieder nach seiner Nähe.
»Hast du die anderen gesehen?«, unterbrach León seine Gedanken.
Er schüttelte den Kopf. »Du? Hast du jemand entdeckt?«
»Ich glaube, ich habe Mary gesehen, als die Wände heruntergefahren sind. Ich bin auf sie zugerannt, habe ihren Namen gerufen, aber sie hat mich nicht bemerkt, glaube ich.«
»Die Wände sind was?!«, fragte Mischa erstaunt.
In Leóns Gesicht zeichnete sich Verblüffung ab. »Wie bist du überhaupt hier reingekommen?« Sein Blick wanderte zu der Wand, durch die Mischa den Raum betreten hatte, aber die Tür darin war verschwunden. Perfekt und glatt widersetzte die Wand sich seiner Suche.
Er zuckte mit den Schultern. »Mathematik.«
»Hä?«
Mischa deutete auf die Wände um sie herum, über die immer noch pausenlos Zahlenkolonnen wanderten. »Das Rätsel ist in diesen Zahlen verborgen und die Lösung ganz einfach, wenn man weiß …«
»Da sind Rätsel?«, unterbrach ihn León verblüfft und zog seine Augenbrauen hoch. Seine tätowierte Stirn legte sich in ebenmäßige Falten, Schweißtropfen legten sich dazwischen. Gerne hätte Mischa die Hand ausgestreckt, um mit den Fingern über die blauschwarzen Linien zu fahren.
Da bemerkte Mischa, dass León ihn immer noch neugierig anschaute, und verdrängte den so unwillkürlich aufgekommenen Wunsch. »Ja, wenn man sie sehen kann. Mathematische Rätsel.«
»Und du kannst sie natürlich lösen, du verrückter Professor, und dadurch Türen öffnen, die sonst nicht da sind.«
»Richtig. Keine Ahnung, warum, aber irgendwie liegen mir Zahlen. Mathe scheint mein Ding zu sein. Als ich die Zahlen sah, waren die Erinnerungen und das Wissen plötzlich da.«
»Das ist gut, das ist …«, sagte León.
»… mehr als gut, denn ich kann uns hier rausbringen.«
»Wir werden hier irgendwo die Portale finden.«
»Ja, alles andere macht keinen Sinn. Das hat doch Jebs Botschaft deutlich gesagt. Sechs Welten, die es zu durchlaufen gilt, dies ist erst die dritte. Wenn die Botschaft lügt … wozu dann der Aufwand? Wer oder was immer auch hinter alldem steckt, es geht garantiert bis zum bitteren Ende. Jemand, etwas will sehen, wie wir leiden, uns umbringen, ums Überleben kämpfen.«
León schaute ihn bei diesen letzten Worten durchdringend an, dann wandte er sich ab. »Was machen wir jetzt?«
Mischa klopfte ihm betont locker auf die Schulter. »Was wohl, wir wandern von einem Scheißraum zum nächsten, bis wir die Tore finden.«
»Und die anderen?«
»Versuchen vermutlich wie du, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.«
»Warum habe ich dich nicht gesehen, eben, auf der Ebene?« Er beäugte Mischa kritisch.
»Weiß ich nicht, ich war ja mit dem Zahlencode beschäftigt.« Mischa versuchte sich an einem verhaltenen Lächeln, um Leóns jetzt wieder offenes Misstrauen zu durchbrechen.
Doch León hatte sich längst wieder einer der Wände zugewandt. »Wie sollen wir hier die anderen finden? Das ist unmöglich.«
»Wir finden sie, unterwegs.«
»Und wenn nicht?«
Mischa dachte darüber nach, wie es sein würde, wenn sie alle die Tore erreichten. Diesmal würde es zum Kampf kommen, wenn unterwegs nicht jemand … aufgab.
Jeb würde sich mit Jenna verbünden, León wahrscheinlich Mary beschützen, so wie er es schon die ganze Zeit tat, dachte Mischa bitter.
Und er? Für einen Moment hoffte er, mit León an seiner Seite weitermachen zu können – war diese innige Umarmung wirklich nur der Wiedersehensfreude geschuldet? Mischa wusste, sobald Mary auftauchte, wäre es damit wieder vorbei. Irgendwie war León ihr zugeneigt, und das, obwohl sie ihn ständig abblitzen ließ.
León hatte Mary aus einer furchtbaren Lage gerettet. Und ja, der Weg von Dankbarkeit zu Liebe war nicht weit. Aber war ein so verschlossener Kerl wie León zu echten Gefühlen überhaupt fähig? Würde er, Mischa, weiterhin bangen müssen, ob sich der tätowierte Junge im entscheidenden Moment gegen ihn wandte?
Mischa hoffte, die Tore zu finden, ohne vorher Jeb, Jenna oder Mary zu begegnen, aber das musste León nicht wissen.
»Wir werden sie schon irgendwo hier drin auftreiben«, sagte er stattdessen. »Diese Welt kann ja nicht endlos sein und wenn ich uns weiter Türen öffne, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder alle vereint sind.«
»Und du kannst wirklich diese Scheißtüren herbeizaubern?«
Mischa grinste. »Weißt du, was Fibonaccizahlen sind?«
»Keine Ahnung, wovon du da redest.«
»Schau her. Fibonaccizahlen beginnen bei 1, jede weitere Zahl ergibt sich aus der Summe der beiden Vorgängerzahlen. 1, 2, 3. 1 + 2 ergibt in der Summe 3. Also wäre der nächste Schritt, die Zahlen 2 und 3 zu addieren, um die nächste Fibonaccizahl zu erhalten.«
»Also 5, oder?«
»Richtig. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, aber eigentlich ist es ganz einfach.« Mischa deutete auf die Wand. »Das alles sind Fibonaccizahlen, und um hier rauszukommen, muss ich die Zahlenfolge nur um eine weitere Zahl fortführen.«
»So einfach ist das?«
»Wenn man es erst mal raushat, ja. Aber ich denke, so einfach wird es nicht bleiben, denn mit Fibonaccizahlen kann man Hunderte von Rätseln stellen. Eines ist komplizierter als das andere. Das hier ist wahrscheinlich nur zum Warmwerden.«
León schwieg einen Augenblick. »Ohne dich wäre ich allein und hier drin gefangen.«
»Nicht ganz. Du meintest doch, dass die Wände verschwinden können. Was hast du da gesehen?«
»Wenig. Die Wände versanken im Boden und vor mir lag eine endlos wirkende, weiße, leere Ebene. Weit und breit keine Gegenstände, keine Orientierungspunkte oder sonst was. Nichts.«
»Aber du hast Mary gesehen.«
»Ich glaube es zumindest. Sie hat sich nicht bewegt und nicht auf meine Rufe reagiert.«
»Und Jenna und Jeb?«
»Keine Spur von ihnen. Ich verstehe nicht, warum du nicht gesehen hast, wie die Wände verschwanden. Wo warst du?«, wollte León wissen.
Mischa machte eine Handbewegung. »In einem Raum wie diesem. Seit ich hier aufgetaucht bin und das Rätsel mit den Zahlen geknackt habe, wandere ich von Raum zu Raum. Alle Räume waren leer. Ich bin immer weitergezogen, denn ehrlich gesagt, ich habe einen Wahnsinnshunger und Durst habe ich auch.«
León sah ihn eindringlich an. »Frag mich mal. Das ist der nächste Punkt, der mich misstrauisch macht. Bisher haben wir immer Ausrüstung, Kleidung, Nahrung und Wasser gefunden, aber hier – nichts. Nicht mal Waffen gibt es. Das Messer, das ich hatte, ist weg. Wir sind vollkommen wehrlos.«
Mischa nickte. Aber zum Glück gab es bisher auch noch keine tödliche Gefahr. Wir sind uns selbst ausgeliefert, einander. Er verdrängte jeden weiteren Gedanken daran, was war, wenn sie sich gegeneinander wenden mussten, um zu überleben. Auch wenn Mischa keinen Zweifel daran hatte, dass es dazu kommen würde.
Stattdessen versuchte er, hoffnungsvoll zu klingen, als er sagte: »Vielleicht finden wir in den anderen Räumen etwas. Mir kommt die ganze Sache wie eine Versuchsanordnung aus dem Labor vor, bei dem man Ratten durch ein Labyrinth jagt, die den Ausgang oder Futter suchen sollen.«
»Mann, Mann, Mann, compañero, du hast echt eine perverse Fantasie.« Leóns linker Mundwinkel zog sich nach oben, dann hielt er inne. »Aber du könntest recht haben, ein bisschen erinnert mich das hier an ein Straßenviertel zu Hause, angeordnet wie ein Schachbrett. Nur wer sich dort auskennt, wird so schnell nicht gefunden.«
»Na ja, so ähnlich. Und wieder eine Erinnerung mehr. Also?«
»Was also?«
»Gehen wir die Sache an?«
León nickte und Mischa wandte sich einer Wand zu. Sein Blick huschte über die Zahlen. Dann drehte er sich um die eigene Achse und betrachtete die anderen drei Wände.
»Das hier ist einfach«, sagte er schließlich. »Die beiden höchsten Fibonaccizahlen sind 89 und die 144, was in der Summe die neue Zahl 233 ergibt.«
Er trat vor und berührte die Stelle an der Wand, über die gerade eine Zwei wanderte. Die Zahl schien aufzuglühen, blieb abrupt stehen und verharrte auf der Stelle. Das Gleiche vollführte Mischa mit zwei Dreien. Nun blinkte die ganze Zahl und geräuschlos öffnete sich ein Durchgang an dieser Wand.
»Sag ich doch«, meinte Mischa achselzuckend. »Ganz einfach.«
León grinste. »Du bist ein verdammtes Genie.«
Sie betraten einen Raum, der dem vorherigen bis auf ein einziges Detail glich.
Der Unterschied lag vor ihnen, in der Mitte des Raumes. Ein brauner Rucksack.
»Was meinst du? Essen?«, fragte Mischa und hätte sich am liebsten sofort daraufgestürzt.
León hielt ihn mit ausgestrecktem Arm zurück. »Pass auf, das könnte eine Falle sein. Besser, wir sind auf alles gefasst.«
Dann trat er auf den Rucksack zu, hob ihn auf und untersuchte ihn. Als er aufblickte, erschauerte Mischa vor dem entsetzten Ausdruck in seinem Gesicht.
»Weißt du, was das ist?«, fragte León, seine Stimme klang rau.
»Was denn?«
»Das ist der beschissene Rucksack, den ich am ersten Tag auf der Ebene verloren habe. Und jetzt verrat mir verdammt noch mal, wie der hierherkommt.«
Der Gang, der vor Mary lag, war in Düsternis gehüllt. Nur ein schwaches Licht hinter ihr, am Ende des scheinbar endlosen Flures, leitete sie. Sie bewegte sich mechanisch darauf zu.
Wieder hatte die Angst sie gepackt und zu jedem Schritt musste sie sich zwingen. Mit der Hand stützte sie sich an der Wand ab, während sie zögerlich und langsam vorwärtstappte. Schlurfend folgte sie den jetzt wimmernden Hilferufen ihres kleinen Bruders in die Dunkelheit. Eine Finsternis, in der viel zu große, grobe Hände regierten. Ihr Vater würde dort sein. Sie musste David vor ihm bewahren.
So soll es sein, dachte Mary. David ist so zart wie ein kleiner Vogel. Vater wird ihm die Flügel brechen, sodass er niemals fliegen kann. Nein, nein, niemals! – und wenn ich dabei sterbe.
Aber da war die alles umfassende Angst. Klammernd hielt sie Mary in ihren Fängen, sie raubte ihr den Atem und ließ sie zittern.
Das Schluchzen ihres Bruders schien nun den ganzen Gang zu erfüllen, hallte von allen Seiten wider. Es zerriss Mary das Herz. Sie presste fest die Zähne aufeinander, richtete sich auf und erhöhte ihr Schritttempo. Und obwohl ihre Füße am Boden zu kleben schienen, die Furcht vor dem, was sie sehen würde, an ihr zog, Mary machte einen weiteren Schritt.
David, halte durch. Ich komme. Gleich ist alles vorbei.
Ihre Füße klatschten kraftlos auf den Boden. Mary spürte, dass sie immer schneller lief. Bald rannte sie schließlich, doch das Licht am Ende des Ganges schien sich immer weiter zu entfernen. Erschöpft blieb Mary stehen. Ihr Atem keuchte. Was passierte hier?
»Mary!«, rief ihr Bruder kläglich aus der Finsternis.
Mary hob den Kopf an, das Licht war verschwunden. Entschlossen streckte sie ihre Arme aus, ging ein paar Schritte geradeaus und traf auf eine solide Wand. In einem Anflug von Panik dachte sie, sie wäre in einer Sackgasse gelandet, doch als sie über die Wand tastete, bemerkte sie, dass der Gang sich vor ihr teilte. Ein Weg führte nach links, der andere in die entgegengesetzte Richtung. Beide unterschieden sich durch nichts. Beide lagen in tiefer Dunkelheit. Wohin sollte sie jetzt gehen? Sie zwang ihren Atem zur Ruhe und lauschte.
Links wisperte die Stimme ihres Bruders. Rechts ebenso, nur dass sie aus diesem Gang auch noch andere Geräusche vernahm.
Dann hörte sie von rechts den schweren Atem eines Mannes. Ein schwaches Stöhnen drang zu ihr. Vater! Und … war da nicht ein blasser Lichtschimmer?
Mary spürte, wie ein kaltes Lächeln über ihr Gesicht zog. Es war so weit. Sie würde ihm gegenübertreten. Ihre Beine drohten erneut aufzugeben und Marys Hände zitterten unkontrolliert, aber dieses Mal würde sie der Angst keine Macht über sich geben.
Mary biss sich auf die Lippen, ein metallischer Geschmack erfüllte ihren Mund.
Vater, ich bin bereit.
Ohne weiteres Zögern schritt sie in den rechten Gang hinein.
Sie hatte keine Kraft mehr für ihre Wut. Wenn das ein Spiel war, dann wollte Jenna die Regeln erlernen. Daher war sie nicht einfach blindlings losgegangen, als die Wände im Boden versunken waren, sondern hatte die Umgebung abgesucht. Und es gab tatsächlich einen winzigen Unterschied in all der weißen Gleichförmigkeit. Zuerst hatte sie sie kaum wahrgenommen, aber wenn man sie erst einmal entdeckt hatte, waren sie kaum zu übersehen.
Im Boden waren schwache Markierungen angebracht, von denen Jenna glaubte, dass sie Begrenzungslinien für die Mauern waren, die später an dieser Stelle einen Raum bilden würden. Jenna war auf die Knie gegangen und den Linien gefolgt, bis sie auf zwei parallel laufende Linien stieß, die einen gleichmäßigen Abstand von ca. zwei Metern zueinander hielten und weit in die Ferne zu führen schienen.
Ein Gang, war es ihr durch den Kopf geschossen. Gänge führen irgendwohin. Womöglich zu einem Ausgang.
Bevor die Wände wieder hochgefahren waren, hatte sie sich zwischen die Linien gestellt und sich von den Wänden umschließen lassen. Sie war tatsächlich in einem Gang gelandet.
Und diesem folgte sie nun. Immer tiefer führte er sie in diese … Konstruktion. Oder auch heraus, dachte Jenna, auch wenn sie versuchte, ihre Hoffnung zu zügeln.
Die Luft hier drin war angenehm kühl und trocken. Aber Jenna hatte ein anderes Problem: brennenden Durst und Hunger. Da sie aber keinerlei Vorräte gefunden hatte, blieb ihr nichts anderes übrig, als weiterzumarschieren und zu hoffen. Sie musste Jeb finden und die anderen.
Jeb war wahrscheinlich wie sie hier drin gefangen, aber Jeb war stark, er hatte in mehr als einer Situation bewiesen, dass er aus eigener Kraft überleben konnte. Trotzdem war sie unruhig. Auf seinen Schutz konnte sie verzichten, nicht aber auf seine Nähe.
Wenn du nur wüsstest, was ich für dich empfinde.
Jenna schwor sich, wenn sie ihn finden würde, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Er sollte wissen, wie es um ihr Herz stand.
Jenna war so tief in Gedanken versunken, dass sie gar nicht bemerkt hatte, dass es im Gang heller geworden war. Sie konnte keine direkte Lichtquelle entdecken, aber eindeutig hatte das Weiß der Wände an Kraft gewonnen, sie schienen jetzt fast von innen zu leuchten.
Makellos, fast blendend hell lag der Gang vor ihr, ohne Türen oder Fenster.
Makellos?
Etwas störte die weiße Fläche der Wände. Zunächst schien es nur ein Flirren zu sein, aber nachdem Jenna näher getreten war und die Wand rechts von ihr untersuchte, begriff sie, dass diese Wand alles andere als makellos war.
Jemand hatte mit krakeliger Schrift etwas in die Wand gekratzt.
Jenna hielt die Luft an.
Kathy war hier!
León glotzte immer noch auf den Rucksack. »Ich fass es nicht!«
»Bist du sicher, dass es dein Rucksack ist?«, fragte Mischa.
»Ich würde das Scheißding unter Millionen erkennen.« León fuhr sich über seinen glatten Schädel und schaute auf. Irgendwie beruhigte ihn diese Geste, aber trotzdem wurde er nicht schlau daraus, was der Rucksack zu bedeuten hatte.
Mischa schaute ihn unverwandt an. »Ist noch was drin?«
»Nein, nichts mehr. Nur die Socken, die ich nie angezogen habe.«
León zeigte Mischa nicht, wie sehr ihn dieser Fund beunruhigte. Wenn es möglich war, dass der Rucksack in dieser Welt wieder ans Tageslicht kam – konnte das auch jedem anderen Gegenstand gelingen? Wurden sie doch verfolgt, ohne dass sie es bis jetzt bemerkt hatten? Wie zum Teufel kam der Rucksack hierher?
León wusste: Ab sofort mussten sie mit allem rechnen. Selbst auf Feinde musste man sich vorbereiten. Und sie hatten nichts. Nicht mal Waffen.
»Was machen wir jetzt?«, unterbrach Mischa seine Gedanken.
»Weitergehen, was sonst.«
Mischa trat einen Schritt heran. Beinahe sanft legte sich seine Hand auf Leóns Schulter. Ein unangenehmer Schauer durchlief Leóns Körper. Er mochte es nicht, berührt zu werden, nicht auf diese Art und schon gar nicht von einem Mann. Trotzdem ließ er Mischa gewähren, er meinte es vermutlich gut. Wollte ihn trösten, warum auch immer. Aber schließlich hielt León es nicht mehr aus und drehte sich weg, tat so, als blicke er sich im Raum um.
»Wie viele von diesen beschissenen Räumen gibt es eigentlich?«
Mischa zuckte mit den Schultern. »Spielt es eine Rolle?«
»Ja, tut es.«
»Bisher hat das Labyrinth oder wo auch immer wir gelandet sind, uns eine faire Chance gegeben, der Welt zu entkommen, in der wir gelandet sind.«
»Kampf ums Überleben nennst du fair?«
»Okay, sagen wir, eine realistische Chance. Warum sollte es jetzt anders sein?« Mischa blickte ihn entspannt an und León verstand nicht, woher seine Gelassenheit kam. »Wir werden uns durch diese Welt kämpfen, bis wir auf die Tore stoßen, um dann eine weitere Welt zu entdecken.«
León schüttelte den Kopf. »Das klingt zu einfach. Und wenn ich eins weiß, dann, dass etwas nie einfach ist. Was ist zum Beispiel mit den anderen?«
»Sie werden hier irgendwo sein, früher oder später finden wir sie.«
»Du klingst nicht so, als wäre es dir besonders eilig damit. Und überhaupt: Woher willst du das wissen?«
»Was ist denn mit dir los?«, wollte Mischa wissen. Sein Gesicht hatte einen unwilligen Ausdruck angenommen. »Du warst doch immer der Einzelkämpfer, hast gedroht, die Gruppe zu verlassen, um dich allein durchzuschlagen. Warum hast du es bisher nicht getan? Warum bist du geblieben, obwohl wir dich doch anscheinend bloß aufhalten?«
Mary, dachte León. Ich bin wegen Mary geblieben und wegen der Einsamkeit, die ich nicht mehr ertragen kann, seit ich Gemeinschaft gefunden habe.
»Ist doch egal, warum, ich bin geblieben und fertig.«
»Mary! Sie ist der Grund, stimmt’s?« Mischa sah ihn herausfordernd an.
»Was soll das jetzt wieder?«, knurrte León.
»Du kannst es ruhig zugeben«, meinte Mischa. Die Intensität in Mischas Augen bei dieser harmlosen Frage ließ León stutzen. Etwas gefiel León nicht im Blick seines Gegenübers.
»Wirst du dich auf ihre Seite stellen?«
»Ich stehe auf keiner Seite von irgendwem. Was soll die blöde Fragerei?«
»Wir werden immer weniger, der Kampf um die Tore wird härter. Und du willst mir erklären, dass du nicht auf irgendjemandes Seite stehst?«
»Was willst du damit sagen?«
»Angenommen wir finden die anderen und wir alle erreichen die Tore, was, glaubst du, passiert dann?«
»Wir werden um die Tore losen müssen.« León ahnte, worauf Mischa hinauswollte. Doch wenn er es laut zugab, wäre er dann nicht angreifbar, würde ihn das nicht schwach machen?
Mischa lachte auf. Seine Augen blitzten. »Selbst wenn wir losen, meinst du, dass Jeb Jenna zurücklässt oder andersherum?« Mischa schüttelte energisch den Kopf. »Am Anfang waren wir sieben und die Chance gering, vom Los getroffen zu werden. Das Schicksal der anderen war uns egal. Jetzt ist das anders.«
León wollte etwas einwenden, doch Mischa hob die Hand. »Du weißt, wie es laufen wird, und ich weiß es auch. Ob was zwischen dir und Mary ist, weiß ich nicht genau. Du hast in der letzten Welt dein Leben riskiert, um sie zu retten. Und was sagt mir das?« Er beugte sich ein wenig vor, bis seine Nasenspitze dicht vor Leóns Gesicht war. »Werde ich eine faire Chance bekommen oder stehe ich jeweils zwei von euch entgegen?« Mischa richtete sich wieder auf. »Versteh mich, León, ich will einfach wissen, woran ich bin.«
León sah ihn ernst an. »Ich verstehe dich, aber da ist nichts zwischen mir und Mary.«
»Und das soll ich glauben?«
Nun beugte sich León vor. »Glaub es oder lass, das ist mir egal.«
León hatte keine Lust mehr auf Mischas Fragen, seinen bohrenden Blick. In einem anderen Leben hätte er ihn vermutlich einfach stehen gelassen. Oder er hätte ihm eine reingehauen. Seinen Körper sprechen lassen, ja, das konnte er. Worte hingegen waren noch nie seine bevorzugten Mittel zur Verteidigung gewesen. Er spürte, dass etwas anderes hinter Mischas Fragerei steckte, aber er konnte sich keinen Reim auf den anderen machen.
Er wusste nur, dass er sich in dessen Gegenwart zunehmend unwohl fühlte. Und dass Mischa nützlich war, um hier herauszukommen. Das war es, was zählte.
Mischa hingegen schien es nicht gerade darauf anzulegen, die anderen zu finden. León bezweifelte, dass Mary, Jeb oder Jenna ähnliche Fähigkeiten besaßen. Das hieß, dass sie alle von Mischa abhängig waren, ob sie wollten oder nicht.
Das kann noch ganz schön heiß werden.
León beäugte seinen Wegbegleiter von der Seite. Gerade versuchte Mischa, ein weiteres mathematisches Rätsel an der Wand zu lösen. Da fiel ihm plötzlich auf, dass Mischa nicht mehr über seine verletzten Rippen sprach.
War die Verletzung schon abgeheilt? Oder biss Mischa einfach nur die Zähne zusammen?
León starrte ihn an, wie der andere ruhig und kontrolliert die Hand über die Zahlen fliegen ließ, so als hätte ihre Auseinandersetzung eben gar nicht stattgefunden.
»Sag mal, Mischa«, fragte er betont ruhig. »Was machen eigentlich deine Rippen? Noch Schmerzen?«
Erst reagierte Mischa nicht. Dann drehte er sich um, ein verblüffter Ausdruck huschte über sein Gesicht. »Nein«, sagte er schließlich und ließ probehalber den Arm kreisen. »Alles okay. Merkwürdig, bis gerade eben habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Scheint schon alles verheilt zu sein. War wohl nicht so schlimm.«
Oh doch, das war es. Ein oder zwei deiner Rippen waren mindestens stark geprellt und jetzt willst du davon nichts mehr spüren?
»Dann ist ja gut«, meinte León.
Eine Tür erschien in der Wand, vor der Mischa stand. Ohne zu zögern, schritt er hindurch. León folgte ihm.
Jennas Hand fuhr über die tief eingekratzten Buchstaben. Immer und immer wieder. Wie konnte das sein? War es Kathy tatsächlich gelungen, in die nächste Welt zu kommen? Gab es etwa noch andere Wege oder weitere Portale?
Kathy war hier.
War das eine Botschaft an die Gruppe? Wollte sie ihnen Angst machen, ihnen drohen?
Das war nicht auszuschließen. Niemand wusste so genau, wie es Kathy ergangen war, nachdem sie aus der Gruppe ausgeschlossen worden war. Niemand wusste, ob Kathy noch lebte. Aber konnte das überhaupt sein? Kathy war zurück? Ohne Portal gab es keinen Weg hierher, das zumindest hatte ihnen Jebs geheimnisvolle Nachricht aus seinem Rucksack weismachen wollen. Was, wenn alles auf Anfang war? War Tian dann auch unter ihnen?
Aber warum sollte Jebs Botschaft eine Lüge gewesen sein?
Falls Kathy zurück war, so viel war Jenna schlagartig klar, hatten sie ein Problem. Was hatte sie vor?
Kathy war zu allem fähig.
Kathy war hier.
Sie war hier. Es klang so, als stünde die Botschaft schon länger dort, als könnte Kathy bereits vor ihnen in diesem Labyrinth gefangen gewesen sein. Aber … das konnte doch nicht sein?
Vielleicht hat jemand diese Botschaft in die Wand gekratzt, um mir Angst einzujagen.
Dieser Gedanke beruhigte sie ein wenig. Es sind nur Buchstaben, sagte sich Jenna immer wieder. Nur Buchstaben. Sie seufzte, warf einen letzten Blick auf die unheilvolle Botschaft und ging weiter. Scheinbar endlos wand sich der Gang vor ihr her. Ihre Gedanken schweiften zurück in die Vergangenheit. Der gleichmäßige Rhythmus ihrer Schritte und die Eintönigkeit der weißen Wände machten es ihr leicht, sich davon treiben zu lassen.
»Sie wollen es wirklich tun?«, fragte eine Stimme, die einem Mann gehörte, dessen Gesicht verschwommen blieb.
»Ja«, antwortete sie heiser.
»Man hat Sie über das Risiko aufgeklärt?«
»Ich habe ein Dokument unterschrieben, indem ich versichere, dass ich umfassend über mögliche Risiken aufgeklärt wurde und dass dieser Versuch auf meinen eigenen Wunsch hin ausgeführt wird.«
»Versuch? Der Begriff trifft es nicht einmal ansatzweise. Was Sie vorhaben, hat niemals zuvor ein Mensch gewagt, und ich bezweifele sehr, dass es ohne Folgen bleiben wird.«
Sie schwieg.
»Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie irreparable gesundheitliche Schäden davontragen werden. Das alles ist Neuland, müssen Sie wissen.«
»Ich weiß.«
»Gut, dann sind Sie also bereit«, sagte der Schemen. »Ich gebe Ihnen jetzt eine Beruhigungsspritze. Sie werden nur noch vage mitbekommen, wie wir Sie vorbereiten. Später werden wir Ihnen eine Infusion legen, die Sie mit allem versorgt. Und dann geht es los.«
»Werde ich bei Bewusstsein sein, wenn Sie die Apparate einschalten?«
»Nein. Sie werden tief und fest schlafen.«
»Also keine Schmerzen.«
»Voraussichtlich nicht, aber wie gesagt …« Er zuckte mit den Achseln. »Auch wir betreten Neuland.«
»Und wenn alles gut läuft …«
»… holen wir Sie zurück«, vollendete er den Satz. »Sind Sie bereit?«
»Ja.«
Dieses eine Wort war das Letzte, woran sich Jenna erinnerte. Obwohl die Szene deutlich vor ihr stand, konnte sich Jenna nicht erklären, was das Gespräch zu bedeuten hatte. Was habe ich getan?
Es war von einem Versuch die Rede gewesen, von Apparaten, von Risiken und davon, dass sie etwas wagte, was kein Mensch vor ihr getan hatte.
Aber was?
War sie krank? Oder war sie hypnotisiert worden? Hatte sie an einem Experiment teilgenommen? Freiwillig? Aber wozu? Was sollte erforscht werden? War sie ausgewählt worden und wenn ja, von wem?
Nein, das klang selbst in ihren Ohren zu absurd. Nein, das konnte nicht sein. Niemals hätte sie sich dieser Gefahr ausgesetzt, wenn sie darüber Bescheid gewusst hätte. Wozu das alles? Es wäre blanker Selbstmord, von den unabsehbaren Folgen ganz zu schweigen.
In der Botschaft, die Jeb gefunden hatte, war davon nicht die Rede gewesen. Und überhaupt, was hatte das mit Mischa, Jeb, Tian, León, Kathy und Mary zu tun? Wo lag die Erklärung für dieses sogenannte Labyrinth, wie es in Jebs Botschaft geheißen hatte?
Nein, nein, nein. Hinter der Sache steckte etwas anderes. Irgendjemand, etwas, hatte sie und die anderen in diese Lage gebracht und sah ihnen nun zu, wie sie um ihr Leben kämpften.
Jenna war so in Gedanken versunken, dass sie beinahe über ihre eigenen Füße stolperte, als sie einen dunklen Gegenstand vor sich auf dem Boden entdeckte. Aus Angst draufzutreten, machte sie einen ungelenken Sprung zur Seite und stützte sich an der Wand ab. Dann erst konnte sie es in Ruhe betrachten.
Es war ein Stück Stoff.
Sie hob es auf und schaute es verdutzt an. Das Muster darauf kam ihr bekannt vor. Der Stoff war an beiden Enden zusammengeknotet. Kurze Zipfel ragten aus dem Knoten hervor.
Jenna starrte auf die losen Fäden, die überall herunterhingen. Dieser Stoff war nicht sauber mit einer Schere herausgetrennt worden, jemand hatte ihn irgendwo rausgerissen.
Und er war blutdurchtränkt. Deswegen erkannte sie auch erst jetzt, dass es das Muster von einem der Hemden war, die sie und die anderen trugen.
Ihr Atem stockte.
Das Stück Stoff, das sie in der Hand hielt, war ein selbst gebasteltes Stirnband. Kathy hatte es für Tian angefertigt, damit er die Schreie der Verfolger nicht mehr so laut hörte.
Wie kam es hierher?
Jenna richtete sich auf, blickte sich in beide Richtungen um, aber es war niemand zu sehen.
Kathy, bist du da?
Jeb taumelte durch die Gänge, die sich vor ihm öffneten, ohne ein Ziel zu verfolgen. Als die Wände verschwunden waren, war es ihm kurzfristig besser gegangen und er hatte wieder Luft bekommen. Trotzdem war er so schwach gewesen, dass er eine Weile auf allen vieren vorwärtsgekrochen war. Schnell hatte er erkannt, dass er so nicht vorankommen würde. Irgendwann hatten sich die Wände um ihn herum erhoben und einen Gang gebildet, dem er nun orientierungslos folgte.
Sein Kopf war leer. Jegliche Gedanken nur noch ein weit entferntes Echo in der Halle seiner Ängste. Die Beklemmung kam in Wellen und inzwischen war er darauf vorbereitet, aber er konnte ihr so gut wie nichts entgegensetzen. Seine Widerstandskraft war gebrochen. Jeb hatte sich kraftlos der Angst ergeben.