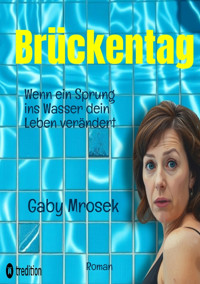8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nichts ist so, wie es scheint! Das erfährt die eigensinnige Archäologie-Studentin und Lost-Place-Liebhaberin Tess in einem ungewöhnlich heftigen Unwetter. Sie entkommt nur mit Mühe und findet Unterschlupf bei der geheimnisvollen Indianerin Aponi, die ihre Sicht auf die Welt in wenigen Stunden ins Wanken bringt. Ein handgeschriebenes Buch eines kanadischen Ureinwohnerstammes und die Aufgabe: „Lerne, wer du wirklich bist, enträtsele diese Welt und lebe wahre Liebe!“ fungieren wie Schlüssel in ein neues Leben. Fortan ist Tess Weg gespickt mit übersinnlichen Erfahrungen. Kurz darauf erkennt sie in dem irischen Quantenphysiker Jon ihren Seelengefährten und reist mit ihm nach Dublin und weiter in die USA, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Es beginnt eine turbulente Reise voller mystischer, dramatischer und heilender Begegnungen… Die eigene Identität zu entdecken und in eine authentische Selbstliebe zu kommen, die absolut erforderlich ist, um auch andere lieben zu können sowie ein bereicherndes Leben zu führen, ist das Hauptthema des Buches. Die Angst vor Bindung – vor echter intimer Beziehung – wird in der Begegnung von Tess und Jon dargestellt. Obwohl sie sich geistig sofort als Seelengefährten erkennen und überwältigende Liebe empfinden, kommen gerade dadurch alle tiefen Ängste ans Tageslicht. Immer wieder wird das Labyrinth erwähnt, das eine Metapher für die materielle, duale Welt darstellt. In dieser Welt ist jeder sich selbst der Nächste. Es ist eine Welt des Kampfes, der Vereinsamung und des Narzissmus. Der Sternenstaub, der im Roman erwähnt wird, ist ein Synonym für die Geistigkeit und reine Liebe, die nichts fordert, sondern stattdessen objektlos aus sich selbst fließt. Es handelt sich um die Liebe, auch Agape genannt, die Beziehungen heilen kann und die Essenz eines glücklichen, freien Lebens ist. Die Träume, die in der Geschichte erwähnt werden, sind hingegen die großen Ablenkungen, die dafür sorgen, dass wir uns auf unseren eigenen Egoismus verlassen und an Ideen festhalten, die für uns und andere schädlich sind. Der Roadtrip, den Tess und Jon unternehmen, ist eine äußere Begebenheit, die metaphorisch eine Innenreise darstellen soll. Mystische (manchmal surreale) Begegnungen dienen dem Erkennen des eigenen Selbst und was wirklich wertvoll ist im Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gaby Mrosek
Das Labyrinth
aus Sternenstaub und Träumen
© 2023 Gaby Mrosek
Umschlag, Coverbild: Michael Mrosek
Druck und Distribution im Auftrag Gaby Mrosek
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-384-03321-5
Hardcover
978-3-384-03322-2
e-Book
978-3-384-03323-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist Gaby Mrosek verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Dieses Buch ist Michael Mrosek gewidmet:
meinem besten Freund
Seelengefährten
Ehemann
Reisebegleiter durch das Labyrinth aus Sternenstaub und Träumen
Ich sehe dich…
Die Botschaft
Aus Sternenstaub und Träumen besteht dein Labyrinth.
Du selbst hast es erschaffen, mit Augen trüb und blind.
Du selbst musst es entzaubern, in all dem Fieberwahn.
Erkenne nun dein Grauen und fange damit an.
Suche nicht in Träumen, verlier dich darin nicht.
Erhebe dich stattdessen über das Gefecht.
Es gibt den Plan der Rückkehr, sei dir gewiss, sei wach.
Und glaube nicht der Schlange, die flüstert du seist schwach.
Ein Plan, der dem gegeben, der aus der Schuld entrinnt.
Ein Plan für den Geliebten, für Retter, Heiler, Kind.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Die Botschaft
1. Die Zusammenkunft
2. Teresia Solveig – Tess
3. Von Geheimnissen und Missionen
4. Anna Blumenfeld – Aponi
5. Amarok
6. Das Labyrinth aus Sternenstaub und Träumen
7. Nacht der Veränderung
8. Rocky
9. Es ist nichts so, wie es scheint
10. Was ist schon normal?
11. Die Alchemie des Sternenstaubs
12. Vergiss die Kontrolle!
13. Kettenreaktion
14. Jonathan O`Healy – Jon
15. Entscheidung für JETZT
16. Planänderung
17. Vertrauen
18. Dem Ruf folgen
19. Kindheitstrauma
20. Verändere sie – die Vergangenheit!
21. Dublin
22. Das Mächtige Mittel
23. Mut zur Liebe
24. Bedienungsanleitung für Beziehungen
25. Das Ereignis
26. Frederic William Wickham – Fred
27. Die Macht der wahren Liebe
28. Die dunklen Träume
29. Helen O´Healy
30. Jons Dunkelheit
31. Urteile, die karmisch sind
32. Begegnung am Pier
33. Eine ganz andere Welt
34. Das Ding mit der Zeit
35. Alles ist mit allem verbunden
36. Liebe schmerzt nicht
37. Weltenspiele
38. Erwachsen werden
39. Helen heilt
40. Kampf der Giganten
41. Leona Powell
42. Die wichtigste Beziehung
43. Selbstliebe ist der Schlüssel
44. Es ist vollbracht
45. Sternennacht und Zweifel
46. Was der Körper niemals lernt…
47. Wer ist nun in Beziehung?
48. Die Liebe hört niemals auf…
49. In der Ewigkeit verbunden, doch in Raum und Zeit getrennt…
50. … habe ich dich niemals überwunden, bleibst du für mich präsent…“
51. My Dear
Weitere Bücher von Gaby Mrosek
Das Labyrinth aus Sternenstaub und Träumen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Die Zusammenkunft
51. My Dear
Das Labyrinth aus Sternenstaub und Träumen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
1. Die Zusammenkunft
Dunkle Gewitterwolken jagten vom Wind getrieben über den Himmel.
Die Landschaft darunter reflektierte die letzten gespeicherten Sonnenstrahlen. Noch vor einigen Minuten repräsentierten sie einen wunderschönen Septembertag. Es war nicht vorherzusehen, dass das Wetter so rasant umschlagen würde und überhaupt zu können vermochte. Ganz plötzlich zogen sie auf, die grauen Wattebälle. Wie kleine unansehnliche Staubflocken auf einem reinen, hellblauen Untergrund. In Sekundenschnelle suchten sie ihresgleichen und verbanden sich zu grollenden Himmelsgebilden, die sogleich durch lautes Donnern akustisch unterstützt wurden.
Die Allee mit den unzähligen Sommerlinden, die vollreifen Maisfelder im Hintergrund, sowie die Landstraße in der Mitte wirkten in einem letzten aufflammenden Schimmer des Sonnenlichts völlig surreal. Ein Zwinkern nur und die ganze Szene hatte ihre Lieblichkeit verloren.
Während nun ein brausender Sturm aufzog, der mit Bäumen und Feldern spielte und die ersten Regentropfen schwer zu Boden gingen, konnte man einen vibrierenden Punkt in der Ferne ausmachen. Dieser Punkt kam schnell näher. Es handelte sich um eine sprintende Frau.
Diese junge Frau hieß Teresia und war völlig unvorbereitet in das Unwetter geraten. Mitten auf der Landstraße zwischen zwei weit entfernten Dörfern sah sie keine Chance, einen Unterschlupf zu finden. Normalerweise liebte Teresia das Wetter mit all seinen Spielarten. Sie war von je her ein naturverbundenes Kind gewesen, das sich im Regen genauso sehr freuen konnte wie bei Sonnenschein. Doch dieses Wetter hatte es in sich und instinktiv war ihr klar, dass sie hier mehr als nur nass werden konnte. Jetzt zuckten grelle Blitze über den Himmel. Der Sturm hatte sich in einen heftigen Orkan verwandelt und er spielte nicht mehr mit ihren langen schwarzen Haaren, sondern riss brutal daran, so dass es wehtat. Eine Böe blies hart in ihr Gesicht. Ihr blieb sämtliche Luft weg. Als ein Lindenast direkt vor ihren Füßen aufschlug, schrie sie hell auf. Eine unbändige Angst ergriff sie. Zum einen war diese sich schnell ändernde Situation so unfassbar, dass sie nicht an ihre Realität glauben konnte, zum anderen arbeitete ihr logischer Verstand im Turbogang und wischte ihre Ungläubigkeit an der ganzen Szenerie beiseite. Mit geschärften Augen checkte sie blitzschnell ihre unmittelbare Umgebung ab. Die einzige Möglichkeit, irgendwo in den nächsten Minuten eine sichere Unterkunft zu finden, lag in dem schmalen Weg links neben ihr. Dieser Trampelpfad führte mitten durch eins der hohen Maisfelder hindurch. Er war ihre einzige Chance. Irgendwo dahinter musste ein Unterstand sein, ein Stall oder vielleicht sogar das Haus des Landwirtes. Noch einmal schaute sie hinweg über die Landstraße, auf der bereits zahlreiche Äste zu Boden gegangen waren. Ein wenig fühlte sie sich wie das kleine Mädchen, das sie einst war. Dieses Kind hatte es geliebt, Lose auf dem Rummel zu öffnen. Meistens waren es nur Nieten oder Trostpreise, die es gewann. Der Weg durch den Mais war wie eines der Lose. Würde er eine Niete sein? Und was wäre dann? Teresia fühlte einen Sog. Vielleicht war es der Orkan, vielleicht ein inneres Ziehen. Sie konnte es nicht deutlich erkennen. Doch dieser Sog war es, der sie alle Zweifel beiseite wischen ließ. Ohne einen weiteren Gedanken begann sie erneut zu rennen. Sie sprintete mitten in das Feld hinein. Der Weg war so schmal, dass die Blätter der Pflanzen über ihre Arme, Beine und so manches Mal über ihr Gesicht fegten. Minutenlang hastete sie völlig durchnässt einfach geradeaus. Vor dem Sturm war sie hier etwas geschützter. Blitze zuckten in immer kürzeren Abständen über den beinahe schwarzen Himmel. Ganz plötzlich trat sie aus dem Feld hinaus und sah vor sich ein kleines schiefes Fachwerkhaus. Erleichtert und ohne eine Sekunde über den Inhaber nachzudenken, stürmte sie auf die uralte Holztür zu. Sie fand keine Klingel, dafür einen altmodischen Türklopfer. Verwundert betrachtete sie die runde Messingscheibe, die ein wunderschönes reliefartiges Labyrinth zeigte. Auf dem breiten Klopfring, der majestätisch darüber hing, war eingraviert: „Aus Sternenstaub und Träumen besteht dein Labyrinth.“
Ein Schauer lief über Teresias Rücken. Sie hatte das starke Bedürfnis, die Augen kurz zu schließen und tief durchzuatmen. Ihr fiel die Hypnosesitzung ein, die sie vor einem Jahr bei einem Psychologen gemacht hatte. Sie hörte die angenehm dunkle Stimme des Therapeuten so deutlich, als würde er genau jetzt neben ihr stehen: „Ich zähle nun von zehn an rückwärts. Wenn ich bei null angekommen bin, öffnen Sie Ihre Augen und sind wieder ganz hier. 10…9…8… das Atmen nicht vergessen…7…6… durch die Nase ein… 5…4… durch den Mund wieder aus…3…2…1 und 0.“
Sie öffnete die Augen in der kurzen Hoffnung, sie würde zu Hause in ihrem Bett liegen und hätte das alles nur geträumt. Stattdessen drückte sie eine schwere Orkanböe gegen die Tür. Es war so, als würde sie einen heftigen Schubs bekommen und der Wind würde ihr zuflüstern: „Geh endlich hinein…“
Beherzt ergriff sie den Messingring und klopfte mehrmals hastig. Die labyrinthförmige Metallscheibe klang dabei mystisch und heller, als sie erwartet hatte.
Es dauerte ein Weilchen, bis Teresia schlurfende Geräusche hinter der Tür wahrnahm. Ungeduldig trat sie mit ihren nassen Chucks von einem Fuß auf den anderen.
Ein Schlüssel wurde von innen im Schloss gedreht und gleich darauf öffnete sich die Tür einen Spalt breit.
Eine wohlige Wärme schlug ihr entgegen und ein orangefarbenes Licht ließ eine gemütliche Stube vermuten. Die Person war in der Lücke nur schemenhaft zu erkennen. Es schien sich um eine alte winzige Frau zu handeln, die mit einem dunkelbraunen Auge hinauslugte.
Teresia wollte etwas sagen. Doch noch bevor ein einziges Wort aus ihrem geöffneten Mund kam, wurde die Tür groß aufgesperrt und eine runzelige Hand zog sie am Ärmel hinein.
„Kommen Sie, Kindchen“, hörte sie die erstaunlich feste und klare Stimme sagen, die nicht zum Erscheinungsbild passen wollte. Jetzt konnte Teresia die alte Dame komplett anschauen. Sie blickte fasziniert auf eine Indianerin. Ja, so sah sie aus: Wie eine kleine Indianerin, noch kleiner als Teresia, die mit ihren knappen 1,60 m nicht gerade eine Riesin war. Ihre taillenlangen schneeweißen Haare waren hier und da von Silbersträhnen durchzogen, deren Schattierungen von hell- bis dunkelgrau gingen. Sie waren zu zwei akkuraten Zöpfen geflochten. Ihr dunkelrotes Kleid war mit wunderschönen Folkloremustern bestickt. Eigentlich hätte Teresia den Eindruck einer verkleideten alten Greisin bekommen müssen, aber nichts dergleichen war der Fall.
Statt sich zu wundern, kam ihr die Begegnung ganz normal und richtig vor.
„Kommen Sie“, wiederholte die Frau und sprach weiter: „Sie sind ja völlig durchnässt! Mit diesem Unwetter hat wohl niemand gerechnet. Ich habe trockene Kleidung für Sie und ein Handtuch. Dort drüben ist das Bad. Wenn Sie fertig sind, treffen wir uns im Salon.“
„Wir treffen uns im Salon“, wiederholte Teresia in ihren Gedanken und musste über die Wortwahl innerlich lachen. Gleichzeitig war sie fasziniert von der Stärke dieser uralten Lady mit der glasklaren Stimme.
„Ich danke Ihnen sehr“, sprach Teresia, während die Frau in einer reich verzierten Bauernkommode neben der Haustür wühlte.
„Ich bin tatsächlich völlig vom Wetter überrascht worden und kenne mich in der Umgebung auch nicht wirklich aus. Da ist ja weit und breit kein Haus zu sehen.“
„So ist es, Kindchen. Sie finden mich im Salon“, erwiderte die Frau und drückte Teresia resolut ein Bündel Stoff in die Arme. Sie zeigte noch mit runzligem Finger auf das Ende des Flures, wo sich anscheinend das Badezimmer befand und schlurfte dann davon.
Teresia zog zunächst ihre völlig durchweichten Stoffturnschuhe aus und stellte sie an die Tür. Im Bad entledigte sie sich ihrer Kleidung und rubbelte sich gründlich trocken. Sie überlegte, ob es in dem altmodischen, dunkelgrün gefliesten Raum so etwas wie einen Fön oder einen Wäschetrockner gab. Aber sie fand nichts dergleichen. So hängte sie alles auf einen kleinen Wäscheständer über der Badewanne. Mit umwickeltem Handtuch begutachtete sie die ihr zur Verfügung gestellte Kleidung. Da gab es eine weite lilafarbene Jogginghose, ein passendes Sweatshirt und dicke selbstgestrickte Socken in allen Farben dieser Welt. Als Unterwäsche dienten ein schwarzes Sport-T-Shirt sowie eine weiße gerippte Herrenunterhose. Teresia schluckte und wusste für einen Moment nicht, ob sie lachen oder weinen sollte.
Noch vor einigen Minuten hatte sie die Wanderung zu einem Lost Place unternommen. Ihr Zeitplan war straff gewesen, aber sie war guter Dinge. Und jetzt stand sie plötzlich nur mit einem fremden Handtuch umwickelt in einem renovierungsbedürftigen Bad und starrte auf viel zu große Klamotten, die sie anziehen sollte.
Sie schloss kurz die Augen und zählte: „ 10…9…8…“
„Quatsch“, sagte sie laut und hörte sogleich wieder auf. Stattdessen begann sie, die weite Unterhose, das ausgeleierte T-Shirt und den Rest über ihren zierlichen Körper zu streifen. Sie schaute an sich hinab und murmelte: „Wie eine Vogelscheuche! Wahrscheinlich sind das die Wechselklamotten für die, die sicher irgendwo im Maisfeld steht…“ Sie grinste unwillkürlich, auch wenn sie in diesem Moment nicht wusste, wie ihr geschah. Zwischen all den mulmigen Gefühlen fand sie Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass sie einen warmen und trockenen Unterschlupf gefunden hatte und die Dame des Hauses gastfreundschaftlich zu sein schien. So knotete Teresia die Kordeln der Jogginghose fest zusammen und krempelte die Hosenbeine zweimal um. Im Oversized-Look verließ sie das Bad, ging den kurzen Flur hinunter und bog in den Salon ein.
Für den Bruchteil einer Sekunde verschlug es ihr den Atem. Sie blieb im Türbogen stehen und schaute sich fasziniert um.
Der Salon, der, wie Teresia vermutete, einfach nur ein Wohnzimmer sein würde, entpuppte sich seines Namens als würdig. Das geräumige Zimmer hatte dunkelgrüne Stofftapeten und an einer langen Wand gab es ein Bücherregal, das an ihre Lieblingsabteilung der Universität erinnerte. Meterlang und raumhoch umfasste es hunderte, eher noch tausende von Büchern. Die dunklen Holzdielen des Bodens waren teilweise mit gemusterten orientalischen Teppichen abgedeckt. Ein prächtiger Kronleuchter hing von der Decke, war aber nicht eingeschaltet. Stattdessen brannten mehrere Salzkristalllampen auf kleinen Tischchen und Hockern. Es gab Lichterketten mit winzigen Lampenschirmchen, die warmes Licht verbreiteten. In der Mitte des Salons stand eine Ledercouch im englischen Stil und gegenüber befand sich ein dunkelgrüner Ohrensessel aus Samt. Genau dort saß die alte Dame und hatte ihre Beine auf einen passenden Samthocker gelegt. Ihre wackelnden Füße waren in ebensolch bunte Stricksocken gehüllt, wie Teresia sie jetzt trug.
Die Dame lächelte sie offen an. In ihren Händen hielt sie festumschlungen eine große Tasse.
„Kommen Sie, Kindchen. Setzen Sie sich zu mir und bedienen Sie sich am Tee. Dann können wir reden.“
Teresia bedankte sich und huschte zur Couch, die mit einer bunten Decke belegt war. Sie setzte sich und schenkte sich den heißen Tee aus der Porzellankanne, die auf einem Stövchen stand, in die bereitgestellte Tasse vor sich.
Für einen Moment war es ganz still. Die Dame schaute sie forschend an und wirkte dabei entspannt. Teresia hingegen fühlte sich mit der Situation etwas unwohl. Sie brach das Schweigen und stellte sich vor: „Mein Name ist Teresia. Teresia Solveig. Tut mir leid, dass ich mich nicht sofort vorgestellt habe. Ich bin noch ganz durcheinander von dem so plötzlich einsetzenden Unwetter…“
„Ist schon gut, mein Herz“, schmunzelte die Frau. Um ihren Mund bildeten sich zahlreiche Fältchen, die an das Wattenmeer der Nordsee erinnerten.
„Meine großen Zehen haben mir angekündigt, dass ein Gast kommt.“
Sie sagte das mit einer so großen Ernsthaftigkeit in ihrer Stimme, dass Teresia auflachen musste. Das Bild dieser zierlichen Indianerin mit den hochgelegten zappelnden Füßen, die so drollige Socken trugen, war herzallerliebst.
„Sie lachen darüber, aber glauben Sie mir, jeder Besuch kündigt sich bei mir an und zwar mit zuckenden Zehen“, sie machte eine kurze Pause und musterte Teresia, „Sie kommen nicht von hier, richtig?“
Teresia nickte und erklärte: „Ich bin für einige Tage in einer Pension untergekommen. Ich will den bekannten Lost Place in der Umgebung erkunden.“
„Lost Place?“, fragte die Frau und zog ihre struppigen Brauen hoch.
„Oh je, jetzt muss ich wieder erklären“, dachte Teresia.
Sie war es gewohnt, Menschen ihr ungewöhnliches Hobby begreiflich zu machen. Besonders ältere Semester konnten damit nicht viel anfangen. Deshalb versuchte sie, ein Gespräch darüber zu vermeiden. Bei der Indianer-Lady würde das wohl nicht funktionieren. Diese war ganz bei der Sache und schien neugierig.
Also begann Teresia zu erzählen. Zunächst etwas zögerlich und knapp. Dann aber kam sie in Fahrt, weil sie bemerkte, wie sehr ihr Gegenüber interessiert war. Sie fühlte wieder den Sog, der sie schon vor einer halben Stunde durch das Maisfeld gezogen hatte. Nun ließ er die Worte aus ihr heraussprudeln.
„Ich war vierzehn, als ich meinen ersten Lost Place entdeckte. Es war eine alte Spielzeugfabrik in meiner Heimatstadt. Gerüchten zufolge sollte es dort spuken. Ich war derart fasziniert von dem Gedanken, dass es einen Ort gibt, an dem irgendwann vor langer Zeit das Leben tobte. Es gab 2000 Mitarbeiter vor Ausbruch des 2. Weltkrieges und sämtliche Spielzeugläden in vielen Städten in Deutschland und ganz Europa wurden von dieser Fabrik beliefert. Ich stellte mir die unendlich vielen Kinder von klein bis groß vor, die mit Teddys, Puppen, Eisenbahnen und Spielen aus der Fabrik eine glückliche Zeit verbrachten. Ich wollte wissen, was die einzelnen Arbeiter ausmachte, wie sie sich fühlten, wenn sie Bauklötze verpackten und kleine Autos montierten. Was mich wirklich bewog, in einer Nacht ganz allein diesen Ort aufzusuchen, war das Spukgerücht. Ich dachte damals, es könnte nur spuken, wenn etwas Unerlöstes oder Unglückliches geschehen war…“
Teresia hielt kurz inne. So ergriff die Indianerin das Wort: „Sie waren nicht an der alten Fabrik interessiert, Kindchen. Es ging Ihnen um Menschen. Sie haben sich um andere gesorgt, sich für sie interessiert. Sie wollten heilen…“
Ein Schauer lief über Teresias Rücken, als sie die Worte hörte. Diese Frau war die erste in ihrem Leben, die glasklar begriff, worum es ihr ging. Niemand von ihren Freunden und noch weniger ihre eigene Familie verstand, was sie antrieb. Sie selbst hatte lange Zeit nicht begriffen, dass es sich nicht um Nervenkitzel des Verbotenen drehte, sondern um die Verbindung von Menschen. Jeder Lost Place erzeugte in ihr stets ein Gefühl der Nähe, das sie nur an einem solchen Ort hatte. Sie wollte etwas aufklären, klarstellen, wieder ganz machen.
„Vielleicht“, antwortet Teresia schlicht. Um schnell das Thema zu wechseln, schob sie hinterher: „Und Sie?“
Die Frau lachte laut auf und man konnte eine Reihe perlweißer Zähne erkennen. Teresia fragte sich augenblicklich, ob es sich dabei um eine Prothese oder echte Zähne handelte.
„Natürlich wollen Sie wissen, wer ich bin, Teresia. Ich darf Sie doch so nennen, oder?“
„Nennen Sie mich Tess. So nennen mich alle.“
„Tess“, wiederholte die Frau und ließ den Namen scheinbar auf sich wirken.
„Ich vergesse manchmal, mich vorzustellen. Ich weiß, wer ich bin. Ein anderer, der mich zum ersten Mal trifft, weiß es nicht. Das entfällt mir oft.“
Während sie über sich selbst lachte, stutzte Tess über diese Aussage. Ob sie es mit einer dementen Person zu tun hatte? Das würde auch das Indianerkostüm erklären. Denn mit der schrägen Aussage, die an dem Verstand der Alten zweifeln ließ, wirkte auch das Folklorekleid nicht mehr wie ein etwas ausgefallenes Outfit. Es war plötzlich eher ein Karnevalskostüm.
Zeit zum darüber nachdenken blieb ihr nicht, denn die Frau sprach weiter: „Sie können mich Aponi nennen. Bevor Sie fragen: Das ist natürlich nicht mein Geburtsname. Meine Eltern nannten mich Anna und ich bin in das Haus der Blumenfelds hineingeboren.“
Tess wunderte sich weiter über die Art, wie sich die Frau ausdrückte. Es schien fast so, als wäre die Anna Blumenfeld nur eine Rolle in einem Bühnenstück für sie.
„Aponi klingt schön“, sagte sie ehrlich bewundernd und fragte dann: „Wer hat Sie denn Aponi genannt?“
In diesem Augenblick zuckte ein greller Blitz vor den kleinen Fenstern des Salons. Gleich darauf donnerte es gewaltig. Tess erschreckte sich dermaßen, dass sie ihren Tee verschüttete. Aponi blieb erstaunlich gelassen. Vielleicht sah und hörte sie auch schlecht.
„Wenn das mal kein Zeichen ist!“, lachte Aponi und reichte Tess eine Pappbox mit Papiertüchern, die neben dem Sessel auf einem Mosaiktischchen stand. Tess nahm einige der dünnen Tücher und wischte die kleine Pfütze vom Tisch, auf den sie zuvor ihre Ellenbogen gestützt hatte.
„Das Wetter braut sein eigenes Süppchen. Wir werden hier noch eine ganze Weile zusammensitzen. Von meiner Namensgebung erzähle ich später. Jetzt konzentrieren wir uns ganz auf Sie. Teresia. Teresia Solveig. Tess. Was ist Ihre Mission?“, Aponi sprach mit fester klarer Stimme. Etwas in ihrem Gesicht hatte sich verändert. Ihre runzelige, braune Haut schien zu leuchten und brachte eine zeitlose Jugend hervor. Nein, Aponi war nicht dement und es war kein Zufall, dass Tess genau jetzt bei ihr gelandet war. Tess wusste das augenblicklich!
Es war wieder da, dieses Wissen, dieses übersinnliche Fühlen und Denken. Der Grund weshalb sie Dr. Hollenbach aufgesucht hatte. Sie wollte nur normal sein und alles dafür tun, um sich auch so zu benehmen. Sie dachte an die Tools, die sie gelernt hatte und die Hypnose: „10…9…8…7…6…5…“
Nein, sie wollte gar nicht aufwachen. Nicht jetzt! Aponi war hier und sie war ganz real. Sie war eine bemerkenswerte Frau, die ganz sicher viel erlebt hatte. Sie wollte sich jetzt ganz auf die Begegnung einlassen. Für die Zeit des Unwetters. Wenn das Unwetter vorbei war, konnte sie immer noch zählen…
2. Teresia Solveig – Tess
Tess war in einer norddeutschen Großstadt aufgewachsen. Schon in ihrer frühen Kindheit hatten die Eltern bemerkt, dass sie anders war.
Anders als ihre drei Geschwister.
Anders als die Kinder in der Tagesstätte und später in der Schule.
Anders als jeder Mensch, den Vater und Mutter im Laufe ihres Lebens kennengelernt hatten.
Ihnen war durchaus klar, dass sich alle Menschen unterschieden und Charaktereigenschaften sowie Talente mitbrachten. Doch die Andersartigkeit von Tess fiel in eine Kategorie, für die es keine Überschrift gab.
Ihre Mutter Kleo, eine hochintelligente Internistin, hatte einmal Scherzens halber gesagt, Tess sei wie ein wandelbares Rezept. Immer wenn man alle Zutaten erraten hätte und eine Ahnung vom Gericht bekäme, würde sie ihre Bestandteile wieder verändern.
Tess war und blieb Außenseiterin in der Welt. In ihrer Familie war sie eine Randfigur, obwohl ihre Marotten Tagesthema zu sein schienen. Es waren die flüchtigen Spiegelungen, die oberflächlichen Erscheinungen, die alle beschäftigten und gar nicht selten ein Schmunzeln, Lachen oder Kopfschütteln hervorbrachten. Die Wahrheit der Teresia blieb unter all dem versteckt und niemand konnte sie auch nur ansatzweise greifen. So fühlte sie sich unverstanden und völlig fehl am Platz.
Vater und Mutter, beide Ärzte, boten ihren vier Kindern den Luxus des gehobenen Mittelstandes - so bezeichneten sie in Gesellschaft bescheiden ihren Reichtum, der weit über Mittelschicht lag. Auch standen den Sprösslingen alle Freizeitaktivitäten und Hobbies offen, solange sie darin Fortschritte machten und im Allgemeinen anerkannt waren. Jedes einzelne der Solveig Kinder hatte eine exquisite Privatschule besucht und beachtliche Erfolge erzielt. Tess wurde mit ihrem hervorragenden Abi sogar Jahrgangsbeste.
Die Andersartigkeit von Tess lag nicht in schulischen Problemen. Sie konnte sich durchaus wie ein Chamäleon anpassen, auch wenn ihr das einen ungeheuren psychischen Druck abverlangte. Sie war überdurchschnittlich intelligent. Ihre emotionale Intelligenz sogar um ein Vielfaches höher.
„Du könntest Chirurgin werden. Gehirnchirurgin. Du hast doch das Zeug dazu. Verschwende nicht deine Talente“, jammerte Kleo oft ihre Tochter an. Das Gehirnchirurgen Thema war gegen Ende der Abschlussprüfung Tagesthema. Tess antwortete darauf nicht mehr. Sie konnte Menschen durchschauen, als lägen sie wie offene Bücher vor ihr auf dem Tisch. Sie sollte insgeheim den Traum der Mutter ausleben. Das zu erkennen, war nicht schwer. Es gehörte zu den üblichen Phänomenen von Eltern schlechthin.
Tess studierte stattdessen Geschichte und Archäologie. Wenn es um ihren eigenen Weg ging, machte sie schon als Kind keine Kompromisse. Das war eine der Eigenarten. Es wurde ihr zumindest als Eigenart ausgelegt: Von ihrer ersten Erzieherin, Grundschullehrerin, Musiklehrerin, Mutter, den Freunden.
Mit ihren achtundzwanzig Jahren wusste sie, dass genau das sie am Leben gehalten hatte. Die Hartnäckigkeit, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen und kompromisslos das eigene Ziel zu verfolgen, war eine Stärke. Eine Stärke die nicht viele besaßen. Und die, die sie besaßen, hatten sie im Laufe von Jahren und Jahrzehnten mühsam erkämpft.
Tess wurde diese Stärke mit in die Wiege gelegt. Sie war ein Teil von ihr und präsent. Sie wusste, sie musste ihren Weg gehen. Dabei gab es ein Problem: Sie hatte bisher keine Ahnung, was genau der Weg war.
Jetzt stand die Frage der Indianer-Lady im Raum. Die Frage nach ihrer Mission. Es gab in Tess Leben nicht einen Menschen, der ihr so bis auf die Seele geblickt und ihr eine derart wichtige Frage gestellt hatte.
„Was ist Ihre Mission?“, erkundigte sich Aponi eindringlich. Eine Erkundigung die alles enthielt. Sie war wie ein Schlüssel. Der Schlüssel nach dem sie achtundzwanzig Jahre gesucht hatte. Ein Schlüssel in Wortform: „Mission“.
Sie war noch sehr jung, als sie zum ersten Mal begriff, dass ihre Gaben, die niemand verstand, zu einer größeren Aufgabe führen würden. In den letzten Jahren hatte sie es Berufung genannt und war auf die Suche gegangen. Die Begegnung mit Aponi sollte eine wichtige Zusammenkunft sein. Glasklar stand das Code-Wort „Mission“ vor ihrem inneren Auge. Gefühle, vermischt mit dumpfen Erinnerungen, durchdrangen ihr Bewusstsein. Sie konnte es nicht greifen. Die Antwort würde Tess dennoch bekommen. Heute. Bei Aponi.
Ein ungeahntes Glücksgefühl stieg in ihr auf und tiefer Frieden durchströmte sie. Sie lehnte sich auf der englischen Couch zurück und atmete lächelnd tief ein und wieder aus.
3. Von Geheimnissen und Missionen
Tess hatte nun ein wenig ihre Kindheit umrissen. Wer sie war, woher sie kam. Als sie gerade von ihrer Vorliebe für Geschichte und Archäologie erzählen wollte, unterbrach Aponi sie mit den erstaunlich hellsichtigen Worten: „Sie sind so wissbegierig, Herzchen. Sie gehen ganz in Ihrem Studium auf, wollen alles auf dieser Weltenebene entdecken, erforschen. Sie wollen die Geheimnisse lüften.“
„Woher wissen Sie das? Ich wollte soeben davon erzählen“, Tess hob erstaunt ihre dunklen Augenbrauen.
Aponi lachte laut auf: „Nun, mir geht es da wie Ihnen. Ich habe die Gabe, die Dinge in ihrer Gesamtheit zu betrachten und fühle die Verbindung zu allem, was lebt. Sie sitzen vor mir, wie ein offenes Buch!“
„Aber… “, stammelte Tess.
„Das kennen Sie doch auch, Liebes! Oder haben Sie noch nie zuvor genau gewusst, was Ihre Mutter gerade denkt? Oder Ihr Therapeut?“, fragte Aponi forschend.
„Äh, ja, doch… Meinen Therapeuten habe ich noch gar nicht erwähnt“, flüsterte Tess zögerlich.
„Menschen wie wir können von der Gesellschaft, die tief schläft, nicht eingeordnet werden. Reiche nicht ganz rund laufende Kinder wie Sie werden schon vorsichtshalber frühzeitig zu einem guten und teuren Therapeuten geschickt. Dort lernen sie, wie sie ihre mitgebrachten Gaben abtrainieren können, um stattdessen auf menschliche Art programmiert zu werden. Bei Ihnen hat das nicht funktioniert“, Aponi zwinkerte ihr zu.
„Nein, nicht wirklich. Ich war bei einigen zum Teil sehr bekannten Psychotherapeuten und Psychiatern. Immer auf Wunsch meiner Eltern. Na, eigentlich war meine Mutter die Ausschlaggebende. Sie findet bis heute, dass mit mir etwas nicht stimmt“, erklärte Tess.
„Sie gehen noch immer in die Therapie, nicht wahr? Freiwillig…“ „Nicht ganz freiwillig. Ich tue es für meine Eltern. Die sind dann beruhigter und sie bezahlen auch weiterhin dafür. Ich habe so einige Werkzeuge an die Hand bekommen, um…“, Tess stoppte kurz und es fiel ihr sichtlich schwer den Satz zu beenden: „…um mich zu beruhigen und nicht komplett abzudrehen.“
„Soso, um nicht abzudrehen. Sie haben eine Mission, mein Kind und Ihre Gaben haben nichts mit einer psychischen Krankheit zu tun. Als Sie auf die Welt kamen, war es bereits besiegelt, dass Sie die Fähigkeit besitzen, das zu tun, was zu tun nötig ist. Sie sind noch jung. Das ist gut. Ich war über fünfzig als ich erkannte, wer ich bin und wofür ich herkam. Trotzdem war alle Zeit auf meiner Seite und ich bin am Ende meiner Mission. Sie stehen am Anfang. Wir sind wie zwei Staffelläuferinnen. Ich übergebe Ihnen jetzt den Stab“, Aponi deutete eine feierliche Verbeugung an. Dann nahm sie ihre Teetasse, füllte sie und auch die von Tess nach und prostete ihr zu: „Da das geklärt ist und wir eine lange Nacht vor uns haben, möchte ich dich, liebe Tess, gerne duzen, wenn es dir recht ist.“
Tess erstarrte. Nicht, weil Aponi ihr das Du angeboten hatte. Das war völlig okay und fühlte sich richtig an. Es war zum einen die Staffelllaufmetapher, die sie in eine Aufgabe zu ziehen schien, die sie sich nicht ausgesucht hatte, zum andern hatte sie nicht vor, die ganze Nacht in einem windschiefen Haus zu verbringen, bei einer uralten Frau, die so viel über sie wusste und die sie gar nicht kannte.
„Mach dir keine Sorgen, mein Herz“, beruhigte Aponi sie und beugte sich weit nach vorn, um ihr die Hand zu tätscheln. „Das Wetter wird in den nächsten Stunden nicht besser werden. Du kannst gerne ins Freie gehen und dich überzeugen. Doch ich kenne diese Spätsommerstürme hier. Sie kommen überraschend und manchmal halten sie vielen Stunden an. Allerdings bringen sie mit ihrer Reinigung auch stets etwas Neues. Ich verspreche dir, dass für dich heute ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt.“
Und da war es wieder: Urplötzlich konnte Tess das Ganze erkennen.
Sie wusste in diesem Moment, dass sie genau hierhergehörte. Ihr war nicht klar, ob es an der Stimme Aponis lag, in der ein geheimnisvoller Klang schwang, oder ob es ihre leuchtenden, fast schwarzen Augen waren, die etwas Hypnotisches an sich hatten. Wahrscheinlich bewirkte es das ganze Setting. Es war wie in einem Bühnenstück, in dem der Regisseur nichts dem Zufall überlassen hatte. Selbst das kleinste Detail, wie eine Blumenvase ganz im Hintergrund, stand nicht zufällig dort. Diese Hütte zwischen zwei fremden Dörfern, war nicht dem Zufall überlassen worden. Das Unwetter an diesem Tag, zu dieser Zeit und an diesem Ort war absolut notwendig, um zu der Verabredung zu kommen. Eine Verabredung, die von langer Hand geplant war. Sie war wegen Aponi hier. Das hier war jetzt ihr Lost Place. Das verfallene Hotel in zehn Kilometern Entfernung war lediglich ein Köder gewesen. Das alles ging blitzschnell durch Tess Kopf. Sie erkannte augenblicklich eine gewisse Synchronizität in ihrem Leben und in dem der Aponi. Doch es ergab zunächst keinen offensichtlichen Sinn. Es war wieder so eine Situation, in der sie normalerweise eine Entspannungstechnik von Dr. Hollenbach ausprobiert und seinen Rat, das Thema zu wechseln, um sich nicht einer Fantasie hinzugeben, angenommen hätte.
Es war nicht die erste ungewöhnliche Begegnung dieser Art. Als Kind hatte sie noch die Fähigkeit besessen, Personen die sie treffen würde, vorauszusehen. Wie die Beziehungen dieser Menschen miteinander zusammenhingen, konnte sie aus einer Art Vogelperspektive erkennen – auch was sie verband und was sie gemeinsam zu unternehmen und zu lernen hatten. Als sie das zum ersten Mal ihren Eltern erzählt hatte, war ihr Vater Kurt, der sowieso sehr wenig sagte, noch stiller geworden und hatte einfach schnurstracks das Zimmer verlassen. Dafür war das Redebedürfnis ihre Mutter Kleo umso größer gewesen. In einem unkontrollierten Schwall waren Worte und immer mehr Worte auf Tess eingeprasselt. Sie konnte sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern, nur dass es grundlegend ungesund und falsch sein würde, so zu denken und zu sprechen. Tess war zu diesem Zeitpunkt acht Jahre alt gewesen. Die kindlich leichte Art, über ihre übersinnlichen Fähigkeiten zu reden, war für die rationale Naturwissenschaftlerin Kleo eine Hiobsbotschaft. Das war der Zeitpunkt, an dem sie zu Psychologen gebracht und ihr verboten wurde, ihre Erlebnisse frei und laut auszusprechen.
„Merk dir das für den Doktor“, wurde zu einem gängigen Satz, den ihre Geschwister und die Eltern benutzen. Irgendwann kam er Tess wie eine unterschwellige Beschuldigung vor.
Die Begegnung mit Aponi brachte all ihre schmerzlichen Erinnerungen wieder in ihr Gewahrsein. Es war zudem das erste Mal, dass sie in einer völlig fremden Umgebung, mehrere Hunderte Kilometer von Zuhause entfernt, zurück in ihre Übersinnlichkeit fand. Das gab ihr eine ungeahnte Freiheit. Freiheit, sich nicht verstecken oder rechtfertigen zu müssen. Wobei sich ihr Leben in der letzten Dekade hauptsächlich ums Verstecken drehte. Tess hatte in ihrer Jugend gelernt, niemandem, der neu in ihr Leben kam, auch nur ansatzweise etwas von ihrem Wahnsinn – so wie Kleo es nannte – zu berichten. Etwas schräg wirkte sie trotzdem auf Kommilitonen und Bekannte. Das Andersartige umgab sie weiterhin. Nur nicht mehr laut, sondern still.
„Du hast die Gabe, mein Herz“, lächelte Aponi sie an. Tess musste nichts erklären. Selbst die winzigste Erläuterung schien ihr völlig fehl am Platz. Denn Aponi wusste es sowieso. Aponi war wie sie. Sie war wie Aponi.
„Ja. Wir sind gleich. Wir haben sie beide, die Gabe. Und beide haben wir damit gehadert. Ich habe sie bis zu meinem fünfzigsten Geburtstag versteckt und habe sie lange Jahre ins Vergessen gedrängt. Doch die Gabe nicht zu leben, macht einen sehr unglücklich. Du musst sie leben! Dafür kamst du her. Es ist deine Mission“, erklärte Aponi feierlich.
„Ich weiß, was du meinst“, flüsterte Tess. „Aber auch wenn ich Dinge begreife, die andere nicht einmal als vorhanden wahrnehmen, so weiß ich doch nichts damit anzufangen. Wenn diese Gabe, so wie du sie nennst, eine Mission ist, dann muss diese Mission unter einem Stern stehen. Sie benötigt eine Überschrift. Verstehst du, was ich meine?“
Tess Herz klopfte bis zum Hals. Nichts, was gerade passierte, fand sie mehr merkwürdig. Sie fühlte, dass sich mit dem heutigen Tag alles ändern würde und sie hier, an diesem Ort mit dieser Alten, endlich die Antwort bekäme. Ihr war, als stünde alles auf dem Kopf. Alles was vorher vertraut war, war jetzt entfremdet. Und das, was sie vor einer Stunde noch nicht kannte, war ihr eine Heimat geworden.
Es war ein Wiedererkennen!
Noch nie war ihr ein Mensch näher gewesen als Aponi in diesem Moment.
Wieder wusste die Indianerin genau, was in Tess vor ging. Sie sagte sanft: „Das Wiedererkennen hat heute begonnen. Der heutige Tag ist eine Initiation. Was heute geschieht, wird dein Leben grundlegend verändern und du wirst deine zugedeckelten Gaben wieder freilegen. Das kannst du doch als Archäologiestudentin wunderbar. Du warst immer eine Suchende und deshalb interessierst du dich für die Antwort, die du in der Geschichte vermutest. Du glaubst, du könntest sie unter altem Geröll entdecken oder in verrotteten Gebäuden. Ich kann das so gut verstehen, und dennoch suchst du an der falschen Stelle.“
Tess schluckte und eine unbändige Angst überkam sie. Es war die Angst vor einer Lebenslüge. Was, wenn sie bisher nichts erreicht hatte? Rein gar nichts? Das sprach sie verzweifelter als gewollt laut aus.
Aponi lächelte weise und sehr liebevoll: „Mein Herz, nichts geschieht einfach nur so. Es gibt keine Zufälle. Alles was du bisher genutzt hast, kannst du jetzt mit klaren Augen sehen. Du hast alles in dir und um dich herum, was du benötigst. Glaube mir, ich war wie du. Eine Suchende. Ich habe meinen Weg als Journalistin probiert. Ich wollte wissen, was Menschen antreibt. Wollte es genaustens bis ins kleinste Detail aus ihnen herauskitzeln. Erst als ich bemerkte, dass die Lösung so nicht zu finden ist, habe ich meine Methode geändert.“
„Aber wonach hast du denn überhaupt gesucht, Aponi? Was wolltest du ergründen und bei Menschen finden? Was will ich ergründen?“, Tess Stimme klang müde. Aponi antwortete nicht sofort, sondern sah sanft in Tess dunkelgrüne Augen. Dieser Blick der alten Dame war tief in ihr spürbar. Es war, als würde er ihr Herz berühren und vorsichtig wachrütteln.
„Du weißt es, Liebes“, flüsterte Aponi. „Du musst es aussprechen. Was suchst du?“
Tess Herz raste wie verrückt. Ihr Gehirn hingegen schien gelähmt. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Auch das erriet die Indianerin: „Es ist dein Herz, das die Antwort weiß. Nicht dein Verstand. Dein Verstand ist – wenn du ihn nicht erziehst – dein größtes Hindernis. Dein Herz muss dich führen, dein Verstand ist lediglich das Werkzeug deines Herzens. Was sagt es dir? Hör auf dein Herz!“
Tess atmete tief durch, schloss die Augen und fühlte in sich hinein. Da war er wieder, der angenehme Sog, der sie sanft anhob und in eine Richtung zog. Sie genoss das wohlige Gefühl der wärmenden Liebe und des Angenommenseins, das sie seit ihrer Kindheit immer wieder verdrängt hatte.
Ganz plötzlich öffnete sie ihre Augen und sagte: „Wahrheit. Ich suche nach der Wahrheit.“
Aponi klatschte begeistert in die Hände: „Das ist es! Du suchst die Wahrheit. Alle Menschen suchen den Sinn in ihrem Leben. Ganz egal, ob sie das so benennen oder ob sie es unbewusst in sich tragen. Dann beginnen sie, irgendetwas in der Welt zu machen. Sie nutzen ihre Talente oder auch nicht. Sie versuchen, ihrem Leben die Bedeutung zu geben und irgendwie einen Ausdruck. Das alles aber bleibt in der Dreidimensionalität von Geburt und Tod. Wenn sie aber nicht einfach nur einen gewöhnlichen Sinn sehen wollen, dann kommen Fragen auf. Fragen, die weltlich betrachtet sehr unbefriedigend beantwortet werden. Für viele Fragen gibt es keine Antwort, die dich ein für alle Mal beruhigen würde. Einige wenige von uns wollen dann nicht mehr Krümel sammeln und sich zufriedengeben. Nein, sie wollen den ganzen Kuchen. Das ist der Punkt, an dem sie erfassen, dass der Sinn des Lebens nur in der Wahrheit begriffen werden kann. Doch was ist die Wahrheit? Was ist sie, Tess?“
„Ich weiß es nicht. Kennst du denn die Wahrheit hinter allem was ist?“, stellte Tess die Gegenfrage.
„Ich bin in den letzten vierundvierzig Jahren so weit gekommen, dass ich eine Widerspiegelung der Wahrheit täglich wahrnehme. Ich erlebe sie öfter und länger als je zuvor. Ich habe auf eine Begegnung gewartet, um meine Aufgabe vollenden zu können. Die Begegnung bist du, Teresia. Wie schon gesagt, ich gebe dir jetzt und in den nächsten Stunden den Stab weiter. Dann bist du an der Reihe“, Aponi sprach geheimnisvoll. Ihre runzelige Haut leuchtete orange von der Salzkristalllampe, die neben ihr stand. Es war ein Flackern darin zu erkennen, so wie bei einem Feuer. Tess kam die Szene surreal vor und doch war sie logisch und echt.
„Du sagst, du erlebst eine Widerspiegelung der Wahrheit. Wieso spiegelt sie sich wider? Wieso siehst du sie nicht direkt?“, fragte Tess erstaunt.
„Das wirst du schnell erfahren, wenn du deine Mission beginnst. Ich kann dir sagen, dass nichts was wirklich wahr ist, mit deinen körperlichen Sinnen ganz begriffen werden kann. Es kann sich lediglich darin spiegeln. Denn die Wahrheit ist außerhalb von Raum und Zeit. Versuche nicht, das jetzt verstehen zu wollen. Du wirst es später verstehen, im Laufe deiner Arbeit.“
Während Tess mit großen Augen Löcher in die Luft schaute und versuchte, ansatzweise diese Information zu begreifen und zu verarbeiten, stand Aponi auf und lief auf das riesige Bücherregal zu. Zielsicher begutachtete sie ein bestimmtes Regal auf ihrer Augenhöhe. Dann zog sie pfeilschnell ein Buch mit dunkelbraunem Einband heraus. Dabei sagte sie bestätigend: „Da haben wir es.“
Fröhlich lächelnd legte sie das Buch auf Tess Schoss und setzte sich wieder in ihren Sessel.
Tess nahm die Schrift vorsichtig in beide Hände. Der Einband war ein wenig abgewetzt, hatte aber eine gute Qualität, wahrscheinlich Leder. Goldene Schnörkelbuchstaben waren allesamt gut zu lesen: „Das Labyrinth aus Sternenstaub und Träumen“.
Eine gefühlte Ewigkeit herrschte Stille. Aponi wendete nicht den Blick von Tess und diese nicht vom Buch.
„Das ist eine große Hilfe“, unterbrach Aponi die Lautlosigkeit. „Ich wünschte, ich hätte diese Schrift von Anfang an besessen. Jetzt bin ich froh, sie dir übergeben zu können.“
„Hm“, machte Tess und begann, vorsichtig in dem wertvollen Buch zu blättern. Seine Seiten bestanden aus dünnem Papier, ja beinahe Seidenpapier. Es gab keine Seitenzahlen auf den vergilbten Rändern. Die Buchstaben waren winzig. Sie bemerkte ihre Zwiegespaltenheit zu dem Werk. Zum einen zog es sie magisch an. Dieses besondere Buch schien ein tiefes Geheimnis zu umhüllen und der Reiz dieses zu entschlüsseln, fühlte sich gut an. Es war das gleiche Kribbeln, das sie empfand, wenn sie wieder von einem neuen Lost Place gehört hatte und mit der Recherche dazu begann. Zum anderen war da aber ein Gefühl, das sie nicht einordnen konnte, weil sie es noch nie gefühlt hatte. Es war eine gewisse Angst oder eine Art Ehrfurcht vor etwas, das ihr eine Nummer zu groß erschien.
Weil die Buchstaben so klein waren und das Licht im Raum zu dämmrig, konnte sie auch gar nichts wirklich richtig entziffern. Sie wollte Aponi gerne antworten. Vor allem wollte sie die alte Dame nicht enttäuschen, die sie so überaus euphorisch anblinzelte. Sie beschloss, kurzerhand einfach mehr über das Buch erfahren zu wollen, ohne von vorneherein ihre Zweifel zu äußern.
„Erzählst du mir von diesem Buch?“, fragte sie etwas zögerlich.
„Du bist ängstlich. Das ist nicht schlimm. Es ist sogar ziemlich normal, denn tief in deinem Inneren weißt du, dass es jetzt für dich weitergeht und du ab sofort deine Gaben leben musst. Allerdings ist es auch deine Aufgabe, diese Angst unter Kontrolle zu bringen. Ansonsten wirst du auf deiner Mission scheitern. Angst kannst du nicht gebrauchen. Es sind Verantwortung und Vertrauen, die du benötigst, damit du deine Komfortzone verlässt. Ich erkläre dir heute alles, was es zu erklären gibt und dann beginnt dein Abenteuer.“
Aponis Gesicht strahlte so hell und voller Freude, dass es Tess schwer fiel zu sagen: „Oh Moment, das geht mir alles zu schnell. Wir kennen uns erst seit heute Nachmittag. Trotzdem fühle ich die tiefe Nähe und Verbindung zu dir. Ich glaube auch fest daran, dass wir uns nicht durch Zufall begegnet sind. Und ich freue mich, so eine Art Seelenverwandte gefunden zu haben, aber ich werde sicher nicht irgendeine Aufgabe übernehmen, die mir eine Schrift sagt oder so eine Art Nachfolgerin von dir werden! Ich bin sehr selbständig und selbstbestimmt. Und zielgerichtet. Ich weiß nicht einmal, was du mit diesem Staffelstab meinst. Was willst du mir übergeben?“
Aponi verlor nicht ihr entspanntes Lächeln.
„Weißt du, mein Kind, ich war genau wie du. Ich bin auch stets meinen eigenen Weg gegangen und hab für meine Rechte gekämpft. Das war in der damaligen Zeit noch bitter nötig als Frau. Da hast du es heute schon leichter. Du wirst nicht mehr so sehr nach deinem Geschlecht beurteilt. Zumindest stehen dir erst einmal alle Wege offen. Bevor du weiter etwas ablehnst, von dem du nicht das Geringste weißt, will ich dir meine Geschichte erzählen…“
4. Anna Blumenfeld – Aponi
Anna wurde in den 1920er Jahren in eine reiche Kaufmannsfamilie hineingeboren. Zusammen mit ihren Eltern, den Großeltern und zwei Tanten lebte sie in einem großen Stadthaus und genoss als einziges Kind nicht nur alle Aufmerksamkeit, sondern wurde auch in ihren Talenten gefördert. Vater sowie Mutter waren für die Verhältnisse der damaligen Zeit innovativ und modern. So konnte sich die kleine Anna entfalten und ihrer blühenden Phantasie freien Lauf lassen.
„Blühende Fantasie“ nannten es die Familienmitglieder. Für Anna war es ganz normal, über ihre Freunde zu reden, die anscheinend nur sie sehen konnte. Da gab es einen jungen weisen Indianer, der sie, seit sie denken konnte, beinahe täglich begleitete und manchmal auch eine Frau, die engelsgleich bei ihr war, um einfach nur da zu sein und nicht zu sprechen. Schon früh zeichnete und malte sie faszinierende Bilder und in ihrer Jugend ganze Gemälde. Alle zeigten das, was die Menschen mit ihren Augen nicht sehen konnten.
Zunächst bekam sie ein Stipendium bei einer renommierten Kunsthochschule. Doch das Studium brach sie ab, um lieber Germanistik und Journalismus zu studieren. Das Malen blieb dennoch für die nächsten Jahre ihr Steckenpferd. Dabei hatte sie die Möglichkeit, sich auszudrücken und ungezwungen autark zu sein. Außerdem wurden selbst ihre verrücktesten Werke nicht hinterfragt und sie nicht gezwungen, sich zu outen. Das Betrachten von Kunst ließ viel Interpretationsfreiheit für jeden Einzelnen. Diese Freiheit war wie ein Joker. So konnte Anna geheimnisvoll zu ihren Werken schweigen. Das machte sie umso begehrenswerter. Meistens malte sie ihre zuvor geträumten Träume und viele hatten ein Labyrinth zum Inhalt. Das Labyrinth wurde sozusagen ihr Markenzeichen. In ihrer Stadt und der näheren Umgebung war sie eine durchaus bekannte und geschätzte Künstlerin.
Ihre Neugier hingegen galt dem Journalismus. Anna wollte wissen, was Menschen antrieb und warum sie Dinge taten, die sie eben so taten. Als kleines Mädchen sagte ihr der Indianer, dass es eine Mission für sie geben würde und dass diese nicht direkt mit ihren Bildern zu tun hätte. Sie seien aber ein wichtiges Ventil für sie und eine Erinnerung an alle, die sie sahen. So machte sie sich auf den Weg, die Welt zu erkunden und Antworten für ihre Fragen zu finden. Obwohl sie so behütet und geachtet aufwuchs, eckte sie oft mit ihrer Art an und wurde nicht selten von Mitschülern für verrückt erklärt. Später ging es dann mit Studienkollegen weiter und sie verlor immer wieder Freunde. So beschloss sie irgendwann still und heimlich, sich anzupassen an die Welt, die alle für real und richtig hielten. Anna war einfach müde geworden, so anders zu sein. Sie wollte endlich irgendwo ankommen. Sie wollte nicht weiter auffallen und gab das Malen mit dreißig Jahren auf. Sie stürzte sich stattdessen in ihre Journalistenkarriere. Erst als sie an ihrem fünfzigsten Geburtstag ein Foto in einem Hochglanzmagazin entdeckte, begann sie sich zu erinnern. Das Bild zeigte einen großgewachsenen schlanken Indianer, der der Schamane eines Stammes in Kanada war. Dieser Mann hatte so viel Ähnlichkeit mit dem Geist aus ihrer Kindheit und Jugend, dass sie erschrak und eine Anzahl von Gefühlsduschen sie direkt in die Erinnerung katapultierten.
Das war der Beginn ihrer Reise durch das Labyrinth. Eine Reise, die sie als Kind begonnen hatte, um sie dann für viele Jahre auf Eis zu legen.
Sie war ledig, kinderlos und finanziell völlig unabhängig. So überlegte sie nicht lange, sondern wollte den Kontakt zu der geistigen Welt ihrer Kindheit wieder aufnehmen. Die engelsgleiche Frau konnte sie nicht mehr sehen. Auch der Indianer erschien selbst auf intensives Bitten nicht bei ihr, aber sie bekam eine Information, die wichtig war. Sie fackelte nicht lange, packte wenige Sachen und flog nach Recherche direkt nach Kanada, um den Schamanen aus der Zeitschrift aufzusuchen. Aufgrund ihres Berufes, ihrer Kontakte und Erfahrungen war auch das ein Leichtes.
Und so kam es, dass sich Anna Blumenfeld in den 1970er Jahren an einem frühen Septembertag im Landeanflug auf Yukon Valley befand. Sie hatte ein Bed-and-Breakfast-Zimmer in Whitehorse City, dem größten Ort in dem Gebiet, gebucht. Für Anna war es nicht ungewöhnlich zu reisen. Durch ihre Arbeit war sie viel in der Welt herumgekommen. Auch in Kanada war sie schon gewesen, als sie einen Bericht über die Polarlichter schreiben sollte. Diese Reise war dennoch anders. Sie bemerkte an ihrer Aufregung, dass sie ein Abenteuer unternahm, das ein anderes Format hatte. Viele Jahre hatte sie ihre Neugier, gepaart mit der Suche nach Sinn und Glück, hinter ihrem Schreibjob versteckt. Die vielen Zeitungen und Zeitschriften, für die sie schrieb, waren sozusagen ihre Deckung, ihr Schutzschild. Niemals konnte man ihre Sehnsucht und die sehr intimen Fragen direkt mit ihr selbst in Zusammenhang bringen. Jeder wusste schließlich, dass Neugier und Engagement einfach zum Journalistenbusiness dazu gehörten.
Während die Räder des Flugzeuges unsanft auf den Boden titschten, wurde Anna bewusst, dass hinter ihrer so selbstbewussten Fassade tiefe Angst vor einer Art Comingout steckte. Wie Schuppen fiel es ihr von den Augen! Das war auch der Grund, weshalb sie ihr Kunststudium abgebrochen hatte. Es waren unliebsame Fragen der Professoren. Es gab da einen, der schien sie wie mit Röntgenaugen zu durchleuchten. Professor Emil Duval. Er wollte mehr wissen über ihre farbenfrohen Labyrinthe. Sie fühlte sich bei ihm wie auf dem heißen Stuhl und irgendwann total in die Ecke gedrängt. So beschloss sie, nur noch aus Freude zu malen und von sich preiszugeben, was ihr beliebte. Als freischaffende Künstlerin hielt sie sich völlig bedeckt. Sie ließ Interpretationen im Raum stehen und schmunzelte heimlich über die vielen Ideen in den Köpfen ihrer Gemäldeliebhaber.
Doch was sie antrieb, was sie sah und hörte, das behielt sie für sich. Sie zweifelte nie auch nur eine Sekunde an ihrer geistigen Gesundheit. Sie wusste, dass sie außerordentliche übersinnliche Fähigkeiten besaß. Das für sich selbst zu wissen war aber etwas anderes, als damit rauszugehen in die Welt. Der Indianer hatte ihr vieles mit auf den Weg gegeben. Er hatte ihr erklärt, dass sie sich in einem Labyrinth befinden würde, das ihr ganz allein gehörte. Ein Labyrinth für das sie selbst verantwortlich war. Er hatte ihr gesagt, dass sie vor ihrem Körpereintritt als Anna Blumenfeld einen Vertrag mit sich selbst und einer Reihe von anderen eingegangen war. Diese anderen würde sie finden und mit ihnen lernen. Letzten Endes würde sie das Labyrinth verlassen und nach Hause gehen, so wie es bestimmt war. Er hatte auch immer wieder betont, dass es ihr Wille sei und dass nur ihr eigener Wille überhaupt zählen würde. So griff sich Anna schließlich das Wort „Wille“ und sie gab ihm die Bedeutung von Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Sie interessierte sich weiter für die Geheimnisse des Labyrinthes, aber eben inkognito und wie sie jetzt erkannte, sehr feige hinter ihrem Presseausweis. Der war der Freifahrtschein, alles fragen und recherchieren zu dürfen, ohne dass sie sich im Geringsten preisgeben musste.
Annas kleiner Koffer war schnell zur Stelle und auch der engagierte Fahrer war sofort gefunden. Ihr Organisationstalent und ihre Berufsroutine waren jetzt mehr als hilfreich. Denn so musste sie sich nicht großartig den Kopf über ein fremdes Land zerbrechen.
Angekommen in dem heimeligen Zimmer mit seinen Rosentapeten und zartrosafarbener Bettwäsche, setzte sie sich sofort an den winzigen Sekretär im Raum und schrieb einige Fragen nieder. Sie fühlte noch keinen Jetlag und hatte auch kein Verlangen, sich nach dem endlos langen Flug auszustrecken. Sie war schon weiter als 7000 Kilometer geflogen. Bis hierher war alles gewohnte Routine. Doch ab sofort betrat sie unbekanntes Terrain.
Der Indianer lebte in Whitehorse City - in der Stadt, in der sie im Bed-and-Breakfast untergekommen war. Die Dame des Hauses hatte ihr eine Zeichnung gemacht, weil sie gerade keinen Stadtplan dahatte. Es waren tatsächlich nur wenige Minuten Fußweg bis zu Amarok. Das war sein Name.
Anna schaute auf den kleinen Wecker auf ihrem Nachttischchen. Es war 11.11 Uhr am Vormittag. Amarok wusste, dass sie am frühen Nachmittag kommen würde, wenn es mit dem Flug glattging. Sie hatte sich gedacht, dass sie zunächst duschen und eine Kleinigkeit zu Mittag essen würde, um dabei ganz in Ruhe über die Begegnung nachzudenken. Doch jetzt war alles irgendwie ganz anders. Jetzt hatte sie Schmetterlinge im Bauch und wollte ihn sofort treffen. Dieses Gefühl des Lampenfiebers war bereits unerträglich geworden. Das war der Punkt, an dem man entweder Reißaus nahm oder sich ganz schnell in die bedrohlich scheinende Situation begab. Flüchten oder kämpfen. Anna war eine mutige Frau. Ja, auch sie kannte das Gefühl der heiteren Aufregung und der feuchten Hände, wenn sie auf die Bühne musste, um einen Preis entgegenzunehmen, oder wenn sie einen Prominenten interviewte. Das war für sie ein Antrieb und sie genoss den erhöhten Herzschlag.
Jetzt war es anders. Jetzt war dieses Gefühl nicht anregend, sondern aufregend überreizend.
Hier in diesem lieblichen Rosenzimmer, einen Steinwurf von Amarok entfernt, lagen ihre Nerven blank. Sie konnte keine drei Stunden mehr warten, bis sie ihn traf. Das durfte sie ihrem Blutdruck nicht zumuten.
So atmete sie ein paarmal tief durch, griff den Zimmerschlüssel mit dem überdimensionalen Kugelanhänger und ihre Handtasche. Dann lief sie schnurstracks die Treppe hinunter und hinaus auf die ruhige Straße. Für einen Moment blieb sie stehen und blickte über die sanfte Gebirgskette am Horizont.
Was würde das Gespräch mit dem Indianer bringen? Sie hatte ihn angerufen, bevor sie herflog. Verwunderung, dass die deutsche Presse schon wieder mit ihm reden wollte, war durch das Telefon zu spüren. Doch Anna wollte das Missverständnis nicht aufdecken. Sie konnte ihm einfach nicht sagen, dass sie zwar eine Journalistin sei, aber ihn rein privat aufsuchen wollte. Ihr, der wortgewandten und mit Auszeichnungen überhäuften Pressefrau, fehlte jede Erklärung. So ließ sie es einfach sein.
Jetzt war die Stunde der Wahrheit gekommen. Gleich müsste sie ihm reinen Wein einschenken. So lief sie langsam die Straße entlang, schaute hin und wieder auf die Wegbeschreibung und kam schließlich zu einer einfachen, aber sehr gepflegten Hütte.
Ein niedriges Holztörchen ließ sich nach innen öffnen. Der schmale Kieselsteinweg führte zur Haustür. An dieser hing ein breiter Klopfring, auf dem in deutscher Sprache graviert war: „Aus Sternenstaub und Träumen besteht dein Labyrinth“. Unter dem Ring befand sich eine Metallplatte mit der Gravur eines Labyrinthes. Anna erschrak über dieses Zeichen. Sie erinnerte sich an ihre vielen Labyrinth-Träume und die daraus resultierenden Gemälde. Schon Jahre - ja Jahrzehnte - hatte sie nie oder höchstens sehr selten daran gedacht.
Sie klopfte zögerlich an die Tür. Ein heller Klang ertönte. Zunächst geschah nichts und sie dachte einen Augenblick, es wäre vielleicht niemand daheim. Doch dann hörte sie Geräusche. Es wurde schwungvoll geöffnet. Vor ihr stand ein großer, schlanker Mann mit langen Haaren, die vollständig ergraut waren. Er trug ein kariertes Flanellhemd lässig über weiten Jeans. Er stutzte kurz und fragte dann: „Anna Blumenfeld?“
In dem Moment, in dem sie den dunklen Klang seiner Stimme hörte, beruhigte sie sich schlagartig. Sie lächelte und nickte. Sie wusste, dass Amarok ein gutes Deutsch sprach und so antwortete sie ihm in ihrer Muttersprache: „Ja, ich bin es. Allerdings bin ich ein wenig zu früh. Ich hoffe, das macht nichts…“
„Hm“, brummte er und begutachtete sie. „Kommen Sie herein.“
Anna trat in die rustikale Stube. In dem großen Raum war alles sehr einfach gehalten. An der Wand hingen Felle und ein paar Geweihe. Amarok wies auf den dunklen Holztisch und Anna setzte sich auf einen der vier Stühle.
„Tee?“, fragte er. Sie nickte dankbar, denn so langsam machten sich Durst und Hunger bemerkbar.
Während er in der winzigen Küchenzeile gegenüber hantierte, fragte Anna: „Wie kommt es, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Das ist mir schon bei unserem Telefongespräch aufgefallen.“
„Hm“, brummte er erneut und drehte sich mit forschendem Blick zu ihr. „Das hatte ich bereits in dem letzten Artikel erwähnt. Sie haben ihn nicht geschrieben. Aber müssten Sie als Reporterin so etwas nicht wissen?“
Anna räusperte sich und wusste, dass es Zeit war, Farbe zu bekennen.
„Nun ja. Ich habe mich nicht so sehr für diesen Bericht über die Ureinwohner hier im Yukon Territorium interessiert und so habe ich die Seiten nur überflogen. Ich wollte Sie kennenlernen. Darum ging es mir.“
Er kam mit dem Tee und den Tassen an den Tisch und setzte sich ihr gegenüber.
„Sie wollen mich kennenlernen?“, fragte er und zog seine dichten schwarzgrauen Brauen hoch.
„Wissen Sie, Amarok – ich darf Sie doch Amarok nennen? Ich bin nicht als Journalistin hier. Ich bin als Privatperson nach Kanada gekommen. Als Anna. Nur als Anna…“, sie wusste, dass eine echte Erklärung jetzt fällig wurde. Trotzdem machte sie zunächst eine Pause.
„Nur als Anna, sagen Sie, hm…“, antwortete er und lehnte sich mit aufgestützten Unterarmen über den Tisch, in ihre Richtung. Sie schaute direkt in sein Gesicht. Seine dunkelbraunen Augen umspielten viele Fältchen. Er hatte eine große gebogene Nase und trug einen Dreitagebart. Anna hatte nicht die leiseste Ahnung, wie alt er wohl sein mochte. Vielleicht war er Anfang sechzig oder schon siebzig? Seine braune Haut wirkte trotz der vielen Mikrofältchen und der senkrechten Stirnfalte zart und jugendlich.
„Ich habe so etwas noch nie gemacht, müssen Sie wissen. Ich habe Sie in diesem Hochglanzmagazin gesehen. Sie haben mich sofort an jemanden erinnert, den ich als Kind kannte. Der mich lange Zeit begleitet hat und den ich irgendwann verloren habe. Es ist nicht so, dass ich mich nicht allgemein für den Artikel interessiere. Normalerweise bin ich Feuer und Flamme, wenn es um die Welt mit ihren zahlreichen Facetten geht. Es war dieses Foto. Dieses eine Foto von Ihnen, das etwas in mir ausgelöst hat. Ich wollte ab diesem Moment nichts mehr aus dem Bericht erfahren. Ich hatte Angst, er könnte meine Kindheitserinnerung zerstören. Ich weiß, das muss sich für Sie jetzt unsinnig und völlig verrückt anhören, aber ich musste Sie einfach in Natura sehen. Sie kennenlernen oder irgendwie erneut kennenlernen…“