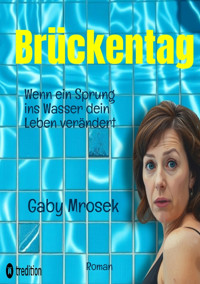6,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Du stehst an einem Punkt in deinem Leben, an dem es scheinbar nicht rund läuft? Dir passieren Schicksalsschläge und eine Angst, die tief in dir sitzt, kommt ständig bedrohlich näher? Du fragst dich, was das alles soll? Letztendlich fragst du nach der Wahrheit und dem Sinn des Lebens? Die sehr persönliche und heilsame Erzählung "Bruderherz - Mein Weg mit Jesus" deckt genau diese Fragen auf und liefert tröstliche Antworten, die einen ganz anderen Ansatz haben, als du es von der Welt, die du siehst, gewohnt bist. Begib dich mit mir auf die Reise in dein Innerstes und entdecke dort deine eigene Macht und Stärke. Ich teile mit dir meine ganz eigenen spirituellen Erfahrungen mit meinem geistigen Führer, der sich mir als Jesus vorstellt und nicht einmal im Ansatz so ist, wie ihn die Kirchen und Historie darstellen. Wenn du wirklich froh werden und tatsächlich lieben willst, unabhängig von den äußeren Erfahrungen, die du in dieser Welt noch machst, dann ist diese Erzählung deine ganz persönliche und ich habe sie für dich aufgeschrieben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gaby Mrosek
Bruderherz-Mein Weg mit Jesus
© 2021 Gaby Mrosek
Verlag und Druck:tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-19453-3
Hardcover:
978-3-347-19454-0
e-Book:
978-3-347-19455-7
Coverbild: Michael Mrosek
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Ich widme dieses Buch dir,denn es ist kein Zufall,dass du diese Worte gerade liest…
Prolog
Was ist das Leben?
Du entstehst scheinbar neun Monate lang im Bauch einer Frau, die du dann Mutter nennst, wirst geboren und irgendwann stirbst du wieder. Alles, was sich dazwischen abspielt, nennst du Leben.
Für manche ist diese Zeitspanne verdammt kurz. Einige Jahre nur, womöglich Sekunden. Für andere ist sie lang. Bisweilen sogar 100 Jahre und mehr.
Ganz schlicht ist genau das das Leben. Nüchtern betrachtet. Wozu es überhaupt da ist und womit man es füllt, das ist eine ganz andere Frage.
Über den Sinn des Lebens wird philosophiert, seit wir denken können. Für jeden bedeutet er etwas anderes. Ebenso wie glücklich zu sein. Womit bin ich glücklich? Was will ich erreichen? Was kann ich überhaupt erreichen? Habe ich die Mittel dazu? Reicht meine mir mitgegebene Intelligenz, meine Schönheit, mein Einfluss? Wurde ich schon als Kind geliebt und gefördert? Wie sahen meine Chancen aus? Hatte ich Glück mit dem Ort und der Zeit, in die ich hineingeworfen wurde?
Nicht zuletzt stellen sich die Fragen: Ist Leben gleich Leben? Gibt es wertvolleres Leben und weniger wertvolles?
Hat ein Massenmörder das gleiche Lebensrecht wie eine Mutter Teresa?
Brennt das Leben eines schwerst geistig und körperlich behinderten Menschen lediglich auf Sparflamme oder ist es gar ein verschwendetes?
Kann man sein Leben verspielen oder wegwerfen? Oder für einen anderen opfern?
Du siehst schon, die Fragezeichen türmen sich, und wir könnten so endlos weitermachen. Viele hunderte von Seiten über Sinn und Zweck, Antrieb und Zwänge, über die vielen religiösen und philosophischen Hintergründe, über Karma, Wiedergeburt und Hölle. Letztendlich über einen existierenden oder nichtexistierenden Gott und wozu das ganze Treiben überhaupt gut sein soll.
Und genau jetzt, wo es kompliziert wird und wir ins Grübeln kommen, hören wir schon wieder auf damit.
Ich möchte dir nun eine ganz andere Frage stellen, eine, über die es sich lohnt nachzudenken, nämlich die:
Was, wenn genau das alles in allem gar nicht DAS LEBEN ist?
Ja, du liest richtig.
Ich formuliere es als Antwort:
Das alles in allem ist nicht DAS LEBEN. Absolut nicht!
Das ist der Punkt, an dem du mehr erfahren willst, über das wahre Leben. Etwas, das keine Art Puppentheater oder eine Verkettung irgendwelcher Umstände ist. Ob du nun mit mir gehst im Geist, der sämtliches Potenzial hat, die Wahrheit zu erkennen, oder ob du das mit einer einzigen Handbewegung vom Tisch fegst, ist einzig und allein deine Entscheidung.
Falls du all das für Unsinn hältst, macht das gar nichts. Du kannst einfach weiter wie bisher leben – mit allen Höhen und Tiefen und mit dem Kreislauf von Geburt und Tod. Das alles wird es solange für dich geben, bis du dich freiwillig dagegen entscheidest. Und solange gilt: Es ist nichts bedroht. Niemals. Denn die Wahrheit lässt sich nicht bedrohen. Ewiges ist ewig und Leben kann nicht sterben. Du machst einfach weiter: Zeit, Raum, Illusionen – wenn du das so entscheidest, auch noch Millionen von Jahren.
Wenn du dich aber entschließt, mehr zu erfahren, dann komm mit auf meine Reise zurück zur QUELLE. Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen und Wiedererkennen der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist seit Anbeginn der Zeit bereits in dir.
Ich danke dir für dein Bereitsein…
Der Traum
Ich laufe durch die finsteren Straßen. Es ist mitten in der Nacht. Rechts und links von mir ragen hohe Gebäude in die wolkenverhangene Dunkelheit. Ich schaue nach oben, in der Hoffnung, wenigstens einen Stern zu entdecken, und wenn er noch so klein sein möge. Doch nichts ist da, außer schwere Schatten, die mich zu erdrücken scheinen. Ich fühle deutlich, wie Angst in meine Glieder kriecht. Ich laufe schneller. Was mache ich hier, in der fremden Stadt, mitten in der menschenleeren Nacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß einzig und allein, dass ich mich verlaufen habe und nach Hause möchte.
Die Straßen werden zu immer schmaleren Gassen. Nebelschwaden steigen aus Gullideckeln empor und formen sich zu unheimlichen Monstern. Mein Herz pocht wie verrückt. Ich möchte schreien, aber da kommt kein Ton aus meiner Kehle. Wo bin ich? Was will ich hier? Ich weiß es nicht…
Da! Am Ende meines Weges sehe ich sie – die weiße Tür! Ich renne auf sie zu, bin schon fast da. Ich erkenne sogar den Lacktropfen, diesen kleinen Schönheitsfehler, der sich damals beim Streichen ganz unbemerkt eingeschlichen hatte. Ich greife nach der Klinke, fühle das kalte Metall, drücke sie nach unten und höre die quietschenden Scharniere. Für einen winzig kurzen Augenblick bin ich erleichtert, denn ich stehe tatsächlich im Schlafzimmer meiner Eltern. Ich kann sie in der Dunkelheit schemenhaft erkennen. Sie liegen da unter dicken Daunenbetten und schlafen. Unschlüssig bleibe ich mitten im Raum stehen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich blicke hinunter auf den dunkelblauen Teppichboden, der mir sonst so vertraut ist. Ich sehe ihn, aber er ist mir jetzt so fremd. Er beginnt, Wellen zu schlagen. Erst sachte, dann heftiger. Meine Eltern in ihren Betten verschwinden. Sie rollen einfach davon oder bin ich es, die ruckartig nach hinten gezogen wird? Ich will schreien: „Mama! Papa!“ ich kann es aber nicht Im selben Moment stehe ich wieder auf der Straße und das Suchen beginnt erneut.
Ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Nacht noch das Schlafzimmer meiner Eltern betrete. Doch ich erinnere mich sehr wohl, welchen Verlust ich jedes Mal aufs Neue durchlebe, wenn ich auf die kalte Straße zurückgeworfen werde.
Irgendwann lösen sich die Bilder auf. Sie wirbeln durcheinander: die großen Gebäude, die finsteren Schatten, meine schlafenden Eltern und hell in der Mitte die weiße Tür, die umgeben ist von einem Teppichozean. Mit deren Verschwinden schlage ich die Augen auf und stelle fest, dass ich geträumt habe. Statt Erleichterung zu empfinden, wie es nach einem Albtraum üblich ist, überkommt mich eine tiefe Gewissheit, die schrecklich ist. Ich bin zwar aus einem Nachttraum erwacht, bleibe aber in einem Tagtraum gefangen.
Ich träume weiter, bin fremd hier und alles um mich herum ist ein Betrug.
An diesem Morgen beschließe ich zu erwachen, und ich bin 5 Jahre alt…
Wer ich zu sein scheine
40 Jahre sind seit dem Traum vergangen – vierzig…
Oft fühle ich mich noch immer wie dieses fünfjährige Mädchen, das erkannt hat, dass es träumt. Das Kind, das an jenem Morgen nach dem Traum beschlossen hatte, aufzuwachen. Der Beschluss war wie ein Versprechen, mehr noch, ein Schwur. Da gab es diese Gewissheit, dass alles gut werden würde. Ja, das würde es, denn ich wollte es so. Das Ganze war eine Frage der Zeit, die unaufhörlich verstrich – für jeden anderen und ebenso für mich. Mein Geist völlig zeitlos, mein Körper nicht die Bohne…
Natürlich ist auf der körperlich materiellen Ebene alles anders. Es hat sich verändert, verändert sich ständig und unaufhörlich wie von Zauberhand. Aus diesem Kind ist ein Teenager geworden, eine junge Frau, eine Frau mittleren Alters. Wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich mir oft fremd. Da sehe ich die Person, die sich ständig und auf magische Art zu verändern scheint.
Als ich noch sehr jung war, glaubte ich, ich könnte ewig leben, mit diesem Körper, der für alle Zeit jung bleiben würde. Natürlich wusste ich mit meinem Verstand, dass jeder Mensch hier geboren wird, erblüht, eine Zeit lang im Saft steht und letztendlich wieder verblüht bis zum totalen Zerfall. Ja, ich wusste es – und dennoch konnte ich mir nicht vorstellen, dass Leben sterben kann. Einfach zu sterben kam mir so unglaublich vor. So unglaublich falsch.
Ich erinnere mich an meine Oma Johanna, die mir mit fast 90 Jahren sagte: „Mein Kind, das Leben ist wie ein Traum. Gerade eben war ich so jung und nun schau mich an.“
Darüber musste ich als 19-Jährige lachen. Ich dachte damals: „Ich bin schon immer jung und es kommt mir ewig vor.“ Dennoch nagte der Gedanke in mir und er wurde zu einem Puzzleteil.
Das Leben ist nicht wie ein Traum. Das Leben, das ich als solches wahrnehme, ist ein Traum. Das wusste ich doch schon irgendwie.
Obwohl ich mit dem Thema Zeit damals sehr locker kindlich umging, gab es aber von jeher diese Phasen des Innehaltens. Ich nannte es: das Puzzleteilchensuchen. Ausschlaggebend war dieser Traum, den ich mit 5 Jahren hatte. Ich konnte damals mit niemandem darüber reden. Zum einen fehlten mir die passenden Worte, zum anderen der Mut, das meinen Eltern zu erzählen. Trotzdem war ich nicht wirklich allein. Denn da gab es dieses Etwas, was stets bei mir war. Es redete keine Worte mit mir. Aber es war da. Oft. Eigentlich immer. Ich konnte es als Wärme spüren, als Schutz und Freude. Das war sehr schön und es fühlte sich so selbstverständlich an. Obwohl ich es genoss, dieses Wesen bei mir zu haben, begann ich, je älter ich wurde, das Wissen darum wieder zu verdrängen und zu verschleiern. So verfolgte ich irgendwann den Gedanken, ich lebe gar nicht wirklich als Mensch auf dieser Erde, sondern ich träume das alles nur, nicht bewusst und aktiv weiter.
Die unangenehme Ahnung, ich sei so eine Art Alien in einer fremden Welt, blieb allerdings. Es machte sich als Unwohlsein bemerkbar. Irgendetwas schien mir immer zu fehlen. Ich begann ängstlich zu werden je älter ich wurde und zweifelte an mir und anderen. In meinem Inneren begann ich Puzzleteilchen zu sammeln, die ich im Laufe der Zeit in einer lauten und chaotischen Welt finden konnte. Puzzleteile, die zusammengesetzt das Bild der Wahrheit ergeben sollten. Getrennt von meinem Alltagswissen lagerte ich sie an einem stillen Ort in meinem Geist ein. Ich machte immer wieder Erfahrungen, die man spirituell nennen kann und die ganz plötzlich kamen, ohne mein Dazutun. Und es waren Worte und Sätze von Menschen, die mich umgaben und die wie Schlüssel in ein geistiges Schloss zu passen schienen. Sie ließen mich aufhorchen und hellwach werden. Da war zum Beispiel der Satz einer Mitschülerin. Wir saßen in der Pause zusammen und redeten über den zweiten Golfkrieg, der zu diesem Zeitpunkt gerade tobte. Nachdem wir uns ängstlich in Rage geredet hatten, meinte sie plötzlich sehr leise: „Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, die Hölle ist hier! Wir sitzen mitten drin und haben uns da selbst hineinmanövriert…“
Wir wurden alle sehr still und für mich war das eine unglaublich große Menge an Puzzleteilen.
Die Hölle ist hier!
Ich lebe also tatsächlich gar nicht da, wo ich eigentlich hingehöre. Ich träume mich in einem Traum oder bin ich gar in der Hölle? Nein! Ich träume mich in einer Hölle! Wie auch immer ich da hineingeraten sein mag…
In meinen zahlreichen schlaflosen Nächten versuchte ich, all das „Wissen“, diese Puzzleteile zusammenzusetzen, damit sie ein Ganzes ergeben würden. Doch nichts dergleichen geschah. Viel zu viele Teile fehlten mir. Ich sah vor meinem geistigen Auge ein überdimensionales Puzzle aus Millionen von Teilen. Und von diesen Teilen hatte ich gerade mal eine Handvoll und nicht einmal die, die direkt miteinander in Verbindung schienen.
So ging es weiter und weiter. Zwischen suchen, finden, verwerfen, alles wieder verdrängen. Das machte mich sehr unzufrieden.
So stolperte ich durch meine Kindheit und Jugend. Immer auf der Suche nach der Wahrheit, um diese Suche ständig wieder zu unterbrechen. Manchmal unterbrach ich sie, weil ich so viele Probleme zu haben schien und mich voller Selbstmitleid diesen hingab. Manchmal aber auch, weil ich plötzlich so glücklich war oder so verliebt und mich dann doch wieder als Kind dieser Welt fühlte. Es gab viele Lücken im Teppich und es waren meine totalen Tiefpunkte, die mich wieder auf Puzzleteilchensuche brachten.
Während ich also nach Sinn und Zweck der ganzen Welt fragte und überlegte, wann dieser Traum wohl enden würde, tauchte dieses Es - dieses Wesen – intensiver bei mir auf. Manchmal konnte ich es körperlich spüren, manchmal im Geist als helles Licht erkennen. In den Nächten, in denen ich mich sehr vor der Dunkelheit fürchtete, umgab es mich wie eine Schutzhülle und ich wusste ganz genau, dass nichts und niemand die Macht hatte, durch diese Hülle zu dringen. Oft wurde ich mitten in der Nacht wach und fühlte jemanden an meinem Bett sitzen. Ich konnte ihn nicht mit meinen Augen sehen, aber er war da. Ich hatte keine Angst. Ganz im Gegenteil: Ich fühlte tiefen Frieden und einen starken Schutz. Meine Mutter erklärte mir damals, ich würde das nur träumen. Aber ich träumte nicht. Denn das war realer als mein körperlicher Wachzustand tagsüber.
Das Wichtigste aber war, es fühlte sich völlig angstfrei an. Da gab es nur diese Stille, diesen Frieden und eine Gegenwart, die ich tagsüber nicht entdecken konnte. Zu groß war da meine Angst vor dem Leben selbst. Sie konnte Ausmaße annehmen, die mich komplett lähmten und mich kaum atmen ließen. Manchmal war es so schlimm, dass ich glaubte, nur der Tod wäre eine echte Alternative. Nachdem ich mit meinen destruktiven Gedanken auch destruktive Ergebnisse anzog, stürzte ich mich verzweifelt in meine Trauer und tiefe Depressionen überkamen mich. Ich war mitten in der Pubertät und ein Bündel aus Angst und Zweifeln. Nicht zuletzt beschuldigte ich insgeheim alle um mich herum – natürlich auch mich selbst. Ich quälte mich täglich aus dem Bett, zwang mich zur Schule, wo eine Horde lauter und gemeiner Schüler auf mich wartete. Ich ließ den stinklangweiligen Unterricht mit schimpfenden und unfairen Lehrern über mich ergehen und übernahm still das Urteil, dass mit mir etwas nicht stimmen würde. Ich zog hohe Mauern um mich herum, damit möglichst wenig von da draußen an mich herankam. An vielen Nachmittagen hockte ich lethargisch in meinem Zimmer und war bemüht allen Frust und Groll aus mir herauszuschreiben. Ich wollte die ganze Schuld und diese schlimme Angst irgendwie weghaben und so nutzte ich ein Tagebuch. Das half allerdings nur sehr kurz, ebenso wie die düstere Musik, die ich laut aufdrehte. Spätestens am Abend war sämtliche Erleichterung wieder dem tiefen Weltschmerz gewichen. Mir war klar, dass ich vor mir selbst nicht fliehen konnte und auch meine Ideen nicht einfach wegschreiben konnte.
Schließlich hielt ich das alles nicht mehr aus und ich begann, meinen Selbstmord zu planen. Ich sah wirklich keinen Sinn in allem. Ich hatte mein Leben genau abgewogen, einen höheren Plan gesucht, einen Sinn, den das alles ergeben sollte. Aber soviel ich auch gesucht hatte, ich war zu null Ergebnis gekommen. Das Einzige, was ich sah, war, dass letztendlich alles Leben auf diesem feindlichen Planeten zum Tode verurteilt war.
Selbst wenn mir eine Wahrsagerin vorausgesagt hätte, dass ich bei bester Gesundheit 100 Jahre alt werden würde, einen wundervollen Beruf hätte, viel Geld und Luxus, sowie die Liebe meines Lebens treffen würde und mit einer vollkommen glücklichen Familie gesegnet wäre, so wäre mir das zu wenig gewesen.
War ich etwa undankbar? Nein, das war ich keinesfalls, denn was alles würde mir das schon bringen, wenn ich mit dem Tod bezahlen müsste. Und das würde ich ganz sicher irgendwann. Das war sowieso unausweichlich.
Außerdem war mir von keinem solch glücklichen Menschen je berichtet worden. Die meisten schlugen sich doch mehr schlecht als recht durchs Leben. Überall wohin ich auch schaute, sah ich Krankheit, Leid und Tod. Bei manchen kam es knüppeldick, bei anderen lief es halt ganz gut. Trotzdem erkannte ich keinen Sinn. Ich dachte mir, ich könnte mir viel weiteres Leid ersparen, wenn ich freiwillig abtrete – sozusagen einfach eine Abkürzung nehme. Ein allerletztes Mal noch betete ich zu Gott – das machte ich übrigens sehr oft, auch wenn die erhofften Resultate und erfüllten Erwartungen irgendwie ausblieben. Bevor ich ging, wollte ich noch einmal wissen, warum er so etwas überhaupt zuließ oder womöglich eigenhändig tat. Ich wollte diesen verflixten Plan, der hinter allem Schmerz und Unglück steckte, erfahren. Wenn doch Gott ein liebender Gott war, wie konnte er das alles zulassen? Also betete ich inbrünstig und lange mit tiefen Hoffnungen auf ein Wunder.
Ganz ehrlich? Ich hörte nichts. Rein gar nichts. Und so beschloss ich, es ihm zu zeigen und eben selbst nachzuhelfen, um vorzeitig dem Grauen ein Ende zu setzen. Angst zu sterben hatte ich nicht. Warum sollte ich auch? Es war schließlich das Leben, das mir Angst machte. Ich nahm mir vor, Schlaftabletten zu schlucken und friedlich aus dieser jämmerlichen Welt hinauszudämmern ins Nichts, was auch immer das war. Vorstellen konnte ich mir das Nichts nicht. Das war mir in Anbetracht meiner seelischen Qualen auch völlig egal.
Doch dann geschah plötzlich etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Diese Präsenz, die ich nachts so oft in meiner Nähe gespürt hatte, begann zu reden. Und zwar geradewegs in meine verqueren Gedanken hinein.
„Du glaubst wirklich, du könntest das tun? Dich töten? Du kannst nicht sterben! Es gibt keinen Tod. Du machst es für dich selbst nur schlimmer, denn du wirst sofort wiederkommen, mit einem neuen Körper, aber mit denselben wahnsinnigen Gedanken. Räum auf in deinem Geist und finde, was du wahrhaftig suchst!“
Ich erschrak fürchterlich. Mir wurde schlagartig bewusst, dass ich Verantwortung tragen musste. Das klingt simpel und es war auch so simpel. Ich hatte plötzlich eine andere Einsicht – so als hätte sich ein winziges Fenster geöffnet und ein Lichtstrahl wäre eingefallen. Ich wusste, es gibt für mich etwas zu tun, auch wenn ich noch immer keinen Plan hinter den Dingen sah. Ich nahm mir also die Worte zu Herzen, gab den Selbstmordplan auf und beschloss, weniger traurig zu sein und weniger ängstlich. Ich war der Stimme dankbar, weil sie mich auf eine andere Art zu trösten vermochte, die ich üblicherweise kannte. Gleichzeitig verdrängte ich sie, weil ich mit der übersinnlichen Erfahrung nicht klar kam.
So überlebte ich meine Jugend ohne jeden Selbstmordversuch, auch wenn dieser Gedanke nicht völlig verschwand. Aber ich hatte keinen Drang mehr, ihn auszuagieren.
Und so überlebte ich auch alles andere, was auf meinem Weg lag. Ich fühlte mich zwar weiterhin fremd in jeglicher Umgebung, mal mehr, mal weniger, aber ich begann, mich anpassen zu wollen. Anpassen an die Vorstellungen dieser Welt.
Ich verliebte mich, machte einen ordentlichen Schulabschluss und studierte mit Erfolg Sozialpädagogik, weil ich glaubte, ich müsste etwas Sinnvolles machen. Und anderen helfen schien mir da am besten geeignet.
Ich versuchte überall dort zu sein, wo man mich brauchte. Ich wollte gut sein und geliebt werden. So wurde mein Helfersyndrom geboren.
Das konnte ich auch gut einsetzen, nachdem meine Kinder geboren waren. So lenkte ich alle Aufmerksamkeit nach außen und überlegte, was in den unterschiedlichsten Situationen für alle Beteiligten das Beste war. Für alle, außer mir. Denn wer ich wirklich war und was ich selbst wollte, das wusste ich überhaupt nicht.
Mit Ende 30 entwickelte ich meine zweite Depression. Besser gesagt, ich öffnete den Käfig, in dem ich diese Trauer wie ein wildes Tier gebändigt hielt. Wenn das Fass mal wieder zum Überlaufen gebracht war, meinte ich, jetzt endlich mal nur an mich denken zu müssen. Da gab es in meinem Denken nur entweder oder, weiß oder schwarz. Ich las zahlreiche Selbstbehauptungsbücher, die mein Märtyrer-Ego aufpolieren sollten. Doch all die Ratschläge brachten nur kurzfristige Erleichterung und die verpuffte so schnell, wie sie gekommen war.
Mit 38 Jahren befand ich mich am selben Punkt wie mit 15. Dieselbe Depression hatte mich eingeholt. Ich war zwar scheinbar in einer anderen Situation, das sah aber nur äußerlich so aus. Der Schmerz, die Angst und die pure Verzweiflung waren absolut identisch.
Hatte ich denn gar nichts gelernt?
Ich hatte 23 Jahre Zeit gehabt, um in meinem Geist aufzuräumen.
Genutzt hatte ich das nicht. Ich war wie ein unwilliger Schüler gewesen. Und was passiert mit unwilligen Schülern? Sie bleiben sitzen. Und so steckte ich mitten in einer handfesten Midlife-Crisis. Herzlichen Glückwunsch…
Mein Mann und ich hätten eigentlich sehr glücklich sein können. Wir waren wie füreinander geschaffen und liebten uns. Wir hatten zwei süße und kluge Töchter, ein neues schönes Haus in einer tollen kindgerechten Siedlung. Bei uns war immer etwas los – viele spielende und lachende Kinder und eine warme fröhliche Atmosphäre. Mein Mann hatte einen langjährigen festen Job und war als Vater sehr präsent. Ich konzentrierte mich voll auf mein Muttersein und arbeitete maximal halbtags als Sozialpädagogin in der Sprachförderung für Vorschulkinder.
All das wollte ich so und ich war stets mit ganzem Herzen bei meiner Familie.
Trotzdem war da etwas falsch. Es fehlte etwas! Dieses Etwas, das irgendwie im Hintergrund da zu sein schien. Etwas, das ich nicht greifen konnte, auch wenn es manchmal ganz nah war.
Wie undankbar, könnte man sich denken. Aber es fühlte sich nicht richtig an, eher künstlich und aufgesetzt. Eine ganz natürliche Freiheit fehlte.
Es war, als würde man versuchen, das Meer in Flaschen abzufüllen.
Der Sommerurlaub kam mir gerade recht. Wir fuhren nach St.-Peter-Ording, auf einen Bauernhof an die Nordsee. Schon am ersten Tag fühlte ich meine Gliederschmerzen, unter denen ich öfter mal litt und sie wurden an der See nicht besser, sondern schlimmer. Irgendwie gab es einen Streit nach dem anderen und am dritten Tag passierte das Drama: Meine jüngste Tochter stürzte vom Pony und zog sich einen äußerst komplizierten Ellenbogenbruch zu. Das Gelenk war förmlich herausgerissen und hatte sich gedreht. Ihr Arm schwoll in Sekundenschnelle auf ein Dreifaches an. Sie schrie und heulte vor Schmerzen. Immer wieder rief sie: „Ich will sterben!“ Es war sehr dramatisch, und ich fühlte mich als Mutter völlig hilflos. In der Klinik war schnell klar: meine Tochter musste operiert werden und danach zunächst stationär bleiben.
Mein Mann fuhr mit unserer ältesten Tochter zurück auf den Hof. Ich blieb bei unserer Jüngsten. Sie hatte starke Schmerzmittel bekommen und war kaum noch ansprechbar, als ich sie noch bis zur OP-Tür begleiten konnte. Ich küsste sie, winkte und blieb allein im Flur zurück. Es war bereits später Abend und der Chefarzt war für die Not-OP gerufen worden, weil sich kein anderer Chirurg an diese komplizierte OP mit dem kleinen Kindergelenk traute.
Es war ein Albtraum – absolut!
Da stand ich nun, ganz allein. Um diese Uhrzeit lief keine Schwester auf dem Gang herum, keine Patienten. Ich setzte mich in den Wartebereich. Es war still. Und ich begann darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert war. Unser Urlaub war futsch. Meine fünfjährige Tochter wurde gerade narkotisiert und niemand konnte mir sagen, wie gut die OP gelingen würde und welche Folgeschäden es geben würde. Ich fühlte tiefe Verzweiflung.
Eine Verzweiflung, in die ich mich gerade ganz tief fallen ließ. Doch bevor ich auf dem Höllenboden aufschlug, stoppte das Szenario. Ich stoppte es mit einer glasklaren Entscheidung. Ich stoppte einen Film.
Ich tat etwas, was ich bis jetzt in meinem ganzen Ego-Leben und Habenwollen und Erwarten noch nie getan hatte.
Ich ließ los…
Es war kein aufgebendes Loslassen. Also kein Scheißegal-Sein, wie man es empfindet, wenn man sich selbst schützen will und völlig enttäuscht ist.
Es war ein vertrauendes Loslassen. Ich hatte ganz plötzlich eine Art Lücke in meinem Geist entdeckt, in der ich eine unglaubliche Präsenz und Gegenwart spüren konnte. Ich wusste ganz konkret, dass diese Lücke, dieses Schlupfloch immer schon da war, ich es aber in den meisten Fällen einfach übersehen hatte. Das wichtigste daran war aber die Erkenntnis, dass ich mich selbst dafür entscheiden musste. Und zum allerersten Mal entschied ich mich dafür!
Es war der 01. Juli 2008 spät am Abend und ich war augenblicklich Daheim!
Ich wurde still. Meine Gedanken hörten auf zu plappern. Ich konnte mir tatsächlich sagen, es ist alles gut. Es ist nichts bedroht!
In diesem Augenblick war ich voller Frieden und es war sogar Freude da. Auch die Angst um meine Kleine war vollstem Vertrauen in den Operateur gewichen.
In diesem wunderbaren Gewahrsein wurde die Tür hinter der Annahme geöffnet und ein älterer Herr in OP-Kleidung kam in den Raum.
„Sind Sie die Mutter? Ich habe Ihr Kind operiert. Es ist alles gut. Und obwohl diese Operation kompliziert war, ist mir etwas Unglaubliches gelungen… Es ist fast…ein Wunder…“
Wir standen uns gegenüber und seine hellblauen Augen strahlten mich voller Freude an. In dem Moment passierte etwas mit uns. Ich bin mir sicher, dass auch er das spürte. Wir waren im Geist für einen Augenblick verbunden und da war etwas Höheres bei uns. Dieses Gefühl des Einsseins und der tiefen Geborgenheit war so überwältigend, dass ich mir schwor, es niemals zu vergessen.
Ich bin nicht allein, niemals!
Ich wachte die ganze Nacht über mein Kind, obwohl ich hätte schlafen können, denn mir wurde ein Bett zur Verfügung gestellt. Ich war nicht müde. Aber ich war so froh. Nicht nur, weil die OP geglückt war, sondern auch, weil sich mein Geist wieder zu öffnen begann und ich eine Erfahrung gemacht hatte, die Worte nur ansatzweise umreißen können.
Ich hatte einen Augenblick in die Ewigkeit geblickt, in der es nur das pure Leben gibt. Ganz plötzlich war mir klar, dass Leben nichts anderes ist als Gegenwart, ganz in dieser Präsenz zu sein, Liebe zu fühlen – Liebe zu sein und mit dieser Liebe auch im Frieden und in der Freude. Ich wusste, an diesem Tag ist etwas mit mir passiert, das ich nicht mehr vergessen konnte. Es war ein Beginn. Der Beginn eines langen Heilungsprozesses.
Die Weggabelung
Der Unfalltag meiner Tochter war der Tag, an dem ich mit vorsichtig ausgestreckten Fühlern begann, einen neuen Weg einzuschlagen.
All die Jahre zuvor hatte ich Puzzleteile gesammelt, so wie ein Schmetterlingssammler Falter präpariert und hinter Glas setzt. Doch kann er die Tiere jemals fliegen sehen? Er begutachtet sie lediglich, betrachtet sie und liest sich allerlei Wissen an. Er bleibt in der passiven Rolle. Die leblosen Körper werden ihm nie die Freude machen und von Blume zu Blume tänzeln. Sie werden ihre bunten Flügel niemals flattern lassen und um seine Nase segeln. Geschweige denn ist der Sammler selbst der Schmetterling, der die Erfahrung der Leichtigkeit des Dahinschwebens macht.
Ich war wie dieser Schmetterlingssammler, betrachtend, staunend und passiv unbeweglich.
Nun wurde ich zum Schmetterling selbst. Ich schlüpfte vorsichtig aus meinem Kokon und begann endlich, endlich zu fliegen. Was mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar war: Ich bewegte mich zügig auf einem schmalen Weg genau auf die Gabelung zu, an der es kein Zurück mehr gibt.
Wir setzten unseren Urlaub trotz überdimensionalem Gips unseres Kindes fort und es war alles okay. Ja, das Wort „Okay“ drückt es passend aus. Es war nicht so, dass ich nun, als neugeborener Schmetterling zu Höhenflügen aufbrach oder wir als Familie in einen ungetrübten Glückszustand kamen. Es war eher eine Neutralität, die etwas Leichtes in sich trug. Im Laufe der nächsten Wochen war ich einfach wacher und aufmerksamer. Inwiefern da etwas mit mir passierte, war nicht greifbar und dementsprechend ist es nicht in Worte zu fassen. Am ehesten kann man es als Blickwinkeländerung bezeichnen. So als hätte ich mein Leben lang in einem Haus gewohnt und wäre nun in das neu gebaute Haus gegenüber gezogen. Mein altes Haus stand noch genauso da wie zuvor, ich aber konnte es von der anderen Seite betrachten. Und genau das tat ich jetzt ohne Unterlass. Ich betrachtete mein altes Leben. Das Leben, das sich in meinem Geist abspielte.
Immer öfter erwischte ich mich dabei, dass ich meine Gedanken beobachtete und dabei Erschreckendes bemerkte: Ich hasste, ich grollte, ich zürnte, ich tobte.
Beim Einkaufen begutachtete ich die Leute um mich, beim Arzt, in der City, in der Nachbarschaft, auf der Autobahn. Es dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde und mein Urteil stand. Ich wusste genau, was das für ein Typ war, der in meine Wahrnehmung kam, und ein Großteil schnitt übel ab. Auch wenn ich einen Menschen zu 99 Prozent positiv beurteilte, wie Freunde und Familie, so blieb das eine Prozent. Ein Prozent, den ich früher nicht bemerkt hatte. Ich empfand es sogar als liebevoll, einen Freund auf seine Fehler aufmerksam zu machen. Schließlich urteilte ich ja auch über mich und hatte selbst so viele Baustellen und war dankbar über Rückmeldungen, damit ich es besser machen konnte.
Nun – das war mein altes Leben. Mit meiner neuen - oder besser gesagt wiederentdeckten – Sensibilität erkannte ich, wie viel Wahrheit in dem alten Spruch steckt: Ratschläge sind auch Schläge.
Dass ich eine Angreiferin auf meine Umwelt war, erkannte ich am deutlichsten bei Spaziergängen mit unserem Hund. Es war banal und genau deshalb sah ich es so überaus deutlich. Ich stellte mir Menschen vor, die mich beschuldigten. Denn irgendwie fühlte ich stets eine latente nicht greifbare Schuld in mir. Es waren scheinbar harmlose Ideen, wie zum Beispiel die wieder kehrende Angst, ich würde dumm angequatscht werden, weil der Hund seinen Haufen in die Siedlung setzt. Und das, obwohl ich ganz demonstrativ einen Gassibeutel am Griff der Hundeleine trug. Daraufhin wurde ich wirklich des Öfteren angesprochen, ob ich denn auch die Hundekacke entfernen würde, ganz zu schweigen von den vielen vorwurfsvollen Blicken, die ich erntete. Das entfachte in mir nur noch mehr Wut. So erkannte ich zum ersten Mal ganz bewusst den Teufelskreis aus beschuldigen und beschuldigt werden. Ich ertappte mich dabei, dass ich auch ansonsten viele unfreundliche Gedanken in meinem Geist hegte: über Menschen, mich eingeschlossen, Situationen, Umstände, Orte.
Dieses Aufdecken von ablehnenden Gedanken machte mich fertig. Wieso war ich so voller Hass und Ablehnung? Wieso misstraute ich allen? Ich wusste nicht mehr, wer das eigentlich dachte. Es fühlte sich an, als wäre da ein fremdes Wesen in mir, das all diese Ideen in mir ausgesät hatte und dessen Saat nun prächtig wucherte. Das war doch nicht ich, die so bösartig dachte! Oder etwa doch?
Ich war total verunsichert und traurig. In dieser Zeit weinte ich sehr viel und wusste nicht, wie ich dieses Denken aufgeben konnte. Doch da war auch wieder die andere Stimme. Die Stimme, die mir gesagt hatte, ich könnte nicht sterben, die Stimme, der ich die Präsenz zuordnete, die so oft nachts bei mir war und die letztlich auch Wunderbares in der Klinik bewirkt hatte. Ich fühlte sie bei mir. Zeigte sie mir möglicherweise meinen Geisteszustand? Ich akzeptierte sie in meinem Leben und gab stillschweigend die Bereitwilligkeit zu lernen.
In meinem neuen Haus hatte ich nicht nur einen anderen Blick, ich hatte auch ein neues Fenster dazubekommen, das mich weiter denn je schauen ließ. Ich bekam innere Bilder. Es waren augenblickliche Visionen, die ich nie voraussagen oder erbitten konnte.
Einmal stand ich in der Küche und spülte ab, plötzlich hatte ich ein Bild vor Augen, das definitiv nicht von mir kam – also nicht willentlich erdacht oder fantasiert. Es war da, so wie wenn man das Fernsehgerät einschaltet. Ich sah den Doktor, meine Tochter und mich vor der Nordseeklinik stehen. Wir lächelten alle und hinter uns stand Jesus mit ausgebreiteten Armen, ebenfalls lächelnd. Dann verschmolz das Bild und ich konnte nur noch ein Lächeln wahrnehmen und solch tiefe Liebe, dass ich vor Rührung weinen musste.
Seit dem Urlaub waren einige Wochen vergangen. Mein Geist hielt Ausschau nach etwas anderem. Nach dem anderen. Instinktiv wusste ich, dass es da war. Natürlich war es da. Schließlich hatte ich genug Erfahrungen gesammelt mit dieser anderen Welt. Ich wusste nur nicht, was es war oder wo. Es war um mich, in mir und dennoch nicht greifbar.
Ich war neugierig auf das, was sich angekündigt hatte. Neugierig und sehr ungeduldig. So stürzte ich mich in Buchhandlungen, auf der Suche nach der Antwort. Bücher waren von jeher eine wichtige Quelle für mich gewesen. Sie waren mein Alpha und mein Omega. Ich hatte sozusagen eine Beziehung zu jedem Buch, das ich gerade las. Manchmal las ich auch zwei Stück parallel. Ich stellte mir vor, dass ich durch den Inhalt eines Buches eine gewisse Verbindung zu dem Schreiber aufbauen konnte. All die Ideen in all den tausenden von Büchern in zig Regalen faszinierten mich einfach und so nutzte ich mal wieder mein eingebautes Ortungssystem. Ich konnte nämlich jedes Buch finden, das ich lesen sollte, das mich weiterbrachte in meinem Lernen. Ich musste mich nur in die Mitte einer Buchhandlung oder Bücherei stellen und meine Gedanken zum Schweigen bringen. Dann wurde ich von dem richtigen Buch angezogen wie ein Magnet. Ich lief los und ziemlich zielstrebig auf das für mich gerade wertvolle Buch zu. Das funktionierte und zwar zu 100 Prozent. Jedes Buch, das ich je las, brachte mich weiter. Sogar die Bücher, die sich viel später als leeres Geplapper herausstellten. Heute weiß ich, ich konnte zu einer gewissen Zeit nur gewisse Dinge lernen. Dazu gehörte auch ein Ausschlussverfahren.
Dieses Mal funktionierte es nicht. Zum ersten Mal! Da war nichts. Kein kleinstes Zucken in irgendeine Richtung. Stattdessen die tröstende Stimme, die mich um Geduld bat. Ich war enttäuscht und verunsichert. Auch weil ich nicht wusste, ob diese innere Stimme eine von mir erzeugte war. Sie kam jedes Mal plötzlich und überraschte mich, aber sie kam ja aus meinem Inneren, war also in meinem Kopf, in meinen Gedanken.
An einem Samstagabend im Spätsommer des Jahres 2008 war ich noch lange Zeit wach, nachdem meine Familie schon schlafen gegangen war. Es war recht warm und der klare Nachthimmel hing voller funkelnder Sterne. Er wirkte wie ein schweres Samtgewand mit aufgesetzten Diamanten. Ich trat auf die Terrasse hinaus und schaute nach oben. Es war so wunderschön und ich fragte mich, was wohl hinter all dem da oben steckte.
Plötzlich hatte ich das starke Bedürfnis, mit Gott zu sprechen. Gleichzeitig zweifelte ich an seiner Existenz, denn irgendetwas schien nicht zu stimmen mit der Schöpfung und dem angeblich allmächtigen Schöpfer. Hier war alles so zerbrechlich, so vergänglich. Brauchte dieses Gottwesen wirklich Milliarden von angreifbarer Menschen, Tiere und Pflanzen, die zu jeder Zeit wegen jedem Dreck zu Staub zerfallen konnten? Und war es sein Wunsch, dass wir ihn anbeten sollten? War er wirklich so eitel? Und dass Religionen gegeneinander kämpfen sollten? Hier war alles dem Tod geweiht. Oberflächlich wirkte der Planet Erde einladend, eine wunderschöne blaue Kugel mitten im stockfinsteren Universum. Aber man musste gar nicht lange suchen und schon war er da, der Haken. Auf jedem Quadratmeter Rasen tobt ein mikroskopisch kleiner Krieg. Jeder Wurm kämpft ums Überleben. Hier wird alles geboren und alles wird wieder sterben.
„GOTT!“, schrie ich sehr laut. Laut in meinem Geist. Mein Mund blieb fest geschlossen, denn ich hatte nicht vor, meine Nachbarn zu beunruhigen.
„GOTT! WAS SOLL DER GANZE SCHEISS!?“
Meine geistige Stimme schrie hinauf zu den Sternen. Ich fragte mich, ob Gott womöglich gar nicht da oben war. Was, wenn er hier neben mir auf der Terrasse stand? Ja, ich hatte ein oder zwei Gläser Wein getrunken. Dennoch war ich bei klarem Verstand. Ich bemerkte, dass es mich Mut kostete, so mit dem Schöpfer zu reden. Immerhin war das doch der, der den Menschen eine Sintflut geschickt hatte und eine Heuschreckenplage. Nicht zuletzt hatte er seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen – für was eigentlich? Für die Sünden seiner anderen Kinder?
Mir kam eine Familie mit einigen Kindern in den Sinn. Ich stellte mir vor, dass alle Töchter und Söhne ganz schrecklich wären. Sie beklauten die Eltern, schlugen und beschimpften sich gegenseitig, quälten die Haustiere, schwänzten die Schule. Alle taten das, bis auf einen. Der half den Eltern, wo er nur konnte, war ein guter Schüler, ein liebevoller Sohn. Und was taten die Eltern? Sie griffen sich den sanften Sohn und brachten ihn um. Als Opfer für all ihre schlechten Kinder! Der Gute musste für die Bösen sterben? Und das hat ihn, den Vater, glücklich gemacht? Wirklich? Ich würde sagen, das schreit nach Jugendamt! Wieso hinterfragte das keiner? Bei dieser Art von Vater musste ich ständig im Ungewissen sein. Wann würde ich geprüft werden? Wann müsste ich dran glauben? In seinem Namen…
Sie war schon komisch diese Situation und auch ein wenig theatralisch. Hätte ich allein auf einem Berg gestanden, hätte ich die Worte mit meiner menschlichen Stimme herausgebrüllt. Ich bemerkte aber, dass es da gar keinen Unterschied gab. Ich konnte ebenso mit meinem Geist brüllen. Und jetzt wollte ich es wissen. Wollte wissen, wer mich da seit fast 40 Jahren dermaßen verarschte. Also bat ich um das, worum ich längst hätte bitten sollen:
„GOTT! WENN ES DICH GIBT, DANN SAG MIR DIE WAHRHEIT!“
Ja, das war es auf den Punkt gebracht. Ich hatte keinen Bock mehr auf Puzzleteile. Das dauerte mir zu lange. Ich wollte das fertige Bild sehen. Jetzt! Nach dieser eindringlichen Bitte war ich so ausgepowert, als hätte ich einen Marathon gelaufen. Ich ging ziemlich gefühllos ins Haus und ins Bett…
Drei Tage später bekam ich die Antwort…
Es ist nicht so, dass ich darauf gewartet hätte. Und wenn, dann vielleicht als Metapher in einem Buch oder so. Etwas, was man zunächst glücklich als Wunder begreift, um es später mit Zweifeln zu wiederlegen. So, wie ich bis jetzt durch das Leben gegangen war mit meinen Puzzleteilen.
Aber nein, ich bekam eine ziemlich direkte Antwort. Die Antwort kam durch eine Bekannte. Unsere Kinder gingen gemeinsam in die erste Klasse. Vorher hatten sie schon im Kindergarten zusammen gespielt. Die Mutter und ich pflegten normalerweise einen gewissen Smalltalk. Das war es schon, nicht mehr und nicht weniger.
Dieses Mal war alles anders. Ich traf sie in einem Spielwarengeschäft in unserer Heimatstadt. Ich hatte sie schon gesehen, als ich hineinging. Sie drehte mir zunächst den Rücken zu. Doch ganz plötzlich wendete sie sich abrupt um und sah mich. Sie schaute mich an, anders als sonst. Es wirkte, als habe sie mein Kommen bereits erwartet. Ein Schauer lief über meinen Rücken. Diese Begegnung war merkwürdig und schräg. Ich wäre gerne geflohen. Das verbat mir mein Anstand und so sagte ich stattdessen schüchtern: „Hallo“, winkte von weitem und wollte mich irgendwie verdrücken. Doch sie war schneller. Sie kam auf mich zu, ohne Begrüßung, packte mich bei den Schultern und fragte: „Du willst die Wahrheit hören?“
Ich zuckte zusammen, konnte es kaum glauben, versuchte etwas zu stammeln.
Sie wartete keine Antwort ab: „Ich habe neulich am Abend deinen Hilferuf wahrgenommen und wenn du willst, bin ich für dich da.“
„Du hast was?“, flüsterte ich und mein Magen schien sich umzudrehen. Sie konnte unmöglich mein Gebet im Garten meinen. Oder sollte ich eher sagen, meine gebrüllte Forderung? Hatte ich versehentlich doch laut geschrien und sie war in der Nähe gewesen? Nein, ich war mir sicher, dass es nur Gedanken waren, wenn auch sehr laute… Vielleicht war das jetzt alles nur ein Missverständnis. Vielleicht meinte sie etwas anderes? Vielleicht drehte sie durch? Drehte ich durch? Oder gar wir beide? Wie hing das alles zusammen?
Es stellte sich schnell heraus, dass wir im Geist tatsächlich kommuniziert und sie das in der Tat gehört hatte, was ich da in das Universum posaunte.
Der Tag war der Beginn einer regen Freundschaft. Wobei das Wort Freundschaft unser Tun gar nicht ausdrücken kann. Für mich war diese intensive Beziehung der direkte Weg, um endlich meinen Geist weiter zu öffnen. Für das, was wahrhaftig ist, und um das aufzugeben, was mich zurückhielt in meinem wahren Lernen.
Wir trafen uns oft und regelmäßig über einige Monate. Und es wurde zur tiefsten Erfahrung, die ich fähig war bis zu diesem Zeitpunkt zuzulassen.
Ich akzeptierte diese Bekannte schließlich als meine Lehrerin. Sie führte mich ein in ihr Wissen über Engel, Channelings und Geistheilung. Sie bezeichnete sich selbst als Geistheilerin und wir erlebten zusammen Erstaunliches, Übersinnliches und Grandioses. Oft waren noch andere Eingeweihte mit von der Partie und ich genoss unseren wunderbaren Zirkel. Mein Glaube, dass es mehr gibt, als wir mit den Augen sehen können, festigte sich. Zu viele Dinge passierten, als dass