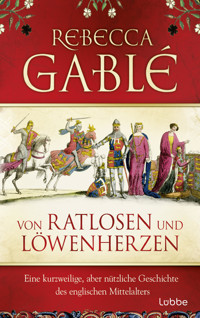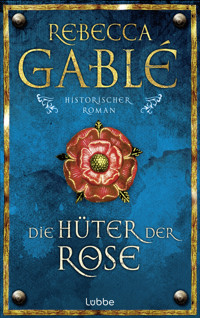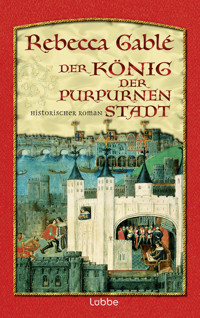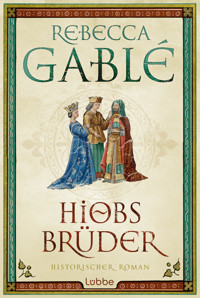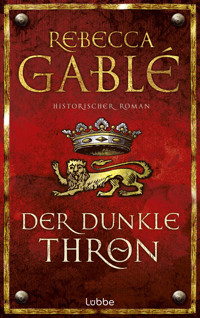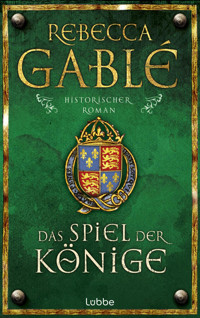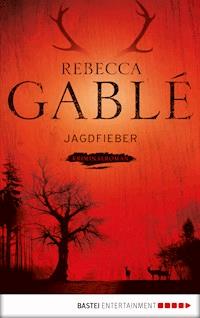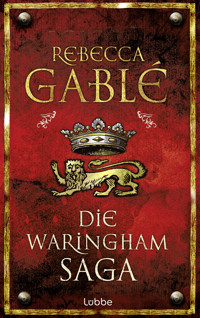Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Waringham Saga
- Sprache: Deutsch
England 1360: Nach dem Tod seines Vaters, des wegen Hochverrats angeklagten Earl of Waringham, zählt der zwölfjährige Robin zu den Besitzlosen und ist der Willkür der Obrigkeit ausgesetzt. Besonders Mortimer, der Sohn des neuen Earls, schikaniert Robin, wo er kann. Zwischen den Jungen erwächst eine tödliche Feindschaft.
Aber Robin geht seinen Weg, der ihn schließlich zurück in die Welt von Hof, Adel und Ritterschaft führt. An der Seite des charismatischen Duke of Lancaster erlebt er Feldzüge, Aufstände und politische Triumphe - und begegnet Frauen, die ebenso schön wie gefährlich sind. Doch das Rad der Fortuna dreht sich unaufhörlich, und während ein junger, unfähiger König England ins Verderben zu reißen droht, steht Robin plötzlich wieder seinem alten Todfeind gegenüber ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:12 Std. 26 min
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Titel
DRAMATIS PERSONAE
Karte
Widmung
1360–1361
1366–1370
1376–1381
1385–1389
1397–1399
Nachbemerkung
Zeittafel
Das Haus Plantagenet
Das Haus Lancaster
Über Rebecca Gablé
Hat es dir gefallen?
Impressum
Über dieses Buch
EIN FASZINIERENDES RITTEREPOS VOR DEM HINTERGRUND GROSSER GESCHICHTE
England 1360: Nach dem Tod seines Vaters, des wegen Hochverrats angeklagten Earl of Waringham, zählt der zwölfjährige Robin zu den Besitzlosen und ist der Willkür der Obrigkeit ausgesetzt. Besonders Mortimer, der Sohn des neuen Earls, schikaniert Robin, wo er kann. Zwischen den Jungen erwächst eine tödliche Feindschaft.
Aber Robin geht seinen Weg, der ihn schließlich zurück in die Welt von Hof, Adel und Ritterschaft führt. An der Seite des charismatischen Duke of Lancaster erlebt er Feldzüge, Aufstände und politische Triumphe – und begegnet Frauen, die ebenso schön wie gefährlich sind.
Doch das Rad der Fortuna dreht sich unaufhörlich, und während ein junger, unfähiger König England ins Verderben zu reißen droht, steht Robin plötzlich wieder seinem alten Todfeind gegenüber …
REBECCA GABLÉ
DAS LÄCHELNDERFORTUNA
Historischer Roman
DRAMATIS PERSONAE
Es folgt eine Aufstellung der wichtigsten Figuren in möglichst sinnvoller Anordnung, wobei die historischen Personen mit einem * gekennzeichnet sind. Stammbäume der Häuser Plantagenet und Lancaster sowie eine Übersicht über die historischen Ereignisse finden sich im Anhang.
Robert of Waringham, genannt Robin
Agnes, seine Schwester
Isaac, sein Freund, möglicherweise sein Bruder
Conrad, Stallmeister von Waringham
Maria, seine Frau
Elinor, ihre Tochter
Stephen, Conrads rechte Hand
Geoffrey Dermond, Earl of Waringham
Matilda, seine Frau
Mortimer, ihr Sohn
Blanche Greenley, Mortimers Frau
Mortimer, ihr Sohn
Alice Perrers*, Matildas Nichte
Leofric, der Findling
Edward III.*, König von England
Edward of Woodstock, der Schwarze Prinz*, sein ältester Sohn
John of Gaunt*, Duke of Lancaster, sein mächtigster Sohn
Edmund of Langley*, später Duke of York, sein dümmster Sohn
Thomas of Woodstock*, später Duke of Gloucester, sein gefährlichster Sohn
Joan of Kent*, Gemahlin des Schwarzen Prinzen
Richard of Bordeaux*, ihr Sohn, später Richard II.
Blanche of Lancaster*, Lancasters erste Gemahlin
Henry Bolingbroke*, ihr Sohn
Constancia von Kastilien*, Lancasters zweite Gemahlin
Katherine Swynford*, Lancasters Geliebte und dritte Gemahlin
John Beaufort*, ihr Sohn
Henry Beaufort*, später Bischof von Lincoln, ihr Sohn
Henry of Monmouth*, genannt ›Harry‹ of Lancaster,
Sohn Bolingbrokes und seiner Gemahlin Mary Bohun*
Oswin, der Taugenichts
Gisbert Finley, Robins Cousin
Thomas, Joseph und Albert, seine Brüder
Giles, Earl of Burton
Giles, sein Sohn
Joanna, seine Tochter, Robins Gemahlin
Anne, Edward und Raymond, ihre Kinder
Christine und Isabella, Joannas Schwestern
Luke, der Schmied
Hal, der Stallknecht
Francis Aimhurst, Robins Knappe
Tristan Fitzalan, jüngster Sohn des Earls of Arundel*,
ebenfalls Robins Knappe
Henry Fitzroy, ein walisischer Ritter
Peter de Gray, ein verrückter Ritter
Geoffrey Chaucer*, Dichter, Diplomat und Hofbeamter
Roger Mortimer*, Earl of March
Peter de la Mare*, seine rechte Hand
Henry Percy*, Marschall von England und
Earl of Northumberland
Henry ›Hotspur‹ Percy*, sein Sohn
Thomas Beauchamp*, Earl of Warwick, Appellant
William Montagu*, Earl of Salisbury
Thomas Holland*, Earl of Kent, König Richards Halbbruder
John Holland*, sein Bruder
Robert de Vere*, Earl of Oxford, später Marquess of Dublin und Duke of Ireland
Sir William Walworth*, Bürgermeister von London
Sir Robert Knolles*, Glücksritter
Sir Patrick Austin, sein unehelicher Sohn, Befehlshaber der königlichen Leibwache
Wat Tyler*, Bauernführer
Richard Fitzalan*, Earl of Arundel, Appellant
Thomas Mowbray*, Earl of Northampton, später Duke of Norfolk, Appellant
Thomas Hoccleve*, Dichter, Hofbeamter und zumindest in jungen Jahren ein Taugenichts
Jerome of Berkley, Abt von St. Thomas
Bruder Anthony, der Zorn Gottes
Vater Gernot, Dorfpfarrer von Waringham
Vater Horace, Dorfpfarrer von Fernbrook
William Wykeham*, Bischof von Winchester
Dr. John Wycliffe*, Kirchenreformer, Professor in Oxford, vielleicht ein Ketzer
Lionel, sein Schüler, Robins Schulfreund
Simon Sudbury*, Erzbischof von Canterbury und Kanzler von England
William Courtenay*, Bischof von London, später Erzbischof von Canterbury
William Appleton*, Franziskaner, Lancasters Leibarzt und Ratgeber
John Ball*, vox populi
Thomas Fitzalan*, Bischof von Ely, später Erzbischof von York
Für
MJM
I am derely to yow biholde
Bicause of your sembelaunt
And euer in hot and colde
To be your trwe seruaunt.
Der jammervollen Welten Wandlungen
Zum Guten wie zum Üblen, bald Elend, bald Ehre
Ohne alle Ordnung oder weisen Ratschluß
Sind sie bestimmt von Fortunas Wankelmut.
Und dennoch, ihr Mangel an Gnade
Wird mich nicht hindern zu singen, müßt ich auch sterben
All meine Zeit und mein Schaffen sind verloren
Doch letztlich, Fortuna, werde ich Dir trotzen
Noch ist mir das Licht meines Geistes geblieben
Freund und Feind zu erkennen in Deinem Spiegel
Das hat Dein Drehen und Winden,
Dein Auf und Ab mich gelehrt.
Doch wahrlich, keine Macht hat Deine Arglist
Über den, der sich selbst beherrscht
Meine Duldsamkeit soll mein Trost sein
Denn letztlich, Fortuna, werde ich Dir trotzen
Geoffrey Chaucer
1360–1361
»Wenn sie uns erwischen, wird es sein, als sei das Jüngste Gericht über uns hereingebrochen«, prophezeite Lionel düster. Sein rundes Jungengesicht wirkte besorgt, und er schien leicht zu frösteln. Eine schwache Brise bauschte seine Novizenkutte auf.
»Du kannst immer noch umkehren«, erwiderte Robin kühl. Er war beinah einen Kopf größer als sein gleichaltriger Schulkamerad, und er nutzte diesen Größenunterschied, um verächtlich auf ihn hinabzublicken.
Lionel war oft der verzagtere und immer der vernünftigere von beiden. Doch seine Furcht, vor seinem Freund an Gesicht zu verlieren, war größer als die vor den möglichen Folgen ihres Unterfangens. »Wofür hältst du mich?«
»Das kommt darauf an …«
Sie grinsten sich zu. Robin konnte das Gesicht seines Freundes schwach erkennen, und er sah seine Zähne aufblitzen. Die Nacht war nicht dunkel, denn in zwei Tagen war Vollmond. Zu ihrer Rechten erahnten sie die Umrisse des Kapitelsaals, wo die Mönche ihre täglichen Versammlungen abhielten. Er bildete die nördliche Begrenzungsmauer des Kreuzganges. Genau vor ihnen lag der schnurgerade Weg zum Haupttor. Die alten Linden, die ihn säumten, standen reglos in der Finsternis, wie eine Reihe Soldaten vor einem Nachtangriff. Robin und Lionel nahmen diesen Weg jedoch nicht. Lautlos überquerten sie den grasbewachsenen Innenhof, umrundeten den Fischteich und glitten schließlich in den schwarzen Schatten der Klostermauer, die sich zu beiden Seiten erstreckte und nach ein paar Ellen mit der Dunkelheit verschmolz.
Lionel ging drei Schritte nach rechts und blieb dann stehen. »Hier ist es am besten«, wisperte er. »Auf der anderen Seite steht ein Baum, an dem wir hinunterklettern können.«
Robin sah an der Mauer hinauf und nickte. »Du zuerst.«
Er machte eine Räuberleiter, und Lionel legte eine Hand auf seine Schulter, stellte den rechten Fuß in Robins ineinander verschränkte Hände und stieg hoch. Er bekam die Mauerkante zu fassen und zog sich mit seinen kräftigen Armen hinauf. Dann brachte er sich in eine sitzende Haltung, ließ die Beine baumeln und spähte hinunter. »Und jetzt?«
»Leg dich auf den Bauch, laß die Beine zur anderen Seite hinunterhängen und zieh mich hoch. Ganz einfach.«
»O ja. Wirklich ganz einfach. Warum lasse ich mich nur immer auf deine Torheiten ein, Waringham, kannst du mir das sagen?«
Robin streckte ihm die Hand entgegen. »Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt?«
Lionel wußte wie so oft keine Antwort. Er packte zu, und schließlich saßen sie beide keuchend oben auf der Mauer. Sie spürten nicht mehr, daß die Septembernacht kühl war, sie waren sogar ein bißchen ins Schwitzen gekommen. Also verschnauften sie einen Augenblick.
Der Baum war eine uralte Weide. Sie überragte die Klostermauer ein gutes Stück, und ihre zahlreichen knorrigen Äste reichten fast bis zum Boden. Man konnte daran hinabklettern wie an einer Leiter. Die Äste ächzten leise, und das Laub raschelte, als die beiden Ausreißer sich an den Abstieg begaben. Ein paar lange, schmale Blätter schwebten lautlos zu Boden.
»Ich hoffe nur, Oswin hat unsere Verabredung nicht verschlafen«, raunte Robin. »Dann war die ganze Mühe umsonst.«
»Wehe«, schnaubte Lionel. »Ich schlag’ ihm seine Pferdezähne ein, wenn er uns versetzt!«
»Ho, Mönchlein, große Worte für eine halbe Portion wie dich«, ertönte plötzlich eine leise Stimme hinter ihnen. »Hier bin ich schon.« Aus dem Schatten löste sich eine dunkle Gestalt und kam auf sie zu.
»Ich wünschte, du würdest mich nicht immer so nennen.« Lionel seufzte unglücklich.
»Wie? Mönchlein? Aber das bist du doch, oder etwa nicht?« Er beachtete Lionel nicht weiter und schlug Robin freundschaftlich auf die Schulter. »Waringham, alter Galgenvogel. Laß uns zuerst das Geschäft erledigen, wenn’s dir recht ist.«
Sein Ton hatte sich leicht verändert. Seit Oswin in den Stimmbruch gekommen war und seine Schultern so breit wie die seines Vaters geworden waren, war er für die Klosterschüler ein gottähnliches Idol, das sie mit unerschütterlicher Hingabe verehrten. Oswin behandelte sie dementsprechend mit gebotener Herablassung. Sein Vater war Stallknecht und kümmerte sich um die kleine Schar Pferde und Maultiere, die die Abtei von St. Thomas besaß. Seit er im Krieg gewesen war, trank er, und es war Oswin, der den Großteil der Arbeit erledigte. Er schuftete von früh bis spät, bereitete für sie beide die Mahlzeiten, wurde nicht selten am Abend ins Wirtshaus gerufen, um seinen betrunkenen Vater abzuholen, und erntete gelegentlich zum Dank ein blaues Auge. Niemand dachte im Traum daran, ihn zur Schule zu schicken, ihn lesen zu lehren und all die anderen Dinge, die die Schüler des klösterlichen Internats lernten. Oswin würde immer bleiben, was er war. Und trotzdem beneideten sie ihn, die Söhne von Landadeligen und reichen Kaufleuten. Um seine Freiheit und seine prahlerische Männlichkeit.
Nur auf Robin hatte er weder mit Großspurigkeit noch mit seinen meist gutmütigen Einschüchterungen Eindruck machen können. Vielleicht war das der Grund, warum er den jungen Waringham von all diesen kleinen Bücherwürmern am liebsten mochte und ihm allein Zugang zum Pferdestall gestattete.
Robin legte einen Farthing in Oswins ausgestreckte Hand. Sein Gegenüber ließ die kleine Münze mit einem zufriedenen Grinsen verschwinden. »Ziemlich knauserig für einen reichen Mann.«
Robin schüttelte kurz den Kopf. »Bringst du uns dafür hin oder nicht?«
Oswin tat, als zögere er. Als er feststellte, daß Robin nicht noch einmal in die kleine Tasche am Ärmel seiner Kutte greifen würde, brummte er mit gespielter Verstimmtheit: »Meinetwegen. Dann kommt.«
Er wandte ihnen seinen breiten Rücken zu, und die beiden Jungen folgten ihm eilig. Sie liefen etwa eine Meile über die feuchten Wiesen, die das Kloster umgaben. Dann gelangten sie an ein kleines Flüßchen, das sie auf einem Holzsteg überquerten. Dahinter erhoben sich die ersten Häuser von Curn, einem kleinen Dorf, kaum mehr als ein Weiler, wo die Bauern lebten, die die klösterlichen Felder bewirtschafteten. Oswin führte sie auf einem staubigen Weg an der armseligen Holzkirche vorbei, am Haus des Dorfpfarrers und dem Wirtshaus. Damit ließen sie den Dorfplatz hinter sich, und die Häuser wurden wieder spärlicher.
Sie sprachen nicht, und es gab auch nichts zu bereden. Das Geschäft mit Oswin war über mehrere Wochen verhandelt worden und vor zwei Tagen zum Abschluß gekommen. Er hatte seinen Lohn, und er wußte, was sie dafür wollten. Weder Robin noch Lionel verspürten Neigung, dem anderen einzugestehen, daß sie weiche Knie hatten und kaum genug Spucke im Mund, um zu schlucken.
Plötzlich hielt Oswin an. »Hier ist es«, raunte er. »Wartet hier. Und seid um Himmels willen leise!«
Er hatte sie zu einem kleinen Holzhaus gebracht, das noch armseliger schien als die anderen. Das Dach neigte sich in einem verwegenen Winkel, als wolle es jeden Moment abstürzen. Es gab keinen Kamin. Nur ein einziges Fenster neben der Tür gähnte sie schief an wie das Maul eines Ungeheuers. Ein wenig Rauch und zuckendes Licht drangen heraus.
Oswin näherte sich weder Fenster noch Tür. Er trat statt dessen an die Rückwand des Häuschens, beugte sich ein wenig vor und stand dann still. So verharrte er so lange, bis die beiden Jungen ungeduldig wurden. Magisch angezogen traten sie näher.
»Was ist?« flüsterte Robin, heiser vor Aufregung.
Oswin wandte sich zu ihm um und legte einen Finger an die Lippen. »Jungs, ihr kriegt wirklich was geboten für euer Geld«, versprach er tonlos. Dann winkte er sie näher und wies mit den Zeigefingern auf zwei Astlöcher in der Wand, nahe nebeneinander, eins höher, das andere niedriger. Ermutigend klopfte er Robin die Schulter und schlenderte anschließend Richtung Wirtshaus davon, zweifellos, um festzustellen, wie betrunken sein Vater inzwischen war.
Robin überließ Lionel das niedrigere Loch, lehnte behutsam die Stirn an die rohe Holzwand und spähte durch die höhere Öffnung hinein. Zuerst konnte er nicht viel erkennen. Drinnen schien es dunkler zu sein als hier draußen. Er war enttäuscht und erleichtert zugleich. Gerade, als er sich abwenden und von Oswin sein Geld zurückfordern wollte, erhaschte er eine Bewegung. Und dann erkannte er mit einemmal Formen und hielt den Atem an.
Das Häuschen bestand nur aus einem einzigen Raum. Nahe der Tür befand sich eine kleine Kochstelle. Das Holz war fast heruntergebrannt, nur hier und da züngelten noch Flammen aus der Glut. An der Wand zur Linken war ein Bett, ein üppiges Strohlager mit einer Wolldecke darauf. Und auf dem Bett saß Emma, die Witwe des Kuhhirten, der diese jämmerliche Hütte gehörte. Es hieß, sie sei siebzehn gewesen, als ihr Mann vor zwei Jahren von einem wilden Stier aufgespießt worden war, und es hieß weiter, daß Emma sich ihre Witwenschaft nicht sonderlich zu Herzen nahm. Sie war eine lebenslustige junge Frau, und sie war wunderschön. Die Schüler von St. Thomas ließen sich keine Gelegenheit entgehen, einen Blick auf sie zu werfen, wenn sie gelegentlich sonntags das Hochamt in der Klosterkirche besuchte, und tagelang schwärmten sie heimlich oder offen von dem, was sie gesehen hatten.
»Was betet ihr sie aus der Ferne an?« hatte Oswin halb verächtlich, halb belustigt gefragt. »Für einen halben Penny könnt ihr sie haben.«
Sie hatten nicht so recht verstanden, was er meinte, und Bruder Anthony hatte ihre Unterhaltung unterbrochen und Oswin vom Schulgelände gejagt, ehe sie ihn um eine Erklärung bitten konnten. Doch Oswin hatte offenbar recht gehabt. Denn Emma war nicht allein. Und sie war nackt.
Fassungslos starrte Robin auf ihre großen Brüste, die ihm riesig vorkamen, wie Euter. Er dachte an den verstorbenen Kuhhirten und unterdrückte ein nervöses Kichern. Ihre Haut erschien im schwachen Feuerschein kupferfarben, die Höfe und Warzen ihrer großzügigen Brüste schwarz. Nicht zum erstenmal spürte Robin dieses unerklärliche, herrliche und gleichzeitig schreckliche Gefühl irgendwo tief unten in seinem Körper. Aber es war noch nie so heftig gewesen. Er glaubte, das Gefühl wolle ihn in die Knie zwingen, es war, als müsse er sich zusammenkrümmen.
Der Mann, der neben dem Bett stand, war Cuthbert der Schmied. In der schwachen Glut zeichneten sich die mächtigen Muskeln seiner Arme und Schultern deutlich ab, und Robin glaubte zu erkennen, daß Emmas Blick bewundernd darüberstreifte. Cuthbert sah auf sie hinunter, offenbar ebenso gebannt wie Robin. Dann erwachte er zum Leben. Er legte die Hände auf ihre Brüste, und Emma ließ sich zurückfallen, bis sie ausgestreckt auf dem Rücken lag, ihre kastanienfarbenen Locken umgaben ihr Gesicht wie ein dunkler Schleier. Sie schloß die Augen, und ihr wunderbarer, kirschroter Mund lächelte zufrieden, während die rauhen Hände des Schmieds sanft über ihre Haut glitten. Dann ließ er sie plötzlich los, legte die Hände auf ihre angewinkelten Knie und schob sie auseinander. Robin stockte beinah der Atem. Gleich darauf verdeckte der breite Körper des Mannes dem Jungen die Sicht. Der Schmied legte sich zwischen Emmas Beine, und sofort begannen die beiden Körper, sich in einem langsamen, wunderbar harmonischen Rhythmus zu bewegen. Robin wußte, was sie taten. Der Unterschied zu Kühen oder Schafen oder Pferden war nicht so groß, daß er es nicht verstanden hätte, trotzdem war es völlig anders. Ihm wurde ungeheuer heiß. Der Rhythmus der beiden Körper wurde schneller und schneller, bis sie zuckten und sich wanden und ein bißchen grotesk wirkten. Und dann hörte er einen seltsamen Laut. Er verstand nicht gleich, was es war. Aber dann erklang der Laut wieder, diesmal lauter. Sie stöhnte. Und dann stöhnte er auch. Aber es war nicht, als hätten sie Schmerzen. Es war, als ob … als ob … Er fand kein Wort dafür.
Seine Handflächen, die er links und rechts neben den Kopf an die Wand gelegt hatte, waren feucht. Seine Augen brannten. Er wußte nicht, wie lange er schon starrte, ohne zu blinzeln. Und dann lag plötzlich eine energische Hand auf seiner Schulter und riß ihn von dem Astloch weg.
Robin fuhr entsetzt zusammen und unterdrückte im letzten Moment einen Laut. Erwischt! dachte er wütend. Sie haben uns erwischt!
Aber es war nur Lionel. Er starrte ihn mit riesigen Augen an, und sein Gesicht schien im fahlen Mondlicht kalkweiß. Wortlos zerrte er Robin von der Hauswand weg, bis sie außer Hörweite waren.
»O mein Gott, ist mir schlecht«, keuchte Lionel gepreßt.
»Was? Warum?« fragte Robin verständnislos. Er war immer noch benommen, halb dankbar, daß er dem beunruhigenden Schauspiel nicht länger folgen mußte, halb enttäuscht.
Lionel schüttelte sich unwillkürlich. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nichts so Abscheuliches gesehen!«
Robin schwieg betroffen. Er hatte es nicht abscheulich gefunden. Keineswegs.
»Jetzt verstehe ich, was die Brüder meinen, wenn sie von der Sünde des Fleisches reden. Wer das tut, muß einfach in die Hölle kommen!«
»Blödsinn. Was, glaubst du, haben deine Eltern gemacht, bevor du geboren wurdest?«
Lionel war schockiert. »Bestimmt nicht das!«
Robin grinste vor sich hin. »Also ehrlich, manchmal bist du wirklich zu dämlich.«
»Was soll das heißen? Was willst du über meine Eltern sagen?«
Robin hörte deutlich den drohenden Unterton. »Gar nichts.« Er hob begütigend die Hände. »Nur, daß es natürlich ist. Alles Leben entsteht so. Es ist nicht schmutzig. Das reden sie uns nur ein. Und der Teu… ich meine, ich wüßte zu gerne, warum.«
»Es ist nicht natürlich«, widersprach Lionel heftig. »Es ist falsch und sündig. Die Frauen sind daran schuld. Sie tragen immer noch die Sünde Evas mit sich. Das sagt Bruder Philippus. Und jetzt glaube ich das auch. Wie sie ihn angesehen hat! So voller … Gier! Und wie kalt sie gelächelt hat. Was für eine Hexe sie doch ist. Ich weiß nicht, wie sie mir je gefallen konnte. Nein, ich glaube, jede Frau ist mit Satan im Bunde.«
Was Lionel sagte, hörte Robin nicht zum erstenmal. Bruder Philippus hatte ihnen aus vielen Büchern gelehrter Männer vorgelesen, die alle das gleiche sagten. Aber er konnte es einfach nicht glauben. Er dachte immer an seine Mutter, wenn er hörte, daß alle Frauen sündig seien, daß sie von Natur aus größere Sünder seien als Männer, daß sie überhaupt die Sünde in die Welt gebracht hatten und daß eigentlich nur Jungfrauen in den Himmel kommen konnten. Dazu zählte seine Mutter eindeutig nicht, denn sie war verheiratet gewesen und hatte fünf Kinder geboren. Aber sie war ihm trotzdem immer als das vollkommenste aller Wesen erschienen, klug und schön und liebevoll. So hatte er sie jedenfalls in Erinnerung. Und als Bruder Philippus ihnen zum erstenmal von der Sünde aller Frauen vorgelesen hatte, hatte er die ganze Nacht wachgelegen und gebetet, Gott möge bei seiner Mutter eine Ausnahme machen. Die Vorstellung, daß sie im ewigen Feuer der Hölle brennen könnte, jetzt und bis in alle Ewigkeit, hatte ihn ganz krank gemacht.
Das war schon über vier Jahre her. Damals war er noch ein kleiner, leichtgläubiger Bengel gewesen, und seine Mutter war erst kurz zuvor gestorben. Heute glaubte er längst nicht mehr alles, was die Brüder ihnen auftischten. Trotzdem verspürte er ein leichtes Unbehagen. Er hatte den Anblick von Emma und Cuthbert nicht als abstoßend empfunden, im Gegenteil. Er hatte sich ein bißchen geschämt, weil er spionierte, weil er etwas ansah, das ganz gewiß nicht für fremde Augen bestimmt war. Aber was sie taten, erschien ihm nicht sündig. Lag es am Ende daran, daß er selbst sündig war? Sollte Bruder Anthony etwa doch recht haben, der jeden Tag wenigstens einmal behauptete, daß ihm, Robin, ein warmer Platz in der Hölle sicher sei?
Er zog unbehaglich die Schultern hoch. »Und ich denke, Bruder Philippus und seine Gelehrten haben nicht recht. Es kann nicht Sünde sein. Warum sollte Gott es so eingerichtet haben, daß die Menschen in Sünde gezeugt werden? Heißt es nicht, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen?«
Lionel schüttelte entschieden den Kopf. »Du solltest die Bibelauslegung lieber denen überlassen, die sie verstehen und die das Wort Gottes nicht für ihre Zwecke verdrehen.«
Sie waren wieder an der Mauer des Klosters angelangt. Robin kletterte auf den untersten Ast der Weide. »Schön, denk, was du willst. Aber wenn man dich hört, könnte man meinen, Oswin hat recht. Aus dir wird tatsächlich noch ein echter Klosterbruder.«
Lionel sah ihn ärgerlich an. »Man muß kein Mönch sein, um gottesfürchtig zu leben und sich von der Sünde fernzuhalten.«
Robin seufzte. »Vielleicht nicht. Aber wenn du glaubst, diese Geschichte hier beichten zu müssen, dann laß mich dabei aus dem Spiel, hörst du. Bring mich nicht in Schwierigkeiten mit deiner unbefleckten Heiligkeit.«
Lionel preßte die Lippen zusammen. »Manchmal fürchte ich um deine Seele, Robin.«
Robin schwang sich über die Mauer. »Dann bete für mich, Mönchlein.«
Als Bruder Bernhard am nächsten Morgen das Dormitorium betrat, seine mißtönende Handglocke schwang und mit seiner rauhen Baßstimme donnerte: »Gelobt sei Jesus Christus!«, sprangen dreißig Jungen im Alter zwischen sieben und vierzehn Jahren von ihren Lagern auf und erwiderten im Chor: »In Ewigkeit, Amen!«
Nur Robin rührte sich nicht. Bruder Bernhard sah stirnrunzelnd zu ihm hinüber, aber ehe er herbeihinken konnte, um ihn mit einem gezielten Tritt auf die Beine zu bringen, hatte Lionel ihn am Ellenbogen gepackt und halb hochgezerrt. »Aufstehen«, zischte er eindringlich.
Robin fuhr aus dem Schlaf auf, strampelte seine leichte Wolldecke zurück und kam stolpernd hoch. »In … Ewigkeit, Amen.«
Bruder Bernhard brummte übellaunig und ging ohne Eile davon.
Robin rieb sich die Augen und gähnte herzhaft. »Ich wünschte, ich könnte nur ein einziges Mal so lange schlafen, bis ich von selbst aufwache.«
»Müßiggang …«, begann Lionel, und Robin winkte eilig ab.
»Ich weiß, ich weiß. Aber die Sache hat auch eine andere Seite. Wer schläft, sündigt nicht, oder?«
Lionel fiel keine überzeugende Erwiderung ein, und kurze Zeit später gingen sie nebeneinander in einem schweigenden, ordentlichen Zug mit den anderen Schülern zur Frühmesse.
Nach dem Frühstück, das wie jeden Morgen aus einem Stück hartem, dunklem Brot und einem Becher verdünntem Bier bestand, begaben sie sich zum Schulhaus. In der ersten Stunde hatten sie Rechenunterricht bei Bruder Bernhard. Robin vergaß für eine Weile, wie unausgeschlafen er war, obwohl er gerade diese Stunde auch im Halbschlaf mühelos hätte bewältigen können. Der Umgang mit dem Abakus barg für ihn schon lange keine Tücken mehr. Manchmal, wenn Bruder Bernhard guter Laune war, erzählte er Robin ein wenig über die Grundbegriffe der Geometrie, und dann hatte er einen ungewöhnlich aufmerksamen Zuhörer. An diesem Morgen allerdings ließ er sie nur Kopfrechnen üben. Robin war ein bißchen gelangweilt, aber es hielt ihn zumindest wach. In der anschließenden Lateinstunde dagegen kämpfte er fortwährend mit dem Schlaf. Auf der Suche nach Ablenkung sah er wieder und wieder aus dem Fenster in den Obstgarten. Der Spätsommermorgen war heiß und dunstig geworden. Der Tau auf dem Gras und den Blättern der Apfelbäume war längst getrocknet. Still standen sie im warmen, fast messingfarbenen Sonnenlicht, und ihre Äste bogen sich unter ihrer rotgoldenen Last. Der süße Duft der Früchte lockte Wespen in Scharen an. Schon ein bißchen träge tummelten sie sich um das Fallobst im hohen Gras.
Robin war dankbar für den wenig spektakulären Ausblick. Wenn der Herbstregen einsetzte, würden die Fenster mit Holzläden verschlossen, damit die Feuchtigkeit nicht ungehemmt in den Schulraum eindringen konnte, und sie würden wieder im trüben Halbdunkel bei eisiger Kälte sitzen. Aber noch war es nicht soweit, noch konnte er hinaussehen in den blauen Himmel und über die Felder hinter dem Obstgarten, die größtenteils schon abgeerntet waren. Erntezeit. Zu Hause brachten sie jetzt auch das Korn ein. Von früh bis spät würden die Bauern und ihre Familien auf den Feldern sein. Dann kam die Dreschzeit, und wenn das Stroh gebündelt war, kamen die Erntefeste, mit großen Feuern und Tanz und Ausgelassenheit, und das frischgebraute Bier würde in den Krügen schäumen, und niemand schickte die Kinder ins Bett …
»Waringham, du gottloser Schwachkopf, was gibt es da draußen so Erbauliches zu sehen?«
Robin fuhr leicht zusammen. »Nichts, Bruder Anthony.«
»Nichts?« Der kleine Mönch durchschritt die Gasse zwischen den Schulbänken, und sein schwarzes Habit flatterte dabei um seinen hageren Körper. Robin saß ganz hinten, weil er zu den Größten gehörte. Ein bevorzugter Platz, aber Bruder Anthony hatte gerade die letzten Bänke immer besonders im Auge. Er warf einen kurzen Blick durch das Fenster. »Warum starrst du dann immerzu hinaus?«
»Es tut mir leid«, murmelte Robin ohne die geringsten Anzeichen echter Reue und unterdrückte ein Gähnen.
Bruder Anthonys Lippen waren schmal und weiß, ein sicheres Anzeichen seines Mißfallens. »Also, was haben wir denn da draußen? Ich sehe Apfel- und Birnbäume und vier Brüder bei der Obsternte. Ist es das, was dich so fasziniert?«
Die anderen Jungen lachten leise, ein bißchen nervös vielleicht.
Robin sagte nichts.
Bruder Anthony schüttelte verächtlich den Kopf. »Ich versuche, dir ein paar elementare Regeln der Stillehre beizubringen, und du siehst aus dem Fenster. Du glaubst, ein Obstgarten sei interessanter als Vergilius. Du bist ein Taugenichts!«
Robin sah auf seine Hände. »Ja, Bruder Anthony.«
»Voll sündiger Gedanken!«
»Ja, Bruder Anthony.« Lionel ist da ganz deiner Meinung, dachte er halb grimmig, halb belustigt. Er bemühte sich um eine ausdruckslose Miene.
»… nach dem Unterricht hierbleiben und die nächsten dreißig Zeilen auswendig lernen. Ich werde dich heute abend abhören. Besser, du lernst sie gut, Waringham!«
Robin hatte nur mit halbem Ohr hingehört. Bruder Anthonys wüste Beschimpfungen hatten sich schon lange abgenutzt. Er hörte sie viel zu oft, um ihnen noch besondere Beachtung zu schenken. Doch als die letzten Worte zu ihm vordrangen, sah er entsetzt in das kantige Gesicht mit den scharfen, hellblauen Augen auf. »Aber …«
»Ja? Was wolltest du sagen, Schwachkopf?«
Er biß sich auf die Unterlippe. Heute nachmittag wäre er an der Reihe gewesen, mit Bruder Cornelius nach Posset zu fahren. Es war nur ein Marktflecken, etwa drei Meilen westlich des Klosters, aber im Vergleich zu Curn war Posset eine Stadt. Auf dem Markt wurde das wenige eingekauft, was die Brüder nicht selber herstellten, wie Wolle zum Beispiel. Jede Woche durfte einer der älteren Schüler Bruder Cornelius begleiten. Es gehörte zu den wenigen Abwechslungen in ihrem tristen, streng geregelten Internatsleben, und sie fieberten dem Ausflug schon Wochen im voraus entgegen. Bruder Cornelius, der Cellarius, war ein gutmütiger, fettleibiger Mönch, dessen Tonsur mit den Jahren zu einer großen, glänzenden Glatze geworden war, umgeben von einem schmalen Kranz grauer Zotteln. Er war so ganz anders als Bruder Anthony und die übrigen Lehrer, denn er ließ die Jungen den Wagen lenken, ließ sie unbeaufsichtigt und länger als nötig in dem bunten Treiben auf dem Markt herumstreunen, schwatzte einem Bäcker ein paar Honigkuchen für seine ewig ausgehungerten Begleiter ab, und er erzählte ihnen Geschichten aus der Zeit vor dem Krieg. Als der König nicht viel älter gewesen war als die Schüler von St. Thomas jetzt, bevor der Schwarze Tod gekommen war, und man konnte glauben, England sei damals ein dichtbevölkertes Land voll unbeschwerter Fröhlichkeit gewesen. Sie liebten Bruder Cornelius. Die Ausflüge mit ihm waren wie ein Hauch von Freiheit.
Robin spürte seine Enttäuschung wie einen großen, grauen Ozean, der sich vor ihm auftun wollte. Es würden mehr als drei Monate vergehen, bevor er wieder an der Reihe war. Für einen Augenblick fürchtete er, er werde in Tränen ausbrechen. Statt dessen wurde er zornig. »Ihr seid ungerecht, Bruder Anthony.«
Betroffenes Schweigen legte sich über die Klasse.
»Was sagtest du?« erkundigte der Lehrer sich leise.
Robin rang um seinen Mut. »Ich … habe überhaupt nichts getan. Ich habe meine Aufgaben gelernt, alles, was Ihr uns aufgetragen habt. Aber Ihr fragt mich nicht einmal danach. Warum?« Er hätte wirklich gerne den Grund gekannt, warum Bruder Anthony ihn so verabscheute.
Der kleine Mönch betrachtete ihn ungläubig. »Du willst mit mir disputieren?«
Robin nickte kurz. »Warum nicht? Es kann so verwerflich nicht sein, denn das ist es doch, was wir in der Rhetorik lernen sollen, oder nicht? Bruder Jonathan sagt, sie sei der Schlüssel zu allen weiteren Freien Künsten. Und Latein«, fügte er in einer plötzlichen Anwandlung bitteren Hohns hinzu, »hat er nicht erwähnt.«
Noch während er sprach, dachte er: Meine Güte, habe ich das wirklich gesagt? Ich muß wahnsinnig sein.
Die anderen Schüler starrten ihn an wie einen grotesken Krüppel auf dem Jahrmarkt. Bruder Anthony war noch ein bißchen blasser geworden. Steif ging er zu seinem Pult zurück und nahm seinen Stock auf. »Komm her, Waringham.«
Robin erhob sich langsam; seine Knochen erschienen ihm bleischwer. Er ließ den dürren Mönch nicht aus den Augen. Als er vor ihm anhielt, standen sie Auge in Auge.
»Beug dich vor, du Höllenbrut. Hochmut und Ungehorsam sind eine Eingebung Satans. Wir wollen doch sehen, ob wir ihn dir nicht austreiben können.«
Robin glaubte nicht, daß der Teufel irgend etwas mit dieser Sache zu tun hatte, und er glaubte auch nicht, daß Bruder Anthony das glaubte. Er biß die Zähne zusammen.
Ein schüchternes Klopfen gewährte ihm Aufschub. Zögerlich öffnete sich die Tür, und ein Laienbruder steckte den Kopf in den Raum. »Entschuldigt, Bruder Anthony.«
»Was gibt es?« fragte der Lehrer barsch.
Der Bruder ließ seinen Blick über die Klasse schweifen. »Robert of Waringham?«
Robin wandte sich um. »Das bin ich.«
»Vater Jerome will dich sprechen. Jetzt gleich. Komm mit mir.«
Robin rührte sich nicht und starrte ihn verblüfft an. Was in aller Welt mochte das zu bedeuten haben? Dann ging ihm auf, daß vermutlich alles besser war, als jetzt hierzubleiben. Er sah fragend zu Bruder Anthony.
Der Mönch scheuchte ihn mit einer ungehaltenen Geste weg. »Geh schon. Ich werde es nicht vergessen.«
Robin lächelte dünn. »Nein. Da bin ich sicher, Bruder Anthony.«
Der Laienbruder führte ihn schweigend aus dem Schulhaus, durch den Kreuzgang, am Refektorium vorbei zu dem bescheidenen Häuschen, das der Abt von St. Thomas bewohnte. Mochte er auch der Vorstand eines der mächtigsten Klöster Südenglands sein, Jerome folgte dennoch der Benediktinerregel wortgetreu. In seinem Haus gab es nicht mehr Komfort als im Dormitorium seiner Mitbrüder. Er hielt jeglichen weltlichen Prunk für Teufelswerk. Er war ein Asket, und seine Contemptus-Mundi-Schriften hatten einige Beachtung gefunden. Von den Mönchen und den Schülern seines Klosters wurde er gleichermaßen gefürchtet und geachtet, und Robin überlegte unbehaglich, was diese unerwartete Audienz zu bedeuten hatte. Nervös überdachte er die Bilanz seiner Verfehlungen der letzten Wochen. Nichts davon war schlimm genug gewesen, um diese Unterredung zu erklären. Und wenn ihre Abwesenheit während der vergangenen Nacht entdeckt worden war, warum wurde er dann alleine zu Vater Jerome zitiert?
Der Laienbruder wies auf das kleine Holzhaus des Abtes und entfernte sich eilig. Schüchtern klopfte Robin an, und auf eine gemurmelte Aufforderung von drinnen trat er ein.
Jerome of Berkley saß auf einem Holzschemel an einem niedrigen Tisch. Eine Pergamentrolle lag ausgebreitet vor ihm. Der Raum war recht dunkel, aber der Kerzenstummel auf dem Tisch brannte nicht. Im Kamin lag kalte Asche. Robin schauderte in der plötzlichen Kühle. Die Sonne war nicht bis hierher gedrungen.
Der Abt ließ die Schriftrolle los; die Enden rollten sich langsam ein, und das Pergament raschelte leise. »Du bist Waringham?«
Robin hielt den Blick gesenkt und versteckte die Hände in den Ärmeln seiner Kutte. »Ja, Vater.«
»Robert, nicht wahr?«
»Ja, Vater.«
»Setz dich, mein Sohn.«
Robin sah sich verstohlen um und entdeckte einen weiteren Schemel unter dem Tisch. Er trat näher, zog ihn hervor und setzte sich auf die Kante.
»Wie alt bist du, Robert?«
»Zwölf, Vater.«
»Und wie lange bist du schon hier?«
»Fünf Jahre, Vater.«
»Und bist du glücklich in St. Thomas?«
»Natürlich, Vater.«
Der alte Mönch schüttelte fast unmerklich den Kopf. »Sei ehrlich, Junge. Es ist eine wichtige Frage.«
Robin sah verwundert auf und betrachtete den ungebeugten, weißhaarigen Mann zum erstenmal offen. Er kannte ihn kaum. Der Abt des Klosters hatte zu viele Pflichten, um sich regelmäßig um die Schüler und damit den Nachwuchs seines Hauses kümmern zu können. Diese Aufgabe mußte er anderen überlassen. Er wies lächelnd auf den Korb Äpfel vor sich. »Bist du hungrig?«
Robin nickte wahrheitsgemäß. Seit er nach St. Thomas gekommen war, war kein Tag vergangen, da er nicht hungrig aufgewacht und hungrig zu Bett gegangen war. Die Rationen im Kloster waren mager. Seine unablässige Gier nach Essen hatte ihn oft beschämt, denn keiner seiner Lehrer hatte ihm erklärt, daß ein Junge, der viel wächst, auch viel essen muß.
Jerome schob ihm den Korb hin. »Dann greif zu.«
Er wählte einen Apfel aus und biß hinein. Er war reif und süß; der Saft tropfte auf seine Hand.
Nach einem kurzen Schweigen nahm der Abt das Gespräch wieder auf. »Fünf Jahre sind eine lange Zeit, Waringham. Glaubst du, du würdest gerne für immer hierbleiben?«
Robin hörte auf zu kauen. Das blanke Entsetzen trieb ihm den Schweiß auf die Stirn, und er schwieg beharrlich. Ihm fiel keine höfliche Antwort ein.
Jerome lächelte milde. »Sei ganz offen, mein Sohn.«
»Nein, Vater.«
»Und was willst du tun, wenn du uns verläßt?«
»Ein Ritter des Königs werden. Wie mein Vater.«
Jerome hörte auf zu lächeln, und sein Gesicht wurde seltsam still. »Glaubst du, das ist die beste Weise, auf die du Gott dienen kannst?«
Robin biß noch einmal in seinen Apfel, um Zeit zu gewinnen, kaute langsam und schluckte. »Vor allem will ich meinem König dienen.«
»Wie kommt es, daß du den König mehr liebst als Gott?«
Der Junge überlegte seine Antwort genau. Er fürchtete eine Falle. »Das tue ich nicht. Nur in anderer Weise. Es ist so viel leichter, den König zu lieben. Er ist ein Mann, ein mächtiger Kriegsherr, er hat die Schotten aus dem Norden vertrieben, und er wird auch die Franzosen besiegen. Er ist …« Leibhaftig, hatte er sagen wollen und besann sich im letzten Moment.
Der Abt drängte ihn nicht. Er faltete die Hände vor der Pergamentrolle. »Wieso bist du so sicher, daß der König den Krieg gewinnt?«
»Weil er bisher jede Schlacht gewonnen hat. Weil er tapfer und klug ist und viele tapfere und kluge Männer an seiner Seite hat, wie den Schwarzen Prinzen und meinen Vater.«
Jerome nickte langsam, als habe er solch schlagkräftigen Argumenten nichts entgegenzusetzen.
Robin hielt seinen abgenagten Apfel am Stiel und ließ ihn kreisen. Er wußte nicht, wohin damit.
»Du bist also stolz auf deinen Vater?«
»O ja, Vater.«
Jerome beugte sich leicht vor. »Und was ist Stolz?«
Robin preßte die Lippen zusammen und ärgerte sich über sein unbedachtes Eingeständnis. »Sünde«, murmelte er und zweifelte insgeheim, daß es auch Sünde war, auf jemand anderen und nicht für sich selbst stolz zu sein.
»So ist es«, erwiderte der Abt leise, seine Stimme klang wie ein Seufzen. »Und du weißt, daß Gott uns Prüfungen schickt, um uns demütig zu machen, nicht wahr?«
Ein unheimliches Gefühl beschlich Robin. Er hatte den Verdacht, daß sie sich dem eigentlichen Gegenstand der Unterhaltung näherten und daß es sich um eine viel ernstere Sache als um Verstöße gegen die Klosterregel handelte. Er nickte argwöhnisch.
Der alte Mönch betrachtete den blonden Jungen ihm gegenüber, dessen dunkelblaue Augen ihn so durchdringend ansahen. Er war mager und groß, von Gestalt fast schon ein Mann, aber das Gesicht mit dem vollen Mund, der schmalen Nase und den Sommersprossen war das eines echten Lausebengels. Er empfand tiefes Mitleid für dieses verlorene Lamm und bat Gott, er möge ihm die richtigen Worte schicken, um dem Jungen die furchtbaren Nachrichten so schonend wie möglich beizubringen.
Der Abt stand auf und trat an das kleine Fenster neben der Tür, wandte Robin wieder das Gesicht zu und ließ sich von der Sonne seinen schmerzenden Rücken wärmen. »Du bist ein guter Schüler, Waringham. Ich weiß, daß du dich nur mühsam in unsere harte Disziplin einfügst, aber du hast einen wachen Verstand. In Latein hast du Bruder Anthony bald übertroffen – sehr zu dessen Verdruß –, und wie ich höre, machst du in allen Fächern des Trivium gute Fortschritte und schreibst sogar recht ordentlich. Unser Orden braucht Leute wie dich. Ich bin sicher, du könntest mit der Zeit dein Wesen zügeln, aus deinen Wildheiten wirst du herauswachsen. Du könntest lernen, daß ein Leben für Gott das einzige wahre Glück bedeutet.«
Robin hörte höflich, wenn auch ein bißchen ungeduldig zu. Er teilte Vater Jeromes Zuversicht hinsichtlich seiner Läuterung nicht.
Der Abt unterbrach sich, als er spürte, daß er die Aufmerksamkeit des Jungen verlor. »Mein Sohn, ich habe schlechte Neuigkeiten. Aber bevor ich dir sage, was geschehen ist, will ich, daß du weißt, daß du hierbleiben kannst. Ich würde dafür sorgen, daß du hier aufgenommen wirst. Ich meine kostenlos, Robert, verstehst du?«
Robin sah ihn mit bangen Augen an. »Danke, Vater. Aber selbst wenn ich wollte, mein Vater würde es niemals erlauben …«
Sein Mund wurde mit einemmal staubtrocken, als er den Abt ansah, und er wußte plötzlich genau, was kommen würde.
Jerome faltete die Hände und nickte betrübt. »Dein Vater ist tot, Robert.«
Er blinzelte und versuchte zu schlucken. Es ging nicht. Er schluckte nur Luft, und sein Adamsapfel klickte trocken. Er hielt den Kopf gesenkt und starrte blind auf seine Hände.
Es war eine lange Zeit still. Schließlich spürte er eine Hand auf seinem Kopf, und der Abt murmelte: »Es tut mir leid, mein Sohn.«
Robin rührte sich nicht. Du hast immer gewußt, daß es jederzeit passieren kann, dachte er dumpf. Jetzt ist es passiert. Dir selbst wird es eines Tages vielleicht genauso ergehen. So war das eben; er war ein Ritter seines Königs, und der König befand sich im Krieg. Der Krieg forderte Opfer, und er, Robin, hatte das immer verstanden. Und er hatte seinen Vater nie wirklich gekannt. Es war nicht so, als risse der Verlust eine Lücke in sein Leben. Als Robin geboren wurde, war der Krieg schon über zehn Jahre alt. Sein Vater war kaum je daheim gewesen; es war immer seine Mutter gewesen, die das Gut verwaltete und an Stelle ihres Mannes die Entscheidungen traf. Aber Robin trauerte trotzdem um die stattliche Erscheinung in der schweren, teuer erkauften Rüstung. Er erinnerte sich gut an die wenigen Mußestunden, die sie zusammen verbracht hatten. Er war es gewohnt, sich daran zu erinnern, denn diese Erinnerung war alles, was er von seinem Vater hatte. Er hatte die Erinnerungen gepflegt wie kostbare Kleinodien. An den Abend, zum Beispiel, als sein Vater ihm und seinen beiden Brüdern von der Belagerung von Calais erzählt hatte. Am nächsten Tag waren sie zusammen auf die Jagd geritten, und sein Vater und sein großer Bruder Guillaume hatten einen riesigen, wirklich furchteinflößenden Keiler erlegt im Wald von Waringham. Und seine Mutter hatte geschimpft, als sie abends heimkamen, weil sie eine Jagd für einen kleinen Jungen wie Robin zu gefährlich fand. Er und sein Vater und sein Bruder hatten mit betretenen Gesichtern ihren Vorhaltungen gelauscht und sich hinter ihrem Rücken verstohlen angegrinst …
Die Erinnerung erschien ihm auf einmal fahl und lückenhaft, und er hatte einen dicken Kloß in der Kehle. Er versuchte, an etwas anderes zu denken, und dann riß er plötzlich erstaunt die Augen auf. Gütiger Jesus … »Ich bin der Earl of Waringham!«
Vater Jerome runzelte die Stirn. »Nein, mein Sohn. Das bist du nicht.«
»Aber ich bin jetzt der Älteste. Und wenn mein Vater gefallen ist …«
»Das ist er nicht.«
Robin sah ihn verständnislos an.
Jerome hob hilflos die Schultern. »Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Nur, daß es irgendwo in der Normandie ein unbedeutendes Scharmützel gegeben hat. Dein Vater wurde am Tag nach der Schlacht verhaftet und des Hochverrats beschuldigt. Ich weiß nicht, was genau man ihm vorwarf. Er sollte hier in England vor ein Gericht kommen, aber … er hat sich erhängt.« Er hielt kurz inne und sah in das Gesicht des Jungen, das schneeweiß geworden war.
»Aufgehängt«, hauchte Robin ausdruckslos.
Jerome nickte traurig. »Ja, mein Junge. Offenbar wertete der königliche Gerichtshof seinen Selbstmord als Schuldanerkenntnis. Sein Lehen und alle Ämter sind ihm aberkannt worden. Und damit auch dir. Du bist kein Lord mehr. Du bist ein Niemand. Aber wenn du bei uns bleibst, kannst du immer noch alles erreichen.«
Robin hörte nicht zu. Ein dumpfes Dröhnen hatte in seinem Kopf eingesetzt, das viel lauter war als die brüchige Stimme des alten Mannes. Das konnte einfach nicht wahr sein. Völlig ausgeschlossen. Sein Vater war kein Verräter. Das Wort schien in seinen Ohren zu gellen. Es war ein entsetzliches Wort. Verräter. Und ein Selbstmörder obendrein, verdammt für immer und ewig …
Er erhob sich mühsam. »Darf ich gehen?«
Der Abt schüttelte den Kopf. »Einen Augenblick noch. Was hast du vor?«
»Ich will nach Hause.«
»Zu deiner Familie? Willst du uns deswegen verlassen?«
Warum kannst du mich nicht zufriedenlassen, dachte Robin. Er spürte einen kraftlosen Zorn auf den alten Mönch. Er kam ihm vor wie eine gierige Krähe, die ihn nicht aus ihren Krallen lassen wollte. »Ich …« Er schüttelte den Kopf, um das Dröhnen zu vertreiben. »Ich habe zu Hause keine Familie.«
»Deine Mutter …?«
»Sie ist an der Pest gestorben. Meine Schwester Isabella und meine beiden Brüder auch. Meine andere Schwester, Agnes, ist in einem Kloster in Chester. Mein Vater hat sie hingebracht, weil es da angeblich mit der Pest nicht so schlimm war …« Mein Vater hat sie hingebracht. Mein Vater ist tot. Aufgehängt. Ein Verräter.
Er schloß für einen Moment die Augen.
Jerome legte ihm die Hand auf die Schulter. »Dann wollen wir es dabei belassen. Deine Schwester wird sicherlich in ihrem Kloster bleiben können, wenn ich der Mutter Oberin einen Brief schreibe. Und du wirst vorerst bei uns bleiben.«
»Nein, Vater.«
Der Abt sah ihm ernst in die Augen. »Ich befehle es, Robert.«
Der Junge machte einen Schritt zurück und befreite sich von der großen, knöchrigen Hand. »Ich werde nicht Mönch werden. Ich werde niemals die Gelübde ablegen. Ihr könnt mich nicht zwingen!«
»Ich will dich zu nichts zwingen. Ich befehle dir nur, hierzubleiben und nicht nach Waringham zurückzukehren. Du hast dort keinen Menschen und kein Zuhause mehr. Und du bist noch zu jung, um auf dich gestellt zu sein.«
Lächerlich, dachte Robin wutentbrannt. Der König war kaum älter als ich, als er den Thron bestieg!
»Hast du mich verstanden, Junge?«
Robin hörte deutlich die leise Drohung aus dem trockenen Krächzen der alten Krähe. Er senkte den Blick, um seine Auflehnung zu verbergen, und täuschte Gehorsam vor. »Ja, Vater.«
Er folgte Jeromes Befehl und blieb in St. Thomas. Bis kurz nach Mitternacht. So lange hatte er gebraucht, um Abschied von Oswin und Lionel zu nehmen und seine Pläne zu machen, und er wollte den Schutz der Dunkelheit nutzen, ebenso wie den Vorsprung, den die Nacht ihm gewährleisten würde.
Im Dormitorium herrschte fast vollkommene Stille. Robin hörte nur die gleichmäßigen Atemzüge der anderen, und ab und zu raschelte es leise, wenn einer sich auf seinem Strohlager regte. Robin lag als einziger wach und lauschte. Irgendwann würde ein leises Füßescharren und Kuttenrascheln ihm anzeigen, daß die Brüder sich zur Mette begaben. Es würden nur leise Geräusche sein; er mußte aufpassen, damit er sie nicht versäumte. Mit brennenden Augen starrte er auf das Fenster in der gegenüberliegenden Wand, durch das der Mond ins Dormitorium schien. Robin mußte nicht befürchten, daß er einschlafen würde. Wenn er auch in der vergangenen Nacht wenig geschlafen hatte, war er doch so hellwach, daß er beinah zweifelte, ob er überhaupt je wieder würde schlafen können.
Mit einemmal war er ganz allein auf der Welt. Der Tod seiner Mutter und seiner Geschwister bei der zweiten, furchtbaren Pestwelle vor vier Jahren hatte ihn hart getroffen. Aber sie waren immer noch eine Familie gewesen. Sein Vater und seine Schwester waren noch dagewesen. Sie hatten einen schweren Verlust erlitten, wie fast jede Familie, die Robin kannte, aber sie waren immer noch das Geschlecht von Waringham, und er hatte nie daran gezweifelt, daß sein Vater eine neue Frau finden und daß er neue Geschwister bekommen würde. Jetzt hatte sich alles geändert. Sein Vater war dahin, ebenso wie der Name. Ein Niemand, hatte Vater Jerome gesagt. Und es stimmte. Robin von Nirgendwo. Die Welt war aus den Fugen. Er schien überhaupt nicht mehr zu wissen, wer sein Vater eigentlich gewesen war. Er lag auf dem Rücken, starrte in die Dunkelheit, und seine Gedanken drehten sich immerzu im Kreis.
Dann hörte er endlich, worauf er gewartet hatte. Das leise Flüstern der Sandalen auf dem gepflasterten Weg zur Kirche. Schwere Schritte und leichte. Gleichmäßige und hinkende. Er richtete sich vorsichtig auf und wartete. Als er nichts mehr hörte, zählte er mit geschlossenen Augen langsam bis hundert. Dann schlug er die Decke zurück und stand auf. Er zog die verhaßte Kutte eilig über den Kopf, und zum Vorschein kamen ein fadenscheiniger, knielanger Kittel und ausgefranste, fleckige Hosen aus grauem Tuch, Oswins Sonntagsstaat, den Robin ihm für seine letzten paar Münzen abgekauft hatte. Lautlos schlich er zur Tür.
Die Nacht war wieder kühl. Er spürte Feuchtigkeit unter seinen nackten Füßen. Er zog die Tür behutsam zu und sah sich um. Kein Mensch weit und breit. Hastig überquerte er den Platz und glitt in den Schatten des Schulhauses. Er schlich an der Wand entlang auf die andere Seite in den Obstgarten. Der Mond gab ausreichend Licht, um die Reihen knorriger Apfelbäume auszumachen. Robin griff mit beiden Händen in die niedrigen Äste und erntete. Er würde wenigstens einen, vielleicht auch zwei Tage brauchen, bis er nach Waringham kam. Und er wollte nicht auf die Mildtätigkeit Fremder angewiesen sein. Die Zeiten waren schlecht, und nur die Klöster konnten es sich leisten, hungrige Wanderer zu beköstigen. Aber gerade um die Klöster gedachte er einen weiten Bogen zu machen.
Er zog seinen Gürtel fest und stopfte die Äpfel in den weiten Kittel, bis er glaubte, sein Vorrat sei groß genug. Als er an das kleine Törchen des Obstgartens kam, trat plötzlich eine dunkle Gestalt aus dem Schatten.
»Was hast du hier verloren, Höllenbrut?« zischte eine gepreßte Stimme.
Robin blieb stehen. Für einen Augenblick war er erschrocken, aber dann grinste er verwegen. »Nicht in der Mette, Bruder Anthony?«
Der Mönch stellte sich ihm in den Weg. »Halt deinen vorlauten Mund, Waringham. Ach, so heißt du ja gar nicht mehr, nicht wahr? Wie soll ich dich wohl in Zukunft nennen, he?«
»Das könnt Ihr halten, wie Ihr wollt. Ich werde nicht hier sein, um es zu hören.«
»Bist du sicher? Denkst du, ich weiß nicht, was Vater Jerome entschieden hat?«
Robin betrachtete ihn kühl. Der gehässige, bittere kleine Lateinlehrer barg plötzlich keinen Schrecken mehr für ihn. Er schien schon der Vergangenheit anzugehören, ebenso wie sein Vater und sein Name. »Das kümmert mich nicht. Laßt mich vorbei.«
Der Mönch machte statt dessen einen Schritt auf ihn zu. »Was fällt dir ein, so mit mir zu reden!«
Robin ließ ihn nicht aus den Augen. Zum ersten Mal ging ihm auf, daß er ebenso groß war wie Bruder Anthony. Wer weiß, dachte er erstaunt, vielleicht könnte ich ihn mit einem unerwarteten Stoß aus dem Weg schaffen. Aber man kam in die Hölle, wenn man Hand an einen Mönch legte …
»Seid Ihr gekommen, um mich in lateinischen Versen abzufragen, Bruder Anthony? Versäumt Ihr dafür die Mette?«
»O nein. Ich bin gekommen, um zu verhindern, daß du gegen Vater Jeromes Anweisung verstößt und dich bei Nacht und Nebel davonschleichst. Was ja wohl deine Absicht war. Über die Verse, die du lernen solltest, werden wir morgen reden. Verlaß dich darauf. Und jetzt scher dich zurück ins Dormitorium. Na los!«
Robin riß die Augen auf und zeigte auf einen Punkt über der Schulter des Mönches. »Seht doch nur, Bruder Anthony …«
Der Bruder wandte den Kopf, und ehe ihm aufging, daß er auf einen billigen Trick hereingefallen war, hatte Robin einen Apfel hervorgeholt und warf ihn dem Mönch zielsicher an die Schläfe. Bruder Anthony fiel benommen zu Boden.
Robin machte zwei Schritte auf ihn zu. Bevor Anthony noch wußte, wie ihm geschah, hatte er ihm die Kordel abgenommen, die dem Mönch als Gürtel diente, ihm die Hände zusammengebunden und das lose Ende an einem Baum festgemacht.
Als er fertig war, war Bruder Anthony wieder Herr seiner Sinne. »Robert! Mach mich wieder los, du Teufel! Auf der Stelle, oder ich werde dich …«
Robin blieb nicht dort, um sich die schrecklichen Drohungen anzuhören, die Bruder Anthony immer speziell für ihn reservierte. Er setzte über den niedrigen Zaun des Obstgartens, lief zur Mauer und sprang daran hoch. Seine Eile und sein großes Verlangen nach Freiheit verliehen ihm Kraft. Es gelang ihm, mit einem gewaltigen Sprung die Mauerkante zu erfassen, und er merkte kaum, daß er sich die Knie dabei aufschlug. Ohne große Mühe hangelte er sich hoch. Er hielt sich nicht mit dem Weidenbaum auf, der kaum zehn Ellen entfernt rechts von ihm aufragte. Statt dessen sprang er von der Mauer. Er landete gut auf weichem Gras und lief etwa in östlicher Richtung über ein Stoppelfeld. Er hoffte inständig, daß niemand Bruder Anthony vor dem Laudes-Gebet vermissen würde. Und er hoffte, daß ein geworfener Apfel nicht das gleiche war wie ›Hand anlegen‹.
Als der Morgen graute, kam er an den Rand eines Waldes. Ein schmaler Weg führte hindurch. Robin folgte ihm, bis er an einen kleinen Bach gelangte. Er kniete sich am Ufer ins Gras, beugte sich vor, steckte den Kopf ins Wasser und trank. Der Junge war müde und schrecklich durstig; das Wasser tat ihm gut. Es war kalt und kribbelte in den Ohren. Er legte sich auf den Rücken, sah in den heller werdenden Himmel und hörte den Vögeln zu. Dann schlief er ein.
Ein Regenguß riß ihn unsanft aus dem Schlaf. Robin fuhr erschrocken auf und sah verwirrt um sich. Wo in aller Welt bin ich? dachte er verwundert, und dann fiel ihm alles wieder ein. Die Erinnerung kam wie ein Schock. Er blieb einfach sitzen, wo er war, mit dem Rücken zu dem kleinen Flüßchen, und sah auf den nassen Waldboden. Der Regen fiel in dicken, klatschenden Tropfen, und bald war Robin bis auf die Haut durchnäßt. Aber er spürte es kaum. Er versuchte, für die verdammte, verräterische, selbstmörderische Seele seines Vaters zu beten. Doch er fand sein eigenes Gebet wenig überzeugend. Nicht einmal sich selbst konnte er glaubhaft einreden, daß es sich bei der Sache um ein fatales Mißverständnis, eine Verknüpfung unseliger Umstände handeln mußte. Wie sollte er da Gott überzeugen? Sein Unvermögen, eine plausible Erklärung zu finden, und das beklemmende Bewußtsein seiner eigenen Verlorenheit trieben ihm heiße Tränen in die Augen.
Endlich stand er auf und sah sich suchend nach etwas um, das ihm den Weg weisen konnte. Der Himmel hing voll tiefer Wolken, und er konnte den Stand der Sonne nicht ausmachen. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren und schätzte vage, daß es bald Mittag sein mußte. Er befand sich in einem Eichenwald. Die Bäume waren sehr alt und standen nicht besonders dicht. Die ersten Blätter färbten sich schon gelb, hingen naß und glänzend herunter und zitterten leicht, wenn ein Tropfen sie traf. Robin begutachtete die mächtigen Stämme und stellte fest, daß die ihm zugewandte Seite moosbewachsen war. Das brachte ihm seine Orientierung zurück. Er wußte, daß sein Weg nicht schwer zu finden war, er mußte nur ein paar Meilen in nördlicher Richtung gehen, dann würde er irgendwann auf die Straße nach Canterbury stoßen. Und diese Straße führte an Waringham vorbei.
Er drehte der unbemoosten Seite der Stämme den Rücken zu und ging los, bahnte sich einen möglichst geraden Weg durch dichten Farn und struppiges Gebüsch, bis er auf einen Pfad stieß. Er schien genau in die richtige Richtung zu führen.
Bald ließ der Regen nach. Eine Zeitlang fiel er noch in dünnen, lautlosen Fäden, dann kam die Sonne zwischen den Wolken hervor, und kurz darauf war der Himmel wieder blau.
Als die Sonne schräg stand, veränderte sich der Wald. Die alten, hohen Bäume wurden spärlicher. Statt dessen erhoben sich auf beiden Seiten des Pfades Birken. Sie standen so dicht zusammen, daß man kaum hindurchsehen konnte, und ihre Äste bildeten über dem schmalen Pfad ein schattenspendendes Dach. Dagegen hatte Robin keinerlei Einwände. Seine Kleidung war längst getrocknet, und ihm war heiß. Ohne zu zögern, betrat er den dunklen Hohlweg – und lief buchstäblich ins offene Messer.
Der Mann stand so plötzlich vor ihm, daß Robin glaubte, er habe eine Vision. Es war, als sei er einfach aus der klaren, blauen Abendluft entstanden. Ein Dämon. Aber das war natürlich nur eine Täuschung. Er mußte zwischen den Birken auf der Lauer gelegen haben, um sich auf den ersten Wanderer zu stürzen, der unvorsichtig genug war, allein und unbewaffnet in sein Revier einzudringen. Er war ein furchterregender Geselle: In der Hand hielt er einen langen Dolch, sein Haar und sein langer Bart waren wild und struppig wie die Birkenzweige um sie herum. Er war klein und untersetzt, und auf der linken Wange hatte er eine wulstige Narbe. Sie war alt und schien von einem breitgezackten Messer herzurühren, das ihm nicht nur das Gesicht aufgeschlitzt, sondern auch das linke Auge ausgestochen hatte.
Robin hatte genug gesehen. In einer einzigen Bewegung machte er eine Kehrtwendung und einen gewaltigen Satz in die Richtung, aus der er gekommen war. Und damit war seine Flucht beendet. Er war einem zweiten Banditen direkt in die Arme gelaufen. Sie hatten ihm eine Falle gestellt.
Der andere Wegelagerer war dünner und schmächtiger als sein Kumpan, daher brachte ihn der Zusammenstoß aus dem Gleichgewicht. Er fiel, zog Robin mit sich zu Boden und krallte beide Hände in seinen Ärmel. Der Stoff riß mit einem müden, brüchigen Laut. Robin trat und schlug, aber gerade als der Griff sich lockerte, war plötzlich der kräftigere der beiden Diebe über ihm, zog den Kopf des Jungen an den Haaren zurück und setzte ihm die Klinge an die Kehle.
Robin hielt still.
»Was haben wir denn hier, Bürschchen?« krächzte eine Stimme über ihm, die hervorragend zu der Erscheinung paßte.
Robin antwortete nicht. Der zweite Bandit, ein verwahrloster, blonder Junge und kaum älter als er selbst, kam ächzend auf die Füße und wischte sich ein bißchen Blut aus dem Gesicht. »Der kleine Dreckskerl hat mir die Nase eingeschlagen«, verkündete er zornig.
»Und wenn schon«, erwiderte der andere ohne jedes Mitgefühl. »Wenn du dich einfach so über den Haufen rennen läßt …«
Robin schluckte unwillkürlich, und als sein Adamsapfel sich bewegte, spürte er die entsetzliche Schärfe der Klinge. Er schloß für einen Moment die Augen.
Die Hand riß an seinen Haaren. »Also, was hast du für uns, he?«
Robin hielt den Kopf ganz still und versuchte, nur ja nicht wieder zu schlucken. »Nichts. Nur ein paar … Äpfel.«
Etwas wie ein Hammerschlag traf ihn an der Schläfe. Er fiel zur Seite. Das einzige, was er sicher wußte, war, daß das Messer verschwunden war.
»Nichts?« dröhnte die Stimme empört. »Das ist zu wenig!«
Robin richtete sich vorsichtig auf. »Was hast du gedacht? Wonach sehe ich aus? Als würde ich Gold mit mir herumtragen? Ein paar Äpfel, das ist alles. Ihr könnt sie gern haben. Sie sind gut, wirklich.«
Der untersetzte Kerl packte ihn von hinten, drückte ihm mit dem Unterarm die Luft ab und preßte sein Gesicht ganz nah an Robins. Der Junge konnte jede einzelne Krümmung der schlecht verheilten Narbe genau erkennen, ebenso wie die widerliche, leere Augenhöhle. Die Nähe dieser Erscheinung zusammen mit dem Gestank, der von dem Mann ausging, raubten ihm fast die Sinne.
»Äpfel, he? Und das ist alles? Du bist ganz sicher?«
Robin nickte schwach. Schaudernd spürte er Hände, die über seine Brust tasteten und nach und nach seine ganze Wegzehrung ans Licht förderten. Schließlich lagen die rotgelben Früchte auf einem kleinen Hügel neben ihm im Gras.
Der Jüngere sah ernüchtert darauf hinab. »Das ist alles.«
Das runzlige, bärtige Gesicht, das Robins ganzes Blickfeld ausfüllte, verzerrte sich zu einer grotesken Fratze. Es lächelte. Robin sah aus nächster Nähe eine Reihe winziger schwarzer Zahnstümpfe.
»Hm. Vielleicht nicht ganz. Vielleicht kann uns dieser hübsche blonde Engel hier doch noch für unsere lange Wartezeit entschädigen.«
Der andere schien ihm kaum zuzuhören. Er wischte sich abwesend die blutige Nase, wählte einen der Äpfel und biß hinein.
»Hm. Wirklich nicht übel.« Dann warf er dem Alten einen verächtlichen Blick zu. »Also dann mach schon, wenn es das ist, was du willst, du widerlicher alter Hurensohn.«
Das gräßliche Narbengesicht entfernte sich ein wenig, und Robin konnte wieder atmen. Große, ungeheuer kräftige Hände zerrten ihn auf die Füße. Er spürte Schweiß am ganzen Körper, ohne zu wissen, was genau ihn mit so namenlosem Entsetzen erfüllte. Der Dolch konnte es kaum sein, er war vorerst in der Scheide verschwunden, die vom Gürtel des Einäugigen baumelte.
Als er wieder stand, trat er nach hinten aus, traf das Schienbein seines Peinigers und entlockte dem Mann einen entrüsteten Schrei. Der Griff des Wegelagerers lockerte sich ein wenig. Ein neuerlicher Faustschlag streifte Robins Kopf, aber er riß ihn schnell genug zurück, um der eigentlichen Wucht zu entgehen. Er spürte einen heißen Zorn, der ihm Schnelligkeit und Kraft verlieh. Blitzschnell fuhr er herum, kniff die Augen zu und zielte genau, ehe er wieder zutrat. Er traf gut. Das gesunde Auge des Banditen klappte zu, er sank wimmernd auf die Knie und verschränkte die Hände vor dem Schritt. Keuchend wandte Robin sich zur Flucht. Er schaute gehetzt in Richtung des jüngeren Wegelagerers, aber der winkte lächelnd ab und warf ihm einen seiner Äpfel zu.
Robin fing ihn geschickt auf, ohne anzuhalten. »Klug von dir!« brüllte er über die Schulter zurück. »Denn ich bin der gefürchtete Robin von Nirgendwo!«
Mit größerer Vorsicht ging er in nördlicher Richtung weiter, bis er auf die Watling Street stieß, die Canterbury und London verband und die angeblich schon die Römer angelegt hatten. Er wandte sich nach Osten, und ein freundlicher Bauer nahm ihn ein Stück auf seinem Ochsenkarren mit und setzte ihn schließlich an der Abzweigung nach Waringham ab. Der Weg zum Dorf führte durch den Wald, und mit dem Schatten der Bäume betrat Robin das Land, das einmal seinem Vater gehört hatte.
Als er aus dem Wald kam, schien ihm die tiefstehende, rote Sonne direkt ins Gesicht. Langsam ging er den abschüssigen Pfad zwischen den Weiden entlang und sah auf den Ort im Tal hinunter. Was für ein schönes Dorf Waringham doch ist, dachte er voll unerwartetem Stolz, so ganz anders als Curn. In seiner Mitte befand sich die bescheidene, aber ordentlich gebaute Holzkirche, die, wie er anerkennend feststellte, seit seinem letzten Besuch nicht abgebrannt war. Neben der Kirche lag der baumbestandene Dorfplatz mit dem alten Pranger mitten darauf, glücklicherweise unbesetzt, und ringsherum erhoben sich die strohgedeckten Häuser der Bauern, mit ihren Schuppen und Ställen und Gemüsegärten, größere Häuser in großzügigen Gärten und kleine Häuser in winzigen Gärten, je nach Wohlstand der Bauernfamilien. Kinder spielten unter den Obstbäumen, Frauen hängten Wäsche auf. Am Dorfrand, ein bißchen außerhalb, standen noch zwei weitere Gebäude: die Schmiede und die Mühle. Beide lagen direkt am Tain, der jetzt still und gemächlich durch sein schmales Bett floß. Die Sonne spiegelte sich fast golden auf seiner Oberfläche. Rings um das Dorf erhoben sich Hügel, seicht und wellig, über die sich die Felder erstreckten. Mit Furchen waren sie in schmale Streifen unterteilt, von denen die meisten Bauern drei, manche auch mehr und wieder andere nur einen bewirtschafteten. Jetzt, nach der Ernte, hatten die Schäfer die Herden auf die Stoppelfelder getrieben, nicht so sehr, weil sie besonders gutes Futter boten, sondern damit die Felder gedüngt wurden. Etwas abgelegen auf der rechten Seite, auf der höchsten Anhöhe, stand Waringham Castle.
Robin ließ das Dorf linkerhand liegen und stieg den Hügel zur Burg hinauf. Er betrachtete sie aufmerksam, als sehe er sie zum erstenmal. Es war eine alte Burg aus kriegerischen Tagen, umgeben von einem tiefen Graben und einer schwarzen, moosbewachsenen Steinmauer. Höher und breiter als die Mauer des Klosters, gestand er sich ein, bedrohlicher. Mit ihrer hohen Brustwehr und dem breiten Turm über dem Tor, von dessen Luken aus man siedendes Öl oder Pech oder Pferdepisse auf die Angreifer heruntergießen konnte, wirkte sie abweisend und ehern. Aber so hatte er sie nie empfunden. Er hatte nie das Gefühl gehabt, daß sie ihn einsperrte, sondern sie beschützte ihn. Hinter dieser Mauer konnte man beruhigt schlafen. Während des Bürgerkrieges zwischen König Steven und seiner Rivalin Maude, vor vielen, vielen Jahren, Hunderten von Jahren, als Waringham Castle noch neu gewesen war, hatte es sich als uneinnehmbar erwiesen. Die Waringhams hatten auf der Seite König Stevens gestanden, zu ihrem Glück, wie sich herausstellte, denn Steven hatte diesen fast vergessenen Krieg gewonnen. Maudes Truppen hatten sich an der Mauer von Waringham Castle ihre Dickschädel eingerannt …