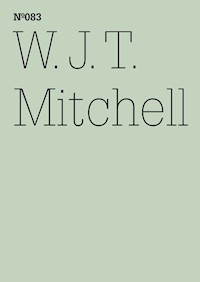12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
W.J.T. Mitchells brillante Studie über das Eigenleben von Bildern in unserer Kultur W.J.T. Mitchell ist eine der wichtigsten Stimmen in der heutigen Diskussion um Wesen und Funktion von Bildern. In seinem jüngsten Buch - dem ersten, das auch in deutscher Sprache erscheint - erkundet der amerikanische Begründer des "iconic turn" das Eigenleben, das Bilder in unserer Kultur führen. Ob es sich um Bilder in Museen oder Bilder in den Medien handelt - sie fordern Reaktionen von uns, sie provozieren und verführen und benehmen sich manchmal so gar nicht wie tote Gegenstände, sondern wie lebendige Wesen mit ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Begierden. Mitchells Beobachtungen zu unserem Umgang mit Bildern sind scharf, provokant und gleichzeitig von bestechender Klarheit. Sie beleuchten nicht nur unsere visuelle, sondern auch unsere politische Kultur, die heute mehr denn je von Bildern geprägt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
W. J. T. MITCHELL
DAS LEBEN DERBILDER
EINE THEORIEDER VISUELLENKULTUR
Mit einem Vorwort von Hans Belting
Aus dem Englischen von Achim Eschbach,Anna-Victoria Eschbach und Mark Halawa
VERLAG C.H. BECK
Zum Buch
W. J. T. Mitchell ist international eine der wichtigsten Stimmen in der Diskussion um Wesen und Funktion von Bildern. In diesem Buch erkundet der amerikanische Begründer des „pictorial turn“ das Eigenleben, das Bilder in unserer Kultur führen. Bilder benehmen sich nämlich manchmal so gar nicht wie tote Gegenstände, sondern treten uns wie lebendige Wesen mit ihren eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Begierden gegenüber. Sie fordern Reaktionen von uns, provozieren und verführen. Mitchells Beobachtungen zu unserem Umgang mit Bildern sind originell, provokant und gleichzeitig von bestechender Klarheit. Sie beleuchten nicht nur unsere visuelle, sondern auch unsere politische Kultur, die heute mehr denn je von Bildern geprägt ist.
Über den Autor
W. J. T. Mitchell ist Professor für Kunstgeschichte und Anglistik an der University of Chicago. Für sein Werk hat er zahlreiche Preise erhalten. Seine wichtigsten Bücher sind in den USA in vielen Auflagen erschienen. The Last Dinosaur Book wurde für den Pulitzer Prize nominiert.
INHALT
Vorwort von Hans Belting
Vorwort
ERSTER TEIL: BILDER
Lebenszeichen – Das Klonen des Terrors
Was will das Bild?
Auf den Spuren des Begehrens
ZWEITER TEIL: OBJEKTE
Anstößige Bilder
Die Romantik und das Leben der Dinge
Totemismus, Fetischismus und Idolatrie
DRITTER TEIL: MEDIEN
Im Gespräch mit den Medien
Das Kunstwerk im Zeitalter der biokybernetischen Reproduzierbarkeit
ANHANG
Dank
Anmerkungen
Anmerkung der Übersetzer
Bildnachweis
Personenregister
VORWORT
von Hans Belting
W. J. T. Mitchell, der an der University of Chicago lehrt, ist heute international einer der führenden Bildtheoretiker. Seine Bücher sind längst Klassiker für alle jene geisteswissenschaftlichen Disziplinen geworden, die sich heute zunehmend Bilderfragen zuwenden. In seinem Buch «Iconology» hat der Autor einen Begriff, der in der Kunstgeschichte durch Erwin Panofsky etabliert wurde, neu und zeitgemäß definiert. Der Untertitel des Buches lautet «Image, Text, Ideology».[1] Es geht darin um die doppelte Frage, wie Texte und Bilder miteinander verbunden sind und was sie voneinander unterscheidet. Doch bringt der Untertitel noch einen dritten Begriff ins Spiel: «Ideology» deutet an, dass sich bei den großen Ideologen der Moderne überraschend auch Bildvorstellungen ans Licht ziehen lassen.
Sein nächstes Buch widmete Mitchell 1994 der «Picture Theory».[2] Die englische Sprache besitzt die glückliche Unterscheidung von «image» und «picture», mit der sie das «Bild» als mentales oder als Bild der Vorstellung von den Artefakten trennt, die von Menschen produziert werden. Zu Mitchells Untersuchung gehörte natürlich auch die Frage nach den Bildmedien, sowohl den historischen wie auch den aktuellen, mit denen die «pictures» erzeugt werden. Das Buch hat Wissenschaftsgeschichte gemacht, als es den «pictorial turn» ausrief, der heute in aller Munde ist. Mitchell bezog sich dabei auf den «linguistic turn», den der Philosoph Richard Rorty 1967 in dem gleichnamigen Buch einführte.[3] Während Rorty die Realität, von der andere Theorien handelten, auf die Zeichenwelt der Sprache zurückführen wollte, setzte Mitchell dagegen die Notwendigkeit einer «Wiederentdeckung des Bildes», wenn es darum geht, unsere Welterfahrung zu deuten. Diese Position ließ sich nur dadurch rechtfertigen, dass sie den gängigen Bildbegriff radikal erweiterte. Die Bilder durchdringen und beherrschen die zeitgenössische Kultur in einem Maße, dass man von einer visuellen oder visuell geprägten Kultur sprechen kann, die durch die Massenmedien inzwischen globalisiert worden ist.
Mitchell prägte den Begriff des «pictorial turn» in dem gleichen Jahr, in dem Gottfried Boehm erstmals vom «iconic turn» sprach. Die beiden Begriffe werden oft für gleichbedeutend gehalten, doch stehen dahinter verschiedene Positionen. Sie kommen zum Ausdruck in Briefen, die die beiden Wissenschaftler in einem kürzlich erschienenen Sammelband aneinander gerichtet haben.[4] Der Briefwechsel wurde auf einer Wiener Tagung vereinbart, die ich am Internationalen Forschungszentrum für Kulturwissenschaften (IFK) 2005 veranstaltet habe. In seinem Brief an Mitchell formuliert Boehm, «dass die Bilderfrage die Fundamente der Kultur berührt» und «eine andere Art des Denkens betrifft. Die Wende zum Bild ist eine Konsequenz der Wendung zur Sprache.» In seiner Antwort beharrt Mitchell darauf, dass der Begriff «pictorial», den man nicht mit malerisch verwechseln darf, die Aufmerksamkeit auf Bildtechniken und Bildmedien lenken soll. Im Gegenzug legt Mitchell die Ungreifbarkeit der mentalen Bilder offen, die zwischen den einschlägigen Medien und unseren Körpern gewissermaßen fluktuieren oder sich ereignen. Es empfiehlt sich, Mitchells Brief zu Rate zu ziehen, wenn man seinen Werdegang verstehen will, der ihn bereits in seiner Dissertation zu einem Künstler führte, der Text und Bild wie kein anderer in der Moderne verbunden hat – dem englischen Romantiker William Blake.
In einem dritten Band, der hier in deutscher Übersetzung vorgelegt wird, stellt Mitchell eine scheinbar paradoxe Frage. «What do pictures want?», der Titel der englischen Ausgabe und gleichzeitig des zweiten Kapitels, lässt sich auch übersetzen als Frage danach, «was Bilder von uns begehren». Diese Frage überschreitet die Grenze zwischen Artefakt und Leben. Dabei werden Artefakte gleichsam zu lebenden Bildern, wofür in der langen Bildgeschichte immer Wunder herhalten mussten. Schon lange hat den Autor die Frage interessiert, in welcher Weise Bilder an Medien und Körper gebunden sind. Auch unsere Körper sind gleichsam lebende Medien, weil sie Bilder empfangen und zugleich sich selbst als Bilder aufführen.[5] Die mediale Beschaffenheit der Bilder führt Mitchell zu dem Schluss, dass Bilder im Akt der Wahrnehmung überhaupt erst entstehen. Er spricht in metaphorischer Weise von einem Blickwechsel zwischen den Bildern und uns, auch wenn er weiß, dass wir es sind, die den Bildern ein solches Leben leihen, um mit ihnen zu kommunizieren, als wären sie dabei unsere Partner. Dabei nehmen wir in Kauf, dass sie nur an das Leben erinnern, ohne es zu besitzen. In einem solchen Akt der Aneignung verwandelt sich die Absenz dessen, was wir auf ihnen sehen, in den Eindruck einer Präsenz, die aber allein in unserem Blick entsteht.
Es seieigens erwähnt, dass Mitchell uns als Leser in ungewohnter Weise ernst nimmt, denn er legt seine Karten stets offen und zeigt auch jene Karten vor, die er nicht verwenden will. Das Inhaltsverzeichnis beweist, wie groß das Spektrum ist, das Mitchell in diesem Buch entwickelt, wenngleich die deutsche Ausgabe den Inhalt etwas gekürzt wiedergibt. Einige Zitate sollen dazu dienen, den Autor schon hier selbst zu Gehör zu bringen. «Bilder sind Gegenstände, die mit sämtlichen Stigmata des Personhaften und des Beseeltseins» gezeichnet sind. «Sie weisen sowohl physische als auch virtuelle Körper auf; sie sprechen zu uns – manchmal im buchstäblichen, manchmal im übertragenen Sinne; oder aber sie erwidern unsere Blicke schweigend über einen ‹Abgrund, der sich nicht durch die Sprache überbrücken lässt› [ein Zitat von John Berger]. Sie weisen nicht nur eine Oberfläche [surface] auf, sondern auch ein Gesicht [face]» (S. 48). Unser Umgang mit Bildern, so Mitchell, ist von solch anachronistischer Art, dass er die Frage aufwirft, ob es nicht auch Idolatrie, Fetischismus und Totemismus in modernen Gesellschaft gibt, die dann natürlich anders aussehen als früher (S. 50). Deshalb will Mitchell die viel besprochene Macht der Bilder vom desire, dem Begehren, her neu aufrollen (S. 52). Der Autor stellt die Medienfrage keineswegs in der Absicht, die Medien einfach an die Stelle der Bilder zu setzen. Vielmehr leuchtet er unsere eigene Mitwirkung an ihrem Medieneffekt subtil aus und stellt damit die notwendige Balance her, die in der Medienwissenschaft heute oft fehlt.
Das Kapitel über «Das Kunstwerk im Zeitalter der biokybernetischen Reproduzierbarkeit» hat derzeit eine besondere Aktualität. Bei Walter Benjamin, auf dessen berühmten Titel Mitchell hier anspielt, war von der «technischen Reproduzierbarkeit» des Kunstwerks die Rede gewesen, die den Begriff des Originals überflüssig macht. Mitchell führt eine doppelte Unterscheidung ein, denn er spricht nicht vom Kunstwerk, sondern vom Bildermachen ganz allgemein, und er stellt ferner die Frage nach den Bildern im Zeitalter der biokybernetischen Reproduktion des Lebens, die lebende Bilder in einem bisher undenkbaren Sinne denkbar macht. Wie wir wissen, haben Bilder bisher Leben immer nur simulieren können, weil sie nicht der Natur zugehörten, sondern der Kultur, die vom Menschen gemacht ist. Wie aber, wenn man Leben so reproduzieren kann, dass Bilder im Lebensprozess selbst entstehen und dieser in die Hände des Menschen gelangt? Eine solche Frage wird gerne aus ideologischen Gründen bagatellisiert, ebenso wie die Unterscheidung von Natur und Kultur. Aber Mitchell weist hier auf einen «turn» hin, der alle bisherigen Wendemarken in der Kulturgeschichte in den Schatten stellt. Deshalb beginnt der Autor das Kapitel mit der Feststellung, dass das «Leben der Bilder» «in unserer Zeit eine entscheidende Wende genommen [hat]. Der uralte Mythos von der Schöpfung lebendiger Bilder, der Erzeugung eines intelligenten Wesens mithilfe künstlicher, technischer Mittel ist […] theoretisch und praktisch möglich geworden» (S. 191).
VORWORT
Sich ein Bild machen, eine Anschauung haben, macht unszu Menschen – Kunst ist Sinngebung, Sinngestaltung,gleich Gottsuche und Religion.Gerhard Richter, Text: Schriften und Interviews (1994)
[…] daß wir als Subjekte auf dem Bild buchstäblichangerufen sind und also dargestellt werden als Erfaßte.Jacques Lacan, Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (1987)
Das vorliegende Buch ist in drei Teile gegliedert: Der erste handelt von Bildern, der zweite von Objekten und der dritte von Medien. Zur Logik dieser Struktur: Unter einem «Bild» verstehe ich jedes Abbild, jede Darstellung, jedes Motiv und jegliche Gestalt, die in bzw. auf irgendeinem Medium erscheint. Unter einem «Objekt» verstehe ich die materielle Grundlage, in bzw. auf der ein Bild in Erscheinung tritt, oder den materiellen Gegenstand, auf den sich ein Bild bezieht bzw. den es zur Erscheinung bringt. Ich möchte hier natürlich auch die Begriffe der Dinghaftigkeit und Gegenständlichkeit evozieren, d.h. die Idee dessen, was einem Subjekt gegenübertritt. Unter einem «Medium» verstehe ich das Zusammenspiel der Verfahren, die ein Bildobjekt mit einem Bildträger zusammenbringen, um ein Bild entstehen zu lassen. Das Buch als Ganzes handelt von Bildern im Sinne von komplexen Verbindungen virtueller, materieller und symbolischer Elemente. Im engsten Sinne ist ein Bild einfach eins dieser vertrauten Dinge, die wir an Wänden hängen sehen, die in Fotoalben eingeklebt sind oder die die Seiten eines illustrierten Buches schmücken. In einem weiteren Sinne erscheinen Bilder jedoch in sämtlichen Medien – in der Verbindung flüchtiger, vergänglicher Schatten und Trägermedien, die das Kino als «Bildershow» ausmacht; beim Aufstellen einer Skulptur an einem bestimmten Ort; in einer Karikatur oder einem Klischee, das sich an einem menschlichen Verhaltensmuster festmachen lässt; in den «Bildern im Geiste», in der Vorstellung von oder der Erinnerung an ein gestaltgewordenes Bewusstsein; oder aber in einer Aussage oder in einem Text, durch den, wie Wittgenstein sagte, «ein Sachverhalt» beschrieben wird.[1]
Im weitesten Sinne verweist ein Bild sodann auf die Gesamtsituation, in der es in Erscheinung tritt, wie etwa, wenn wir jemanden fragen, ob er oder sie über etwas Bestimmtes «im Bilde» ist.[2] Heidegger behauptete bekanntlich, dass wir in einer «Zeit des Weltbildes» leben, worunter er die Neuzeit verstand, in der die Welt zu einem Bild geworden ist – d.h., dass sie sich in einen systematisierten, darstellbaren Gegenstand der technisch-wissenschaftlichen Rationalität entwickelt hat: «Weltbild […] meint daher nicht ein Bild von der Welt, sondern die Welt als Bild begriffen.»[3] Heidegger dachte, dass dieses Phänomen (welches einige von uns den «pictorial turn» genannt haben[4]) einen historischen Wandel darstelle, welcher mit der Neuzeit zusammenfalle: «Das Weltbild wird nicht von einem vormals mittelalterlichen zu einem neuzeitlichen, sondern dies, daß überhaupt die Welt zum Bild wird, zeichnet das Wesen der Neuzeit aus.»[5] Heidegger band seine philosophischen Hoffnungen an eine Epoche jenseits der Neuzeit und jenseits der Welt als Bild. Er ging davon aus, dass der Weg zu dieser Epoche nicht in einer Rückkehr in vor-bildliche Zeiten oder einer entschlossenen Zerstörung des neuzeitlichen Weltbildes lag, sondern in der Poetik – und zwar der Art von Poetik, die uns für das Sein öffnet.
Die These dieses Buches lautet, dass Bilder – einschließlich der Weltbilder – immer mit und bei uns waren und dass es nicht möglich ist, Bilder – und noch viel weniger Weltbilder – hinter sich zu lassen, um eine authentischere Beziehung zum Sein, zum Realen oder zur Welt zu entwickeln. Es hat verschiedene Formen von Weltbildern an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten gegeben, und deshalb beschreiben Geschichtswissenschaft und Vergleichende Ethnologie nicht bloß Ereignisse und Praktiken, sondern auch deren Repräsentationen. Bilder sind unsere Art, einen Zugang zu den Dingen zu bekommen, was auch immer diese sein mögen. Sie sind, noch nachdrücklicher gesprochen (und wie der Philosoph Nelson Goodman es ausdrückt), «Weisen der Welterzeugung», nicht bloß Spiegelungen der Welt.[6] Poetik (im Sinne von «machen», «schaffen», «erzeugen», von poiesis) ist wesentlich für das (Ab-)Bilden. Bilder sind selbst Produkte der Poesie, und eine Poetik der Bilder wendet sich Bildphänomenen so zu, wie Aristoteles es vorschlug: als würde es sich bei ihnen um lebendige Wesen handeln, um eine zweite Natur, welche die Menschen um sich herum geschaffen haben.[7] Im Gegensatz zur Rhetorik oder Hermeneutik ist eine Poetik der Bilder folglich eine Erforschung des «Lebens der Bilder», von den antiken Götzenbildern und Fetischen bis zu den heutigen technischen Bildern und künstlichen Lebensformen, einschließlich der Cyborgs und Klone. Die Frage, die vom Standpunkt einer Poetik gegenüber Bildern zu stellen ist, lautet daher nicht einfach, was sie bedeuten oder bewirken, sondern was sie wollen – welche Ansprüche sie uns gegenüber geltend machen und wie wir auf diese antworten sollen. Das verlangt aber zugleich, auch danach zu fragen, was wir von Bildern wollen.
Die anschaulichste Antwort auf diese Frage stellt das Genre des Horrorfilms bereit. Ein Standfoto aus David Cronenbergs Videodrome(Abb. 1) veranschaulicht auf vollkommene Weise die Bild-Betrachter-Beziehung als einen Schauplatz wechselseitigen Begehrens. Wir sehen, wie sich das Gesicht von Max Wren (James Woods) einem sich wölbenden Fernsehbildschirm nähert, auf dem die Lippen und Zähne seiner neuen Geliebten, Nicki Brand (Deborah Harry), gezeigt werden. Max überlegt, ob er mit dem Kopf in den dargestellten Mund eintauchen soll, der ihn aufgefordert hat: «Komm zu mir, komm zu Nicki.» Die Bildröhre, das Fernsehgerät selbst ist lebendig geworden; aufgeblähte Adern pulsieren unter der Plastilinoberfläche, während der Apparat pocht, schnauft und schnurrt. Nicht nur das Bild Nicki Brands vibriert vor Verlangen, sondern auch das Trägermedium, auf dem es erscheint. Was nun Max betrifft, so fühlt er sich angezogen und abgestoßen zugleich. Er möchte mit dem Bild verschmelzen, in Bildschirm/Mund/Gesicht, das es ihm präsentiert, eindringen, selbst auf das Risiko hin, von ihm verschlungen zu werden. Könnten wir ausschließlich von diesem Bild ausgehen, so müssten wir zu dem Schluss kommen, dass die Antwort auf unsere Frage lautet: Bilder wollen geküsst werden. Und selbstverständlich wollen wir sie zurückküssen.
Abb. 1 Still aus Videodrome (Regie: David Cronenberg, 1983), Max Wren und der Bildschirm
Nicht jedes Bild stellt seine Begierden in derart expliziter und obszöner Weise zur Schau. Die meisten Bilder, die wir schätzen, sind hinsichtlich der libidinösen Felder, die sie aufbauen, hinsichtlich der tödlichen Küsse, zu denen sie einladen, weitaus diskreter. Cronenbergs wunderbare Szene kann allerdings als eine Art unzensierte Momentaufnahme des Lebens und der Leidenschaften der Bilder im Gedächtnis behalten werden, unseres Wunsches, in sie einzudringen, wie auch unserer Angst, von ihnen verschlungen zu werden.[8] (Ich denke, dass ich das Ausmaß an «Männerfantasie», das in der vorgestellten Szene zum Ausdruck kommt, nicht näher kommentieren muss.)
Ein Bild ist folglich ein sehr eigentümliches und paradoxes Geschöpf, konkret und abstrakt zugleich, sowohl ein spezifischer, individueller Gegenstand als auch eine symbolische Form, die eine Totalität umfasst. Sich ein Bild von etwas machen, ein Bild von etwas haben oder es festhalten heißt, eine umfassende Sicht auf eine Situation zu erlangen; es bedeutet aber auch, in einem bestimmten Moment einen Schnappschuss zu machen – dem Moment, wo das Klicken des Kameraverschlusses das Erzeugen eines Bildes kenntlich macht, sei es der Nachweis eines Klischees oder Stereotyps, die Einführung eines Systems oder das Eröffnen einer poetischen Welt (vielleicht alles zugleich). Um schließlich ein vollständiges Bild von Bildern zu erhalten, können wir uns nicht weiterhin mit einem engen Begriff von ihnen zufrieden geben, noch können wir uns einbilden, dass unsere Ergebnisse, gleichgültig wie allgemein oder umfassend sie sein mögen, mehr sein werden als ein Bild von Bildern, Objekten und Medien, und zwar so, wie sie einigen von uns zu einem bestimmten Moment erscheinen. Denn was auch immer dieses Bild ist – wir selbst befinden uns, wie Barbara Kruger gezeigt hat (Abb. 2), immer schon in ihm.
Abb. 2 Barbara Kruger, Untitled (Help! I’m locked inside this picture), 1985
ERSTER TEIL
BILDER
Image is everything.Andre Agassi in einer Reklame für Canon-Kameras
Die Feststellung, dass Image und Bilder alles sind, ist gewöhnlich Anlass zur Klage gewesen und nicht, wie es in Andre Agassis bekanntem Werbeslogan der Fall ist (lange bevor er seinen Kopf rasierte, sein Image änderte und vom Posterboy zu einem echten Tennisstar avancierte), ein Grund zur Freude. In diesem ersten Teil soll demonstriert werden, dass Bilder nicht alles sind, zugleich soll aber auch deutlich werden, wie es ihnen gleichwohl gelingt, uns davon zu überzeugen, dass sie es eben doch sind. Dies liegt zum Teil in der Sprache begründet: Das Wort Bild ist bekanntlich mehrdeutig. Es kann sowohl einen physischen Gegenstand (ein Gemälde oder eine Skulptur) als auch eine mentale, imaginäre Entität bezeichnen, eine psychologische Imago, den visuellen Inhalt von Träumen, Erinnerungen und der Wahrnehmung. Es spielt in den visuellen wie auch den verbalen Künsten eine Rolle – als Name für den dargestellten Inhalt eines Bildes oder für dessen gesamte formale Gestalt (was Adrian Stokes das «Bild in Form» genannt hat); oder es kann als «verbales Ikon» ein verbales Motiv, einen benannten Gegenstand oder eine benannte Eigenschaft, eine Metapher oder eine andere «Figur» oder gar die formale Totalität eines Textes bezeichnen. In der Idee des «Hörbildes» kann es sogar die Grenze zwischen Sehen und Hören überschreiten. Und als eine Bezeichnung für das Nachahmen, als Begriff für Gleichnisse, Ähnlichkeiten und Analogien besitzt es einen quasi-logischen Status als eine der drei großen Ordnungen der Zeichenbildung, den des «Ikons», die (zusammen mit C.S.Peirce’ «Symbol» und «Index») die Gesamtheit aller semiotischen Relationen konstituieren.[1]
Es geht mir hier allerdings nicht so sehr darum, ein Gebiet abzuschreiten, das von der Semiotik abgedeckt wird; ich möchte vielmehr die den Bildern eigentümliche Tendenz betrachten, Menschen aufzunehmen und von ihnen in einer Weise aufgenommen zu werden, die deren Umgang mit Lebewesen verdächtig nahe kommt. Wenn wir über Bilder reden, neigen wir unverbesserlich dazu, in vitalistische und animistische Sprechweisen zu verfallen. Nicht nur, dass sie «das Leben nachahmen», ist von Belang, sondern, dass diese Nachahmungen «ein Eigenleben» anzunehmen scheinen. Im ersten Kapitel möchte ich erkunden, über welche Art von «Leben» genau wir hier sprechen; ferner, wie Bilder jetzt ihre Leben führen, in einer Zeit, wo zum einen der Terrorismus der Kollektivfantasie neues Leben eingehaucht und zum anderen das Klonen der Nachahmung des Lebens eine neue Bedeutung gegeben hat. Im zweiten Kapitel wende ich mich einem Modell von Lebendigkeit zu, das auf dem Gefühl des Begehrens – Hunger, Bedürfnis, Anspruch, Mangel – gründet; und ich erforsche das Ausmaß, in dem das «Leben der Bilder» im Sinne eines Begehrens zum Ausdruck kommt. Im dritten Kapitel («Auf den Spuren des Begehrens») kehre ich die Fragestellung um. Anstatt zu fragen, was Bilder wollen, stelle ich die Frage, wie wir selbst das Begehren betrachten und ins Bild setzen, insbesondere in der wohl fundamentalsten Form des Bildermachens, derjenigen, welche wir «Zeichnung» nennen.
LEBENSZEICHEN – DAS KLONENDES TERRORS*
Man weiß nie, was es mit einem Buch auf sich hat, bis es zu spät ist. Als ich beispielsweise 1994 ein Buch mit dem Titel Picture Theory veröffentlichte, dachte ich, ich verstünde dessen Anliegen sehr gut. Es stellte den Versuch dar, den «pictorial turn» zu diagnostizieren, der sich in unserer gegenwärtigen Kultur vollzogen hat, d.h. die von vielen geteilte Ansicht, dass visuelle Bilder die Wörter als vorherrschendes Ausdrucksmittel unserer Zeit ersetzt haben. Anstatt ihn einfach nur hinzunehmen, unternahm Picture Theory den Versuch, den «pictorial turn» – oder den, wie er manchmal auch genannt wird, «iconic» bzw. «visual» turn – zu analysieren.[1] Konzipiert wurde das Buch, um der landläufigen Meinung von «Bildern, die Wörter ersetzen», entgegenzuwirken sowie um der Versuchung zu widerstehen, alles auf eine einzige disziplinäre Karte zu setzen, sei es nun Kunstgeschichte, Literaturkritik, Medienwissenschaft, Philosophie oder Ethnologie. Anstatt mich auf eine bereits existierende Theorie, Methode oder einen «Diskurs» zu verlassen, um Bilder zu erklären, wollte ich sie selbst zu Wort kommen lassen. Angefangen mit «Metabildern», d.h. Bildern, die über den Prozess des bildlichen Darstellens reflektieren, wollte ich Bilder selbst als Weisen des Theoretisierens erforschen. Ziel war es, kurz gesagt, sich von Theorie ein Bild zu machen, Theorie ins Bild zu setzen; es ging nicht darum, eine Bildtheorie von irgendwo sonst her zu importieren.
Ich möchte mit alldem freilich nicht den Eindruck erwecken, dass Picture Theory unberührt geblieben ist vom Kontakt mit dem reichen Fundus, den die zeitgenössische Theorie zu bieten hat. Semiotik, Rhetorik, Poetik, Ästhetik, Ethnologie, Psychoanalyse, Ethik, Ideologiekritik und Kunstgeschichte wurden (wahrscheinlich zu bunt gemischt) in eine Untersuchung der Beziehungen von Bildern zu Theorien, Texten und Betrachtern verwoben. Diskutiert wurde die Rolle, die Bilder innerhalb literarischer Praktiken spielen, etwa der Beschreibung und der Erzählung; ebenso habe ich die Funktion untersucht, die Texte in visuellen Medien, wie z.B. dem Gemälde, der Skulptur und der Fotografie, einnehmen; schließlich interessierte mich die eigentümliche Macht, die Bilder über Personen, Dinge und Bereiche der Öffentlichkeit haben. Die ganze Zeit über meinte ich, ich wüsste genau, was ich tat – nämlich: erläutern, was Bilder sind, wie sie Sinn stiften und Bedeutung erlangen, was sie bewirken, während ich zugleich ein altes interdisziplinäres Unternehmen wieder aufleben ließ, das sich Ikonologie nennt (die allgemeine Erforschung von Bildern in sämtlichen Medien), und ein neues Unternehmen namens «Visual Culture» initiierte (die Erforschung der menschlichen visuellen Erfahrung und des visuellen Ausdrucks).
Lebenszeichen
Dann traf die erste Rezension zu Picture Theory ein. Die Redakteure von The Village Voice waren in ihrer Bewertung im Großen und Ganzen wohlwollend. Allerdings hatten sie einen Kritikpunkt: Das Buch hatte den falschen Titel. Er hätte What Do Pictures Want? – Was will das Bild? – lauten müssen. Dieser Einwand leuchtete mir sofort ein, und ich beschloss, einen Aufsatz unter ebendiesem Titel zu schreiben. Dieses Buch ist das Resultat dieses Entschlusses; es trägt viele meiner Forschungen zur Bildtheorie von 1994 bis 2002 zusammen, darunter besonders die Arbeiten, die das Leben der Bilder untersuchen. Dabei verfolge ich das Ziel, die vielfachen Formen von Lebhaftigkeit oder Vitalität, die Bildern zugeschrieben werden, in Augenschein zu nehmen, sprich: die Wirkund Antriebskraft, die Autonomie, Aura und Fruchtbarkeit oder andere Symptome, die Bilder zu «Lebenszeichen» machen. Damit meine ich, dass sie nicht bloß als Zeichen für Lebewesen fungieren, sondern dass sie vielmehr als Lebewesen auftreten. Sofern die Frage Was will das Bild? überhaupt irgendeinen Sinn macht, dann deshalb, weil wir davon ausgehen, dass Bilder so etwas wie Lebensformen darstellen, die durch Begierden und Sehnsüchte angetrieben werden.[2] Die Frage, wie diese Annahme zum Ausdruck kommt (und wie sie verleugnet wird) und welche Bedeutung sie besitzt, ist die drängendste Frage dieses Buches.
Doch zunächst zur Frage: Was will das Bild? Wieso sollte solch eine offensichtlich müßige, unseriöse bzw. unsinnige Frage länger als einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit beanspruchen?[3] Die kürzeste Antwort, die ich zu geben vermag, kann nur durch eine weitere Frage formuliert werden: Woran liegt es, dass Menschen eine derart merkwürdige Haltung gegenüber Bildern, Objekten und Medien einnehmen? Wieso verhalten sie sich so, als wären Bilder lebendig, als verfügten Kunstwerke über eine eigene Seele, als besäßen Bilder die Macht, Menschen zu beeinflussen, Dinge von uns zu fordern, uns zu überzeugen, zu verführen und in die Irre zu leiten? Und was noch rätselhafter ist: Woran liegt es, dass uns dieselben Menschen, die jene Haltungen offenbaren und sich derartigen Verhaltensweisen hingeben, wenn man sie danach fragt, versichern, dass sie sich sehr wohl darüber im Klaren sind, dass Bilder nicht lebendig sind, dass Kunstwerke nicht über eine eigene Seele verfügen und dass Bilder in Wirklichkeit ziemlich machtlos sind, auch nur irgendetwas ohne das Zutun ihrer Betrachter zu leisten? Anders gesagt: Wie lässt sich erklären, dass Menschen dazu fähig sind, ein «doppeltes Bewusstsein» gegenüber Bildobjekten, Bildträgern und Darstellungen in einer Vielfalt von Medien aufrechtzuerhalten, zwischen magischem Glauben und skeptischem Zweifel, naivem Animismus und nüchternem Materialismus, mystischen und kritischen Haltungen hin und her zu schwanken?[4]
Der gängige Weg, ein solches doppeltes Bewusstsein aus der Welt zu schaffen, besteht darin, eine seiner Seiten (im Allgemeinen die naive, magische, abergläubische Seite) jemand anderem zuzuschreiben und die nüchterne, kritische und skeptische Position als die eigene auszugeben. Es gibt etliche Kandidaten für die Rolle des «Anderen», desjenigen, der daran glaubt, dass Bilder lebendig sind und über einen eigenen Willen verfügen: Primitive, Kinder, die Masse, die Ungebildeten, die Unkritischen, die Unvernünftigen, kurz: die «Anderen».[5] Ethnologen haben Überzeugungen wie diese üblicherweise dem «Geist des Wilden» zugeschrieben, Kunsthistoriker dem nicht-westlichen bzw. vormodernen Geist, Psychologen dem neurotischen oder infantilen Geist, Soziologen dem Volksgeist. Zugleich hatte aber jeder Ethnologe und Kunsthistoriker bei einer solchen Zuschreibung seine Bedenken. Claude Lévi-Strauss etwa macht deutlich, dass uns der Geist des Wilden – was auch immer es mit diesem auf sich haben mag – vieles über den Geist der Moderne lehrt. Und Kunsthistoriker wie David Freedberg oder Hans Belting, die über den magischen Charakter der Bilder «vor dem Zeitalter der Kunst» nachgedacht haben, räumen eine gewisse Unsicherheit ein, wenn es um die Frage geht, ob naive Überzeugungen wie diese auch in der Moderne noch gesund und munter sind.[6]
Lassen Sie mich von Anfang an die Karten auf den Tisch legen. Ich glaube, dass in der modernen Welt magische Haltungen gegenüber Bildern ebenso machtvoll sind, wie es in den sogenannten Zeiten des Glaubens der Fall war. Des Weiteren glaube ich, dass die Zeiten des Glaubens ein wenig skeptischer waren, als wir es ihnen zugestehen. Ich meine, dass das doppelte Bewusstsein, das wir in Bezug auf Bilder zeigen, ein tiefsitzendes und beständiges Merkmal des menschlichen Verhaltens gegenüber bildlichen Darstellungen ist. Es ist keineswegs etwas, über das wir «hinwegkommen», sobald wir erwachsen oder modern werden oder ein kritisches Bewusstsein erlangen. Zugleich möchte ich damit nicht andeuten, dass sich unsere Einstellungen gegenüber Bildern niemals ändern oder es keine bedeutenden Unterschiede zwischen Kulturen, geschichtlichen oder Entwicklungsstadien gibt. Die spezifischen Weisen, wie dieses paradoxe Doppelbewusstsein von Bildern zum Ausdruck kommt, sind erstaunlich vielfältig. Zu ihnen zählen Erscheinungen wie populäre und gehobene Auffassungen von Kunst; Verhaltensweisen Strenggläubiger gegenüber religiösen Ikonen und Reflexionen, die Theologen über sie anstellen; das Verhalten von Kindern (und Eltern) gegenüber Puppen und Spielsachen; die Gefühle, die Nationen und Bevölkerungen kulturellen und politischen Ikonen gegenüber zeigen; die Reaktionen, welche auf technische Fortschritte in der Medien- und Vervielfältigungsindustrie folgen; und die Verbreitung von archaischen Rassevorurteilen. Zu ihnen gehört außerdem die unabwendbare Neigung der Kritik, als ikonoklastisches Unternehmen aufzutreten, als das pädagogische Bemühen, Bilder zu entmystifizieren und als etwas Falsches zu entlarven. Meiner Ansicht nach ist Kritik als Ikonoklasmus ebenso ein Symptom für das Leben der Bilder wie ihr Gegenstück: der naive Glaube an das innere Leben von Kunstwerken. Ich hoffe, einen dritten Weg erkunden zu können, einen Weg, der in Nietzsches Götzendämmerung vorgeschlagen wird: «die Götzen» mit der «Stimmgabel» der Sprache der Kritik bzw. der Sprache der Philosophie «auszuhorchen» und zum Klingen zu bringen.[7] Dies entspräche einer Form von Kritik, die nicht davon träumt, die Bilder überwinden zu wollen, die nicht darauf abzielt, all die falschen Bilder zu zerschmettern, die uns verhexen, oder auch nur danach trachtet, eine klare Trennung von wahren und falschen Bildern einzuführen. Es würde sich um eine Form von Kritik handeln, die gerade genügend Kraft besitzt, den Bildern einen Widerhall zu entlocken, die aber nicht so stark ist, sie zu zerschlagen.
Roland Barthes formulierte das Problem, mit dem wir es zu tun haben, sehr treffend, als er anmerkte, dass «die gängige Meinung […] das Bild aufgrund einer gewissen mythischen Vorstellung des Lebens dunkel für einen Ort des Widerstands gegen den Sinn [hält]: Das Bild ist Darstellung, das heißt letztlich Wiederaufleben […].»[8] Als Barthes dies schrieb, war er davon überzeugt, dass die Semiotik – die «Wissenschaft der Zeichen» – den vom Bild geleisteten «Widerstand gegen den Sinn» bezwingen und «die mythische Vorstellung des Lebens» entmystifizieren würde, die die bildliche Darstellung wie eine Art «Wiederaufleben» erscheinen lässt. Später, als er über das Problem der Fotografie nachdachte und sich einer Aufnahme seiner eigenen Mutter in einem Wintergarten gegenübersah, welche er als das «Zentrum aller Photographien der Welt» auffasste, begann er, mit seiner Überzeugung, durch Kritik die Magie des Bildes überwinden zu können, zu hadern: «[…] und so überließ ich mich beim Anblick des Photos aus dem Wintergarten ganz dem BILD, der EINBILDUNG.»[9] Das punctum bzw. die Wunde, die eine Fotografie hinterlässt, übertrumpft stets das studium, den Sinn bzw. den semiotischen Inhalt, den sie aufzeigt. Eine ähnliche (und simplere) Veranschaulichung dieses Sachverhalts bietet einer meiner Kollegen aus der Kunstgeschichte: Wenn Studenten sich über die Idee von einer magischen Beziehung zwischen einem Bild und dem, was es darstellt, lustig machen, dann bitte man sie darum, eine Fotografie ihrer Mutter zu nehmen und dieser die Augen auszuschneiden.[10]
Barthes’ wichtigste Beobachtung ist, dass der Widerstand des Bildes gegen den Sinn – sein mythischer, vitalistischer Status – eine «vage Vorstellung» darstellt. Diese vage Vorstellung so deutlich wie möglich zu machen, die Art und Weise zu analysieren, wie Bilder lebendig zu werden und einen eigenen Willen zu entwickeln scheinen – das ist es, worin der Zweck dieses Buches besteht. Anstatt dies alles als eine Frage von Sinn und Macht zu begreifen, fasse ich es als eine Frage des Begehrens auf und suche herauszufinden, was Bilder wollen, und nicht, welchen Sinn sie in sich tragen oder was sie bewirken. Der Frage nach dem Sinn ist von Seiten der Semiotik und Hermeneutik ausgiebig – man könnte sagen: erschöpfend – nachgegangen worden, was zur Folge hat, dass jeder Bildtheoretiker irgendeinen Rest oder «Mehrwert» zu entdecken scheint, der über Begriffe wie Kommunikation, Bedeutung und Überzeugung hinausgeht. Das Modell von der Macht der Bilder ist sorgfältig von anderen Gelehrten erforscht worden,[11] doch scheint mir, dass es gerade nicht jenes paradoxe doppelte Bewusstsein erfasst, um das es mir geht. Wir müssen nicht nur den Sinn von Bildern in Rechnung stellen, sondern ebenso ihr Schweigen, ihre Zurückhaltung, ja auch ihre Zügellosigkeit und ihre widersinnige Hartnäckigkeit.[12] Nicht nur über die Macht der Bilder müssen wir Rechenschaft ablegen, sondern auch über ihre Machtlosigkeit, ihre Ohnmacht, ihren Jammer. Mit anderen Worten: Wir müssen beide Seiten des Paradoxons des Bildes zu fassen suchen: dass es lebendig ist – aber auch tot; mächtig – aber auch schwach; bedeutungsvoll – aber auch bedeutungslos. Die Frage nach dem Begehren eignet sich in idealer Weise für die vorliegende Untersuchung, da sie gleich am Anfang eine entscheidende Doppeldeutigkeit einbringt. Zu fragen, was Bilder wollen, heißt nicht bloß, ihnen Leben, Macht und Begehren zuzuschreiben, sondern auch die Frage danach aufzuwerfen, was es ist, woran es ihnen mangelt, was es ist, das sie nicht besitzen, was ihnen nicht beigemessen werden kann. Anders gesagt: Zu behaupten, dass Bilder nach Leben und Macht «verlangen», impliziert nicht notwendig, dass sie auch tatsächlich über Leben und Macht verfügen oder dass sie auch nur dazu in der Lage sind, sich all dies zu wünschen. Es mag bloß ein Zugeständnis sein, dass ihnen an etwas Derartigem mangelt, dass sie etwas vermissen lassen oder (wie wir zu sagen pflegen) es ihnen an etwas «fehlt».
Es wäre allerdings unaufrichtig zu leugnen, dass in der Frage nach dem, was Bilder wollen, ein Animismus, Vitalismus und Anthropomorphismus mitschwingt und sie uns dazu führt, Fälle zu berücksichtigen, in denen Bilder so behandelt werden, als wären sie Lebewesen. Selbstverständlich ist die Idee vom Bild als Organismus «nur» eine Metapher, eine Analogie, deren Grenzen es abzustecken gilt. David Freedberg plagte es, dass es sich hierbei «bloß» um eine literarische Konvention, ein Klischee oder einen Tropus handelt, und er bringt dann wegen seines eigenen geringschätzigen Gebrauchs des Wortes bloß weiteres Unbehagen zum Ausdruck.[13] Das lebendige Bild stellt meiner Ansicht nach sowohl einen verbalen als auch einen visuellen Tropus dar, eine Sprachfigur, ein Bild des Sehens, der grafischen Gestaltung sowie des Denkens. Es ist, anders gesagt, ein sekundäres, reflexives Bild von Bildern, etwas, das ich an anderer Stelle ein «Metabild» genannt habe.[14] Die Fragen, die dementsprechend zu stellen sind, lauten: Wo liegen die Grenzen dieser Analogie? Wohin führt sie uns? Was veranlasst ihr Erscheinen? Was verstehen wir überhaupt unter «Leben»?[15] Wieso erscheint die Verbindung zwischen Bildern und Lebewesen als so unausweichlich und notwendig, wo sie doch fast durchweg Ungläubigkeit hervorruft: «Glauben Sie wirklich, dass Bilder etwas wollen?» Meine Antwort lautet: Nein, das tue ich nicht. Doch dürfen wir nicht ignorieren, dass sich Menschen (auch ich) nicht davon abbringen lassen, so zu sprechen und zu handeln, als würden sie daran glauben. Eben das ist es, was ich mit dem «doppelten Bewusstsein» meine, das Bilder umgibt.
Das Klonen des Terrors
Die philosophische These dieses Buches ist in ihren Grundzügen recht einfach: Bilder verhalten sich wie Lebewesen; Lebewesen lassen sich am besten als etwas beschreiben, das Bedürfnisse hat (z.B. Begierden, Forderungen, Triebe); daher ist es unvermeidlich, die Frage zu stellen, was Bilder wollen. Meine These hat allerdings auch eine historische Dimension, die es deutlich zu machen gilt. Wenn Menschen, um Marx zu paraphrasieren, Bilder erzeugen, die ein Eigenleben und ihre eigenen Begierden zu haben scheinen, tun sie dies weder stets in derselben Weise noch unter Bedingungen, die ihrer eigenen Wahl unterliegen. Wenn das Phänomen des lebendigen Bildes oder der belebten Ikone eine anthropologische Universalie ist, eine Eigentümlichkeit, die der fundamentalen Ontologie des Bildes schlechthin zuzurechnen ist, dann stellt sich die Frage: Wie verändert sich dieses Phänomen mit der Zeit und von der einen Kultur zur anderen? Und: Warum drängt es sich unserer Aufmerksamkeit gerade in diesem besonderen Moment der Geschichte so kraftvoll auf? Wenn das lebendige Bild tatsächlich stets Gegenstand eines doppelten Bewusstseins, eines simultanen Glaubens und Verleugnens gewesen ist, was sind dann die Bedingungen, die es heutzutage immer schwieriger machen, dieses Verleugnen aufrechtzuerhalten? Anders gesagt: Warum erscheinen verschiedene Formen des «Iconoclash» – des Krieges der Bilder – derart auffällig als Teil des «pictorial turn» in unserer Zeit?[16]
Eine Antwort auf diese Fragen lässt sich nicht auf abstrakte Weise geben. Sie muss in den spezifischen, konkreten Bildern gesucht werden, die die derzeitige Aufregung über das Schaffen und Stürmen von Bildern am augenfälligsten verkörpern. Man betrachte zwei Bilder, die auf so deutliche Art unsere derzeitige historische Lage anzeigen. Das erste ist Dolly das Schaf (Abb. 3), das geklonte Tier, das zur globalen Ikone der Gentechnik geworden ist, mit all ihren Verheißungen und Drohungen. Das zweite zeigt die Zwillingstürme des World Trade Center im Augenblick ihrer Zerstörung (Abb. 4) – ein Spektakel, das eine neue, durch den Terrorismus bestimmte Weltordnung einleitete. Die Kraft dieser Bilder liegt nicht bloß in ihrer Gegenwärtigkeit oder ihrer thematischen Aktualität begründet, sondern fußt auf ihrem Stellenwert als Enigma und Omen, als Vorbote für unsichere Zeiten. Sie veranschaulichen zudem das sinnliche Spektrum einer unsere Zeit kennzeichnenden Bilderangst, die vom überwältigend traumatischen Spektakel der Massenvernichtung bis zur subtilen Schauerlichkeit des geklonten Schafes reicht, welches zwar als visuelles Bild nicht sonderlich bemerkenswert ist, als Idee jedoch beträchtliche Ängste verkörpert.
Abb. 3 Dolly das Schaf, Roslin Design
Der Klon bezeichnet das heutige Potenzial zur Erzeugung neuer Bilder – Bilder, die insofern neu sind, als sie den alten Traum von der Erschaffung eines «lebendigen Bildes» erfüllen, einer Replik oder Kopie, die nicht bloß ein mechanisches Duplikat ist, sondern ein organisches, biologisch lebensfähiges Simulakrum eines Lebewesens. Indem der Klon den Begriff der belebten Ikone auf den Kopf stellt, macht er das Verleugnen des lebendigen Bildes unmöglich. Wir erkennen nun, dass es nicht nur einige wenige Bilder sind, die lebendig zu werden scheinen, sondern dass Lebewesen selbst immer schon in der einen oder anderen Form Bilder gewesen sind. Jedes Mal, wenn wir etwas wie «Sie ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten» sagen oder auf die Verbindung zwischen dem Begriff einer Art und der optischen Erscheinung hinweisen, werden wir dieser Tatsache gewahr.[17] Durch den Klon erhalten derartige Gemeinplätze einen neuartigen Nachhall – ein klassisches Beispiel für das, was Freud das Unheimliche nannte, den Augenblick, in dem die gewöhnlichsten Formen des sonst verleugneten Aberglaubens (das Monster im Schrank oder die Spielsachen, die lebendig werden) als unleugbare Wahrheiten wiederkehren.
Abb. 4 World Trade Center in Flammen, 11. September 2001, Reuters