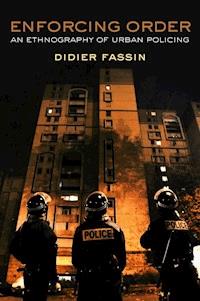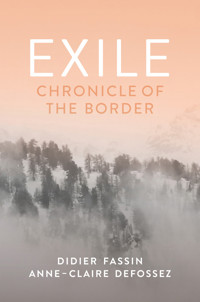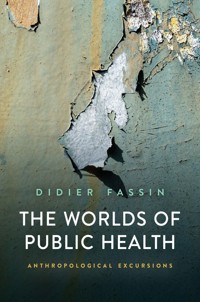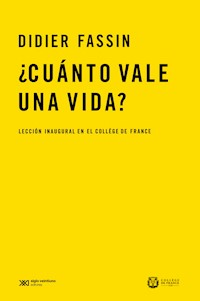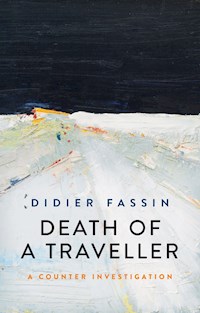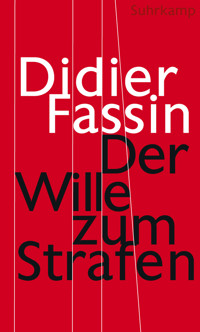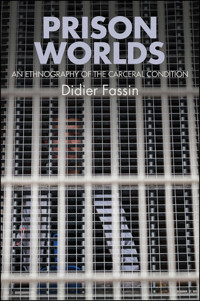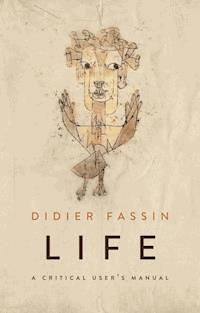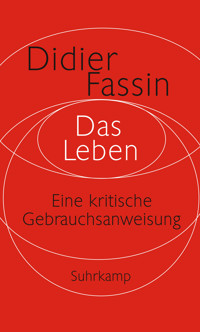
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Leben gilt, in Adornos Worten, seit der Antike als der eigentliche Bereich der Philosophie, die nach dem richtigen und guten Leben fragt. Seit etwas mehr als einem Jahrhundert ist das Leben aber auch zu einem Gegenstand der Sozialwissenschaften geworden. Der renommierte französische Mediziner, Anthropologe und Soziologe Didier Fassin regt in seinem faszinierenden Buch nun zu einem kritischen Dialog zwischen Philosophie und Sozialforschung an.
Zur Debatte stehen dabei drei Konzepte: Die »Formen des Lebens« untersucht Fassin angesichts der widersprüchlichen Interpretationen von Ludwig Wittgensteins Begriff der Lebensform. Mit der »Ethik des Lebens« beschäftigt er sich unter Bezug auf Walter Benjamins Idee der Heiligkeit des Lebens als höchstem Gut. Und die »Politik des Lebens« erkundet Didier Fassin im Anschluss an Michel Foucaults Konzept der Biopolitik. Gestützt auf zahlreiche ethnografische Fallstudien, die zeigen, wie Leben in verschiedenen kulturellen und historischen Kontexten betrachtet und erfahren wird, entwickelt Fassin eine kritische Ethnologie gegenwärtiger Gesellschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
3Didier Fassin
Das LebenEine kritische Gebrauchsanweisung
Frankfurter Adorno-Vorlesungen 2016
Übersetzt von Christine Pries
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Hauptteil
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
7Inhalt
Dank
Vorrede Minima Theoria
I
Formen des Lebens
II
Ethik des Lebens
III
Politik des Lebens
Schluss Ungleiche Leben
Anmerkungen
3
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
5
Für Anne-Claire,
mit der ich
fürs Leben eine Gebrauchsanweisung
gefunden habe
9Dank
Die Ehre, die mir zuteilwurde, am Institut für Sozialforschung der Frankfurter Goethe-Universität die Adorno-Vorlesungen zu halten, ist die einzige Entschuldigung, die ich zur Rechtfertigung des ambitionierten Projekts vorbringen kann, das der Titel anzukündigen scheint. Offen gesagt, habe ich denjenigen, die mich in den Monaten vor diesen Vorträgen nach deren Thema fragten, nicht ohne eine gewisse Verlegenheit geantwortet, dass ich über »das Leben« sprechen würde. Die scheinbare Einfachheit eines Wortes mit drei, vier oder fünf Buchstaben — je nachdem, ob auf Französisch, auf Englisch oder auf Deutsch — vermittelte jedoch mit Sicherheit den falschen Eindruck, und das ungläubige Stutzen meiner Gesprächspartner, das auf diese ebenso verwegene wie rätselhafte Äußerung folgte, zwang mich, einige Erklärungen abzugeben. Ich führte also meine Absicht an, die in erster Linie ethnographischen Untersuchungen, die ich im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte auf mehreren Kontinenten durchgeführt hatte, noch einmal zu überdenken und eine Reihe von philosophischen Begriffen auf den Prüfstand zu stellen, die mich während all dieser Jahre inspiriert, aber nicht zufriedengestellt hatten. Ich erinnerte daran, dass für meine verschiedenen Forschungsgebiete die Frage nach den Lebensweisen und den Umgangsweisen mit dem menschlichen Leben immer gegenwärtig gewesen sei. Ich erzählte von den Formen des Lebens, der Ethik des Le10bens und der Politik des Lebens. Damit meine doppelte — empirische und theoretische — Fragestellung Sinn ergab, versuchte ich letztendlich, meinen Gesprächspartnern eine Gebrauchsanweisung zu liefern.
Als eine Form der Hommage an Georges Perec, der gesagt hat, »Leben« heiße, »von einem Raum zum anderen zu gehen und dabei so weit wie möglich zu versuchen, sich nicht zu stoßen«, ist die Verwendung dieses Ausdrucks im Titel des vorliegenden Buches auch eine Weise, dessen Projekt bescheidener zu machen, es verständlicher wirken zu lassen und ihm den Anstrich einer Art von Bricolage zu geben, die dazu anregt, es als Puzzle zu betrachten, dessen Teile der Leser entdecken und dabei neu zusammensetzen soll. Gleichwohl entspricht der Gegenstand dieses Textes seiner Ankündigung: Es geht darin um das Leben — und um die Leben. Die Annahme, dass darin der rote Faden einer Laufbahn liegt, die in der Medizin begann und dann auf die Anthropologie umschwenkte, ist naheliegend und teilweise sicherlich zutreffend. Vom Biologie-Unterricht wäre ich zum Sammeln von Biographien übergegangen: vom Leben der Organe zum Leben der Menschen. Doch das ist nicht alles. Denn der Blick, den ich anhand der Formen des Lebens, der Ethik des Lebens und der Politik des Lebens auf das Leben werfe, ist nicht neutral. Er ist vom Thema der Ungleichheit geprägt, das heißt von der Ungleichheit der Leben, die von meiner Kindheit in einer euphemistisch so genannten Sozialwohnung bis zu meiner Entdeckung der nichtwestlichen Gesellschaften durch das Elend, das mir in den indischen Städten begegnete, meine Weltsicht geformt hat. Insofern hätte dieses Buch vielleicht den unmissverständlicheren Titel »Über die Ungleichheit der Leben« tragen sollen. So wie das gesamte Werk des Autors von Das Leben. Gebrauchsanweisung11von einer Abwesenheit heimgesucht wird — von der Abwesenheit seiner im Zweiten Weltkrieg getöteten Eltern —, glaube ich, dass meine gesamte Forschung von einem Bewusstsein für die Ungleichheit der Leben durchdrungen ist. Deshalb habe ich meine Gebrauchsanweisung für das Leben zur näheren Bestimmung mit dem Adjektiv »kritisch« versehen.
Bei der Überarbeitung dieser Vorträge für die Veröffentlichung habe ich nicht nur an ihrem Ablauf festgehalten — einem Triptychon, dessen einzelne Teile mit einem theoretischen Überblick beginnen, der in die empirische Untersuchung einführen und dabei einen neuen Synthesevorschlag machen soll —, sondern auch an ihrem Kontext: an der Bezugnahme auf Adorno zu Beginn des Buches und an der Erinnerung an die tragischen Momente der Zeit, als die Minima Moralia verfasst wurden, am Ende jedes Kapitels. Denn alles, was geschrieben wird, hat eine Geschichte, und ich wollte die Schreibweise dieser in Frankfurt in jener Institution gehaltenen Vorträge beibehalten, in der eine der bedeutendsten Formen der Gesellschaftskritik vor beinahe einem Jahrhundert das Licht der Welt erblickt hat, weiterverfolgt und erneuert wurde.
Dieses Stichwort möchte ich zum Anlass nehmen, dem Direktor des Instituts für Sozialforschung, Axel Honneth, meinen Dank dafür auszusprechen, dass er mich zu meiner großen Überraschung eingeladen hat, diese Vorträge zu halten, und mir dadurch Gelegenheit gab, die bis dahin verstreuten Puzzleteile des Lebens zusammenzutragen. Ich möchte auch all den Forscherinnen und Forschern und Professorinnen und Professoren danken, die als Mitglieder oder Gäste ständig oder zeitweilig am Institut tätig sind und deren Anmerkungen, Fragen und Kritikpunkte zur Präzisierung meines Den12kens beigetragen haben, vor allem José Brunner, Thomas Khurana, Thomas Lemke, Yves Sintomer, Sarah Speck, Felix Trautmann und Peter Wagner. Außerdem bin ich Sidonia Blättler dafür dankbar, dass mein Besuch in Deutschland so angenehm verlaufen ist, Eva Gilmer für das Angebot, meinen Text in ihrem renommierten Verlag zu veröffentlichen, und schließlich Christine Pries für ihr Talent, ihn sowohl aus dem Englischen als auch aus dem Französischen zu übersetzen. Insofern dieses Buch auf mehreren Jahrzehnten wissenschaftlicher Forschung und menschlicher Erfahrung beruht, ist es mir ohnehin nicht möglich, die Schuld zum Ausdruck zu bringen, in der ich bei so vielen Personen stehe, besonders bei den Studierenden und Kolleginnen und Kollegen an der École des hautes études en sciences sociales und am Institute for Advanced Study, aber auch bei all denjenigen, denen ich im Laufe meiner Feldforschungen vor allem in Südafrika und in Frankreich begegnet bin und die Bruchstücke ihres Lebens mit mir geteilt haben.
Princeton, 21. Dezember 2016
13Vorrede Minima Theoria
Erfüllte Leben geradenwegs seine Bestimmung, so würde es sie verfehlen. […] Der Gedanke wartet darauf, daß eines Tages die Erinnerung ans Versäumte ihn aufweckt und ihn in die Lehre verwandelt.
Theodor W. Adorno, Minima Moralia, 1951
In den ersten Zeilen der »Zueignung« der zu weiten Teilen während des Zweiten Weltkriegs im US-amerikanischen Exil verfassten Minima Moralia an seinen Freund und Kollegen Max Horkheimer erinnert Theodor W. Adorno mit Bitterkeit und Wehmut an das, »[w]as einmal für den Philosophen Leben hieß«.[1] In den modernen Gesellschaften, fährt er fort, habe nämlich der materielle Produktionsprozess jenes Leben »zur ephemeren Erscheinung« herabgestuft, die Konsumsphäre biete nur noch einen »Schein des Lebens« oder vielmehr ein »Zerrbild wahren Lebens«. Unter diesen Bedingungen beziehe sich »[d]ie traurige Wissenschaft« der Denker seiner Zeit, wie er seinen Text in ironischer Bezugnahme auf das berühmte Buch von Nietzsche bezeichnet, »auf einen Bereich, der für unvordenkliche Zeiten als eigent14liches Gebiet der Philosophie galt«, mittlerweile aber »der intellektuellen Nichtachtung, der sententiösen Willkür und am Ende der Vergessenheit verfiel: die Lehre vom richtigen Leben.« Erwähnenswert ist übrigens an dieser Stelle, dass der deutsche Ausdruck »das richtige Leben« im Englischen mit »good life« übersetzt wird. Das liegt daran, dass er die Doppelbedeutung von »gutem Leben« und »richtigem Leben« hat und damit ein Beispiel für das semantische Spannungsverhältnis abgibt, das im Zentrum der Moralphilosophie zwischen der ethischen Beziehung zu sich selbst und der ethischen Beziehung zu anderen Menschen besteht.
Wie dem auch sei: Die pessimistische Bilanz des immer noch bedeutendsten Vertreters der ersten Generation der Frankfurter Schule und in dieser Eigenschaft eines der Begründer der »kritischen Theorie der Gesellschaft« läutet die Totenglocke für das, was einmal das Leben in seiner ganzen moralischen Fülle war — ob er es nun als wahr, gerecht oder gut bezeichnet. Davon bleibt nur eine »entfremdete Gestalt«, deren Sackgassen er sich in einer Reihe von kurzen und düsteren Meditationen über ganz alltägliche Phänomene und ganz gewöhnliche Gegenstände der heutigen Welt zu zeigen bemüht. Diese Meditationen bieten mithin, was Rahel Jaeggi »eine Kritik des Kapitalismus als Lebensform« nennt, das heißt nicht nur als ungleiches Produktionsverhältnis, sondern auch als herabwürdigende Daseinsweise: Jaeggi zufolge bringen sie gleichzeitig eine »Ethik und Ethikkritik« zum Ausdruck, die Möglichkeit eines anderen Lebens und zugleich die Unmöglichkeit, es herbeizuführen.[2] Adornos bewusst bruchstückhafte Über15legungen zu den kulturellen Praktiken der Männer und Frauen seiner Zeit werfen nämlich die Frage nach den gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen auf, die die Einrichtung einer, wie er es nennt, »menschenwürdigeren Ordnung« erlauben würden. Davon seien wir allerdings noch weit entfernt, räumt er ein, insofern der »Blick aufs Leben […] übergegangen [ist] in die Ideologie, die darüber betrügt, daß es keines mehr gibt«. Manifestation einer »Verzweiflung«, die durch das Schreiben im Schatten der Ruinen von Nazideutschland noch stärker hervortritt.
Seit dem Erscheinen dieses Textes sind 65 Jahre vergangen, und der Kapitalismus, den wir kaum noch beim Namen nennen — und mittlerweile lieber mit einem zweideutigen Euphemismus als »Liberalismus« bezeichnen —, scheint noch größere Triumphe zu feiern und noch unumstrittener zu sein als zu der Zeit, als Adorno sein Buch schrieb, während die tragischen Lehren des Zweiten Weltkriegs und seiner Völkermorde, aus denen sich das Denken seiner Zeitgenossen auf schmerzliche Weise speiste, anscheinend in dem Maße verblassen, wie sich Identitätsdiskurse Gehör verschaffen und autoritäre Versuchungen Bahn brechen: Die Gewaltsamkeit und Unsicherheit einer aus dem Gleichgewicht geratenen Welt werden zur Legitimation aller möglichen Formen von Ausschließung und Unterdrückung herangezogen. Dies sind beunruhigende Anzeichen für ein neues »Zeitalter der Angst«, um den Titel des im selben Zeitraum von dem britischen Schriftsteller W. H. Auden geschriebenen Langgedichts wieder aufzugreifen, denn ein sol16ches Auf und Ab des demokratischen Lebens belastet die Menschenleben auf grundverschiedene und oftmals ungleich starke Weise.[3] Das heißt, dass die Minima Moralia nichts von ihrer Klarsichtigkeit verloren haben, auch wenn es angebracht ist, ihre Analysen den heutigen Realitäten anzupassen, damit man von neuem über jenes »beschädigte Leben« nachdenken kann, von dem im Untertitel des Buchs die Rede ist. Diesbezüglich muss der paradoxe Charakter der Überlegungen unterstrichen werden, die Adorno anstellt. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe, die der Zweite Weltkrieg und die Vernichtungspläne des Naziregimes darstellen, wählt Adorno das, was Miguel Abensour die »kleine Form« nennt, die »wesensmäßig mit einer Rebellion gegen die Welt des Kriegs und des Schreckens verbunden ist«.[4] Daher der minimalistische Titel; daher die Rückführung der Perspektive auf das einzelne Individuum; daher die Forderung nach einer Philosophie, die für die Verteidigung des — wahren, richtigen oder guten — Lebens einschlägig ist.
Ich möchte meinen Ausführungen trotzdem eine andere Stoßrichtung geben, indem ich das Individuum wieder in die Gesellschaft und in die Welt hereinhole: in die Gesellschaft heißt in den relationalen Raum, der es konstituiert; in die Welt heißt in den globalen Raum, in dessen Rahmen es sich bewegt. Mehr als die Wechselfälle des ethischen Subjekts, denen Adorno seine Überlegungen widmet, versuche ich, die Nöte der politischen 17Gemeinschaft zu durchschauen. Eher als mit den kulturellen Entwicklungen, die er in Frage stellt, beschäftige ich mich mit der Entschlüsselung struktureller Phänomene. Und zu diesem Zweck beabsichtige ich, die Kritik der Lebensweisen, die er formuliert, durch eine Kritik des Umgangs mit dem und mit den Leben zu ersetzen. Nicht: Wie leben wir? Oder: Wie sollen wir leben? Sondern eher: Welchen Wert messen wir dem menschlichen Leben als abstrakter Vorstellung bei? Und auch: Wie bewerten wir Menschenleben als konkrete Realitäten? Jeder Spalt und erst recht jeder Widerspruch zwischen der Wertschätzung des Lebens im Allgemeinen und der Herabwürdigung mancher Leben im Besonderen ist dabei für eine moralische Ökonomie des Lebens in den Gesellschaften der Gegenwart von Bedeutung.
Unter moralischer Ökonomie verstehe ich die Produktion, Zirkulation, Aneignung und Leugnung von Werten, aber auch von Affekten im Zusammenhang mit einem Gegenstand, einem Problem oder, weiter gefasst, einem sozialen Phänomen — im vorliegenden Fall dem Leben. Dieser Begriff macht sowohl Anleihen bei der Analyse, die E. P. Thompson vorgenommen hat, als er die Hungeraufstände im England des 18. Jahrhunderts mit Hilfe der moralischen Ökonomie der Bauern erklärte, das heißt mit Hilfe der Normen und sozialen Verpflichtungen, nach denen sich ihre Erwartungen und Praktiken richteten, als auch bei der Interpretation, die Lorraine Daston vorgelegt hat, als sie die Wissensproduktion im 17. Jahrhundert untersuchte und dabei die Rolle der moralischen Ökonomie der Wissenschaft unterstrich, das heißt der Werte und Affekte, die von den Gelehrten geteilt wurden.[5] Er rückt aber auch an mehre18ren wesentlichen Punkten davon ab. Im Unterschied zu Thompson begrenze ich die moralische Ökonomie nicht allein auf den Aspekt von Gütern und Dienstleistungen, sondern weite sie auf alle sozialen Konfigurationen aus, die für die Beschreibung des moralischen Zustands der Welt einschlägig sind: Die Art und Weise, wie das Leben betrachtet und wie mit den Leben umgegangen wird, ist dabei einer der stärksten Analysatoren. Im Unterschied zu Daston interessiere ich mich weniger für eine stabile Ordnung, um die herum sich ein Konsens bilden kann, als für die Schwankungen, denen die Werte und Affekte im Laufe der Zeit unterliegen, und für die Art und Weise, wie sie dabei in ein Spannungs- oder Konkurrenzverhältnis treten: Die Entwicklungsschritte und Widersprüche der abstrakten Wertschätzung des Lebens und der konkreten Bewertung von Leben sind wesentlich für meine Ausführungen. Dort, wo die eigenen moralischen Vorlieben des britischen Historikers deutlich werden, stellt meine Analyse der moralischen Prinzipien und Gefühle außerdem den Versuch dar, sie eher aufzudecken und zu interpretieren, als sie zu beurteilen, und 19während die US-amerikanische Historikerin einen kulturgeschichtlichen Ansatz verfolgt, bemühe ich mich darum, die sozialen Logiken und Machtverhältnisse nachzuvollziehen, auf denen die Produktion, Zirkulation, Aneignung — wozu auch der Missbrauch gehört — und Leugnung, ja sogar Ablehnung der Werte und Affekte beruht. Die moralische Ökonomie, die ich mir vorstelle, ist nicht die moralische Ökonomie einer Gruppe oder eines Gebiets, sondern die moralische Ökonomie dessen, was in einer bestimmten Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll ist. In dieser Hinsicht ist das Leben, dessen Auslöschung Adorno beklagt hat, vielleicht noch nie zuvor Gegenstand so heterogener und widersprüchlicher moralischer Besetzungen gewesen. Einer so verstandenen moralischen Ökonomie des Lebens ist dieses Buch gewidmet.
*
Doch wissen wir wirklich, wovon wir sprechen, wenn wir vom Leben sprechen? Das ist mehr als ungewiss und deshalb müssen wir uns fragen, was das Wort eigentlich bedeutet.
»Eines der gebräuchlichsten Wörter ist Leben. Fast jeder würde sich beleidigt fühlen, wenn man ihn fragte, was er darunter verstehe«, schreibt John Locke, doch er fügt sogleich hinzu: »Wenn jedoch entschieden werden soll, ob eine Pflanze, die im Samenkorn fertig ausgebildet vorliegt, Leben habe, ob der Embryo im Ei vor der Bebrütung oder ein Ohnmächtiger ohne Sinnesempfindung und Bewegung am Leben sei oder nicht, dann ist leicht zu beobachten, daß mit der Anwendung eines so bekannten Wortes wie ›Leben‹ nicht immer auch eine klare, deutliche, feststehende Idee ein20hergeht.«[6] Für Locke liegt die Schwierigkeit also vor allem in der Bestimmung der Grenzen des Lebens: in seinen unklaren Anfängen im Samenkorn oder Ei, die sich heute bekanntlich in den Debatten um einen vorsätzlichen Schwangerschaftsabbruch fortsetzen, und seinem ungewissen Ende in einer empfindungs- und bewegungslosen Ohnmacht, die später im Zusammenhang mit der Feststellung des Hirntods Probleme aufwerfen sollte.
Doch bei der Antwort auf die Frage, was das Leben ist, geht es auch um Fragen anderer Natur, die mit der außergewöhnlichen Vieldeutigkeit des Substantivs selbst zusammenhängen. Es bezeichnet nämlich ebenso eine Eigenschaft organischer Wesen wie miteinander verbundene biologische Phänomene, die Zeit, die zwischen Geburt und Tod verstreicht, und eine Vielzahl von verschiedenartigen Ereignissen, die diesen Zeitraum ausfüllen, ganz zu schweigen von der metonymischen oder metaphorischen Verwendung des Wortes, wenn man vom Leben berühmter Männer oder vom Leben der Gegenstände spricht. Handelt es sich in allen Fällen um dieselbe Sache? Ist das Leben eines Menschen von der gleichen Ordnung wie das Leben der Zellen, aus denen er besteht? Der gesunde Menschenverstand stört sich an solchen komplizierten Fragen zwar kaum, weil jeder ungefähr versteht, was Ausdrücke wie Lebenswissenschaften, Lebenserwartung, Lebenshaltungskosten, Leben auf dem Lande oder geistiges Leben im weitesten Sinne bedeuten, in denen das Wort offenkundig jedes Mal einen 21anderen Sinn hat. Für die Philosophen gilt das aber nicht: Sie scheinen vor einer Sackgasse zu stehen, wenn sie versuchen, die Vorstellungen vom Leben zum Beispiel eines Biologen und eines Romanciers zusammenzudenken.
Über diese Schwierigkeit ist sich auch Georges Canguilhem im Klaren, wenn er schreibt: »Vielleicht ist es sogar noch heute unmöglich, die grundlegende Vorstellung zu überwinden, dass alles Leben Gegenstand biologischen Wissens und in der Erfahrung gegeben ist, und dass man seine Geschichte von seiner Geburt bis zu seinem Tod beschreiben kann.«[7] Die Definition wirkt simpel und doch vereint sie bemerkenswert heterogene Bestandteile, die auf ein semantisches Spannungsverhältnis hinweisen. Wissen und Erfahrung, Biologie und Geschichte: Das ist der große, für das Leben charakteristische Dualismus. Dass es sich dabei um einen scheinbaren Dualismus handelt, hat schon Hannah Arendt festgestellt: »Dies Leben ist durch Anfang und Ende begrenzt, es vollzieht sich zwischen zwei Grundereignissen, seinem Erscheinen in der Welt und seinem Verschwinden aus ihr, und folgt einer eindeutig gradlinig bestimmten Bewegung, wiewohl diese Bewegung ihrerseits noch einmal von der Triebkraft des biologischen Lebensprozesses gespeist wird, dessen Bewegung im Kreise verläuft. Das Hauptmerkmal des menschlichen Lebens, dessen Erscheinen und Verschwinden weltliche Ereignisse sind, besteht darin, daß es selbst aus Ereignissen sich gleichsam zusammensetzt, die am Ende als eine Geschichte erzählt werden können, die Lebensgeschichte, die […] Bio-22graphie.«[8] Natürlicher Lebenskreislauf und weltliche Ereignisse, Biologie und Biographie: Diese beiden Prozesse machen aus dem Leben jene Einheit, die in Bezug auf ihre materielle Dimension überdeterminiert und in Bezug auf ihren Ablauf gleichzeitig indeterminiert ist. Denn der eine bezieht den Menschen genauso wie die Tiere und die Pflanzen in den großen Komplex der Lebewesen mit ein, während der andere aus ihm ein außergewöhnliches Lebewesen macht, insofern er zu Bewusstsein und Sprache fähig ist.
Ist diese Alternative unhintergehbar? Lässt sich das Leben im Sinne der Biologie mit dem Leben im Sinne der Biographie zusammendenken? Diese Fragen haben die Philosophen zwei Jahrtausende lang beschäftigt. So haben sie das Leben nacheinander mit Aristoteles als belebte Materie, mit Descartes als Bewegungsmechanismus und mit Kant als sich selbst erhaltenden Organismus betrachtet. Von einer vitalistischen Vorstellung sind sie also zu einer mechanistischen Auffassung und dann schließlich zu einem organizistischen Ansatz übergegangen, jedes Mal mit einer anderen Trägersubstanz: erst Seele oder Atem, dann Körper und Körpersäfte, schließlich Organe und Umwelt. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit ging es in all diesen Auffassungen in gewisser Weise gleichbleibend um die Frage nach dem Verhältnis von Lebendem und Menschlichem, der Infrastruktur des Ersteren und der Superstruktur des Letzteren. Vor allem bei Hegel »ist das Leben ein Übergangsbegriff, der den Bereich der Natur und den Bereich der Freiheit miteinander verbindet«, wie Thomas Khurana schreibt,[9]23denn auch wenn die biologischen Gegebenheiten ihm Schranken auferlegen, kann es durch einen Prozess der Selbstorganisation die Autonomie erzeugen, die für das Zustandekommen einer biographischen Entwicklung erforderlich ist.
Im Unterschied zu diesen Versuchen, die beiden Dimensionen des Lebens miteinander zu verbinden, hat sich die Gegensätzlichkeit seiner beiden Bedeutungen im Laufe des letzten Jahrhunderts und mehr noch in den letzten Jahrzehnten in einer Weise verhärtet, dass ihre Trennung unüberwindlich geworden zu sein scheint.
Was das Leben im biologischen Sinne anbelangt, hat das Studium des Lebendigen mit dem ungewöhnlichen Beitrag eines Theoretikers der Quantenmechanik, Erwin Schrödinger, eine andere Größenordnung angenommen und so eine neue Perspektive eröffnet.[10] Seither tritt der Physiker als Biologe auf, seine Analyse reicht bis auf die molekulare Ebene herab, methodisch macht er Anleihen bei der Thermodynamik und die Struktur des Atoms wird zu dem Code, dessen unzählige Kombinationen die Diversität der Lebewesen und die Entstehung von Ordnung aus dem entropischen Chaos ermöglichen. Die Entdeckung der Doppelhelix der DNA bestätigt einige Jahre später diese Theorie und legt darüber hinaus den Grundstein für ein neues Verständnis des Lebens, das von nun an auf Information und Replikation beruht — ein Verständnis, das ein halbes Jahrhundert da24nach durch die Entschlüsselung des menschlichen Genoms weiter verfeinert wird. Sogar die Epigenetik stellt dieses Paradigma nicht grundsätzlich in Frage, weil der Einfluss der Umwelt auf das genetische Erbgut, dem sie Rechnung tragen will, über molekulare Mechanismen erfolgt, die die Genexpression verändern. Als nunmehr integrale Bestandteile der Biologie bringen Biochemie und Biophysik mit anderen Worten Theorien hervor, die sich auf eine immer weiter vorangetriebene Molekularisierung des Lebens stützen, auch wenn sie bei mikrobiellen Populationen systematische Ansätze auf einem höheren Komplexitätsniveau nicht ausschließen.[11] Parallel dazu interessieren sich die Arbeiten über den Ursprung des Lebens für die Entstehung des Lebens auf der Erde im Präkambrium und gleichzeitig für mögliche Anzeichen von Leben an anderen Orten des Universums. Zu diesem Zweck bemühen sie sich zu verstehen, wie leblose Moleküle sich in organische, replikationsfähige Moleküle verwandeln konnten, sodass sich Nukleinsäuren bildeten, und sie versuchen, auf der Grundlage lebender irdischer Organismen Spektren-Datenbanken aufzubauen. Zum einen sind die Mikrobiologen auf der Suche nach LUCA (»last universal common ancestor«), dem Urvorfahren aller Zellen, und nach den Umweltbedingungen, die seine Verwandlung begünstigt haben. Zum anderen fahnden die Astrobiologen nach »gasförmigen potentiellen Biosignaturen«, die das Vorhandensein von Leben auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems beweisen.[12] In beiden Fällen trifft sich 25die Wissenschaft mit dem Imaginären von Männern und Frauen, und die Aussicht, den letzten Ursprung des Lebens oder Anzeichen außerirdischen Lebens zu entdecken — und sei es in Gestalt von Molekülen und nicht von erkennbaren Wesen —, bringt die Menschen zum Träumen und treibt die Forschungsetats in die Höhe. Insgesamt lässt sich an der Erkundung des Lebens als biologischem Phänomen beobachten, dass durch den Übergang vom Spekulativen zum Experimentellen, vom Makroskopischen zum Mikroskopischen und von den Körpern zu den Molekülen das Verständnis des Lebens immer weiter auf seine materielle Grundeinheit — eine Ansammlung von Atomen — eingeschränkt worden ist und gleichzeitig räumlich und zeitlich auf spektakuläre Weise ausgeweitet wurde: Der Mensch löst sich dabei in einem raumzeitlichen Netz molekularer Bestandteile auf, die vor mehreren Milliarden Jahren entstanden sind und die es möglicherweise auch an anderen Orten im Universum gibt.
Was das Leben im Sinne der Biographie anbelangt, so verläuft seine Geschichte ganz anders, zusammenhangloser, weniger kumulativ. Gleichwohl ist es möglich, einige Stationen dieser Geschichte — besonders im Zusammenhang mit dem Aufkommen des Romans in der Literatur — und einige ihrer Merkmale, vor allem im Zusammenhang mit der immer bangeren Frage auszumachen, wie man das Leben aufschreiben soll. Zum einen, und das gab es bis dahin nicht, macht der Roman, so wie er sich ab dem 18. Jahrhundert entwickelt, aus dem Le26ben nicht nur ein interessantes Thema (sujet), sondern auch einen eigenständigen Gegenstand (objet), wie Heather Keenleyside über Tristram Shandy gesagt hat.[13] Er erhöht das Leben zu einer mehr oder weniger linearen Abfolge von Ereignissen, anhand derer sich die subjektiven Charakterzüge der Figuren herausbilden — ob man dabei nun an Jane Austens Sittenroman denkt, an Goethes Bildungsroman oder kurz darauf an die großen Romanprojekte von Balzac und Zola, die anhand der Lebensgeschichten der Figuren die Gesellschaft einer ganzen Epoche rekonstruieren. In ihrer vollendetsten und zugleich radikalsten literarischen Ausdrucksform wird die autobiographische Erzählung bei Marcel Proust zum Leben selbst, das durch die kreative Arbeit des Schreibens an Größe gewinnt und das er das wahre Leben nennt, dessen Kenntnis wir vor lauter Konventionen und Gewohnheiten vielleicht bis zu unserem Tod versäumen.[14] Zum anderen räumen die Sozialwissenschaften der Lebensgeschichte neben den großen theoretischen und methodologischen Darlegungen ihrer Gründerväter von Anfang an einen bedeutenden Platz ein, ob es sich nun um William Thomas' und Florian Znanieckis Rekonstruktion des Werdegangs eines polnischen Bauern handelt oder um Oscar Lewis' Schilderung der Geschichte einer 27mexikanischen Familie.[15] Seit den 1980er Jahren hat aber vor allem das Zusammenspiel der Reaktionen auf den Strukturalismus, auf die feministische Kritik und auf die Postcolonial Studies besonders in der Anthropologie zur Forderung nach Anerkennung der Individuen, ihrer Geschichte, ihrer Wahrheit und ihrer Worte geführt.[16] Der narrative turn ist auch eine subjektivistische Wende. Man soll nicht länger im Namen der Subalternen sprechen, sondern ihre Stimme zu Gehör bringen, was im Einzelnen vor allem für den Historiker mit der Schwierigkeit verbunden ist, dass ihre Leben oftmals vergangen sind, ohne große Spuren in den Archiven zu hinterlassen.[17] Mit einigen Jahrzehnten Abstand beginnen sich jedoch auf Seiten der Literatur ebenso wie auf Seiten der Sozialwissenschaften Zweifel an der Lebensgeschichte und ihrer Gleichsetzung mit dem Leben bemerkbar zu machen, wie anhand der Dekonstruktion der narrativen Form bei Samuel Beckett und der Infragestellung der biographischen Illusion bei Pierre Bourdieu deutlich wurde.[18] Als kohärente Form gerät das Leben unter Verdacht.
28