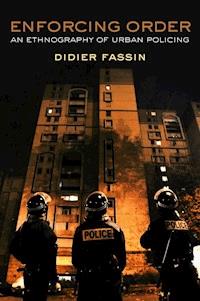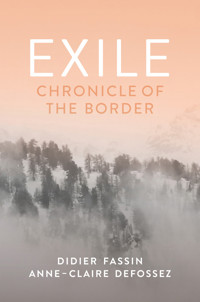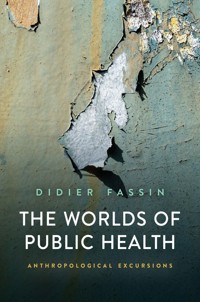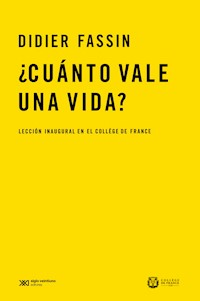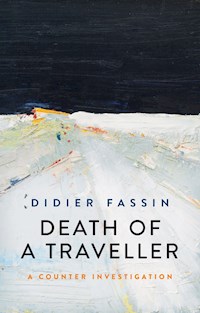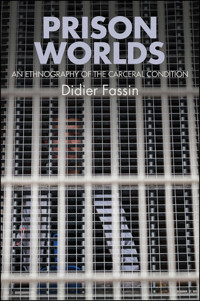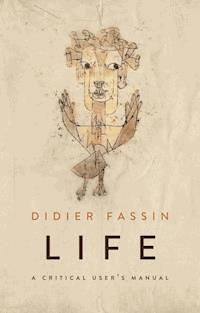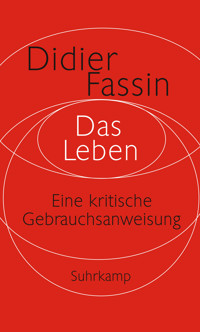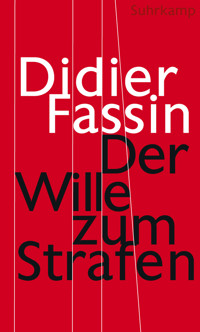
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den letzten Jahrzehnten lässt sich ein härteres Durchgreifen der Polizei, eine Verschärfung des Strafrechts und ein teils massiver Anstieg der Gefangenenzahle in allen liberalen Demokratien beobachten. Ein neuer Wille zum Strafen greift um sich, wie Didier Fassin in seinem brisanten Buch nachweist.
Um dieses Moment des Strafen zu verstehen, geht Fassin drei zentralen Fragen nach: Was ist Strafen? Warum strafen wir? Und wen bestrafen wir? Anhand zahlreicher Fallbeispiele vergleicht er die faktische Praxis des Strafens mit klassischen Theorien des liberalen Rechtsstaats und zieht historische sowie ethnologische Forschungen zu anderen Kulturen des Strafens heran. Es zeigt sich: Die realen Strafpraktiken weichen stark von den liberalen Idealvorstellungen ab. Sie geben den Blick frei auf einen hochgradig ungerechten und diskriminierenden Repressionsapparat, der die dunkle Seite der gegenwärtigen neoliberalen Gesellschaften bildet, mit deren Siegeszug er zeitlich und geographisch korreliert. Ein auf ethnographischer Forschung sowie theoretischen Einsichten basierendes und zugleich in seinen Fallgeschichten erschütterndes Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Didier Fassin
Der Wille zum Strafen
Aus dem Französischen von Christine Pries
Suhrkamp
5In Erinnerung an meinen Vater
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
7Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorwort Moment und Momentum des Strafens
Dank
Lexikalische Anmerkung
Einleitung Zwei Geschichten
Erstes Kapitel Was ist Strafen?
Zweites Kapitel Warum strafen wir?
Drittes Kapitel Wer wird bestraft?
Schluss Die Strafe neu denken
Bibliographie
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
9Vorwort Moment und Momentum des Strafens
Dass in den letzten Jahrzehnten auf der ganzen Welt ein Zeitalter des Strafens eingeläutet wurde, ist ein ziemlich schlecht erforschtes Phänomen, über das viel zu wenig debattiert wird. Gesetzesverstöße werden immer strenger bestraft. Alle internationalen Studien zeigen, dass dieser Trend in keiner direkten Korrelation zur Entwicklung von Kriminalität und Delinquenz steht. Die repressive Wende hängt zwar in manchen Fällen mit der Zunahme von Verbrechen und Vergehen zusammen, aber sie wird auch dann noch weiterverfolgt, wenn die Zahl der Straftaten sinkt. Sie schlägt sich vor allem in immer häufigeren und immer längeren Haftstrafen nieder, aber auch darin, dass in immer mehr Fällen Untersuchungshaft verhängt wird.
Dieses Phänomen lässt sich, wenn auch mit signifikanten Abweichungen, fast überall in Europa beobachten.1 Im Laufe der 1990er Jahre hat sich die Gefängnispopulation in der Tschechischen Republik nahezu verdreifacht; in Italien und in den Niederlanden verdoppelt sie sich; in Portugal, Griechenland, England, Polen, in der Slowakei und in Serbien wächst sie beinahe um die Hälfte; in Spanien, Belgien, Deutschland, Ungarn, Slowenien und Kroatien nimmt sie um ungefähr ein Drittel zu; stabil ist sie nur in der Schweiz, in Schweden, in Norwegen, in Luxemburg, in Bulgarien und in Albanien, und in Dänemark, Finnland und Island verringert sie sich sogar. Russland wiederum erlebt eine Zunahme der Gefan10genenzahl um die Hälfte, die jetzt eine Million überschreitet. Im darauffolgenden Jahrzehnt verlangsamt sich das Anstiegstempo zwar, aber die Zahl der Häftlinge erhöht sich trotzdem fast überall in Europa kontinuierlich. Allein in Portugal, Deutschland und in den Niederlanden zeichnet sich ab Mitte der 2000er Jahre ein signifikanter Rückgang ab, während in den skandinavischen Ländern die Inhaftierungsrate weiter niedrig bleibt. Mit der Einbuße eines Viertels seiner Gefangenen binnen zehn Jahren bildet Russland eine Ausnahme innerhalb dieses Tableaus, doch man darf nicht vergessen, dass es bei sehr hohen Zahlen angefangen hat.
Ein ähnlicher Trend lässt sich auch auf den anderen Kontinenten feststellen. Im Laufe der 2000er Jahre — als den einzigen, über die wir Vergleichsdaten besitzen — ist die Zahl der Gefangenen in Amerika, die Vereinigten Staaten ausgenommen, um 108 Prozent gestiegen, in Asien um 29 Prozent, in Afrika um 15 Prozent und in Ozeanien um 59 Prozent. In Brasilien liegt die Erhöhung bei 115 Prozent und erreicht eine halbe Million. In der Türkei steigt sie auf 145 Prozent und hat sich jüngst noch einmal erhöht. Natürlich müssten diese Zahlen noch mit Hilfe nationaler Daten bereinigt werden, insofern die Unterschiede zwischen den Ländern unterschiedliche Zustimmungsgrade zu den Strafverfolgungsmaßnahmen und letztendlich erhebliche Abweichungen in Bezug auf die Umsetzung der demokratischen Prinzipien erkennen lassen. So ist die Entwicklung in den Vereinigten Staaten am ausgeprägtesten und gleichzeitig ist sie auch am gründlichsten untersucht worden. 1970 saßen dort 200 000 Personen in den Bundes- und Staatsgefängnissen ein, 40 Jahre später sind es aber achtmal so viele, und einschließlich der lokalen Haftanstalten (jails) nähert sich die Gesamtzahl 2,3 Millionen.2 Wenn man die 11Straftäter auf Bewährung (probation) und diejenigen, deren Strafe ausgesetzt wurde (parole), dazurechnet, übersteigt sie sieben Millionen. Die wachsende Gefängnispopulation, unter der sich unverhältnismäßig viele schwarze Männer befinden, ist vor allem eine Folge der härteren, Automatismen mit schwereren Strafen verbindenden Gesetzgebung und der größeren Unnachgiebigkeit der Strafrechtsorgane, vor allem der Staatsanwälte, im Zusammenhang mit zunehmender Ungleichheit und Gewalttätigkeit. Der »Anti-Drogen-Krieg« ist ein entscheidender Bestandteil dieses Entwicklungsprozesses einer Erhöhung und Differenzierung der Zahl der Gefängnisinsassen gewesen.
Wenn nun aber solche Regelmäßigkeiten auf der ganzen Welt auftreten, muss man davon ausgehen, dass sie einen wichtigen Sachverhalt belegen, der über die historische Eigenart einzelner Nationen hinausgeht. Dieser Sachverhalt ist zeitgebunden: Er zeichnet sich in den 1970er und 1980er Jahren ab und beschleunigt sich dann je nach Land in unterschiedlichem Tempo. Ich schlage vor, von einem Moment des Strafens zu sprechen.3 Der Ausdruck »Moment« bezieht sich offenkundig auf einen besonderen Zeitraum oder eine Raum-Zeit; denn das Phänomen, für das er steht, erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und entwickelt sich mit ganz wenigen Ausnahmen auf allen Kontinenten. Doch man muss ihn auch im dynamischen Sinne seiner lateinischen Etymologie verstehen, der sich in der Physik erhalten hat, um eine Bewegung, einen Impuls, eine Einwirkung zu bezeichnen: Dabei handelt es sich um die Kraft, die über den Wandel bestimmt, dem man beiwohnt, also um den Beweggrund.4 Das Englische verfügt diesbezüglich denn auch über zwei Wörter: moment und momentum. Was kennzeichnet also den bzw. das Moment des Strafens?
12Wie mir scheint, entspricht er jener einzigartigen Situation, in der die Lösung zum Problem wird. Wenn eine Gesellschaft Störungen der öffentlichen Ordnung erlebt, Normverletzungen, Gesetzesverstöße, reagieren ihre Mitglieder im Prinzip mit Sanktionen, die den meisten von ihnen zweckdienlich und notwendig erscheinen. Das Verbrechen ist das Problem, die Bestrafung dessen Lösung. Mit dem Moment des Strafens ist die Bestrafung zum Problem geworden.5 Und zwar aufgrund der Anzahl der Individuen, die sie ausgrenzt oder unter Aufsicht stellt, aufgrund des Preises, den sie deren Familien und Umfeld zahlen lässt, aufgrund der ökonomischen und menschlichen Kosten für die Gemeinschaft, die sie nach sich zieht, aufgrund der Produktion und Reproduktion von Ungleichheiten, die sie begünstigt, aufgrund der wachsenden Kriminalität und Unsicherheit, die sie erzeugt, und schließlich aufgrund des Legitimitätsverlusts, der aus ihrem diskriminierenden oder willkürlichen Vollzug resultiert. Obwohl sie die Gesellschaft vor Verbrechen schützen soll, wirkt die Bestrafung mehr und mehr wie etwas, das sie bedroht. Im Moment des Strafens kommt dieses Paradox zum Ausdruck.
*
Zur Veranschaulichung dieses Moments des Strafens werde ich ausführlicher auf den Kontext eingehen, den ich am besten kenne. Frankreich erlebt die repressivste Phase seiner jüngeren Geschichte zu Friedenszeiten. Wenn man die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ausnimmt, sind dort nämlich noch nie so viele Männer und Frauen inhaftiert gewesen. In etwas mehr als 60 Jahren hat sich die Anzahl der Gefängnisinsassen verdreieinhalbfacht: 1955 lag die Zahl der Häftlinge bei 1320 000, 1985 bei 43 000 und 2015 bei 66 000. Mit beinahe 70 000 Gefangenen wurde im Jahr 2016 ein neuer Rekord aufgestellt. Bei verurteilten Straftätern im offenen Vollzug ist der Anstieg noch ausgeprägter: Ihre Zahl hat sich innerhalb von 30 Jahren fast vervierfacht. Insgesamt befinden sich so heute mehr als eine Viertelmillion Menschen im Gewahrsam der Justiz.6 Diese Entwicklung verdankt sich allerdings nicht der Zunahme der Kriminalität, wie man anzunehmen geneigt sein könnte. Obwohl die diesbezüglichen Statistiken aufgrund von Schwankungen sowohl in Bezug auf die Definition der Rechtsverstöße als auch in Bezug auf deren Anzeige durch die Opfer und deren Erfassung durch die Behörden nicht leicht zu deuten sind und obwohl der Trend bei den verschiedenartigen, in Frage kommenden Straftaten keineswegs homogen ist, bestätigen die Teilinformationen, über die wir verfügen, für das letzte halbe Jahrhundert einen beinahe kontinuierlichen Rückgang der besonders besorgniserregenden Kriminalitätsformen, angefangen mit Tötungsdelikten und besonders schwerwiegenden Gewaltverbrechen.7 Es wäre zwar vorstellbar, dass die mit dem Terrorismus zusammenhängenden Vorfälle einen signifikanten Anteil an der beobachteten Entwicklung haben. Aber faktisch hat diese schon in den 1970er Jahren eingesetzt, also lange vor den ersten Anschlägen, und außerdem ist sie vor allem geringfügigen Vergehen geschuldet, die den größten Teil der wachsenden Zahl der Verurteilungen ausmachen. Die von terroristischen Anschlägen verursachten Tragödien haben allenfalls einen sich schon lange abzeichnenden repressiven Prozess verstärkt und legitimiert, indem sie seine Hinterfragung erschwerten, auch wenn er im Wesentlichen minderschwere Taten betraf.
Wenn sich diese Entwicklung nicht einem genuinen 14Anstieg der Kriminalität verdankt, wie lässt sie sich dann erklären? Zwei Phänomene, die in der französischen Gesellschaft tiefe Spuren hinterlassen haben, kommen hier zusammen: eine zunehmende Empfindlichkeit gegenüber Gesetzesbrüchen und deviantem Verhalten sowie eine Fokussierung des öffentlichen Diskurses und Handelns auf Fragen der Sicherheit. Das erste Phänomen ist kulturell, das zweite politisch.
Auf der einen Seite bringen die Individuen immer weniger Toleranz gegenüber etwas auf, das sich als störend für ihre Lebensweise erweist.8 Unhöflichkeiten, laute Drohungen, verbale Angriffe, Handgreiflichkeiten unter Nachbarn, Streitereien zwischen Eheleuten: Eine ganze Reihe von interpersonalen Konflikten, die auf lokaler Ebene empirisch gelöst werden könnten, werden mittlerweile zu einem Fall für die Polizei, landen oftmals vor Gericht und enden in manchen Fällen im Gefängnis. Dieser Trend betrifft übrigens auch die Rechtsverstöße ohne Opfer, wie das Konsumieren von Rauschmitteln, das Parken vor Hauseingängen, die Verunglimpfung der Nationalflagge, die Inanspruchnahme von Prostituierten oder das Tragen bestimmter religiöser Symbole. Das Sinken der Toleranzschwelle gegenüber Verhaltensweisen, die bis dahin nicht vom Gesetz und seinen Vertretern geahndet worden sind, geht einher mit einem allgemeinen Trend zur Befriedung der sozialen Räume, der mit einer Ausweitung der moralischen Erwartungen zusammenfällt. Dieser Trend macht sich allerdings nicht bei allen Gesetzesübertretungen und mithin deren Urhebern auf dieselbe Weise bemerkbar. Er klammert bewusst die herrschenden Schichten aus und trifft die unteren Schichten besonders hart. Steuerhinterziehung wird im Allgemeinen eher toleriert als Ladendiebstahl. In einer solchen Hierarchisierung der Ordnungsstörun15gen und der entsprechenden Abstufung der Sanktionen kommen faktisch sowohl eine Verhärtung der sozialen Beziehungen als auch eine Differenzierung der moralischen Urteile zum Ausdruck.
Doch auf der anderen Seite verstärken die politischen Eliten die Beunruhigung der Bürger in Bezug auf ihre Sicherheit, ja greifen ihr sogar vor.9 Ihre Herangehensweise an diese Frage geht über eine demokratische Reaktion auf die Bedürfnisse derjenigen hinaus, die sie dazu bevollmächtigt haben, sich um ihre Probleme zu kümmern. Mit Hilfe der medialen Aufbereitung der vermischten Meldungen und gewalttätiger Vorfälle begleiten, verschlimmern, ja wecken diese Eliten Ängste und Befürchtungen. Sie instrumentalisieren sie. Sie erhoffen sich nämlich Wahlvorteile von der Dramatisierung der Lage und der Inszenierung der eigenen Autorität durch die Demonstration von Strenge, und man muss durchaus zugeben, dass diese Strategie im Laufe der letzten Jahrzehnte bei den Parteien und Politikern oftmals erfolgreich war, die sich dieser Themen angenommen haben, um die Emotionen und Leidenschaften, die sie hervorrufen, zu schüren. Eine populistische Kriminalpolitik ist für diese Eliten im Übrigen umso vorteilhafter, als es ihnen häufig schwerfallen würde, auf anderen Gebieten, wie etwa der sozialen Gerechtigkeit, ähnliche Leistungen vorzuweisen, wenn sie an der Macht sind.
Die selektive Intoleranz der Gesellschaft und die populistische Kriminalpolitik bedingen sich also wechselseitig. Allein reichen weder die eine noch der andere aus, um die Entwicklung zu erklären, die sich seit einem halben Jahrhundert beobachten lässt: Man kann sich nicht mit der Anführung des Unsicherheitsgefühls auf Seiten der Bevölkerung begnügen, wie manche es tun, oder allein ihre Manipulation durch die Eliten brand16marken, worum andere sich bemühen. Erst die Kombination der beiden Phänomene bringt den einseitigen Entwicklungsschub hervor, der sich feststellen lässt.10 Im öffentlichen Handeln schlägt diese Kombination sich konkret hauptsächlich auf zwei Weisen nieder: in einer Ausweitung der Strafverfolgungsbereiche und in einer Verschärfung des Sanktionssystems durch schwerere Strafen. Auf der einen Seite werden Taten kriminalisiert, die bisher nicht strafbar waren: Neue Rechtsverstöße werden geschaffen, während auf Gesetzesübertretungen, die früher mit bloßen Geldbußen geahndet wurden, inzwischen eine Gefängnisstrafe steht. Straßenverkehrsdelikte sind diesbezüglich ein vielsagender Fall. Der Einsatz der staatlichen Organe, der Opferverbände und der Experten für öffentliche Gesundheit hat zur Verabschiedung immer strengerer Gesetze geführt, zum Absenken des Grenzwerts bei Alkoholkontrollen, zum Aufstellen von Radarkontrollen und zur Einführung eines Punktesystems beim Führerschein. In der Folge sind die Verurteilungen aufgrund von Verstößen gegen die Verkehrssicherheit innerhalb von 20 Jahren um die Hälfte gestiegen, und im Laufe der letzten zehn Jahre haben sich die Verurteilungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach Führerscheinentzug verdreieinhalbfacht, was jährlich Anlass zu 3000 Gefängnisstrafen ohne Bewährung gibt.11 Auf der anderen Seite werden die Sanktionen für bestehende Tatbestände verschärft: Es gibt mehr Verurteilungen zu Freiheitsentzug und die Verurteilten bleiben länger in Haft. Zu dieser Ausrichtung der Strafrechtspraxis haben verschiedene Faktoren beigetragen: Durch die Einführung von Strafen mit obligatorischem Strafmaß hat sich der Anteil der verhängten Mindeststrafen um das Fünffache erhöht und ist das durchschnittliche Strafmaß bei Gefängnisstrafen von acht auf 17elf Monate gestiegen; bemerkenswert ist, dass sich ihr Einfluss trotz ihrer Streichung aus dem Gesetzestext weiterhin bemerkbar macht. Durch die Zunahme von Urteilen nach beschleunigten Verfahren wie der Comparution immédiate, also der sofortigen Vorführung des Beschuldigten vor einen Haftrichter, hat sich die Strenge erhöht, denn Schätzungen zufolge wird in diesem Rahmen doppelt so oft auf Freiheitsentzug erkannt wie bei Entscheidungen nach herkömmlichen Verfahren. Und schließlich hat der vereinte Druck von Seiten der Staatsgewalt und der öffentlichen Meinung auf die Richter diese dazu bewogen, sich dadurch abzusichern, dass sie häufiger Gefängnisstrafen verhängten oder die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft verfügten.12 Insofern hat der Wandel der Empfindlichkeiten und der Politik Auswirkungen auf das gesamte Strafrechtssystem. Er führt zu schwereren Strafen.
*
Wie lässt sich dieser für die Gesellschaften der Gegenwart charakteristische Moment des Strafens gedanklich erfassen? Nachdem ich zehn Jahre lang versucht hatte, anhand einer Reihe von in Frankreich durchgeführten empirischen Untersuchungen über die Polizei, die Justiz und das Gefängniswesen jeweils in einem klar umrissenen (lokalen) Raum und einer ebenso klar umrissenen Zeit (der Gegenwart) Aufschluss über ihn zu erlangen, erschien es mir erforderlich, eine andere, diesmal theoretische Perspektive einzunehmen, um die Grundlagen des Bestrafungsakts zu hinterfragen. Es gibt nämlich vor allem in den Vereinigten Staaten in der Geschichtswissenschaft und in der Soziologie eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, die sich mit der Beschreibung 18und Deutung der Entwicklung der politischen Maßnahmen und Praktiken befassen, die zur gegenwärtigen Situation geführt haben: Sie sind wichtig, und ich werde mich ausgiebig auf sie beziehen. Doch sie stellen nur selten Fragen über die Beschaffenheit der Bestrafung selbst und ihre Hintergründe. Diese Fragen werden in der Hauptsache von Philosophen und Juristen aufgeworfen, und seit mehr als 200 Jahren ist der entsprechende Textkorpus beachtlich: Mit ihnen soll dieses Buch in einen Dialog eintreten. Denn ihr normativer Ansatz sagt, wie die Bestrafung innerhalb des legalen Strafrahmens aussehen sollte und nicht, wie sie ausgesehen hat und wie sie aussieht. In dem Versuch zu verstehen, was Strafen ist, warum wir strafen und wen die Strafe trifft, werde ich ihn deshalb einer kritischen Lektüre unterziehen und mich dabei auf die Ethnografie und die Genealogie stützen.
In der vorliegenden Untersuchung geht es also nicht um den Moment des Strafens als solchen. Der Moment des Strafens dient ihr — im buchstäblichen Sinne — als Prä-text. Doch soll das kein Kunstgriff sein, kein geschickter Einstieg in die Materie, der den Leser einladen soll, sich mit einer besonders anspruchsvollen Materie auseinanderzusetzen. Die Entwicklung, die ich überblickshaft geschildert habe, macht meiner Meinung nach grundsätzlichere Überlegungen über die Bestrafung erforderlich. Man muss sie von der Kruste aus Bildern, Zahlen und Diskursen befreien, die bestimmte Fragestellungen, bestimmte Infragestellungen und bestimmte Änderungsmöglichkeiten verbietet.
19Dank
Dieses Buch ist aus Vorlesungen hervorgegangen, zu denen mich die University of California in Berkeley im April 2016 eingeladen hatte: die jährlichen Tanner Lectures on Human Value, die fast immer von Philosophen gehalten werden (tatsächlich war ich der erste Anthropologe bzw. Soziologe, der seit der Schaffung dieser Vorlesungsreihe in Kalifornien im Jahr 2000 dazu aufgefordert wurde). Auch wenn sie in wesentlichen Teilen überarbeitet und ergänzt wurde, bleibt die schriftliche Fassung dem Entwicklungsfaden und der Argumentationsstruktur der mündlichen Version treu. Es fehlen ihr lediglich die erhellenden, von den drei Diskutanten formulierten Anmerkungen: David Garland, Rebecca McLennan und Bruce Western, deren Kommentare und Kritikpunkte mit Sicherheit dazu beigetragen haben, auf juristischer, historischer und soziologischer Ebene meinen Horizont zu erweitern und meine Analyse zu verfeinern. Auch andere Kollegen haben mich von ihren Beobachtungen profitieren lassen, vor allem Linda Bosniak, José Brunner, Bernard Harcourt, Axel Honneth, Jaeeun Kim, Christopher Kutz, Thomas Lemke, Allegra McLeod, Ayşe Parla, Yves Sintomer, Felix Trautmann, Peter Wagner und Linda Zerilli. Bei der Vorbereitung und Überarbeitung des Manuskripts waren die Vorschläge von Anne-Claire Defossez und Bruno Auerbach wie immer wertvoll für mich. Meine Dankbarkeit gebührt Martin Jay, Nicholas Dirks und dem Tanner Lectures Committee dafür, dass sie mir die Gelegenheit zu diesen theoretischen Überlegungen gegeben haben, die meine empirischen Arbeiten über den Strafvollzugsapparat des französischen Staates aus den letzten zehn Jahren fortsetzen und vertiefen. Aber gerade weil diese unzeitgemä20ßen Betrachtungen, wenn ich mir diese Bezugnahme auf einen Autor erlauben darf, dessen Denken meine Überlegungen begleitet hat, in ethnografischen Erhebungen ihren Ausgang nahmen, die ich im Rahmen eines vom Europäischen Forschungsrat geförderten wissenschaftlichen Programms in einer für öffentliche Sicherheit zuständigen Polizeieinheit, in einem Tribunal de Grande Instance, das heißt einem Landgericht, und einem Maison d'arrêt, also einer Strafvollzugsanstalt, in der in Frankreich neben Untersuchungshäftlingen auch Gefangene mit kürzeren Haftstrafen von bis zu zwei Jahren untergebracht sind, möchte ich auch all jenen danken, die diese Forschungen möglich gemacht und sie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung bereichert haben: Kommissare, Polizisten, Richter, Anwälte, Aufseher, Verwaltungsbeamte, Bewährungshelfer, Sozialpädagogen, medizinische Fachkräfte, Verbandsmitglieder, politische Entscheidungsträger, Strafgefangene, Bürger.
Lexikalische Anmerkung
Die Bezeichnung der Gegenstände dieser Studie wirft einige Schwierigkeiten auf, die sich besonders stark bemerkbar machen, wenn man die beiden Sprachen vergleicht, in denen sie geschrieben wurde — Englisch und Französisch —, und deshalb auch, wo es darum geht, die Zitate von der einen in die andere Sprache zu übersetzen. Zum einen heißt eine Verletzung des Gesetzes — oder sogar einer moralischen Norm — im Englischen allgemein crime, und dieser Oberbegriff wird nach abnehmender Schwere differenziert in felony, misdemeanor und infractions, während das Französische das Wort crime, also »Verbrechen«, den schwersten Taten vorbe21hält, nämlich Tötungsdelikten, und die Ausdrücke »délit« (Vergehen, Delikt) und »contravention« (Gesetzesübertretung) für die geringfügigeren Verbrechensformen verwendet, wobei alle zusammen als »infractions« (Rechts- oder Gesetzesverstöße) bezeichnet werden. Zum anderen wird die Sanktionierung dieser Gesetzesverletzungen — ob nun durch einen Rechtsträger oder nicht — im Englischen ebenfalls mit einem allgemeinen Begriff als punishment bzw. in manchen Fällen — wenn die ausdrückliche Absicht, Leid zuzufügen, angezeigt werden soll — als retribution bezeichnet, während man im Französischen eher die Substantive »punition« (Bestrafung) in der Alltagssprache, »peine« (Strafe) in rechtlichen Zusammenhängen und »châtiment« (das Strafen) im literarischen Kontext verwendet. Insofern in meiner Untersuchung jenseits des Alltagsverständnisses des gesunden Menschenverstands und rechtlicher Techniken über den Bestrafungsakt nachgedacht werden soll, werde ich lieber vom Strafen im Sinne von »châtiment« sprechen, und wo dieser Wortgebrauch nicht zu Verwirrung führt, werde ich mich sogar auf den Begriff des »Verbrechens« beziehen, ohne dass damit schon feststehen würde, um welche Art von Verstoß es sich jeweils handelt. Aus dieser ungewöhnlichen Formulierungsweise spricht wahrscheinlich ein dostojewskischer Einfluss, aber vor allem soll sie zu Überlegungen anregen, die eine geringere Einschränkung durch den allem Anschein nach unverzichtbaren Rahmen des Rechts erfahren und nicht im selben Maße in Worten, das heißt in den Definitionen und Kategorien des Alltagsverständnisses des gesunden Menschenverstands oder der Rechtssprache gefangen sind — offene Überlegungen also zu einer Anthropologie des Strafens.
22Einleitung Zwei Geschichten
In einem berühmten Aufsatz mit dem Titel »Verbrechen und Strafe bei den Primitiven« schildert der britische Anthropologe Bronislaw Malinowski eine Episode, die sich während seines Forschungsaufenthalts auf den Trobriand-Inseln zugetragen hat und sein Verständnis der Art und Weise, wie dort mit einem »Gesetzesbruch« umgegangen wurde, tief beeinflussen sollte.1 »Eines Tages sagte mir ein Ausbruch von lautem Wehgeschrei und allgemeiner Erschütterung im Dorfe, daß sich irgendwo in der Nachbarschaft ein Todesfall ereignet haben müsse. Ich erfuhr, daß Kima'i, ein junger Bursche von ungefähr 16 Jahren, den ich selber kannte, von einer Kokospalme gefallen sei und dabei den Tod erlitten habe.« Als er sich zu der Stätte begab, an der die Begräbnisfeierlichkeiten stattfanden, bemerkte der Ethnologe unter den Beteiligten zwar ungewöhnliche Bekundungen von Feindseligkeit, da er sich aber mehr für die formalen Aspekte des Trauerrituals interessierte, schenkte er ihnen kaum Aufmerksamkeit. Erst später verstand er die Bedeutung dieser Spannungen: Der junge Mann hatte sich nach der Aufdeckung einer inzestuösen Beziehung das Leben genommen, die er zu seiner Cousine mütterlicherseits unterhalten hatte. Denn in den traditionellen melanesischen Gesellschaften stellt das Aufnehmen sexueller Beziehungen und, schlimmer noch, die Heirat mit einer Person aus dem eigenen totemistischen Klan eine Übertretung des Gesetzes der Exogamie dar, was die Trobriander als 23das schwerste Verbrechen betrachten, das man begehen kann. »[N]ichts [ruft] größeres Entsetzen hervor[…] als die Übertretung dieses Verbots«, schreibt Malinowski, auch wenn er hinzufügt, dies sei zumindest »die Idee des Eingeborenenrechts, sein Ideal«, aber »[w]enn es […] auf die Anwendung der Moral und der Ideale im praktischen Leben ankommt, so nehmen die Dinge […] ein anderes Aussehen an«. Dank seines sich lange hinziehenden Aufenthalts in dieser Stammesgemeinschaft wurde ihm klar, dass informelle endogame Praktiken gar nicht so selten und fast nie Gegenstand von Sanktionen waren. Sie wurden missbilligt, aber toleriert: In Anbetracht derartiger Gesetzesverletzungen, kommentiert der Ethnologe, drücke »die öffentliche Meinung wohl ein Auge zu[…]« und »sei entschieden heuchlerisch«.
Was war also geschehen, das Kima'i zu einem dermaßen tragischen Ende trieb? In Wahrheit hatte die Aufdeckung der inzestuösen Beziehung anfänglich nur zur üblichen stillschweigenden Missbilligung der Dorfbewohner geführt — bis zu dem Tag, an dem der Mann auftauchte, der das junge Mädchen heiraten wollte. Er hatte zunächst seinem Rivalen damit gedroht, ihn mit einem Fluch zu belegen, und hatte ihn dann, als diese Vorgehensweise sich als wirkungslos erwies, eines Abends unter Verwendung verletzender Ausdrücke, die nicht ohne Reaktion bleiben durften, öffentlich angeklagt und beleidigt. Angesichts dieser Kränkung gab es nur einen ehrenvollen Ausweg für den unglücklichen Jungen. »Am nächsten Morgen zog er sein Festkleid an, schmückte sich, erkletterte eine Kokospalme, versammelte die Gemeinde, hielt inmitten der Palmblätter eine Ansprache an die Versammelten und nahm von ihnen Abschied. Er erklärte die Gründe für seine verzweifelte Tat und erhob eine verschleierte Anklage gegen den Mann, der ihn in 24den Tod getrieben und an dem ihn zu rächen die Pflicht seiner Klan-Leute war. Dann wehklagte er laut, wie es der Brauch erfordert, sprang von der Palme etwa 60 Fuß tief hinunter und war augenblicklich tot.« Kurz darauf entbrannte eine Schlägerei, bei der der abgeblitzte Bewerber verletzt wurde. Und diese singulären Weiterungen erklären die Unstimmigkeiten während des Begräbnisses.
Für Malinowski ist der bemerkenswerteste Aspekt dieses dramatischen Zwischenfalls allerdings nicht der Selbstmord als solcher, sondern die Seltenheit solcher Akte angesichts der Alltäglichkeit von inzestuösen Liebschaften bei den Trobriandern. In den meisten Fällen zog das, was seine Informanten ihm als schwersten Verstoß gegen ihren Moralkodex beschrieben, keinerlei Strafe nach sich, sondern war nur Anlass von missbilligenden Kommentaren, solange eine gewisse Diskretion gewahrt wurde. Wenn niemand sich persönlich gekränkt fühlte, wurde in der Regel auf magische Handlungen zurückgegriffen, die den vermeintlich Schuldigen irgendeine Form von Kummer zufügen und die Störung der Ordnung beheben sollten, die von der Verletzung des Gesetzes der Exogamie verursacht worden war. In den Augen des Ethnologen widerspricht diese Art des Umgangs mit der Gesetzesübertretung der von einer ganzen Reihe seiner Kollegen geteilten Überzeugung, dass die traditionellen Gesellschaften strikten Normen unterworfen waren, denen ihre Mitglieder aus Furcht vor schwerwiegenden Sanktionen sklavisch gehorchten. Stattdessen fanden sie Mittel und Wege, um ein scheinbar unnachgiebiges Gesetz zu umgehen, indem sie sich mit angedeutetem Missfallen und eher einfachen Flüchen begnügten, die, weil sie der Gruppe Konflikte ersparten, bei gleichzeitiger Berufung auf den Moralkodex der Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung dienten. Diese Analyse 25entsprach der funktionalistischen Theorie des Autors. Nur wenn es zu einem Skandal kam, der das Scheitern der vorsorglichen Strategien offenbarte, war eine radikalere Reaktion erforderlich: der Selbstmord. Doch selbst in diesem Fall war die Sanktion Teil einer von den klassischen Vorstellungen im Hinblick auf repressive Normen und barbarische Strafen weit entfernten moralischen Inszenierung: Sie war ein Akt, den der Beschuldigte sich selbst auferlegte und der eher an Sühne oder Protest denken ließ als an eine Bestrafung.
*
Beinahe 100 Jahre später veröffentlichte am entgegengesetzten Ende der Welt die Journalistin Jennifer Gonnerman im New Yorker einen Artikel mit dem Titel »Before the law«, der die Öffentlichkeit über die tatsächliche Funktionsweise der Rechtsprechungsorgane und Strafvollzugsanstalten in den Vereinigten Staaten unterrichtete.2 Darin schildert sie die Geschichte eines schwarzen Jungen aus der Bronx, Kalief Browder, der 1000 Tage in dem fürchterlichen New Yorker Gefängnis Rikers Island zubrachte. Ihm wurde eine Tat zur Last gelegt, die begangen zu haben er leugnete und für die er nie vor Gericht gestellt wurde. Er war 16 Jahre alt, als er vier Jahre zuvor mit einem Freund abends zu sich nach Hause gekommen war und von mehreren Polizeiwagen umringt wurde. »Ein Beamter teilte ihm mit, dass ein Mann gerade ausgesagt habe, Opfer eines Diebstahls geworden zu sein. ›Ich habe niemanden bestohlen‹, antwortete Browder, ›das können Sie selbst überprüfen‹. Die Polizisten durchsuchten ihn sowie seinen Freund und fanden nichts.« Nachdem sie zum Wagen zurückgegangen waren, in dem der Kläger saß, kehrten sie mit einer neuen 26Version zurück, der zufolge der Übergriff zwei Wochen vorher stattgefunden habe. Den beiden Jungen wurden Handschellen angelegt, und man fuhr sie zum Kommissariat, wo sie die Nacht in Polizeigewahrsam verbrachten. Als sie am nächsten Morgen der Staatsanwaltschaft vorgeführt wurden, erfuhren sie, dass ein mexikanischer Einwanderer sie beschuldigte, ihm seinen Rucksack vom Leib gerissen zu haben. Erneut stritten sie jegliche Beteiligung an diesem Vergehen ab. Während sein Freund bis zu seiner Gerichtsverhandlung auf freien Fuß gesetzt wurde, blieb Browder in Untersuchungshaft, weil er acht Monate zuvor wegen eines geringfügigen Vergehens — obwohl er nicht zugegeben hatte, es begangen zu haben — zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden war, deren Frist noch andauerte. Die Höhe der Kaution wurde auf 3000 Dollar festgesetzt, eine beträchtliche Summe in Anbetracht der kärglichen Mittel seiner Mutter, die sieben Kinder alleine aufzog, von denen fünf adoptiert waren, wie er auch. Er wurde also in der für Minderjährige vorgesehenen Abteilung der überfüllten Strafanstalt Rikers Island zusammen mit 600 anderen, sich in von Gangs kontrollierten Schlafsälen mit 50 Betten zusammenpferchenden jungen Häftlingen eingesperrt.
Zwei Monate später wurde von einer Grand Jury unter dem Hauptanschuldigungspunkt des »Raubs mit Gewaltanwendung« Anklage gegen Browder erhoben. Er lehnte ab, sich schuldig zu bekennen und wurde bis zu seiner Gerichtsverhandlung ins Gefängnis zurückgebracht. In den drei darauffolgenden Jahren wurde er mehrere Dutzend Mal ins Gericht gefahren, aber aufgrund technischer Probleme, einer unvollständigen Ermittlungsakte und fehlender Anwälte oder Staatsanwälte konnte die Verhandlung bei keiner seiner Vorladungen dorthin 27stattfinden. Später gab er an, den Eindruck gewonnen zu haben, dass die Justiz ihn zum Narren halte. Es bestand zwar im Staate New York die Vorschrift, dass die Strafverfolgung eingestellt werden muss, wenn über ein Verbrechen sechs Monate nach Anklageerhebung kein Urteil ergangen ist, doch machten die wiederholten Vertagungen seiner Strafsache diese Regelung unwirksam. Mehrere Male bot der Staatsanwalt ihm zudem an, sich eines minder schweren Vergehens schuldig zu bekennen, und sein Pflichtverteidiger forderte ihn auf, dieses Angebot anzunehmen, aber der junge Mann weigerte sich. Gegen Ende seiner Haftzeit versicherte der Richter ihm sogar, dass er, wenn er seine Schuld eingestehe, auf der Stelle freigelassen werden würde. Andernfalls werde er ins Gefängnis zurückgebracht. Wie bei jeder seiner Vorladungen beteuerte Browder beharrlich seine Unschuld. Offengestanden war ein solches Verhalten mehr als ungewöhnlich. Im vorangegangenen Jahr waren in der Strafgerichtsbarkeit der Bronx lediglich in 166 Strafsachen Urteile ergangen, wohingegen beinahe 4000 mit einem Eingeständnis der Schuld im Vorfeld endeten.
Während dieser Zeit wurden die Lebensbedingungen in der Strafanstalt zwischen Schikanen des Personals und Gewalttätigkeiten der anderen Häftlinge für den jungen Mann immer härter. Eines Abends riefen die Aufseher eine Gruppe von Gefangenen wegen einer Schlägerei zusammen, die kurz vorher ausgebrochen war, und schlugen sie reihum, während sie sie verhörten. Danach sagten sie ihnen, dass sie zur Strafe in Einzelhaft in den Disziplinartrakt kommen würden, wenn sie auf die Krankenstation gingen, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen. Blutverschmiert und mit blauen Flecken kehrten alle Häftlinge schweigend in ihren Zellentrakt zurück. Denn Isolationshaft im Disziplinartrakt gehörte zu den 28