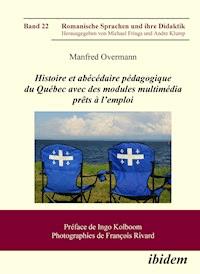12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Edition Noema
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Mein letzter hoffnungsversprechender Joker, mit pädagogischen Sanktionen zu drohen, wurde vermutlich bewusst überhört und mit einem höhnischen Gelächter quittiert. Während sich in meiner Wahrnehmung mittlerweile so manches Schülergesicht zur karnevalesken Fratze verzerrte, gerieten die mich verhöhnenden Meuterer erst so richtig in Fahrt und schienen sich an meiner Demütigung zu laben. Je mehr Anstalten ich machte, die wilde Bande wieder ans Ruder zu bringen, um zumindest einen wie auch immer gearteten Schein von Unterricht zu inszenieren, desto loser und widerspenstiger wurden die Gebärden der Revoltierenden. Nach vier Jahren des pädagogischen Paradieses in einer französischen Elitehochschule verschlägt es Gymnasiallehrer Paul Krieger an eine deutsche Gesamtschule. Und hier erlebt er den Schulalltag so, wie ihn viele Lehrkräfte kennen: als Hölle auf Erden. Zwar sollen alle Schüler Abitur machen, aber der Begriff Leistung darf unter einer ideologisierten Schulleitung nicht verwendet werden. Es beginnt eine groteske Auseinandersetzung um Noten und Erziehungsfragen, die Paul in den Nervenzusammenbruch führt. Doch Paul ist von kämpferischer Natur und beseelt von einem faustischen Wissensdrang. Die Eigenschaft, erfahren zu wollen, was die Welt im Innersten zusammenhält, und eine Psychotherapie helfen ihm wieder auf die Beine – und zurück in den Lehrbetrieb. Es wird wieder ernst für Paul Krieger … Manfred Overmann gelingt mit seinem vorliegenden Roman ein faszinierendes ironisch-absurdes Portrait deutscher Lehranstalten und der in ihnen gefangenen Akteure. Ein Muss für all jene, die mitunter an und in Schulen verzweifeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Ein Furz löst einen Orkan aus
Wie mich die drohende Arbeitslosigkeit an eine Elitehochschule katapultierte
Adieu Germany und Bonjour la France
Die Vertreibung aus dem Paradies und die Ankunft in der Gesamtschulwirklichkeit
Epilog auf die Gesamtschule
Befreiung durch Krankheit: Zwei Forschungssemester bei einem Psychologen
Mein erster Termin beim Psychologen
Abgesang eines Lehrers
Über den Autor
Impressum
Im Mittelpunkt aller besonderen Arten der Tätigkeit nämlich steht der Mensch, der ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur die Kräfte seiner Natur stärken und erhöhen, seinem Wesen Wert und Dauer verschaffen will.
Die letzte Aufgabe unseres Daseins: dem Begriff der Menschheit in unserer Person, sowohl während der Zeit unseres Lebens, als auch noch über dasselbe hinaus, durch die Spuren des lebendigen Wirkens, die wir zurücklassen, einen so großen Inhalt, als möglich, zu verschaffen, diese Aufgabe löst sich allein durch die Verknüpfung unsres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung.
(Wilhelm von Humboldt, Theorie der Bildung des Menschen, 1793)
Ein Furz löst einen Orkan aus
Jeder Mensch hat ein Recht auf Freiheit,Unversehrtheit und ein Leben in Würde.
(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948)
Man furzte und rülpste in meiner Klasse und parallel dazu schrieb ich gerade an meiner Doktorarbeit über den „Ursprung des französischen Materialismus: die Kontinuität materialistischen Denkens von der Antike bis zur Aufklärung“. Ich ekelte mich vor diesem Schauspiel, welches die Schüler im Grundkurs Deutsch einer 8. Klasse gerade veranstalteten, zumal diese olfaktorischen Signale über meinen Geruchssinn nicht nur als unästhetisch gedeutet wurden, sondern geradezu als ekelerregend, widerwärtig oder sogar animalisch. Gleichzeitig und urplötzlich wurde mir aber darüber hinaus meine Hilflosigkeit als unerfahrener junger Lehrer bewusst, der Meuterei Herr zu werden.
Wie sollte ich der Gehorsamsverweigerung auf meine legale Aufforderung entgegnen, deren Wirkung doch der Beförderung des Allgemeinwohls dienen sollte? War es nicht geradezu ein ethischer Imperativ, sich so zu verhalten, dass man seinem Nächsten nicht schadete? Meine eindringlichen Bitten, ein Minimum an Anstand im Klassenverband zu bewahren, nicht zuletzt aus Respekt vor den Mitschülern, wurden ignoriert, der Versuch, mir durch das Anheben der Stimme und einer gemeineren Wortwahl aus dem Grundwortschatz für ausländische Touristen mehr Autorität zu verschaffen, führte nur zur Steigerung des Geräuschpegels in der Klasse und verhallte wie das Echo im Walde.
Mein letzter hoffnungsversprechender Joker, mit pädagogischen Sanktionen zu drohen, wurde vermutlich bewusst überhört und mit einem höhnischen Gelächter quittiert. Während sich in meiner Wahrnehmung mittlerweile so manches Schülergesicht zur karnevalesken Fratze verzerrte, gerieten die mich verhöhnenden Meuterer erst so richtig in Fahrt und schienen sich an meiner Demütigung zu laben. Je mehr Anstalten ich machte, die wilde Bande wieder ans Ruder zu bringen, um zumindest einen wie auch immer gearteten Schein von Unterricht zu inszenieren, desto loser und widerspenstiger wurden die Gebärden der Revoltierenden.
Das olfaktorische Konzert wurde daraufhin fortgesetzt, wobei noch weitere Instrumente hinzukamen, welche die skurrilen Geräusche und Laute hervorbrachten, die in einer so exaltierten und geradezu grotesken Kakophonie gipfelten, dass ich mich fragte, ob meine mir anvertrauten Zöglinge nicht besser in einem Zoo als in einer Lehranstalt aufgehoben seien. Was hatte meine Tätigkeit noch mit Lehren zu tun, wenn sogar das Recht auf körperliche Unversehrtheit übertreten wurde, ohne geahndet zu werden.
Als ich mir dann noch vorstellte, wie die Gär- und Faulgase der Schüler durch das rektale Entweichen aus den Mägen und Därmen das Klassenzimmer in eine stinkende Kloake verwandelte, begriff ich, was der antike Materiebegriff bedeutete: Kleinste Atome entwichen aus den aufgeblähten Unterleibern der tobenden Schüler in meine Klasse, um sich als Leibwind einen Weg durch die Öffnungen meiner Nasenhöhlen bis ins Gehirn zu bahnen. Durch das Anhalten der Luft versuchte ich, den mir aufgezwungenen Reiz des nervus olfactorius zu unterbrechen. Ein schneller Blick auf die Uhr zeigte mir aber, dass die Stunde noch 25 Minuten andauern würde und daher nur ein verfrühter und freiwilliger Tod durch Ersticken mich vor dieser Schmach hätte bewahren können. Mors certa, hora incerta: Der Tod ist sicher, die Stunde unsicher.
Ich wünschte allen Aufrührern eine urplötzlich hervorgerufene Obstipation, d.h. einen absoluten Darmverschluss, der von einem Deus ex Machina veranlasst worden wäre, um die intestinalen Abwinde der gärenden Verdauungsapparate unter Kontrolle zu bringen und um die über 30 Millionen Rezeptoren der Riechzellen vor der Marter eines langsamen Todes zu bewahren. Aber sei es aus Mangel an Bildung oder an Kenntnis der griechischen Kultur, eine solche Lösung war in einer 8. Klasse nicht vorstellbar. Wie sollte das überraschende Eingreifen einer Gottheit konzipiert werden, um meinen sicheren Tod vor dem Unterrichtsschluss abzuwenden, wenn man weder wusste wie Tod (Tot, Tohd, tod) noch wie Gottheit (Gothait, Ghotheid, goteid) überhaupt geschrieben wurden.
Wahrscheinlicher als ein Deus ex Machina wäre offenbar noch die Vorstellung gewesen, wie in Jurassic Park am Ende von einem in letzter Sekunde auftauchenden Tyrannosaurus vor den Velociraptoren gerettet zu werden, aber vor 80 Millionen Jahren hätte ich in der Kreidezeit wahrscheinlich andere Probleme gehabt. Überdies wollen wir eine Schule nicht mit einem Tierpark vergleichen, zumal Velociraptor im Unterschied zu meinen Artgenossen mit seinen zwei Metern Länge noch etwas größer und durch seine Sichelkralle noch furchterregender gewesen sein muss. Außerdem waren nicht alle meine Schüler Fleischfresser, so dass ein solcher Vergleich politisch nicht ganz korrekt wäre und ein fleischfressendes Tier kränken könnte, wenn es bemerkte, dass man es zu Unrecht mit einem vegetarischen Schüler vergliche.
In dieser prekären Situation, in welcher ich mich zweifelsohne befand, musste ich darüber nachdenken, ob ich tatsächlich dafür bezahlt wurde, solche menschenverachtenden Demütigungen, wie sie in den unterschiedlichsten Variationsformen immer wieder und mit geradezu erschreckender Regelmäßigkeit auftraten, hinnehmen zu müssen? Lieber hätte ich noch auf einen Teil meines Gehalts verzichtet, den ich später eventualiter als Schmerzensgeld erneut hätte einklagen können, als diese Aporie, d.h. Aussichtslosigkeit einer Lösungsfindung, zu ertragen.
Bis zum Schellen zeigte meine Uhr noch zehn Minuten an, und der Kapitän war noch nicht tot. Aber war die Klimax bereits überschritten oder noch gar nicht erreicht? Auf der einen Seite loderte das olfaktorische Feuerwerk durch explodierende Stinkbomben, mit denen man wie mit Felsblöcken nach mir warf, auf der anderen Seite verzweifelte ein sich windender Verstand, der trotz der Mobilisation seiner neuronalen Krieger keinen Sieg generieren konnte.
War das sich ausbreitende Universum eine Form von Flatulenz, die sich als unendliche Blähung durch galaktische Winde manifestierte, die sich in meinem Klassenzimmer wie in einem Schwarzen Loch verdichteten? Und wie war ihr Einfluss auf die Zeit? Wurde diese durch ihr Schwerefeld nicht verzerrt? Gingen die Uhren nicht umso langsamer, je mehr man sich ihnen näherte? Und ich war so nah in ihrem Umkreis, dass die Zeit stehen zu bleiben drohte, wo ich mir nichts sehnlicher herbeiwünschte als einen Zeitbeschleuniger.
Die Handlungsohnmacht eines von der Schulwirklichkeit eingeholten Lehrers entwickelte in mir das tragische Gefühl der absoluten Hilflosigkeit und Ratlosigkeit. Wie in einer griechischen Tragödie wurde ich zum Beobachter des eigenen Schicksals und Leidenswegs, ohne dem Fatum eine Alternative abringen zu können. Ich hatte diesem mächtigeren Gegner nichts entgegenzusetzen und musste den geradezu körperlich gewordenen Schmerz wie eine Vergewaltigung meiner Persönlichkeit ertragen, die noch vor einigen Wochen an einer Grande École in Frankreich gelehrt hatte.
Während diese Utopie aber der Vergangenheit angehörte, war die Gegenwart keine Science-Fiction. Diese Schulklasse war so real, physisch vorhanden und materiell erfahrbar, dass man sie selbst unter der Hypothese der Leugnung der Existenz der Außenwelt nicht hätte wegdenken können. Oder hätte mir ein wie auch immer gearteter Deus malignus einen solchen Albtraum aufgezwungen, um mich mit einem dauerhaften Trugschluss von der Wahrheit zu entfernen? Nein, selbst ein Augenzwinkern ließ die erhoffte Schimäre unverändert: die Wahrheit saß mir gegenüber, und sie war nicht schön. Sie war absonderlich, durchgeknallt, abgedreht, hysterisch und grotesk, so mein erstes Urteil. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich beileibe noch nicht, dass es noch schlimmer kommen würde.
Leider zog gleichermaßen der Zweifel in mir auf, selber für dieses anarchische Desaster verantwortlich zu sein. Hatte mich das kritische Denken doch gelehrt, die Fehler für menschliches Missverhalten nicht nur in meinem Gegenüber zu suchen, sondern auch in mir selbst. Hatte ich nicht Kollegen, die sich nie beschwerten und dieselben Schüler sogar wegen ihrer Intuitionskraft, Spontaneität und Hilfsbereitschaft lobten? Wie konnte ihnen ein solcher Dressurakt gelingen? Welche Highlights hatten sie in ihrer pädagogischen Trickkiste? Mit welchen kulinarischen Leckereien und Köstlichkeiten verzauberten sie die Lerner, die ihnen dann wie Jünger ihrem Meister folgten.
Dass es noch andere Methoden geben sollte, die nicht auf der Macht der Sprache basierten, war für mich zum gegebenen Zeitpunkt nicht vorstellbar. Wie hätte ich ahnen können, dass ich selber eines Tages über emotionales Lernen forschen sollte, um zu diagnostizieren, dass nicht das gesamte Schulkonzept falsch und die Schüler animales non rationales waren, sondern der Lehrer am falschen Ort gelandet war, auf dem falschen Planeten. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer“, heißt es im Ersten Buch Moses. Nein, an diesem Ort war ich tatsächlich nicht, und der liebe Gott hatte zudem vergessen, das Licht von der Finsternis zu trennen, und ich sah, dass es nicht gut war. Und auch das Gras und Kraut, das er hatte aufgehen lassen, spross in meiner Klasse nur als Unkraut.
Führte der Weg zur Menschwerdung nicht durch die Erziehung, so fragte ich mich? War die Schule nicht neben dem Elternhaus gleichermaßen für Erziehung verantwortlich? Bei der Annahme des Primats der animalischen Natur im Menschen, welche mir ins Gesicht furzte, begann mein hehres, durch den deutschen Humanismus geprägtes Menschenbild zu schwanken, und es schillerte mir, dass in unserem Erziehungs- und Gesellschaftssystem zweifelsohne einiges falsch gelaufen war. Gerne hätte ich mir wie in Aldous Huxleys Brave New Word herbeigewünscht, dass die mir gegenüber sitzenden ausgewachsenen Embryonen bereits mittels gentechnischer Manipulationen zumindest unterrichtstüchtig gemacht worden wären, da die anschließende mentale Indoktrinierung ebenfalls versagt zu haben schien. In welcher Kaste sollten diese Primaten eines Tages ihre gesellschaftliche Aufgabe verrichten?
Wollte ich nicht Lehrer werden, um bei dem Aufbau einer friedlicheren und besseren Welt mit zu helfen? Wollte ich ursprünglich nicht sogar Sozialarbeiter werden? Oder waren diese ersten zaghaften Berufsvorstellungen darauf zurückzuführen gewesen, dass ich als Schüler selber sozialer Abfall oder Psychopath geworden war, der sich von seinem eigenen Drogenkonsum und der erlittenen katholisch-bourgeoisen Ideologie des aufsteigenden Kleinbürgertums zu befreien versuchte?
Ziemlich uncool geworden war dieser Lehrer. Er verstand die Schüler nicht, und wie hätten sie ihn demzufolge verstehen sollen? Die soziale Komponente der Erziehung war durch ein rein wissenschaftliches Studium und ein Elternhaus, in dem das Geld die Erfolgsstaffel der Karriere und sogar den Grat des Menschentums bestimmte, verloren gegangen. Der beruflich Erfolgreiche maßte sich an, in gleichem Maße auf anderen sozialen Gebieten moralisierend zu intervenieren und als Gut-Mensch Andersdenkende sardonisch zu diffamieren, weil er sich selber unkritisch für das Maß aller Dinge hielt.
Wollte Paul Krieger jedoch, wenn wir dem Ich-Erzähler einen Namen geben sollen, selber jemals genauso gebieterisch werden wie sein Alter? Hatte er nicht selber gegen seinen autoritären Vater angefurzt, bevor er nicht Jahre später zum ersten Mal von der aufklärerischen Zielsetzung moralischer und geistiger Menschheitserziehung gehört hatte, von der er sich jetzt in seiner Klasse um Lichtjahre entfernte?
Bei allem Verständnis: Paul wollte statt deftigen Linsen- oder Erbseneintopf Nouvelle Cuisine servieren, und das nur, weil er mal zwei Jahre an der Sorbonne studiert hatte? War es ihm denn nicht aufgefallen, dass er nicht an einer erzbischöflichen Privatschule, sondern an einer Städtischen Gesamtschule im sozialen Brennpunkt angestellt worden war?
Es scheint uns kein Zufall zu sein, lieber Leser, dass Paul Ihnen gegenüber, bewusst oder unbewusst, bislang verschwiegen hat, dass er an einer Gesamtschule zwar nicht Mensch, aber Lehrer geworden war. Galt es in seiner Familie doch nicht als koscher, sich um die sozial Schwächeren kümmern zu wollen, die im Allgemeinen als niveaulos, dumm und asozial galten.
Wer aus dem Begriff koscher aber ableiten wollte, dass Paul einer jüdischen Familie entstammte, unterläge in diesem Zusammenhang einem fatalen Irrtum, denn seine Familie war stolz darauf, erzkatholisch zu sein, und zwar im Sinne vom griechischen archē, welche das Erste, Oberste, den Anfang oder die Führung signifizierte. Ein anderer Glauben war daher nicht denkbar, ein Sakrileg, und Unglauben etwas Ungeheuerliches für fleißige Kirchgänger, die sonntags während des Hochamts ihre Pelzmäntel zur Schau trugen.
Aber möglicherweise berichtet Paul Ihnen später noch selber über diese marode Baustelle in seinem Leben, sofern er das erzkatholische Milieu und die kleinbürgerliche Werteordnung seiner Eltern nicht bis in den hintersten Winkel seines Hippocampus verdrängt hat, um nicht mehr an die Beobachtungsphobie durch einen allgegenwärtigen strafenden Gott erinnert zu werden, der ihn beim frühkindlichen Masturbieren zugeschaut haben musste.
Wenn der Kirchenkritiker und suspendierte Pfarrer Eugen Drewermann in seinem Buch Kleriker versucht hat zu erklären, aus welchen psycho-sozialen Zwängen heraus jemand Pfarrer wird, so wäre es sicherlich ebenso interessant, eine solche Studie einmal für derzeitige oder noch werdende Lehrer zu unternehmen. Welches Psychogramm würde Paul dabei abgeben, der gerade noch behauptet hatte, dass er Sozialarbeiter hätte werden wollen?
Nun hatte er doch die Chance sich zu bewähren und es besser zu machen als sein Vater, der ihn selber immer alsabnormal und gehirnverbrannt bezeichnet hatte, und zwar nur weil Paul, wie so viele junge Menschen in der Adoleszenz, die Welt hatte verbessern wollen. Sollte Paul sich so weit von seinem ursprünglichen Ideal entfernt haben, dass er sich jetzt selber auf die Spuren seines Vaters begeben hatte, um etwas Besseres zu werden, wie es in seiner Familie so schön hieß?
Doch kehren wir zu unserem selbsternannten Protagonisten zurück, der gerade dringendere und existenziellere Probleme zu lösen hat, als sich von der Psychose eines allgegenwärtigen Gottes oder eines tyrannischen Vaters zu befreien. Die Uhr zeigt noch zehn Minuten Unterricht an. Wie sollte Paul diese längsten Minuten seines Lebens überstehen? Er empfand seine Verzweiflung wie jemand, der gegen den unabdingbaren Harndrang einer völlig überfüllten Blase ankämpfte und wusste, dass sein Vortrag vor den Notabeln einer illustren Öffentlichkeit noch lange nicht beendet war, während die ersten Urintropfen bereits aus seinem zusammengepressten Schließmuskel entwichen. Und selbst wenn seine Rede im selben Augenblick beendet gewesen wäre, hätte er sich keinen Meter mehr vom Pult entfernen können, um die viel zu weit entfernten Toiletten noch unter Wahrung des Anstandes zu erreichen. Jeder kennt dieses furchtbare Gefühl, und niemand möchte in diesem Moment mit Paul tauschen, selbst nicht mit einer leeren Blase.
Die Nerven lagen blank. Das Adrenalin signalisierte Flucht oder Angriff, und ich verwandelte mich zu einem tobenden Monster, welches mir selber so fremd vorkam, dass ich meine nächsten Handlungen wie aus der Filmperspektive betrachtete: Jemand zerrte Miriam mit aller Kraft von ihrem Stuhl und zog sie, die sich mit Fauchen und Zerren widersetzte, an der Hand durch die Klasse, um sie vor die Tür zu setzen. Michael schreckte zurück, weil jemand ihn so anschrie, dass er fast vom Stuhl fiel. Ernst und David setzen sich schnell hin und beteuerten ihre Unschuld, als diese furiose Person brüllend auf sie losstürzte. Natascha wollte noch etwas sagen, aber erstarrte als sie das feuerspeiende Gesicht des wildgewordenen Pädagogen erblickte. Und drei Schüler nahmen kurz vor Stundenende sogar noch zaghaft ihr Heft heraus, ohne zu wissen, was sie damit anfangen sollten. Entweder musste der Lehrer in jedem Moment wie eine überblähte Kröte explodieren, welches zu einer heftigen Detonation geführt hätte, oder er würde alles niederschmettern und zu Boden werfen. „Respekt Herr Krieger“, meinte der übergroße und adipöse Peter. „Sie sind auf unserem Niveau angekommen.“ Dann schellte es, und ich konnte taumelnd und der Ohnmacht nahe mein Gefängnis verlassen. Einen solchen Auftritt konnte ich mir kein zweites Mal leisten.
Wie sehnte ich mich zurück in die heile Welt der Elitehochschule in Frankreich, an der ich vor sechs Wochen noch als Lektor für die deutsche Sprache und Kultur gelehrt hatte, wo ich jetzt nur noch dumpfe Leere empfand und wenig geneigt war, über den Zusammenhang von Lehre und Leere zu reflektieren. Die Beschäftigung mit solchen metaphysischen Spekulationen konnte ich mir vorerst fürwahr abschminken.
Wir hoffen, lieber Leser, dass Sie sich in Ihrem Lieblingslesesessel bis zum jetzigen Zeitpunkt noch wohl fühlen, das Gläschen Wein oder der Softdrink mundet, Ihre Blase Sie nicht belästigt oder zudringlich reizt, und der Gestank des Lehrstalls nicht bis zu Ihnen gedrungen ist. Anderenfalls empfehlen wir eine Stoßlüftung oder den Gang zur Toilette.
Wie mich die drohende Arbeitslosigkeit an eine Elitehochschule katapultierte
Gerne träumte ich von meiner Zeit an der Ecole des Mines in Nancy, dieser französischen Grande Ecole, die zu den Elitehochschulen Frankreichs gehörte und Ingenieure ausbildete, an der ich vier Jahre lang als Lektor unterrichtet hatte. In meiner jetzigen Situation als Gesamtschullehrer erschien mir diese Zeit wie das Goldene Zeitalter, in welches ich mich zurücksehnte wie Rousseau zur Natur: ein Idealzustand der Menschheit vor der Entstehung der Zivilisation, d.h. ohne Laster, ohne Kriege, ohne Gesamtschule und ohne renitente, aufmüpfige, aufsässige und respektlose Schüler. Und um das Schlimmste zu verhindern, hätte man denjenigen, der nach Rousseau einen Zaun um sein Grundstück zog und damit das Eigentum generierte, welches zu Korruption und Zwist unter den Menschen führte, in Analogie also die Gesamtschule gründete, auf der Stelle ermorden müssen, um die zukünftige Degeneration der Gesellschaft zu verhindern.
Vor meiner Gefangenschaft an einer Städtischen Gesamtschule hatte ich vier Jahre im Garten Eden der zukünftigen französischen Elite ein lustvolles Leben führen dürfen. Die Ecole des Mines in Nancy war mein Kanaan, in dem Milch und Honig flossen, und Frankreich war mein Gelobtes Land – wohlgemerkt vor dem Urknall. Ich war frei von Kummer, Plagen und Jammer, und mein geliebtes Weib schenkte mir ein zweites Kind, einen Sohn, der uns als ewiger Sonnenschein begleiten sollte. Die Tochter wurde bald drei Jahre alt und hörte nach dem Umzug aus Köln endlich auf nachts zu schreien. Gegebenenfalls fehlten ihr auch nur die französischen Laute.
Warum war ich jedoch in Nancy gelandet, wo mich ursprünglich nichts dazu prädestiniert hatte, nach Frankreich zu emigrieren? Nachdem ich mein Zweites Staatsexamen für das Lehramt der Sekundarstufe I und II in Französisch, Deutsch und Erziehungswissenschaften im Anschluss an ein zweijähriges Referendariat an dem bilingualen Gymnasium Kreuzgasse in Köln erfolgreich absolviert hatte, drohte unserem ganzen Jahrgang 1986 die Entlassung in die Arbeitslosigkeit. Die Einstellungskurve für Lehrer sank auf ihren Tiefpunkt, und Stellen waren nicht am Horizont. Dadurch, dass von den Referendaren im letzten Jahr bedarfsdeckender, selbständiger Unterricht im Umfang von acht bis zwölf Stunden verlangt worden war, hatten wir sozusagen selber zu einem Stellenabbau beigetragen, deren Opfer wir anschließend wurden.
Der Hauptseminarleiter, Herr Beutler, welcher mich sehr schätzte, setzte in der Zwischenzeit alle Hebel in Bewegung, um zumindest für zwei oder drei Referendare eine Einstellungsmöglichkeit zu finden, zugegebenermaßen auch, um seiner eigenen Tätigkeit einen Sinn zu geben. Denn wer bildete schon gerne zukünftige Arbeitslose aus? Wir waren noch nicht im Jahre 2015 angekommen, als die Massenarbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen und jungen Akademikern aus dem südeuropäischen Raum, zu einer neuen Migrationswelle führen sollte. Während wir in den Nachkriegsjahren auf die Entwicklungsländer in Asien oder Lateinamerika geschaut hatten, überlegten heute viele diplomierte Spanier nach Südamerika auszuwandern, und mein eigener Sohn emigrierte nach Hong Kong, wo er für eine achtunddreißig Quadratmeter Wohnung 2840 Euro zahlen musste. Trotz eines überaus großzügigen Gehaltes, von dem so mancher Lehrer hätte träumen wollen, war am Ende des Monats bei diesen Mietpreisen und den exorbitanten Lebenshaltungskosten immer Ebbe in der Kasse, und das bei einer Wochenarbeitszeit von über 60 Stunden.
Für mich gestaltete sich die Lage im Mai 1986 ziemlich fatal, denn welche Alternativen hätte es für einen angehenden Deutsch- und Französischlehrer in der Industrie geben können? Außer dass ich Worte bewegen konnte wie andere den Hammer, war mein Profil für den Raubtierkapitalismus mit hoher Wahrscheinlichkeit unattraktiv. Jemanden einzustellen, der sich nur auf die Finger schlug und mindestens zwei linke Hände hatte, überforderte den guten Willen eines jeden altruistischen Arbeitgebers.
Schließlich sollte es für mich eine Lösung außerhalb der Landesgrenzen geben, wobei ich nicht missverstanden werden möchte. Es handelte sich um die Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz, wenn ich nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl, welches sich am 26. April 1986, d.h. keine zwei Wochen nach meinem Zweiten Staatsexamen ereignete, auch lieber auf einen anderen Kontinent geflohen wäre. Auf den Kölner Kinderspielplätzen hatten kritische und verantwortliche Eltern Schilder aufgestellt: Der Sand kann verseucht sein, lassen Sie Ihre Kinder hier nicht spielen!
Viele unserer Freunde mit kleinen Kindern wagten es nicht mehr, ihre Wohnungen ohne Atemschutz oder unter Begleitung ihrer Kleinen zu verlassen. Und ich flüchtete mit meiner Frau, Tochter und Freundin, wohlgemerkt die französische Freundin meiner Frau, nach Montpellier, wo letztere eine Wohnung am Strand besaß. Dort spielten wir im Sand, bis bekannt wurde, dass die radioaktive Wolke aus Tschernobyl, geladen mit den Isotopen Iod-131 und Cäsium-137, weder am Rhein noch in den Vogesen vor den Staatsgrenzen der Grande Nation halt gemacht hatte, um die Gallier zu verschonen.
Die offiziellen Stellungnahmen der Regierung, dass Frankreich auf Grund seiner Entfernung von Tschernobyl sowie wegen der gegenläufigen Winde vom radioaktiven Fallout völlig verschont geblieben wäre, erwiesen sich schon bald als eine Mär, aber die Franzosen weigerten sich dennoch ihre Ernährungs- und Freizeitgewohnheiten umzustellen. Sie gingen weiterhin auf den Markt, um dort frisch kontaminiertes Gemüse einzukaufen, weil die Werte in einigen Regionen bis zum 1000-fachen unterschätzt wurden, während die deutschen Bürger teilweise apokalyptische Reaktionen an den Tag legten. Nicht unerheblich für die französische Staatslüge und die Vertuschungsaktion gegenüber den Sansculotten war sicherlich die Tatsache, dass Frankreich seine Stromversorgung zu über 80% aus der Kernenergie bezieht und bis auf den heutigen Tag über 58 Reaktoren in Kernkraftwerken verfügt, direkt hinter den USA mit 99 und zehn Plätze auf der Weltrangliste vor Deutschland mit acht potentiellen Super-Gauen.
Bei meiner Rückkehr nach Köln ereilte mich die Nachricht, dass ein Gymnasium in Montabaur, dem Sitz der Kreisverwaltung des Westerwald-Kreises in Rheinland-Pfalz mit einem gleichnamigen barocken Schloss nach einem Französischlehrer mit beliebigem Beifach suchte. Wenn es sich im Vergleich zur Millionenstadt Köln nur um eine Kleinstadt mit circa 12.000 Einwohnern handelte, so gab es erfreulicherweise dennoch einen ICE-Bahnhof und damit eine Anbindung an die große Welt.
Ich stellte mich innerhalb von drei Tagen persönlich vor, und nachdem die Französischkollegen auf die Bitte des Direktors hin befunden hatten, dass ich ins Team passte und trotz des auffällig guten Examens sowohl der französischen Sprache mächtig als auch ein amüsanter Zeitgenosse war, schien meiner beginnenden Studienratskarriere nichts mehr im Weg zu stehen, außer, dass es noch neun Jahre dauern würde, bis ich lebenslänglich erhielt – als Beamter.
Eine Woche später erhielt ich schon einen offiziellen Bescheid, und zwar schriftlich und in ordnungsgemäßer Form. Vater Staat wusste, wie man im Beamtendeutsch eine Absage formulierte. Nach den einleitenden bedauernden Bekundungen erklärte man mir, dass eine Einstellung nur im Rahmen eines Ländertausches möglich wäre, da bei der Aufnahme eines NRW-Asylanten durch die Landesregierung in Reinland-Pfalz das Bundesland Nordrhein-Westfalen sich dadurch erkenntlich zeigen müsste, dass es im Tausch ebenfalls einen Bewerber aufnahm. Da aber derzeitig kein Kollege nach NRW wechseln wollte, könnte die Stelle mit meiner Person leider nicht besetzt werden.
So einfach gestalteten sich die Dinge in einem föderalistischen Staat, in dem über Jahrhunderte die Länder nicht nur ihre Kulturhoheit bewahrt hatten. Als Folge dessen hieß es: auswandern! Meine Frau war Französin und die Vorstellung, mich in den Dienst der Trikolore zu stellen, bot durchaus einen gewissen Anreiz. Und ein Land zu verlassen, dessentwegen ich bei einem Griechenlandurlaub in den siebziger Jahren als Hitler beschimpft worden war, durfte nicht als Vaterlandsverrat gelten. Über vierzig Jahre später wurde Angela Merkel in dem gleichen Land, welches kurz vor dem Staatsbankrott stand, als Hitler karikiert, weil ihre Politik der Austerität den Griechen eine umstrittene staatliche Sparpolitik verordnete, welche viele Bürger in die Armut abgleiten ließ.
Ich bewarb mich daher unmittelbar nach meinem Examen beim Deutschen Akademischen Austauschdienst, eine glorreiche Idee, auf welche mich ein Freund gebracht hatte, der ebenfalls mit einer Französin liiert war, aber sich schon vor dem Referendariat gegen das Beamtentum entschieden und selbständig gemacht hatte. Er verkaufte Hochräder auf die Arabische Halbinsel, bis dieser ökonomische Hochseilakt ihn aufs Neue in die Büroräume des Kölner Arbeitsamtes zwang.
Der DAAD, wie das Akronym in Fachkreisen gehandelt wurde, vermittelte einigen hundert Lektorinnen und Lektoren Anstellungen an Hochschulen in über 100 Ländern. Und jedes Jahr wurden circa 100 dieser attraktiven Stellen für Nachwuchswissenschaftler ausgeschrieben, die vorrangig ein Studium der Germanistik mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache absolviert hatten, ein exzellentes Examen vorlegen konnten und promoviert waren oder zumindest eine Promotion anstrebten. Letztere hatte ich schon vor zwei Jahren begonnen, als ich auf mein Referendariat wartete und meinte, in der Zwischenzeit etwas Sinnvolles unternehmen zu müssen.
Bei dem Concours oder Auswahlverfahren, zu welchem ich im Juni eingeladen wurde, schlotterten mir zwar die Knie, aber mein zweijähriges Studium an der Sorbonne kam mir bei einer mehrsprachigen Jury sehr zugute, welche von einem Germanistikprofessor genau dieser ehrwürdigen Institution präsidiert wurde. Tatsächlich konnte ich ihm gegenüber durch die angemessenen Antworten auf einige gezielte Fragen bestätigen, dass ich in diesen heiligen Säulen des Wissens nicht nur die französische Sprache gelernt hatte, sondern in meiner Menschwerdung fernerhin vom Stadium der Agrikultur in jenes der Kultur übergetreten war.
Als mir andere Bewerber nach meiner Vorstellung von den komplexen Fragenkatalogen und den schwierigen Gesprächsthemen berichteten, mit denen sie konfrontiert worden waren, insbesondere aus den Bereichen der Wirtschaft, der Politik und der deutschen Geschichte, konnte ich mich als Glücklicher wähnen, der diese Erlesenenprüfung erfolgreich überstanden hatte. Dieses Ergebnis implizierte jedoch noch nicht, dass damit alsbald eine Stelle verbunden war, wie man mir Ende Juni mitteilte. Die Entscheidungsfindung könnte sich über ein erstes und zweites Nachrückverfahren noch bis Oktober hinziehen. Die Zitterpartie ging demzufolge weiter.
In der Zwischenzeit musste aber Geld für die Familie eingetrieben werden. Meine Tochter hatte Hunger. Meine Frau, die sich in einem glücklichen Erziehungsurlaub befand und nur sechshundert Deutsche Mark Erziehungsgeld erhielt – bei den Problemen, die wir mit unserem kleinen Teufel hatten, wäre eine höhere Summe moralisch durchaus angebracht, aber rechtlich nicht durchsetzbar gewesen – war Gott sei Dank damals etwas pummeliger als heute, und die Miete durfte gleichfalls bezahlt werden.
Infolgedessen bewarb ich mich um einen Job in einer privaten Sprachenschule, Linguarama, welche europaweit Sprachkurse für Firmenkunden und Berufstätige anbot, und war erfolgreich. Ich durfte zehn Stunden Deutsch unterrichten, meistens in Einzelunterricht, wobei das Highlight darin bestand, von Zeit zu Zeit eine kleine Firmengruppe beim Mittagsessen zu begleiten, damit die Konversation sogar über den Mittagstisch fortgesetzt werden konnte. Cool! Beim Essen reden und dafür noch bezahlt werden.
Damals verdiente ich nur 10 DM pro Stunde, während die Sprachenschule circa 50 DM einstrich, aber ich musste das Essen davon nicht selber bezahlen. Gott sei Dank! Ich kam immer satt nach Hause. Und auf diese Weise erfährt man schon früh, was Ausbeutung und Mehrwert bedeuten, nämlich der Wert, den meine Arbeitskraft im Verhältnis zu meinem Verdienst zusätzlich einbrachte und vom Arbeitgeber kassiert wurde, welcher schließlich alle Risiken trug. Sozialversicherung und Krankenversicherung zahlte man mir natürlich nicht. Aber welchen Anlass hätte ein junger Mann haben können, krank zu werden, zumal ein Job immer nur eine vorübergehende Tätigkeit ist.
Parallel arbeitete ich noch in einem Übersetzungsinstitut. An diesem Ort verhielt sich das kapitalistische System ähnlich: Ich bekam 20 Pfennig pro Zeile, die dem Auftraggeber vom Institut mit 80 Pfennig fakturiert wurde. Schnell begriff ich, dass ich nur bei der Ablieferung schlechter Übersetzungen vom Französischen ins Deutsche und res versa gut verdienen konnte, und da mich der Inhalt im Regelfall nicht nur nicht interessierte, sondern ich ihn mitunter, insbesondere bei technischen Übersetzungen, gar nicht verstand, begannen meine moralischen Zweifel zu schwinden, nämlich keine gute Übersetzung abzugeben. Dennoch drängte sich meinem Gewissen bisweilen die Frage auf, ob ich einen Übersetzungsauftrag nicht besser ablehnen sollte, weil er zu wissenschaftlich, wirtschaftlich oder technisch war, allerdings wäre dann meine Kompetenz in Frage gestellt worden, und es bestand die Gefahr, keinen Anschlussauftrag mehr zu erhalten. Nach zwei Monaten verlor ich meinen Job, weil wahrscheinlich irgendeine Brücke zusammengebrochen oder eine Maschine explodiert war. Den genauen Grund habe ich nie erfahren, allerdings habe ich seitdem höchsten Respekt vor guten Übersetzern.
Ein dritter Job wurde mir schließlich im Institut Français in Köln angeboten, wo ich als Hilfe der Chefsekretärin dreimal pro Woche von 16– 20 Uhr Unterlagen ordnen, Briefe schreiben und Telefondienste leisten sollte. Diese Tätigkeit wurde nicht nur sehr gut bezahlt, sondern war darüber hinaus anspruchsvoll und mit einiger Aufregung verbunden. Insbesondere, wenn ich abends zwischen 19 und 20 Uhr alleine im Büro war, weil die Chefsekretärin schon nach Hause gehen durfte und dann der Botschafter aus einem frankophonen Land anrief, welches ich vereinzelt geografisch gar nicht situieren konnte, beziehungsweise dessen Akzent ich kaum verstand, wurde ich häufig von Adrenalinschüben geplagt.
Ich durfte keinen Fehler machen, musste die zahlreichen Höflichkeitsformeln der französischen Hochsprache brav aufsagen, die Verbindungen durchstellen, soweit der Direktor oder der Generalsekretär noch auf ihren Arbeitsplätzen verweilten. Des Weiteren wurde ich ab und an zum Diktat gerufen, wobei man wenig Rücksicht darauf nahm, dass ich der Stenographie nicht mächtig und zudem kein Vollblut-Franzose war. Allerdings konnte ich sehr schnell schreiben, an einigen Tagen sogar so schnell, dass ich mein Gekritzel beim Tippen nicht mehr richtig entziffern konnte und peinlicherweise demzufolge Rücksprache halten musste. Aber es war insgesamt ein sehr gesitteter Umgang, und alle Vorgesetzten beachteten eine geradezu höfische Etikette.
Nur gelegentlich stürzte die Sekretärin selbst in Tränen aus dem Direktionszimmer, weil sie kurz vor Dienstende etwa angewiesen wurde, einen Brief noch einmal sauber abzutippen, einige Ergänzungen vorzunehmen oder die Interpunktion zu korrigieren. Leider genügte es vor dreißig Jahren nicht, den Text zu korrigieren und erneut auszudrucken. Das Tipp-Ex war zwar eine enorme Hilfe bei kleinen Fehlern, allerdings konnte ein ganzer Satz nur dadurch korrigiert werden, dass die Seite ein weiteres Mal vollständig neu getippt wurde, wodurch sich bei längeren Texten zusätzlich die Folgeseiten änderten: Quelle catastrophe!
Ich genoss meine Tätigkeit nicht mit geringem Stolz und war mit meiner relativen Kompetenz und geringen Verantwortung gut angesehen, bis mir ein tragischer Fehler unterlief. Es handelte sich darum, das jährliche Kulturprogramm neu zu gestalten, welches darin bestand, Künstler vorzustellen, Film- und Theateraufführungen zu kommentieren, Lesungen aufzuführen oder Gesprächsrunden einzuleiten.
Als einer der wenigen Deutschen im Institut Français erkor man mich als Spezialisten aus, um das französische Programm ins Deutsche zu übersetzen, weil es zweisprachig erschien: eine anspruchsvolle, aber sehr interessante Aufgabe. Und da es sich in dieser Situation nicht darum handelte, einen Zeitmarathon zu gewinnen, weil die Zeile per Stückpreis honoriert würde, wie in einem Übersetzungsinstitut, konnte ich mir alle Zeit der Welt nehmen, um eine qualifizierte Leistung zu erbringen. Gleichermaßen stand meine Ehre auf dem Spiel, wollte ich den Vorgesetzen gegenüber doch nachweisen, dass ich die Kompetenzen besaß, um eine gute Übersetzung anzufertigen.
Ich benötige zwar sehr viel mehr Zeit, als ich gedacht hätte, war aber mit dem Ergebnis hochzufrieden. Der erbrachte Aufwand war jedoch so hoch, dass ich nicht hätte Übersetzer werden wollen. Insofern nochmals meine Hochachtung für diesen Beruf! Da das Programmheft schnell in den Druck musste, warf der Generalsekretär nur noch einen kurzen Blick über meine Übersetzung, lobte mich – und eine Woche später gab es einen lauten Disput im Büro des Direktors mit dem Generalsekretär.
Noch ahnungslos bezüglich der Ursache des Zornausbruchs, saß ich bequem mit der Chefsekretärin im Vorzimmer, und wir fragten uns mit erstaunten Blicken, was in diesem Fall wohl der Anlass für eine so außergewöhnliche Gefühlsäußerung war. Der Direktor, Monsieur Magnon, war immerhin ein hochangesehener gebildeter Mann, welcher sich glücklich wähnen durfte, erfolgreich aus dem Formatierungsprogramm der berühmtesten Eliteschule Frankreichs hervorgegangen zu sein, der École Nationale d’Administration, die von den Kürzel liebenden Franzosen nur ENA genannt wurde.
Diese am 9. Oktober 1945 von Charles de Gaulle gegründete Nationale Hochschule für Verwaltung sollte nach der Vichy-Vergangenheit als Kaderschmiede par excellence die häufig aus der Résistance stammenden ersten höchsten Beamten des Staates ausbilden und eine politisch unbelastete Verwaltung für den Wiederaufbau Frankreichs liefern. Ihre Absolventen werden bis heute als Enarchen bezeichnet, welche der unbesonnene Leser nicht mit den Eunuchen verwechseln möge. Während letztere nach ihrer Kastration, sofern sie diese überlebten, häufig als Palasteunuchen an den Höfen in Byzanz, China oder im osmanischen Reich beispielsweise als Minister, Berater oder Haremswächter dienten, besetzen erstere bis heute die Top-Positionen in allen Behörden und Ministerien Frankreichs.
Am erwähnten Ort werden bekanntlich die französischen Präsidenten produziert und wie es der Soziologe Pierre Bourdieu ausdrückte, reproduziert die Elite sich und ihre dominante Weltsicht immer wieder selbst. Der zweimalige konservative Präsident Jacques Chirac sowie François Hollande, der in den barocken Sälen die bedeutsamste Bekanntschaft seines Lebens machte, indem er Ségolène Royal, die Mutter seiner vier Kinder und Präsidentschaftskandidatin der Sozialisten 2007, kennenlernte, studierten an diesem Ort, ebenso wie die Ministerpräsidenten Dominique de Villepin, Michel Sapin oder die Spitzenpolitiker Alain Juppé, Lionel Jospin oder Edouard Balladour.
Der gegen François Hollandes Lebenspartnerin angetretene Präsidentschaftskandidat und französische Präsident Nicolas Sarkozy studierte hingegen an der Elitehochschule Science Po, dem Pariser Institut für politische Studien, das gleichermaßen Georges Pompidou zum Präsidenten kürte. Der Petit Nicolas hat allerdings nie sein Abschlussexamen absolviert, weil er, so heißt es in bestimmten Medienberichten, an seinen mangelhaften englischen Sprachkenntnissen scheiterte. Dass er trotzdem Präsident wurde, war sicherlich ein hinreichender Trost. Wie klein die französische Elite ist, zeigt allerdings, dass nach dem Scheitern der Präsidentschaftskandidatur von Ségolène Royal fünf Jahre später le Président normal, ihr Lebensabschnittgefährte, das Rennen machte, um die Familie zu ernähren.
Als Mitglied aus diesem exklusiven Club der ENA hätte man von Monsieur Magnon selbstverständlich erwartet, dass er sich in Krisenfällen als Stoiker im allgemeingebräuchlichen Sinne des Wortes verhalten hätte, der seine Emotionen und Affekte immer im Griff behielt und nicht unter Hormonschwanken litt. Letzteres galt in der Tat vielmehr für meine Kollegin im Sekretariat, die bisweilen urplötzlich wie von einer Tarantel gebissen aufspringen konnte, rot anlief und ihren Unmut durch lautes Fluchen in französischer Sprache kundtat. Die Stärke der Artikulation der Laute signalisierte mir, der nicht jedes Schimpfwort verstand, den Schwellengrad ihrer Verwünschungen, die sie ausspie, oder sogar den Grad der Verzweiflung, in welcher sie sich gerade befand.
Nachdem im Büro von Monsieur Magnon erneut eine sinnvolle Weltordnung eingetreten war, weil man sich der Maximen Zenons, Senecas, Epiktets oder Mark Aurelius‘ aufs Neue erinnert hatte, oder weil einem nach dem tobenden Wutanfall der Sauerstoff ausgegangen war, verließ der Generalsekretär, Monsieur Blâme, sozusagen mit eingezogenem Schwanz, das Territorium und zitierte mich seinerseits mit einem zornigen Blick in sein Büro. Dieser ließ keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Situation und war sicherlich kein Vorbote einer guten Nachricht. Marion, die Sekretärin, konnte mir gerade noch viel Glück wünschen, und dann brach ich auf, um den Richterspruch entgegenzunehmen, mit dem festen Willen allerdings mein Los in aller Gelassenheit zu akzeptieren.
„Lieber Herr Krieger“, so hob der Generalsekretär mit pathetischer Stimme an, „es ist ein großes Malheur passiert, dessen Ursache Sie sind, aber dessen Verantwortung mir obliegt. Wie übersetzten Sie das in unserem Programm im Zusammenhang mit dem New Yorker Künstler erwähnte Verb ‚disparaître‘ in dem Satz l’artiste a disparu le 10 juin à 18.30 heures?“ Mir wurde unmittelbar bewusst, dass ich dieses Verb natürlich falsch kontextualisiert und mit „verschwinden“ daher falsch übersetzt hatte. Ich entgegnete daher demütig, dass ich nur eine Bedeutung des Verbs kennte, nämlich „verschwinden“, dass die Übersetzung Der Künstler verschwand am 10. Juni um 18.30 Uhr aber offensichtlich falsch sei.
„Die Kenntnis der Ursache, Herr Krieger“, fuhr Monsieur Blâme fort, „verhindert leider nicht mehr die unliebsamen Folgen, die mit der Tatsache verbunden sind, dass der New Yorker Künstler am 10. Juni keineswegs spurlos verschwunden, sondern verstorben ist. Es handelt sich daher um einen nicht unerheblichen Übersetzungsfehler, der dem Künstler zwar nicht das Leben zurückgibt, uns aber momentan das Leben zur Hölle macht, weil das Programm in der Zwischenzeit 6.000 mal gedruckt und an alle wichtigen Persönlichkeiten und Institutionen verschickt worden ist.“ „Der Künstler, lieber Herr Krieger, um es noch einmal ganz deutlich und unmissverständlich zu formulieren, ist weder verschwunden noch abhandengekommen, noch weggegangen, sondern gestorben, aus dem Leben gegangen – und nicht fortgegangen oder von der Bildfläche verschwunden, nein, er ist von uns gegangen.“
„Der völlig skandalisierte französische Botschafter“, so setzte Monsieur Blâme seine Schilderung fort, „hat heute Morgen bereits Monsieur Magnon zur Rechenschaft gezogen und mir gerade, wie sagt man noch im Deutschen, ja, die Leviten gelesen, wie Sie es sicherlich durch das Haus haben schallen hören, weil ich diesen fundamentalen Übersetzungsfehler bei einer Kontrolllektüre natürlich hätte aufdecken und verbessern müssen. Der Sündenbock bin demgemäß ich, aber Monsieur Magnon fühlt sich selbstverständlich in gleichem Maße der Lächerlichkeit preisgegeben. Das Telefon steht seit heute Morgen nicht mehr still, und selbst die Presse möchte diese furchtbare Anekdote allem Anschein nach der Öffentlichkeit nicht vorenthalten.“
„Werde ich jetzt fristlos entlassen?“, stotterte ich mit zittriger Stimme. „Das wird doch sicherlich sehr unangenehme Konsequenzen haben.“ „Wenn jemand gefeuert würde“, Herr Krieger, „dann sicherlich ich, aber das ist in unserer Institution nach so vielen Dienstjahren unwahrscheinlich, zumal ich in einem Jahr ohnehin in Pension gehen werde. Aber mit der Schmach müssen wir voraussichtlich noch eine Weile leben, und Sie werden diesen Fehler mitnichten jemals in Ihrem Leben vergessen. Nun dürfen Sie wieder an Ihre Arbeit zurückkehren – disparaîssez ! – gehen Sie mir zumindest für heute aus den Augen, weil es genügend andere Anlässe geben wird, welche mir diesen Irrtum immer wieder vor Augen führen werden. Bonne journée et au revoir!“
Ins Büro zurückgekehrt, wartete Marion schon ungeduldig auf die Erklärung, die ich ihr unmittelbar enthüllen würde. Nachher lachten wir ein wenig forciert darüber, on riait jaune, wie man im Französischen sagt. Noch beherrschte ich die Sprache nicht in allen ihren Feinheiten, und selbst dreißig Jahre später verbarg mir diese sicherlich wunderbare Sprache noch so manches Geheimnis, während meine Frau mir vorrechnete, dass sie mittlerweile mehr Jahre in Deutschland als in Frankreich gelebt und in der Zwischenzeit in beiden Sprachen Probleme hätte.
Während ich weiterhin in der Sprachenschule einige Sprachkurse gab und dreimal in der Woche nachmittags am Institut Français arbeitete, fragte mich Monsieur Blâme eines Nachmittags, ob ich unter Umständen Interesse hätte, im WDR Schulfunk in der Funktion eines didaktischen Beraters tätig zu werden, da ich doch Französischlehrer sei. Wenn dem so sei, würde er für mich einen Termin mit dem Direktor des Schulfunks festlegen, damit ich mich persönlich vorstellen könne. „Wissen Sie“, Herr Krieger, „trotz Ihres Fehlers, der uns einige Sturmwinde zugezogen hat, sprechen Sie doch ein sehr gutes Französisch und scheinen mir ein halbwegs intelligenter Mensch zu sein. Möglicherweise ergibt sich hier für Sie ja mit ein bisschen Glück mittelfristig eine interessante Arbeitsperspektive.“
Mein Herz hüpfte vor Freude, meine Frau zeigte sich über diese unerwartete Wendung überschwänglich glücklich und das Gespräch, welches ich eine Woche später mit Herrn Meßler führte, hatte meine unmittelbare Mitarbeit an einem Französischlehrwerk zur Folge, welches L’hôtel des quatre vents (Das Hotel der vier Winde) hieß. Ohne längere Schulerfahrung, außer meiner zweijährigen Tätigkeit als Referendar, wurde ich anfänglich mit circa 10 Stunden pro Woche als didaktischer Berater eingestellt, der den bereits fertiggestellten ersten Band mit einem Sonderstundenkontingent aufmerksamst lesen, kommentieren und nach Möglichkeit verbessern sollte. Dieser Tätigkeit konnte ich sogar im Home-Office nachkommen.
Dann hatten wir das erste Treffen des Teams, welches mit der Erstellung des WDR-Lehrwerks betreut war. Tatsächlich handelte sich um die Ausarbeitung eines französischen Hörfunk-Sprachkurses von Radio France und dem WDR Köln in Koproduktion mit den Rundfunkanstalten der ARD, und ich sollte daran mitarbeiten. Das Team bestand mit mir aus sechs Mitarbeitern, die sich einmal im Monat unter der Leitung von Herrn Meßler trafen, um über die neu konzipierten Lehr- und Lerneinheiten zu befinden.
Zwei Personen fielen mir sofort auf, als wir in dem hoch modernen Konferenzraum des WDR Platz nahmen: an erster Stelle der Leiter des Schulhörfunks selbst. Seine groß gewachsene Gestalt von aristokratischer Autorität erweckte den Eindruck, dass er seit seiner Kindheit nicht aufgehört hatte zu wachsen, wobei ich selber bei einem Meter siebzig schon meine maximale Höhe erreicht hatte und keineswegs von mir behaupten konnte klein aber fein zu sein. Bei Herrn Meßler hingegen war alles Eleganz, Gefälligkeit, Großzügigkeit, und sein harmonisches Gebärdenspiel verriet das würdevolle Benehmen einer edlen Seele.
Herr Meßler war um die 50 Jahre alt. Alles an ihm war nobel, generös, jovial, höflich und taktvoll, aber nichts konventionell oder steif. Im Gegenteil, er sprühte vor Witz und Bonmots. Seine wortgewandte Sprache wurde durch die Verwendung des Französischen nicht gemindert. Sie klang in meinen Ohren wie swingender Jazz mit Verve und Esprit.
Die zweite Hauptfigur in unserer Runde stellte ein bereits äußerlich auffälliger neumodisch gekleideter französischer Journalist, der nicht nur schlank, sondern fast schon dünn war und sich bewegte, als hätte er nach einer im klassischen Ballett verbrachten Kindheit seit einigen Jahren zum Modern Dance gewechselt. Dazu passte nicht nur sein leichtfüßiger, fast schwebender Gang, sondern auch seine blondlockige Schönheit, die ihn aus Paris wie in einer Choreographie begleitete. Beide beherrschten die deutsche Sprache allerdings nur rudimentär, weswegen wir überwiegend Französisch parlierten. Aber die Grande Nation ist unterdies häufig nicht so polyglott.
David, der kleine Franzose in den Maßen von Nicolas Sarkozy, aber etwas affektiert oder manieriert, verkörperte für mich den typischen Dandy und evozierte in mir Bilder von Charles Baudelaire, Lord Byron oder Oskar Wilde. Äußerst elegant mit einem körpernah geschnittenen Maßanzug gekleidet, kultiviert, wie sich herausstellte, und mit den formvollendeten Manieren eines Gentlemans, der die Sprache, wohlgemerkt die französische, als Kunstwerk praktizierte. Darüber hinaus erweckte er durch ein gewisses narzisstisches Selbst, das es zu inszenieren galt, den Eindruck, dass er vermutlich ein ungezwungenes Verhältnis zum Geld hatte und der Journalismus nur eine intelligente Beschäftigungsform oder einen Zeitvertreib darstellte, der mit den Niederungen anstrengender Erwerbstätigkeit nichts gemein hatte. In welcher Funktion die Blondine ihre Existenzberechtigung in unserer Runde hatte, konnte ich nicht feststellen, aber selbst wenn sie nur ästhetisches Beiwerk gewesen wäre, hätte sicherlich niemand auf diese entzückende Augenweide in der vollen Pracht ihrer Formen verzichten wollen, selbst wenn sie nur eine anmutige Dekoration sein sollte.
Herr Meßler zeigte in jeder Situation die Meisterhaftigkeit seiner Gesprächsführung und seine edle Gesinnung, die immer auf Harmonie gerichtet und Wohlwollen basiert war, selbst wenn verschiedentlich völlig entgegengesetzte Positionen vertreten wurden. Er gehörte zweifelsohne zu Ciceros civitas optimatium, d.h. den besten Bürgern zur Organisation einer Demokratie. Er war immer überaus freundlich und zuvorkommend. Niemand von uns hatte jemals den Eindruck, dass er nicht ernst genommen würde, etwas Falsches oder sogar Unsinniges gesagt hätte. Alle Äußerungen und Beiträge wurden gewürdigt und gemeinsam optimiert. Die Arbeitsatmosphäre war daher überaus angenehm und nicht weniger effizient. Im Gegenteil, Herr Meßler achtete akribisch darauf, dass die gut durchorganisierten Tageordnungspunkte nach genauem Zeitplan abgearbeitet wurden, weil insbesondere die Anwesenheitszeit der externen Mitarbeiter des Projektes sehr eingeschränkt und genau festgelegt war. Aber selbst bei seinen Anweisungen behielt Herr Meßler immer ein Lächeln und breit hochgezogene Wangen.
Unser Gast aus Paris, der durch seine Mimik und Gestik als Gaukler oder Taschenspieler hätte auftreten können, war von Herrn Meßler unter Vertrag genommen worden, weil er durch seinen Inspirationsgeist und seine journalistische Wortakrobatik das Handlungsgerüst des Lehrbuchs aufbauen sollte, und heute standen die nächsten vier Lektionen zur Verhandlung, die dialogisch angeordnet waren. Schnell waren wir von seinen Ideen zur Fortsetzung der Geschichte begeistert, allein nicht nur bei mir, sondern ebenfalls bei Herrn Meßler und den anderen Lehrwerksautoren traten erhebliche Zweifel bezüglich des verwendeten Sprachniveaus auf.
Wie sollte eine solche Wortchoreographie für Schüler im Anfängerunterricht verständlich gestaltet werden? Die von David verwendeten Vergangenheitsformen würden erst in den nachfolgenden Lektionen eingeführt werden. Des Weiteren waren einige hypertaktische Sätze durch die Häufung von Konjunktionen, Subjunktionen oder die Verwendung noch unbekannter Konjunktionaladverbien für unser deutsches Ausländerpublikum, welches Französisch meistens als zweite oder dritte Fremdsprache lernte, zu komplex. Hinzu kam eine Ansammlung von Adverbien oder Adjektiven, die zwar das Geschehen spannend, aufregend oder lustig und humorvoll gestalteten, jedoch nur für diejenigen, welche das, was es zu lernen galt, schon beherrschten.
Selbst dem begabtesten Schüler konnte an diesem Punkt keine positive Sinnkonstruktion gelingen. Die Demotivation war damit vorprogrammiert, selbst wenn wir eingangs unseren Spaß hatten. In dieser prekären Situation möge jemand versuchen, einen Text mit sechs verschiedenen Meinungsträgern, die wir waren, gemeinsam umzuschreiben, noch leichter wäre es gewesen einem Bären das Tanzen beizubringen. Mithin trug man dem Didaktiker auf, die notwendigen Reduzierungen vorzunehmen, ohne allerdings die Dynamik oder Spannung zurückzufahren – eine Quadratur des Kreises.
Die nächste Sitzung fand in einem Monat statt. Da die meisten in der Zwischenzeit durch die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder galoppiert waren und durch den aufgewirbelten Staub des Alltags den originären und authentischen Text von David wohl vergessen hatten, provozierte mein neuer Basistext, der so spannend war wie eine amerikanische Tupperwarendose, keinen Aufruhr. Die didaktische Reduktion hatte sowohl den Wortschatz als auch die grammatikalische Progression an den Handlungsverlauf angepasst, und der Text hätte jetzt sogar von einem Gesamtschüler verstanden werden können – sofern seine Eltern Franzosen waren.
Man dankte mir für meine Arbeit, aber jeder war darauf gespannt, welche Fortsetzungsgeschichte David wieder präsentieren würde. Das Spektakel eines Wortezauberers war in diesem Fall verlockender als die Kontemplation von Lehrbuchsätzen, die wie Krokodile in eine hypnotische Starre gefallen waren. In diesem Fall könnte nur noch über das spätere Drehen am Lautsprecherregler des Radios der völlig heruntergedimmte Geist der Zuhörer wieder auf neuronalen Standard hochgefahren werden. Nein, wir haben tatsächlich alle eine sehr gute Arbeit geleistet, und das Lehrbuch wurde ein großer Erfolg – damals.
In einer der letzten Sitzungen geschah dann noch etwas völlig Unerwartetes, Außergewöhnliches, Spektakuläres. Nach einer zehnminütigen Pause standen plötzlich zwei Champagner-Flaschen auf dem Konferenztisch, und zwar der prickelnden Luxus-Marke Dom Pérignon aus dem Hause Moët & Chandon. Es gäbe ein besonderes Ereignis zu zelebrieren und einen netten Mitarbeiter zu honorieren, so kündigte Herr Meßler mit feierlicher Stimme an. Dann gratulierte er mir für meine Lektorenstelle, von der er gerade durch einen freudigen Telefonanruf meiner Frau erfahren hatte, die mir an der Université de Nancy II und der Ecole des Mines (Ingenieurhochschule) durch ein Schreiben des Deutschen Akademischen Austauschdienstes offeriert worden war. Zwar bedauere er, zukünftig auf meine Mitarbeit an dem Lehrwerk Hôtel des quatre vents verzichten zu müssen, aber aus Frankreich wehte nun ein anderer Wind, dessen Tragweite ich nicht verpassen dürfe. Die Stelle sollte bereits in zwei Wochen angetreten werden, da es sich schon um das zweite Nachrückverfahren handelte, und meine unmittelbare Zusage sei unabdingbar. Im Taumel der Freude fand ich kaum mehr die richtigen Worte, weder im Deutschen noch im Französischen, um mich bei allen zu bedanken, und sehnte mich nur noch danach, den Brief endlich in meinen Händen zu halten. Es war der 10. Oktober 1986, und die Studienseminare sollten am 24. Oktober beginnen.
Adieu Germany undBonjour la France
Nach einer kurzen Bahnfahrt kam ich bei uns zu Hause in der Nikolaus-Groß-Straße in Köln an, wo meine Frau und ich uns in die Arme fielen. Sie war die beste Frau aller möglichen Welten, und das nicht nur, weil sie mir diese frohe, herzerfrischende Botschaft überbracht hatte, welche unser Leben für die nächsten vier Jahre völlig verwandeln sollte. Wir würden uns nicht nur unbeschwert, denn frei von finanziellen Sorgen, einrichten können, sondern unser Sohn – meine Frau war im fünften Monat schwanger – würde darüber hinaus ein richtiger Franzose werden und unsere zweieinhalbjährige Tochter, welche ihre ersten Redekünste bereits in beiden Sprachen begonnen hatte, ein hoffentlich warmes Sprachbad nehmen. Natürlich freute ich mich selber wie ein kleines Kind, wieder in den Zaubertrank der französischen Sprache und Kultur eintauchen zu können, um mich wie Obelix durch eine magische Kraft zu verwandeln.
Bislang hatte ich nur zwischen 1976 und 1978 zwei Jahre als Student an der Sorbonne verbracht und ein wenig vom Baum der Erkenntnis genascht, welches viel zu wenig war, um mich den philosophischen Wahrheiten zu nähern oder den französischen Wein und die französische Lebensart in meinen Adern zu empfinden. Nun aber sollte der an der Sorbonne entsprungene Strom in Eden sich aufteilen und einen der vier Paradiesflüsse nach Lothringen leiten, um meinen Garten in Nancy zu bewässern, wo ich zwar keine Viehherden hüten würde, aber zwei wunderbare Gotteskinder.
Bei einem genauen Kalkül mag dem Leser auffallen, dass Paul 1976 sein Studium aufnahm und im Mai 1986 mit dem Referendariat abschloss, so dass zwischen 1976 und 1986 genau 10 Jahre lagen. So lange hatte er studiert, und dann trotzdem in Deutschland kein Stellenangebot erhalten. Aber wie so manche kluge Idee aus einem Irrtum entstand, wollte Paul sich gerne dieser positiven Vorsehung fügen, die ihn an die Hand nahm, um ihn zum zweiten Mal in das Gelobte Land zu begleiten.
Paul glaubte zwar weder an das Fatum noch an die Prädestination, weder an das buddhistische oder hinduistische Karma noch an das Kismet im Islam, jedoch schien es ihm evident, dass es ein Prinzip von Ursache und Wirkung geben musste, welches wir allzu oft als Zufall verkennen, weil wir die Komplexität der multiplen Ursachen mit unserem beschränkten Verstand nicht zu durchschauen mögen.
Dabei war aber doch alles ganz leicht zu verstehen: Paul hatte sein Zweites Staatsexamen als Lehrer bestanden. Darauf folgte eine Anstellung als Lehrer oder keine Anstellung als Lehrer. Im zweiten Fall, d.h. nach der nicht erzielten Wirkung der Lehramtseinstellung, suchte das gescheiterte Subjekt gezwungenermaßen nach einer oder mehreren alternativen Lösungsmöglichkeiten, d.h. in Pauls Fall etwa die Bewerbung um eine Lektorenstelle beim DAAD, die Arbeit in einem Übersetzungsbüro oder im Institut Français. Da der Generalsekretär, Monsieur Blâme, den Direktor des Schulfunks beim WDR, Herrn Meßler, kannte, der auf der Suche nach einem didaktischen Mitarbeiter für seinen Hörfunk-Sprachkurs war, und gleichzeitig mit einem arbeitslosen Lehrer in Verbindung stand, der ein wenig Französisch konnte, weil er eine Französin geheiratet und zwei Jahre an der Sorbonne studiert hatte, wurde Monsieur Blâme die Ursache für Pauls Tätigkeit beim WDR – und damit für den Champagner, der zwei Monate später an das Hörfunk-Team ausgeschenkt wurde.
Die genaue Ursachenforschung für Pauls Lektorenstelle in Nancy im zweiten Nachrückverfahren hingegen ist in ihrer Analyse so komplex, dass wir lieber wieder vom alten Zufall sprechen möchten, selbst wenn dieser nur unser Unvermögen bekundet, die Handlungskomplexität unseres Lebens nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip zu erfassen. Und würden wir jetzt darüber hinaus die weder von Paul noch von uns verstandene Quantenphysik mit reflektieren, welche die Gesetze der klassischen Newtonschen Mechanik aufgelöst hat, wäre uns der Zufall wieder ein lieber Freund, um unsere Handlungsfreiheit beizubehalten, wenn wir sie auch nur postulieren und nicht beweisen können.