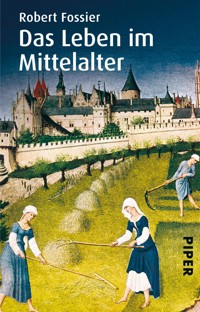
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sein Leben lang hat sich der große französische Historiker Robert Fossier mit dem Mittelalter beschäftigt. Jetzt legt er, als Höhepunkt seines Lebenswerks, ein unkonventionelles Buch über das Leben im Mittelalter vor. »Ich rede von all dem, was sonst nicht zur Sprache kommt: vom Regen und dem Feuer, vom Wein und den alltäglichen Ritualen, vom Umgang mit der Natur und den Tieren, von der Hacke und der Ernte: also von all dem, was den Menschen im Mittelalter wirklich bewegt hat.« Fossier zeigt uns ein Mittelalter, das alles andere ist als finster, und macht uns bekannt mit Menschen, die gar nicht so anders sind als wir, trotz des halben Jahrtausends, das uns von ihnen trennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Vorwort
»Wir, die Menschen des Mittelalters, wussten das alles«, legt ein Autor aus dem letzten Jahrhundert einer seiner Figuren in den Mund. Dieser launige Satz mag Gebildete zum Schmunzeln bringen, aber was ist mit den Unwissenden? Mit denen, für die das Mittelalter nur ein weites Gebiet mit vage umrissenen Konturen ist? Deren kollektives Gedächtnis Könige, Mönche, Ritter und Kaufleute aufmarschieren lässt, Männer und Frauen, die sich zwischen Kathedralen und Trutzburgen tummeln, in einer von Blutdurst, religiöser Inbrunst und Banketten geprägten – »mittelalterlichen« – Kultur? Und was ist mit den Politikern, Journalisten und Medienleuten, die auf Podien steigen und apodiktische Urteile über eine Zeit fällen, von der sie meistens keine Ahnung haben?
Sie alle hängen wohl noch immer der Vorstellung vom »finsteren Mittelalter« an, der wir hier ein vorurteilsfreies Bild entgegensetzen wollen.
Vor mehreren Jahrzehnten spotteten Lucien Febvre und nach ihm, etwas weniger boshaft, Fernand Braudel über den Anspruch, eine im Wandel begriffene Bevölkerung in einer Zeitspanne von tausend Jahren erforschen und beschreiben zu wollen. Sie stimmten darin überein, dass das Terrain der Geschichte getreu Marc Blochs solider Definition aus den menschlichen Verhältnissen, dem Menschen und seiner Gesellschaft bestehe, glaubten aber nicht daran, dass man in einem so großen Zeitraum aussagefähige Urbilder finden könne. Für sie existierte der »mittelalterliche Mensch« nicht. Dennoch wählte vor ungefähr zwanzig Jahren Jacques Le Goff diesen Ausdruck (L``homme médiéval) als Titel für ein Buch, das er mit den Essays von zehn weiteren renommierten Historikern herausgab. Dabei umging er geschickt die Verallgemeinerung, indem er – wie in einer Bildergalerie – »soziale Grundtypen« Revue passieren ließ: den Mönch, den Krieger, den Bürger, den Bauern, den Gelehrten, den Künstler, den Händler, den Heiligen, den an den Rand Gedrängten…und die Frau in der Familie. Die Porträts verdankten ihre künstlerische Frische und Lebendigkeit den verfügbaren Quellen zur damaligen Wirtschaft und Gesellschaft, den Heldensagen und der Phantasie sowie der besonderen Art ihrer Darstellung. Die entstandene Typologie des mittelalterlichen Menschen schafft einen äußeren Rahmen, der uns heute einen leichten Zugang bietet und Elemente umfasst, die auch die drängenden Probleme unserer Zeit beleuchten.
Mein Ansatz ist ein anderer. Warum auch dieses Fresko erweitern oder gar korrigieren, indem man andere »Typen« darstellt oder Differenzierungen und neue Aspekte einführt? Eine solche Arbeit wäre uferlos, mühselig und wenig hilfreich. Im Übrigen fehlte mir hier auch die Kompetenz. Dagegen fällt mir auf, dass die Menschen, die in dem besagten Werk oder in anderen, weniger ehrgeizigen Unternehmungen beschrieben werden, unabhängig von ihrer Herkunft – und ohne dass die Verfasser darüber überrascht erscheinen – gar nicht so anders sind als wir: Sie essen, schlafen, bewegen sich fort, verrichten ihre Notdurft, haben Geschlechtsverkehr und denken sogar ähnlich wie wir: Auch wir gebrauchen beim Essen unsere Hände, bedecken unsere Blöße, haben Sex, schützen uns möglichst vor dem Regen, lachen und weinen, schreien herum – wie die Menschen zur Zeit Karls des Großen, Ludwigs des Heiligen oder Napoleons. Natürlich bin ich mir bewusst, dass es in den verschiedenen Epochen Unterschiede im Alltag, im Denken und in den Moden gibt. Aber wenn man den Menschen, den von gestern wie von heute, in seinem normalen Leben betrachtet, wird er zu einem Säugetier, das auf zwei Beinen geht und Sauerstoff, Wasser, Kalzium und Proteine braucht, um auf seinem aus Eisen und Nickel bestehenden Planeten zu überleben, der zu Zweidritteln von Salzwasser und zu einem Drittel von einem uferlosen Grün bedeckt ist, in dem sich Milliarden weiterer Arten tummeln. Kurz, der Homo sapiens ist »eine Kreatur«. Und als solche interessiert er mich. Lucien Febvre glaubte zu Unrecht, dass zehn oder zwölf Jahrhunderte dies hätten ändern können.
Der Leser mag diese Äußerungen als provokant empfinden und aufgebracht reagieren. Aber gerade eine solche Empörung illustriert auf wunderbare Weise meinen Standpunkt. Sein Widerwille zeugt in der Tat davon, dass er sich von der Grundvorstellung seines Denkens nicht frei machen kann: dass der Mensch, da vom göttlichen Geist gewollt, ein ganz besonderes Wesen oder, wenn man das genannte religiöse Postulat zurückweist, ein höher begabtes Tier sei. Aber wer sähe denn nicht, dass der Mensch ständig vom Wasser, von Dschungeln und angriffslustigen Tieren bedroht ist, dass er permanent ums Überleben kämpft und in der endlos langen Geschichte seines Planeten vielleicht nicht mehr Spuren hinterlassen wird als einst die Latimeria oder die Dinosaurier vor Millionen von Jahren. Seien wir also bescheidener und hören wir auf, uns selbstgefällig im Spiegel zu betrachten.
Ich versuche »Gewissheiten« ins Wanken zu bringen und hoffe, den Leser zu einer kritischen Überprüfung von Standpunkten zu bewegen, auch auf die Gefahr hin, dass er sie am Ende bestätigt sieht. Ich täusche mich keineswegs darüber hinweg, dass meine Ausführungen Schwächen aufweisen. Die wichtigste besteht darin, dass ich die Kreatur, die ich in ihrer Körperlichkeit mit ihrer Seele und ihrem Gehirn in ihrer Umgebung zu zeichnen versuche, in dem eng abgesteckten Rahmen derjenigen Quellen, die mir verfügbar und zugänglich sind, umreißen muss. Mir fehlt die Kompetenz, um den Menschen an den Fallbeispielen des altägyptischen Fellachen, des tibetischen Mönchs, des Versailler Höflings oder des Minenarbeiters aus Zolas Germinal zu beschreiben. Ich fühle mich nur im Mittelalter einigermaßen zu Hause. Von Berufs wegen musste ich mich mit den Athener Schildträgern und den Kürassieren von Reichshoffen nur für kurze Zeit auseinandersetzen. Das »Mittelalter« hat nun wie jede andere Epoche in der abenteuerlichen Geschichte der Menschheit seine Besonderheiten, die natürlich auch zur Sprache kommen werden, damit ich mir nicht den posthumen Zorn Lucien Lebvres zuziehe. Auch müssen wir uns über den Begriff »Mittelalter« verständigen, ein akademischer Ausdruck, der im französischen Sprachraum – als Le Moyen Âge – von Guizot oder Bossuet geprägt wurde. Handelt es sich um eine Ära mit besonderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Merkmalen? Um den marxschen »Feudalismus«? Aber wie speist man »feudalistisch«? Oder geht es um die Zeit, in der das streitende Christentum seinen Siegeszug antritt? Aber was hat das Antoniusfeuer – die halluzinogene Wirkung der Mutterkorn-Vergiftung – mit dem Johannes-Evangelium zu tun? Brechen wir einen Streit, der müßig wäre, an dieser Stelle ab. Meine Quellen und auch die Mehrheit der wissenschaftlichen Arbeiten, die ich hier verwerten oder auf die ich mich berufen werde, betreffen die Zeit zwischen Karl dem Großen und Franz I. von Frankreich. Ich stütze mich hier wie alle anderen und mit den gleichen fragwürdigen Argumenten hauptsächlich auf den Zeitraum vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, auf das Zeitalter der »Bankette« und »mittelalterlichen« Festprozessionen, die von eifrigen Bürgern organisiert werden. Auch stammen meine Beispiele hauptsächlich aus Frankreich, vor allem aus dem Nordfrankreich, das mir besonders vertraut ist.
Und damit endet mein Versuch noch nicht, voreilige Kritik abzuwehren. Der Mensch, von dem ich rede, ist weder Ritter noch Mönch, weder Bischof noch »Großer« und auch nicht unbedingt Bürger, Kaufmann, Grundherr oder Gelehrter. Es geht vielmehr um den Menschen, der vom Regen, vom Wolf und vom Wein umgetrieben wird, vom Feuer, der Hacke, dem Nachbarn, der Predigt oder dem Segen, kurz, von all dem, das, wenn überhaupt, dann nur gelegentlich oder am Rand und stets unter dem Blickwinkel der politischen Institutionen, gesellschaftlichen Hierarchien, juristischen Regeln oder Glaubensgebote zur Sprache kommt. Was hier geboten wird, ist folglich kein Exposé zur Wirtschaftsweise des Mittelalters, keine Darstellung der Techniken, keine Schilderung von Klassenkämpfen, sondern nur eine Darstellung des kleinen Mannes im Alltag.
Und noch ein letztes Wort: Bei fast allen Aspekten habe ich bei anderen geschöpft, ohne sie explizit zu nennen. Aber, wie man so schön sagt, sie sind auch ohne Nachweis zu erkennen. Ab und zu fließen meine eigenen Anschauungen zur Bedeutung des »Natürlichen« und zum »Elend« des Menschen mit ein. Für sie übernehme ich ebenso die Verantwortung wie dafür, dass ich bei den zeitlichen Abläufen und den geografischen Verhältnissen Dinge zusammengefasst, vereinfacht und verallgemeinert darstelle – womit ich sicherlich die »Experten« gegen mich aufbringen werde. Aber diesen Preis hat jeder Streifzug durch die Geschichte.
Habe ich mein Ziel umrissen? Dann muss ich es nur noch erreichen.
Erster Teil
Der Mensch und die Welt
Hier also steht ein beseeltes Wesen, das normalerweise in einer Umgebung aus Luft lebt, die aus Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff besteht. Es gehört zum Stamm der Wirbeltiere und ist ein Säugetier, das sich in einem regelmäßigen Zyklus fortpflanzt, wobei zwei Individuen verschiedenen Geschlechts zueinanderfinden müssen. Um nachzuvollziehen, auf welchen Wegen dieses Wesen, der Mensch, sich dank seiner Intelligenz allmählich einen – wenn auch nur winzig kleinen – Teil der Schöpfung untertan gemacht hat, muss man sich zwangsläufig mit seinen Wurzeln und den Etappen seiner Entwicklung befassen. Heute herrschen sogar unter denjenigen, die sich mit gebotener Bescheidenheit und Demut an das Problem heranwagen, Unsicherheit und Streit: Wortreich führen sie angesichts des Dunkels, in dem sich unsere Vergangenheit von vor Hunderten von Millionen Jahren verliert, eine Auseinandersetzung um die Frage, wie sich aus einer Art Affe ein so geniales Wesen wie beispielsweise Sigmund Freud entwickeln konnte.
Derlei Fragen lagen den Menschen des Mittelalters allerdings fern, wie auch denen der nachfolgenden Jahrhunderte bis fast in unsere Zeit hinein: Für sie war der Mensch das Werk eines Schöpfers, der ihn im Anschluss an die übrige Welt als Krone seines Werkes nach seinem Ebenbild erschaffen hatte. Die Frau entstand dabei nach dem Mann, als eine Art Korrektur, obwohl dieser doch hätte vollkommen sein sollen. Birgt diese Sicht vom Ursprung des Menschen keinerlei Probleme? Sind alle Unzulänglichkeiten, die man am Menschen entdeckt, zwangsläufig eine Strafe Gottes für den Sündenfall? Das bleibt abzuwarten.
Ein schonungsloser Blick auf den Menschen
Der Leser mache sich – eine zugegebenermaßen schwierige Aufgabe – von den traditionellen Klischees frei und versuche, das Wesen des Menschen zu beschreiben und einzuschätzen.
Ein zerbrechliches Wesen
Eine von der Natur benachteiligte Kreatur
Diese – möglicherweise schockierende – Überschrift ist das Ergebnis archäologischer, philologischer, physikalischer und zoologischer Beobachtungen: gewonnen anhand von Leichen, die intakt aus dem Eis oder dem Torf geborgen wurden, von Mumien Heiliger oder großer Persönlichkeiten, von Skeletten, die, vollständig oder teilweise erhalten, in Nekropolen auftauchten, und von Überbleibseln von Gewändern und Werkzeugen, deren Fundort, Entstehungszeit und Erhaltungszustand hier Details ohne Belang sind. Von diesen Überresten, die unbestreitbar Aufschlüsse geben, unterscheiden sich die – gemalten und gehauenen – bildhaften Darstellungen allenfalls dadurch, dass in ihnen Einzelaspekte hervortreten: so Gebärden, Größenverhältnisse oder Blicke. Die Unterschiede zu unseren Zeitgenossen sind vernünftigerweise zu vernachlässigen: Die Menschen des Mittelalters zeichneten sich, nach ihren Dingen des täglichen Gebrauchs zu urteilen, durch eine kleinere Statur, aber auch durch größere Muskelkraft aus, wie die Großtaten des Ritters oder des Holzfällers illustrieren. Eine Frage der Ernährung? Oder der Lebensart? Und wer könnte übrigens auf einem Friedhof das Schienbein eines stämmigen Leibeigenen von dem eines kränklichen Lehnsherrn unterscheiden?
Hören wir also auf, uns mit Entzücken selbst zu betrachten, wie wir es, die Frauen mehr als die Männer, seit Jahrtausenden tun. Gestehen wir vielmehr ein, dass der Mensch eine hässliche und schwache Kreatur ist. Zwar könnten gewisse Kurven und Rundungen – nach unseren jeweiligen Schönheitskriterien, wohlgemerkt – durchaus als anmutig gelten, doch vieles an unserem Körper ist plump oder nachgerade lächerlich: unsere Füße mit den nutzlosen Zehen, unsere gefältelten und fast unbeweglichen Ohren, unser im Vergleich zum Gesamtkörper viel zu kleiner Kopf (die griechischen Bildhauer haben dies aus Liebe zur Harmonie in ihren Darstellungen gerne korrigiert), der Geschlechtsapparat des Mannes oder die Brüste der Frau! Nur eine Frage der Ästhetik? Und noch schlimmer: Als zweibeiniger Sohlengänger ist der Mensch beim Gehen, Laufen und Springen dem Vierbeiner gegenüber deutlich im Nachteil. Über seine verkümmerten und schwach ausgebildeten vorderen Extremitäten kann jedes Landraubtier nur lachen. Die stumpfen Zähne seines Gebisses sind fast so unbrauchbar wie seine zu Nägeln umgebildeten Krallen. Seine dürftige Behaarung schützt gegen keine Laune des Himmels. Die Stellungen, die ihm sein Geschlechtsakt abnötigt, sind grotesk, auch wenn er sie mit zahlreichen Säugern teilt. Mit zunehmendem Alter schrumpft er, erschlafft sein Fleisch, lassen die Organe ihn im Stich. Schlimmer noch schlagen seine dürftig ausgebildeten Sinnesorgane zu Buche: Er ist eher kurzsichtig und fast nachtblind. Von den Lauten oder Schallwellen in seiner Umgebung nimmt er nur einen Bruchteil wahr. Sein Geruchssinn ist dürftig und sein Tastsinn erbärmlich. Dass sein Fleisch fade und versalzen schmeckt und sein Geruch widerlich ist, lässt sich zwar nur aus den Reaktionen anderer Tiere erschließen, doch sind dies gerade jene, die uns mit ihrer Anmut, ihrer Geschmeidigkeit, ihrem scharfen Sehvermögen und hervorragenden Gehörsinn in Staunen und Entzücken versetzen: der Kreise ziehende Raubvogel, der in der Strömung stehende Fisch oder die zum Sprung ansetzende Katze. Wenn wir aufhörten, uns selbst zu bewundern, wäre die Sache ausgemacht: Die Schöpfung hat den Menschen geradezu stiefmütterlich behandelt. Gleichwohl…
Wie gleichwohl leugnen, dass er auf dem Teil der Erde, der über die Wasseroberfläche aufragt, tiefe Spuren hinterlassen hat? Angesichts seines dürftigen »Marschgepäcks« bedurfte es dazu schon einiger Besonderheiten. Geht man davon aus, dass es sich um eine vom Allmächtigen erschaffene ganz besondere Kreatur handelt, erübrigt sich dafür jede Erklärung. Und auch im Mittelalter wurde danach nicht gefragt: Dass es in der Welt Weiße, Schwarze und Gelbe, Kleine und Große, Gute und Schlechte, Genies und Dummköpfe sowie Christen, Juden und Muslime gab, dies alles entsprang einem höheren Plan, dessen Zweck dem Menschen hernieden verborgen blieb und ihm vielleicht erst in den Höhen offenbart würde. Folglich deutet auch nichts darauf hin, dass die Menschen in diesen Jahrhunderten nach den beiden Kriterien – einem positiven und einem negativen –, die ihre Spezies zum zoologischen Sonderfall machen, gesucht oder diese sogar entdeckt hätten. Als einzigartig betrachten sie heutzutage indes die allermeisten, außer vielleicht einige mit tieferen spirituellen Überzeugungen. Der Mensch ist das einzige Säugetier, dessen vordere Extremitäten vier Finger mit einem gegenständigen Daumen aufweisen. Dieses besondere Kennzeichen ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass er greifen, Feuer entfachen und Werkzeuge – vom Feuerstein bis zum Computer – herstellen und gebrauchen kann, die unstrittige Grundlage, die ihn aus der übrigen Tierwelt heraushebt. Als Meister des Feuers und Herr über das Ding ist er zugleich auch – als Kehrseite der Medaille – das einzige Säugetier, ja Lebewesen, das nur aus Hass oder Vergnügen zerstört oder tötet, ohne dass ihn dazu die Angst, der Hunger oder das geschlechtliche Bedürfnis treiben. Er ist das gefährlichste Raubtier und ein besonders gnadenloses dazu.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























