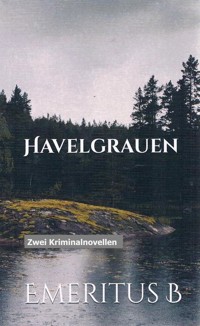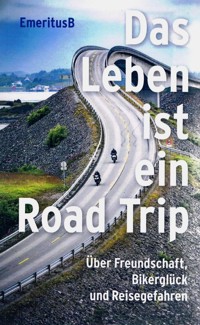
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenige Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer geht für einen in den Niederlanden tätigen deutschen Wissenschaftler mittleren Alters ein fast schon begrabener Traum in Erfüllung: Eine Reise auf dem eigenen Motorrad durch Skandinavien zusammen mit einem Freund. Obwohl er den unerwartet gefundenen Begleiter, einen frisch in die Nachbarschaft zugezogenen jüngeren Arzt kaum noch kennt, werden die beiden verheirateten Männer beim abendlichen Whisky rasch miteinander vertraut, ja Freunde, weil sie es genießen, sich bis in intime Details hinein mit einer wie sich erweist verwandten Seele auszutauschen, insbesondere zu den Parallelen im Verlauf ihrer Midlife-Krisen. Die erste Hälfte ihrer Tour durch das weite Land vonSchweden und Norwegen ist daher in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Als sie auf der Rückreise auf Bitten der norwegischen Polizei einen gestrandeten schwedischen Motorradfahrer mitnehmen, tauchen die Gespräche der Dreiergruppe allerdings in unerwartet beängstigende Dimensionen ab. Das ungehemmt seine sexuellen Ausschweifungen ausmalende Rauhbein aus Malmö erweist sich als düsterer Katalysator und ´tanzt` mit ihnen in einer die beiden Akademiker gleichermaßen abstoßenden wie faszinierenden Nacht durch Landschaften menschlicher Lust, in der ihnen ihr bisheriges erotisches Leben vorkommt wie Kinderspiel auf einer Butterblumenwiese. Danach ist nichts mehr wie es war und letztlich auch ihre Freundschaft dem Untergang geweiht. Zwar können sie den Schweden abschütteln, als dieser ihre Ehefrauen kennenlernen will. Das versprühte Gift in Gestalt ungeahnter Verlockungen wirkt jedoch weiter. Zurück in der Heimat bekommt der Jüngere seinen offensichtlich überreizten Hormonhaushalt nicht mehr in den Griff, und steuert sein Leben unaufhaltsam einer Katastrophe entgegen. Auf der Suche nach immer neuer Spannung jagt ein Seitensprung den anderen, bis seine Ehe zerbricht und zum Schluss auch er selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
EmeritusB
Das Leben ist ein Road Trip
Über Freundschaft, Bikerglück und Reisegefahren
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Impressum
Kapitel 1
Schwer zu sagen, ob das kommende Unheil damals schon in der Luft lag. Die Hochglanzfotos jenes Nachmittags im Sommer 1996 spiegeln auf den ersten Blick Eheharmonie vor Einfamilienhäusern im Sonnenschein wider. Ein Villenviertel in den Niederlanden. Zwei lachende Männer auf hoch bepackten blitzenden Motorrädern, den Helm noch am Lenkrad und die schwarzen Lederstiefel auf dem Asphalt. Abschied von Frau und Kindern. Küsschen hier, Umarmung da, denkt an dies und an das, nichts vergessen? Viel Spaß und fahrt bitte vorsichtig. Ja doch, ja! Ein weißhaariger Nachbar, pensioniert wahrscheinlich, der, lässig auf seinen Rasenmäher gelehnt, das Ganze wohlwollend belächelt und froh sein mag, dass er daheim bleibt, weil er sonst dem liebgewordenen Schnäpschen zum Feierabend entsagen müsste. Auf dem letzten Foto, dem trauten Heim am anderen Ende der Allee bereits entrückt, biegen beide Biker vor einer von Pappeln flankierten schmalbrüstigen weißen Holzkirche um die Ecke, unbekannten Abenteuern entgegen.
Von meinem Reisepartner Robert, einem Niederländer, wusste ich damals kaum mehr, als was man in knapp zwei Jahren guter Nachbarschaft so mitbekommt. Ein angenehmer Typ, wie sich unter anderem bei Gesprächen am Gartenzaun und auf Geburtstagsfeiern gezeigt hatte, zu denen wir uns mittlerweile einluden. Doch Persönliches, gar Intimes?
Robert stammte wie ich aus bürgerlichem Milieu und bezog ebenfalls liberale Standpunkte. Doch wie verhielt er sich im Streit? Setzten ihm dann irgendwelche Komplexe zu, neigte er gar zu Wutausbrüchen?
Sein ausgeglichenes Wesen, seine freundliche, ruhige Art und die polierten Umgangsformen, die zu ihm passten wie der Frack zum Dirigenten, machten ihn auf Anhieb bei jedermann beliebt. Und noch etwas: Ich sah ja, wie ich mir durchaus schmeicheln darf, recht ordentlich aus, aber seinem blendenden Äußeren liefen die Damen bestimmt scharenweise hinterher. Wie ging er mit solchen und anderen Versuchungen um? War er seiner Frau treu, oder gab er sich, was mir nicht unbekannt vorgekommen wäre, wenigstens Mühe, es recht und schlecht zu bleiben? Ich wusste es nicht. Immerhin einte uns die von Anfang an gemeinsam artikulierte Abneigung gegen Politiker mit ihren ewig gebrochenen Wahlversprechen und die immer feinmaschiger gewebten fiskalischen Fangnetze, die wechselnde Regierungskoalitionen unermüdlich um uns rechtschaffene Bürger webten.
„Hinter dem scheinbar so offenen Wesen von meinem Robert steckt im Grunde ein verschlossener Mensch”, hatte mir seine Frau Chantal kurz vor Reiseantritt beiläufig eröffnet, was mich einigermaßen überraschte: „Tiefsinnige Männergespräche sind nicht sein Ding. Über seine Jugend zum Beispiel und seinen innig gehassten Stiefvater schweigt er wie ein Grab. Probleme bespricht er, falls überhaupt, allenfalls mit mir, und das auch nur dann, wenn er ihnen partout nicht mehr aus dem Weg gehen kann.”
Einen Atemzug lang musste ich ziemlich verdutzt ausgesehen haben. Warum sagte sie das? Machte ich auf andere den Eindruck, nach Offenherzigkeit zu lechzen? Kein Haar auf meinem Kopf dachte daran, die in dunklen Ecken verborgenen Wünsche und Ängste, die in jedem Menschen hausen, mit oder vor irgendjemandem ans Tageslicht zu zerren. Meine eigenen sowieso nicht. Ich fand es zudem etwas irritierend, dass sie ihn solchermaßen bloßstellte, aber Robert, der bei dem Gespräch neben uns stand, lachte nur.
Gleichwohl erfüllte sich mir in jenem Mai ein lang gehegter sehnlicher Wunsch, der, mittlerweile fast nur noch ein Traum, in dem Maße schöner geworden war, wie seine Verwirklichung aus Mangel an Gelegenheit und Zeit in unerreichbare Ferne gerückt schien: einmal mit einem Freund eine Motorradreise durch Skandinavien zu unternehmen, jeder auf der eigenen Maschine! Meine wilden Jahre als Student und Jazzmusiker, in denen ich auf den zwei Rädern einer kraftstrotzenden BMW 500 im West-Berlin der Nachkriegszeit den Straßenverkehr belebt hatte, lagen Ewigkeiten zurück. Man wurde älter und eitler, und so zog ich, insbesondere in weiblicher Gesellschaft, irgendwann den Innenraum gebrauchter Käfer vor. Zugige Außenluft schien mir fortan meiner Frisur abträglich. Auch das sechs Jahre nach dem Studium und meiner Berufung an eine holländische Universität aus nostalgischer Verklärung erworbene Boxer-Zweirad, gekauft mit dem Gegenwert der seit meiner Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften nicht mehr gerauchten Zigaretten, war inzwischen längst wieder abgestoßen. In meiner hochgelehrten Arbeitswelt hatte sich niemand für die mich faszinierenden Dimensionen interessiert, in denen von geballter Technik beherrschte Urkräfte mit dem Geruch von Leder, Öl und Benzin regierten. Abgesehen von einigen ebenso seltenen wie behutsamen Biegen ums Karree mit der neugierigen Frau eines Kollegen auf dem Soziussitz war ich, wenn überhaupt, immer allein durch die Landschaft gekurvt. Das jedoch war mir auf Dauer zu langweilig geworden, zudem gab es anderes zu tun.
Mein Job an unserer mittelgroßen, im kleinen Königreich bestens renommierten Universität erforderte den ganzen Mann. Wer dort im wissenschaftlichen Bereich weiterkommen oder wenigstens seine Position behaupten wollte, musste jahrein jahraus nicht nur eine Latte gediegener Veröffentlichungen ausspucken und zudem gut besuchte Vorlesungen anbieten, sondern sich auch, dank der internationalen Studentenrevolution Ende der sechziger Jahre, kräftig in der sogenannten akademischen Selbstverwaltung befleißigen. Mit der Folge, dass die in zahllose Schwafelkommissionen gekarrten Unmengen bedruckten Papiers unsere übliche Arbeitswoche von durchschnittlich sechzig Stunden noch einmal kräftig aufblähten.
In diese Welt passte das Wort Motorrad wie ein Fluch in die Kirche. Aber dann tauchte die Gelegenheit völlig unerwartet doch noch auf, und ich, obwohl normalerweise nicht besonders geistesgegenwärtig, ergriff sie beim Schopf.
Ich erinnere mich wie gestern an den Tag, an dem ich in der Mittagspause bei herrlichem Sommerwetter das letzte Stück von der Uni nach Hause radelte. An die beschauliche breite Allee, umsäumt von hohen Eichen und rot asphaltierten Fahrradwegen. In manchen Vordergärten der großzügig gebauten Villen gackerten Zierhühner. Die ganze Gegend atmete Ruhe und Frieden aus. Doch an jenem Tag war nicht alles so wie immer. Bereits aus der Ferne erspähte ich in der Auffahrt unserer aus den dreißiger Jahren stammenden Doppelhaushälfte einen sich unruhig hin und her bewegenden roten Fleck, der da nicht hingehörte. Eine Frau. Näher dran kniff ich die Augen zusammen. Der äußeren Erscheinung nach hätte es meine liebe Ellen sein können, aber nein, die trug praktisch nie Kostüme, und schon gar keine roten. Überdies, so zeigte meine Armbanduhr, unterrichtete sie zu dieser Zeit noch in ihrer Schule. Also nicht Ellen. Das irritierte mich. Wer war die Frau?
Meine Verwunderung wuchs, je mehr ich, dicht herangekommen, mein Tempo drosselte. Was hat dieses blöde Suppenhuhn da vor unserer Garage herumzuscharwenzeln? Was sucht die da, fragte ich mich.
Gleichzeitig gestand ich mir eine gewisse Verblüffung ein. Das rote Wesen, das sein Hin-und her einstellte und mir erwartungsvoll entgegenblickte, als ich vom Sattel stieg, hätte in der Tat eine jüngere Schwester von Ellen sein können. Mit nicht ganz so regelmäßigen Gesichtszügen wie diese, dafür aber gesegnet mit einer entzückenden kleinen Stupsnase und den appetitlichen Rest in ein enges, rotes Samtkostüm verpackt. Sanfte Rundungen, schmale Taille und alles im genau richtigen Verhältnis an den dafür vorgesehenen Stellen. Näher besehen gehörte das Huhn zu jenen weiblichen Geschöpfen, bei denen man sich als heterosexueller Mann unwiderstehlich ans Erobern macht, sich aber den Gedanken daran sofort wieder abschminkt, weil die Erfolgschancen von vornherein verwahrlosbar erscheinen. Und natürlich, weil es sich nicht gehört.
Solche Klassefrauen halten einem häufig leider Gottes die durch eherne Auffassungen, Kinder und ein geschmackvoll eingerichtetes Zuhause besiegelte eheliche Treue vor, die bestenfalls durch außergewöhnliche Anlässe ins Wanken gerät. Und auch dann nur vorübergehend.
Ich ging jedenfalls auf Distanz, weil ich den üblichen Schmarren in Sachen Zeugen Jehovas oder zumindest eine Spendenaktion vom Roten Kreuz erwartete.
„Was kann ich für Sie tun?”, fragte ich daher nicht unfreundlich, aber kühler und distanzierter, als es sonst bei interessanten Frauen meine Art ist. Denn im Zweifelsfall überwog meine Abneigung gegen Sammelbüchsen jeder Art, schließlich zahlte ich schon genug Steuern für allen möglichen Staatsunfug. Oder was ich dafür hielt.
Sie spürte meine Reserve, zögerte, strich sich mit schlanken Fingern eine im Sonnenschein dunkelbraun glänzende Haarlocke aus dem Gesicht und blickte an mir vorbei in den blauen Himmel, als ob sie von dort Erlösung erhoffte. Ihr Parfüm roch teuer. Dann sagte sie:
„Ja, ich äh … ja, ich bin Chantal van der Laan von gegenüber. Wir sind mit der Renovierung unserer neuen Wohnung fertig und möchten alle Nachbarn zu einem Begrüßungsumtrunk einladen, am kommenden Sonntagnachmittag ab vier. Mein Mann und ich würden uns freuen, dann auch Sie und Ihre Frau empfangen zu dürfen.”
Das stimmte. In der freistehenden weißen Villa schräg gegenüber, aus der sich der betagte Rechtsanwalt Bergmans ein paar Jahre nach dem Ableben seiner zuckerkranken Frau ins Altersheim verabschiedet hatte, waren wochenlang Kolonnen von Handwerkern am Werkeln gewesen. Nicht selten wurde bis in den späten Abend hinein gehämmert, gesägt und gebohrt, dass es eine liebe Lust und Last war, bis eines Tages der Umzugslaster einer Spedition vorfuhr. Moment mal, das war doch gar nicht lange her? Ich staunte. Da mussten sich die neuen Hauseigentümer mächtig mit der Einrichtung beeilt haben, wenn sie schon jetzt auf Gäste vorbereitet sein konnten, alle Achtung. Was nicht bedeutete, dass ich auf eine Vertiefung welch nachbarschaftlicher Kontakte auch immer erpicht war. In unserer Gegend kannte man einander flüchtig, sah und grüßte sich im nur manchmal verzögerten Vorbeigehen oder anlässlich von Trauergottesdiensten in unserer betagten Holzkirche. Mir gefiel es so, und nach mehr stand mir nicht der Sinn.
Aber was soll man machen? Importmenschen von außerhalb mit ganz anderen Gebräuchen? „Ach, das ist ja nett”, sagte ich darum zu dem anmutigen Huhn, meine Steifheit bedauernd, „vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich werde diese gleich nachher meiner Frau vermitteln. Wenn wir nicht schon anderweitig gebunden sind, kommen wir selbstredend gern.”
Zugegeben, das klang geziert wie eine Vogelstelze und wahrscheinlich so krampfhaft unnatürlich, weil ich genau wusste, dass wir kommenden Sonntag jede Menge Zeit haben würden und Ellen sich im Gegensatz zu mir gern auf das Schwatzbudenparkett mit alten und möglichen neuen Freunden begab.
Die neue Nachbarin ließ sich von den Unlustgefühlen, die mein Gesicht zweifellos verriet, kaum beeindrucken. Jedenfalls lächelte sie einnehmend, möglicherweise auch leicht spöttisch, als sie sagte: „Na, dann hoffentlich bis Sonntag. Wir würden uns wirklich sehr freuen.”
Insgeheim hielt sie mich wahrscheinlich für Mister Arroganz persönlich. Als sie auf dem Weg zurück nach Hause die Straße überquerte, fiel mir selbstverständlich auf, dass sich ihre Figur auch von hinten genauso verführerisch proportionierte wie die von Ellen. Und zwar ebenfalls auf langen, schlanken Beinen. Tja, das Leben ist voller Versuchungen.
Die eigentliche Überraschung indes hieß Robert van der Laan, der Ehemann des Huhns. Er war der neue Internist im Krankenhaus unserer Nachbarstadt, um die vierzig Jahre alt und einiges an Zentimetern größer als meine 1,82 Meter. Sein dunkles Kraushaar begann sich, freilich weniger weitgehend als vor Jahren bei mir, an den üblichen Stellen zu lichten. Er sah nicht nur sehr gut aus, sondern überrumpelte seine Mitmenschen auch mit seinem Charme und seiner lockeren Art. Äußerst zuvorkommend, bescheiden und witzig, wenngleich insgesamt nicht zu nett.
Während der Begrüßungsparty ärgerte ich mich zunächst über die reichlich übertriebene Fürsorge, die er seinen drei kleinen Kindern zukommen ließ. Bei jedem Pieps von ihnen ließ er alles und jedermann im Stich und schnellte, mit einem Gesichtsausdruck voller Fürsorge, zu ihnen hin. Gleichwohl gab ich mich rasch gewonnen. Seine ganze Art, sein Lachen, ja der ganze Kontakt mit ihm und seiner Chantal erfrischten uns von Anfang an wie eine warme Dusche.
Nach dem Umtrunk mit Wein, Bier und sonstigem Getränk, wobei wir im Garten sogar die griesgrämige Witwe Peeters wiederholt laut hatten lachen hören, waren Ellen und ich wie von selbst länger als die anderen Gäste geblieben. Die drei Sprösslinge von Chantal und Robert hingen vor dem Fernseher bei Zeichentrickfilmen, und wir duzten einander inzwischen mit einer Selbstverständlichkeit, als ob wir Jahre befreundet waren. Selbst der nicht unbeträchtliche Altersunterschied von etwa anderthalb Jahrzehnten schien wie weggeblasen. Unwillkürlich bekroch mich das Gefühl, mit Robert vielleicht eine Art jüngeren Bruder gewinnen zu können.
Es kam fast noch besser. Beim Abschied an der dunkelblauen Haustür des Ehepaars Van der Laan in beschwingter Stimmung, wozu auch die Grillen im Garten ihren Beitrag zirpten, war uns der Gesprächsstoff noch keineswegs ausgegangen. Auf der Schwelle nach draußen stellte ich zu guter Letzt eine Frage, mit der ich, ohne es zu ahnen, die Pforte zu einer rasanten Vertiefung der Beziehungen mit den neuen Nachbarn aufstieß.
„Sag mal, Robert, ich sehe neuerdings einen weißbehelmten Schnelligkeitsteufel auf einer hellblauen BMW durch unsere Gegend flitzen, der immer in eurer Garage verschwindet beziehungsweise dort herausspritzt. Habt ihr einen Untermieter, oder bist du das? Fahrt ihr normalerweise nicht einen roten Volkswagen?”
Robert lachte: „Ja, das bin ich. Den Passat benutzt meistens Chantal.”
„Ah, hab ich mir fast gedacht. Und was sagt sie zu deinen Künsten? Findet sie diese nicht viel zu gefährlich?” Ich dachte an Ellen, die immer noch den Tag segnete, an dem ich meine zweite und bis dato letzte Maschine verkauft hatte.
„Ganz im Gegenteil. Am liebsten würde sie sich ein eigenes Motorrad zulegen, vorzugsweise eine italienische Guzzi. Leider hat sie jedoch vor kurzem erneut die Führerscheinprüfung verpatzt. Ein Jammer.”
Ich war erstaunt. Wer hätte das gedacht?
„Aber dein Tempo in unserer Straße, Mann Gottes! Unsere Kinder wohnen ja längst außerhalb, aber gerade du als Arzt mit euren Dreikäsehochs solltest eigentlich doppelt vorsichtig sein.”
Robert sah mich an, als ob er darüber noch nie nachgedachte hatte, und rieb sich den Hinterkopf, seine Stirn in Falten. „Tja, da hast du wohl nicht ganz Unrecht, Fedor”, meinte er. „Halte mir jedoch zugute, dass ich mir diesen Wunschtraum erst kürzlich erfüllen konnte. Sozusagen als Belohnung nach Abschluss meiner Ausbildung zum Facharzt. Im Grunde stecke ich noch in meiner Euphoriephase. Und ich passe schon auf. Andererseits”, fuhr er fort, denn so schnell ließ er sich nicht in die Ecke treiben, „fährst du doch auch nicht gerade wie ein Opa durch die Landschaft.” Er gluckste. „Ja, ja, guck bloß nicht so erstaunt. Noch vorgestern musste Chantal auf den Bürgersteig zurückspringen, weil da ein silberner Volvo mit einem Affenzahn angeprescht kam. Und wer saß da hinterm Steuer, wenn sie sich nicht getäuscht hat? Genau, ein gewisser Herr Professor Doktor Lauenberg.”
Das saß. Also war sie es doch gewesen, die ich zu meinem Schreck beinahe mit dem rechten Kotflügel erwischt hatte. Allerdings in einem weniger auffälligem Kostüm. Ich versuchte schuldbewusst auszusehen. „Tut mir leid! Habe ich sie sehr erschreckt?”
Robert winkte ab. „Aber nein, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Sie ist ja selbst temperamentvoll genug. Hättest du übrigens nicht Lust, bei Gelegenheit bei mir hinten drauf mitzufahren? Ich sag dir, schon die Beschleunigung von so einem Apparat führt zu ungeahnten Hochgefühlen. Da hält kein Volvo, was sag ich, da hält kein Sportwagen mit, nicht mal ein Porsche.”
Dass ich laut losprustete, überraschte ihn sichtlich. Auch die beiden Damen, die gerade anderthalb Meter weiter halblaut Erziehungsfragen erörterten, drehten sich kurz zu uns herum.
„Doktor Van der Laan, wem sagen Sie das?”, lachte ich und schlug ihm auf die Schulter. „Mensch, ich fuhr schon Motorrad, da lagst du noch in den Windeln.”
Trotz der fortgeschrittenen Stunde war Robert sofort Feuer und Flamme. „Ehrlich? Erzähl! Darüber will ich mehr hören! Wann war das, wann hast du damit angefangen, was hast du alles erlebt?”
„Ich glaube, das würde uns jetzt zu weit führen”, erwiderte ich, „da komm ich nämlich schnell ins Schwärmen, wie Ellen bezeugen kann. Lieber ein andermal, dann zeig ich dir auch ein paar Fotos. Damals, Jahrzehnte her, war meine gute alte BMW 500 in Berlin unser einziges Transportmittel.”
So ganz gelang es mir jedoch nicht, es dabei bewenden lassen. Ich wiegte meinen Kopf hin und her und schnalzte genießerisch mit der Zunge.
„Mann, Mann, Mann, wenn du wüsstest, wie gern ich daran zurückdenke. Sonne und Wind, der um den Kopf spielt, eine Helmpflicht gab es damals ja noch nicht. Und dann in Jeans und offenem weißen Hemd gemächlich den Ku'damm in Berlin hoch, wo einem alle Mädchen nachgafften. Oder volle Pulle die Avus runter nach Wannsee und zurück, die Berliner Rennstrecke. Durchs Brandenburger Tor, lange bevor die Mauer kam. Herrgott, das waren Zeiten …“
Ich schloss einen Moment die Augen.
„Einmal, als ich Ellen knapp ein halbes Jahr kannte, bin ich sogar für eine Woche zu ihr nach Amsterdam gedonnert. Haben die Vopos vor und in ihren miesen Holzbaracken nicht schlecht gestaunt. Solch eine schwere Maschine mit dem riesigen schwarzsilbernen Büffeltank und dem Klang eines aufgemotzten Traktors, war Anfang der sechziger Jahre, als es noch keine japanischen Fabrikate gab, eine absolute Sensation. So zuvorkommend, ja respektvoll, auch auf der Rückfahrt, wurde ich nie wieder an der damaligen Zonengrenze abgefertigt.” Ich hielt kurz inne und sagte dann, mehr in mich selbst versunken: „Na ja, da war ich Anfang zwanzig. Nicht viel später wollte Ellen lieber trocken sitzen, und so legten wir uns den ersten Käfer zu. Auch nicht übel. Aber seitdem habe ich davon geträumt, wenigstens einmal in meinem Leben mit einem guten Freund durch Skandinavien zu touren.” Ich seufzte. Nun sollte ich aber wirklich gehen, Ellen und Chantal hatten ihren kleinen Small Talk auch schon länger eingestellt und hörten uns Männern geduldig zu.
Robert blickte mich sekundenlang schweigend an. Täuschte ich mich, oder tanzten da tausend Schalke in seinen Augen? Nein, das bildete ich mir bloß ein. Doch dann legte er eine Hand auf meine Schulter, grinste wie ein Spitzbube und sprach den Satz, der mir unvergesslich bleiben wird: „Fedor, I am your man - du hast ihn gefunden.”
„Wie bitte?”, fragte ich ungläubig.
„Mein voller Ernst”, bestätigte Robert. „Gib mir Bescheid, wann es losgehen soll.”
Ich starrte ihn an, immer noch fassungslos. Aber seine Miene zeigte keine Spur von Hintergedanken, nicht den geringsten Hinweis auf einen Scherz, den er sich vielleicht erlaubte. Mein Gott, der meinte, was er da sagte. Merkwürdig, dass man einem Menschen nach so kurzer Zeit nahezu blind vertrauen zu können meint. Ich tat es, und das kam wahrhaftig nicht häufig vor.
„Logisch”, brachte ich heraus, „selbstverständlich.” Dann wandte ich mich ab. Es klingt albern, und der reichlich getrunkene Wein zeigte sicherlich eine gewisse Wirkung, aber ich war so gerührt, dass mir tatsächlich ein paar Tränen in den Augen brannten. Ein magischer Moment.
Kapitel 2
Als ich das Thema am nächsten Morgen beim gemeinsamen Frühstück anschnitt, weil man ein Eisen schmieden soll, solange es heiß ist, schlug mir Ellens gesammelte Empörung entgegen.
„Ihr seid wohl beide nicht bei Trost? Familienväter als Nostalgie-Biker. Hat man sowas Verrücktes je gehört?”
„Sachte, sachte”, versuchte ich zu beschwichtigen, „was ist denn daran so verrückt? Man kann doch über alles ruhig miteinander reden.”
„Ruhig reden? Ich? Mit dir? Zwei erwachsene Männer wandern gemeinsam zurück in die Pubertät, wobei der eine noch mehr spinnt als der andere. Dich kenne ich ja, aber Robert? Dem hätte ich etwas mehr Grips zugetraut. Ein Mediziner!”
Sie arbeitete einen Schluck Tee hinunter, köpfte dann mit einem gleichermaßen wütenden wie elegant wirkenden Hieb ihr Ei und griff sich einen Löffel. Das Spiel ihrer langen, schlanken Finger lenkte mich einen Augenblick ab.
„Schätzchen, erstens kennst du Robert kaum, zweitens geht es nur um einen Plan, und drittens weiß ich im Moment nicht einmal, wie ich das Ganze finanzieren soll.”
Ellen stocherte mit dem Löffel in dem geköpften Ei herum.
„Ja, ja, wie gehabt. Du und deine Pläne, das kenn ich. Heute noch ein vages Vorhaben und morgen gekauft. Wenn wir eine neue Waschmaschine brauchen, hat der Herr kein Geld. Nur wenn es um deine Hobbys geht, ja, dann …”
„Was dann?”
„Dann hast du noch immer Mittel und Wege gefunden. Mit schlafwandlerischer Sicherheit, könnte man sagen.” Sie löffelte das letzte Stück Ei in ihren noch ungeschminkten Mund.
Frauen können im Laufe einer langen Ehe mehr als deutlich werden, selbst wenn diese, wenigstens aus der Sicht des Mannes, überwiegend harmonisch verlaufen ist. Ellen, die mir nicht zuletzt deswegen noch immer lieb und teuer war, hatte sich nicht als Ausnahme entpuppt. Sie bildete mit ihrem scharfen Verstand die stärkste Opposition in meinem Leben, und dagegen war solange wenig einzuwenden, wie mir Freiräume erhalten blieben. Denn wer anders, wenn nicht der Lebenspartner, sollte einem die ärgsten Flausen aus dem Kopf reden oder diese zumindest in einigermaßen zu verantwortende Bahnen lenken?
Ellen hatte einen unserer unfehlbaren prinzipiellen Streitpunkte angerührt, aber es schien mir im Moment strategisch wenig hilfreich, einen Streit vom Zaun zu brechen. Ihre graublauen Augen, die anders so zärtlich gucken konnten, sprühten Feuer. Wohl wissend, dass ich in der Regel gegen ihre meist rational einwandfreien Argumente nicht ankam, lenkte ich ein.
„Also gut, ich kann dich ja irgendwie verstehen. Trotzdem halte ich es nach wie vor für unfair, mich immer wieder an Zusammenhänge zu erinnern, über die wir nun einmal prinzipiell anders denken.”
„Genau. Im Kern denkst du zuerst an dich, dann kommt eine Weile gar nichts, und danach sind irgendwann die Kinder und zum Schluss ich an der Reihe.“
„Nun mach mal einen Punkt”, rief ich. „Wenn du an den Wohnwagen und das Keyboard denkst, beide …”
Sie unterbrach mich mit einer ungeduldigen Handbewegung.
„Ich weiß, ich weiß … hast du von deinem Honorar für das Stahl-AG-Buch bezahlt. Mein Gedächtnis brauchst du nicht aufzufrischen, mein Lieber. Das war Extraeinkommen, trotzdem …”
„Trotzdem was? Hab ich nicht neben meinem Tagesjob dafür jahrelang abends und an unzähligen Wochenenden wie ein Pferd geackert?”
„Zugegeben”, sagte sie, „das fiel dir nicht immer leicht. Aber erstens bist du nun mal kein Klempner, der seine Rohrzange um Punkt fünf nachmittags aus der Hand legen kann und zweitens kein Genie. Wer wollte denn unbedingt an der Uni glänzen und Professor werden? Du doch? Nein, nein, mein Lieber, ein weniger egoistischer, oder zumindest weniger egozentrischer Mann denkt zuallererst an lebensnotwendige Bedürfnisse der Familie und das ganz besonders, wenn sein Normaleinkommen dazu nicht ausreicht. Du nicht.”
So einfach war es meiner Meinung nach nicht. Ellen hatte zwar irgendwo nicht ganz unrecht, und dennoch. Durfte ich es ihr freilich verdenken, dass sie den immensen Berg nicht zu ermessen vermochte, der vor dem Autor am Anfang einer wissenschaftlichen Buchproduktion in den Himmel ragt?
Wer außer dem Esel, der sich die damit verbundenen Konsequenzen freiwillig auferlegt, kennt neben den angenehmen Wegstrecken unterwegs zum Gipfel die weitaus zahlreicheren knochenharten Pisten, wo ihn ausschließlich der Gedanke an sich selbst versprochene saftige Mohrrüben weiter hinaufstolpern lässt?
Oder hält den fast Verdurstenden, das Ziel noch lange nicht in Sicht, in staubtrockener Wüste etwa der Gedanke an den fälligen neuen Geschirrspüler auf den Beinen? Keine Spur, da muss neben einem schaumgekrönten Bier schon etwas mehr in der Ferne winken, wenn sich jemand derartige Strapazen wiederholt aufzubürden bereit ist. Klar, dass wahre Größe beweist, wer sich danach eben doch mit seinen Lieben zum elektronischen Fachhandel oder in einen teuren Möbelladen begibt. Heilige Einfalt. So sollte es vielleicht sein, doch so viel Selbstverleugnung konnte mir seit jeher gestohlen bleiben. Sonst wäre mein erstes Buch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das letzte geblieben. So einfach war das! Aus meiner Perspektive gesehen!
Es ergab indes wenig Sinn, sich weiter im Kreise zu drehen. Ich nahm mir vor, Skandinavien einstweilen auf Eis zu legen und das gebrauchte Motorrad, das ich mir zu einem günstigeren Zeitpunkt zweifellos wieder zulegen würde, vorerst bei seinem jetzigen Eigentümer zu belassen. Doch da traf die Opposition im Haus mit einem weiteren Argument voll ins Schwarze.
„Würdest du dich übrigens liebenswürdigerweise daran erinnern, dass du Erik vor kaum zwei Jahren mit aller Gewalt davon abbringen wolltest, sich von seinem Spargeld ein Moped zu kaufen? Warst du es nicht, dem schon der Gedanke daran den Schlaf raubte?”
„Ja sicher, aber…”
„Und hast du damals nicht für einen Tag eine BMW gemietet, um deinem Sohn zu veranschaulichen, wie aberwitzig gefährlich Motorradfahrer auf ihren zwei lächerlich schmalen Reifen leben? Wie schnell gerade sie im modernen Straßenverkehr übersehen und in schlimmste Unfälle verwickelt werden? Wer hat denn die gemietete Maschine schon nach einem halben Tag zurückgebracht, weil es ihm mit Erik hinten drauf zu brenzlig wurde, na?”
„Ich widerspreche dir ja nicht. Trotzdem hat Erik sich später diese dämliche Puch gekauft. Auch zu meinem Leidwesen, und den Dickkopf hat er nicht von mir. Aber das tut jetzt nichts zur Sache.”
„Was ich meine ist, dass du, sowie es um dein persönliches Vergnügen geht, wieder mal mit verschiedenen Maßstäben misst. Was gilt denn nun? Hast du einen unsichtbaren Panzer um dich, der dich vor allen Gefahren schützt und andere nicht?”
„Na immerhin bin ich erfahrener, und fahre ich defensiv.”
Ich hätte wissen müssen, dass ich ihrem Hohn eine Steilvorlage schenkte.
„Dass ich nicht lache, defensiv? Ausgerechnet du, das selbsternannte Vorbild aller Asse unter den Autofahrern. Wenn man sich, so wie ich, regelmäßig dein sinnloses Fluchen über Idioten, Einzeller und linksfahrende Schnecken im Verkehr anhören muss, die von dir auf der Autobahn manchmal sogar rechts überholt werden, was bekanntlich strengstens verboten ist, dann stelle ich mir unter defensiver Fahrweise etwas ganz anderes vor. Nee, Verehrtester, ein vernünftiger Familienvater begibt sich nicht unnötig in derart riskante Situationen. Ein Glück, dass du in deiner wirtschaftswissenschaftlichen Theorie, deren praktischer Nutzen sich übrigens keinem normal denkenden Menschen erschließt, offenbar einigermaßen sachlich zu argumentieren verstehst, sonst wärst du längst in der Mensa beim Abwaschdienst gelandet. Oder in der Universitätsgärtnerei.”
Ellen konnte die Dinge wunderbar auf den Punkt bringen und als Zugabe mit einem Löffel Mostrich würzen. In ihrer Erregung sah sie hinreißend aus. Ich hätte sie am liebsten auf der Stelle ins Schlafzimmer bugsiert, doch befürchtete ich, dass meine Chancen wegen der entstandenen Stimmung bei nullkommanull lagen. Ich holte tief Atem.
„Willst du mir etwa verbieten, mit Robert durch Skandinavien zu touren? Wie lange habe ich von einer solchen Reise geträumt, zu der ich dich leider nie überreden konnte.”
Jetzt zeigte ihr Gesicht ehrliches Erstaunen. „Verbieten?”, wiederholte sie. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Wir haben uns nichts zu verbieten, und noch weniger denke ich daran, dich durch irgendwelche Absprachen einzuzwängen, an die du dich letzten Endes doch nicht hältst.”
“Na also”, sagte ich, „das ist zumindest ein Anfang.”
„Oho, versteh mich bitte nicht falsch. Obwohl ich dir deine Reise an sich durchaus gönne, bin und bleibe ich schon wegen unserer Kinder prinzipiell dagegen. Zu zweit, so wie früher, hätte ich meine Abneigung gegen die deprimierende Eintönigkeit in den nordischen Weihnachtsbaumwäldern noch überwinden können und wäre ich vielleicht mitgekommen. Als Mutter aber … nein.”
Ich gab wider besseres Wissen nicht auf.
„Moment, in Schweden gibt es auch wunderschöne Seenplatten und in Norwegen die Fjorde, wo man sich ganz klein fühlt.”
Es waren abermals die falschen Argumente.
„Nun fang bloß noch von Elfen und Trollen an”, schnaubte sie mich an, „du weißt genau, was ich meine. Ich kenne dich und akzeptiere, dass du früher oder später fahren wirst. Dem sei so. Aber hoffentlich ist dir ebenfalls klar, dass, wenn etwas passieren sollte, ich nicht zu deiner Bestattung erscheinen werde.”
Ich spürte, dass es ihr im Moment bitterernst war, machte mir aber deswegen keine allzu großen Sorgen.
Sie, die treueste aller Frauen, stand zu ihrem Ehegelöbnis wie eine Mutter zu ihren Kindern, in guten wie in schlechten Tagen, und würde zweifellos im Fall der Fälle meinen Rollstuhl mit bisweilen wohl spitzer Zunge, aber ansonsten klaglos durch die Gegend schieben.
Ich sagte: „Hauptsache, du lässt mich in meiner Todesanzeige als romantischen Individualisten und zufriedenen Menschen fortleben.”
Da musste sie lachen. Ich nahm sie in meine Arme, streichelte sanft ihren Rücken von den Schulterblättern abwärts, wo ihr Po begann. Wir küssten uns. Erst auf den Mund, dann gegenseitig in die Halsbeuge, was mich betrifft der Inbegriff liebender Verbundenheit. Die Entscheidung war gefallen, die Stimmung zu meinen Gunsten gekippt. Augenblicke danach landeten wir doch noch im Schlafzimmer.
In den darauffolgenden Monaten fiel kein Wort mehr über Skandinavien. Wir gingen jeder unserer Arbeit nach, liebten uns, stritten uns, liebten uns. Nur abends zu später Stunde studierte ich im Internet und in gedruckten Medien gezielt den Markt für gebrauchte Motorräder, dabei tatkräftig unterstützt von Robert, der mich zu vielversprechenden Adressen kutschierte. Auch Chantal bedachte mich ab und zu mit Anzeigen, die sie aus den Tageszeitungen schnippelte. Es brachte alles nichts. Die wenigen Maschinen, die innerhalb meiner Preisvorstellungen angeboten wurden, denn mehr als fünftausend Gulden konnte und wollte ich nicht zusammenkratzen, befanden sich in jämmerlichem Zustand. Ausgeleiert, verrostet und zerkratzt, wenig mehr als fahrende Schrotthaufen. Was in Bezug auf Aussehen, Fahrtüchtigkeit und Preis einigermaßen zu passen schien, entsprach vom Typ und der Ausstattung her nicht meinen Wünschen.
Neumodische Motoren mit Wasserkühlung kamen von vornherein nicht in Frage. Für die modernen windschnittigen Boxer mit allen Schikanen, mehreren Scheibenbremsen sowie einem überdimensionierten Auspuffrohr hätte ich mehr als das Doppelte des geplanten Budgets berappen müssen. Sie schieden ohnehin aus, denn einen Hauch Nostalgie wollte ich mir auf keinen Fall versagen. Also mussten es, wie gehabt, nicht nur zwei Zylinder, sondern auch zwei Auspuffrohre sein. Die gab es auf modernen Maschinen nicht mehr.
Fündig wurden wir erst gut ein Jahr später, nachdem Ellen den entscheidenden Tipp gegeben hatte. Unsere vergeblichen Bemühungen waren ihr natürlich keineswegs entgangen.
„Warum sprichst du nicht mal mit dem BMW-Händler, von dem du damals die famose Halbtagesmaschine für Erik und dich gemietet hast? Vielleicht kann der weiterhelfen.”
Meine liebe Frau. Einmal auf meine Linie eingeschwenkt, gab es keine weiteren Diskussionen. Von nun an verhielt sie sich loyal, ja, ausgesprochen kooperativ. Robert und ich fuhren am darauffolgenden Sonnabendmittag in das bewusste Brabanter Städtchen nahe der belgischen Grenze. Ich trug meine Wünsche vor. Der Händler, ein James-Dean-Typ Ende dreißig in braunen Lederjeans, der außer seiner Frau und ein paar Monteuren sinnigerweise einen vollbärtigen Ex-Biker im Rollstuhl als Hauptverkaufskraft beschäftigte, lächelte verständnisvoll. Er erinnerte sich noch gut an Erik und mich.
„Ich wusste, dass du wiederkommen würdest. Wer einmal Blut geleckt …”
Dann jedoch winkte er ab. „Tut mir ausgesprochen leid, Jungs. Ihr seht ja, ich hab den ganzen Laden voller neuer Modelle. Alle in den gängigen Farben. Nur die schwarze R 50 dahinten in der Ecke, mit Beiwagen, ist ein Klassiker, steht aber nicht zum Verkauf.”
„Ja, toll, stach uns gleich in die Augen! Was wäre denn, rein interessehalber, ihr theoretischer Verkaufswert?”, fragte ich.
„Unbezahlbar!!! Ich darf gar nicht überschlagen, wieviel Zeit wir in die Restauration gesteckt haben. Das rechnet sich ausschließlich bei konsequenter Benutzung betrieblicher Leerzeiten. Wärst du denn an einer ähnlichen Maschine interessiert, soll ich freibleibend Ausschau halten?”
„Nein, nein, das nicht, ich habe zwar mit achtzehn auf einem Gespann gelernt, und das fuhr sich tadellos. Nur wenn der Beiwagen in den Kurven manchmal in die Luft stieg, ging mir schon die Muffe. Jetzt soll es aber eine Solomaschine sein. Sag mal, Mark, liege ich denn überhaupt mit dem einigermaßen richtig, was ich mir in finanzieller Hinsicht so vorstelle, also um die fünf Tausender herum?”
Ich sagte einfach Du, denn Biker in Holland duzen einander wie eigentlich überall. Mark wiegte seinen früh ergrauten Kopf hin und her.
„Das dürfte schwer werden, obwohl nicht unmöglich. Vor einigen Wochen hätte ich dir zum Beispiel eine super gepflegte und technisch einwandfreie R90S für sechstausendfünfhundert Gulden anbieten können. Nicht ausgesprochen billig, aber diese schnellen Maschinen sind nun einmal unheimlich gefragt.”
„Welche Farbe?”
„Anthrazitgold.”
„Danke freundlichst, da brauche ich mich nicht zu ärgern, nee, nicht gerade mein Geschmack.”
Mark lachte. „Wenn es weiter nichts wäre, mein Guter. Für ein paar Hunderter mehr hätten wir sie dir in jeder gewünschten Farbe geliefert. Tank, Schutzbleche und Hubraumschilder sind im Nu übergespritzt. Der Rahmen ist ohnehin Standard schwarz. Und danach sieht so ein Apparat aus wie neu.”
„Tatsächlich?”
„Kein Problem!”
„Mist”, sagte ich.
„Du sagst es”, sagte Robert.
Wir hingen noch eine Weile im Laden herum und bewunderten die zum Teil technisch eindrucksvollen, aber mehr oder weniger neuwertigen und deshalb für mich zu kostspieligen Gebrauchtkräder, die dort metallic-grün, rot oder blau auf gutbetuchte Kunden harrten. Als wir davon genug hatten und Anstalten machten, uns auf die Heimfahrt zu begeben, rief Mark uns zurück.
„Wartet mal, mir fiel gerade noch was ein. Neulich erwähnte ein Kunde, der sich für seinen Urlaub eine K 1100 RS zugelegt hat, dass er vielleicht seinen alten Schlitten abgeben will, eine 1978er R100, wenn ich mich nicht irre. Gut in Schuss. Unter Umständen wäre die was für dich.”
Ich war sofort Feuer und Flamme. „Und wieviel müsste ich dafür in etwa ausspucken?”
„Ist, denk ich mal, genau dein Bier, nicht viel mehr und nicht viel weniger. Bei mir wäre sie teurer.”
„Versteht sich. Kannst du mir eine Telefonnummer geben?”
„Na klar, hier, hat meine Frau, die gute Seele, schon notiert, die hört alles. Der besagte Kunde, Lehrer wie du, wohnt ganz in der Nähe. Ich würde in ein bis zwei Wochen mal versuchen, ihn telefonisch zu erreichen, dann ist er zurück und erfährst du mehr.”
„Mach ich. Dank dir herzlich”, sagte ich und schüttelte ihm die Hand. „Wer weiß, vielleicht klappt es ja.”
Wir winkten seiner Frau und dem Rollstuhlbart zum Abschied zu und marschierten Richtung Ausgang.
„Vergiss nicht, mich auf dem Laufenden zu halten”, rief Mark mir hinterher.
„Mach ich. Tschüss, wir sehen uns.”
Bei seinem um die Ecke abgestellten Motorrad angekommen, schlug Robert mir auf den Rücken. Er strahlte.
„Mensch, Fedor, möglicherweise hat unsere Suche bald ein Ende. Klingt alles in allem doch nicht schlecht, oder?”
„Sehe ich genauso. Verdammt anständig von Mark. Hoffentlich geht die Sache so über die Bühne und es kommt nicht noch was dazwischen.”
„Wird schon nicht. Bin gespannt, wie Chantal reagiert”, sagte Robert.
„Meinst du nicht, sie will mitkommen, wenn es denn irgendwann tatsächlich losgeht?”
„Nee, Skandinavien sagt ihr wenig. Sie fährt zwar gern bei mir hintendrauf mit, würde uns aber die Zweisamkeit im hohen Norden gönnen. Nur Irland, da darf ich ausschließlich mit ihr hinfahren, habe ich ihr versprechen müssen. Die Insel hat sie in Gedanken nämlich für uns reserviert.”
„Wart ihr denn schon mal dort?”
„Ja, mit dem Auto. Sie verliebte sich augenblicklich in die besondere Landschaft, so herb und zugleich romantisch. Da will sie unbedingt auf dem Motorrad hin.”
„Gab es schon konkrete Pläne?”
„Solange sie mit ihrem Führerschein beschäftigt war, ja. Sie hatte sich bereits eine Guzzi ausgesucht, die Marke und keine andere musste es sein.”
„Richtig, hast du schon mal erwähnt. Na, hoffentlich schafft sie beim nächsten Anlauf ihren Führerschein.”
Robert zuckte mit den Achseln, bevor er mir den Reservehelm reichte und sich seinen eigenen aufstülpte.
Ich kletterte auf den Soziussitz, und ab ging die Post. An seinem Fahrstil konnte man merken, dass er bestens gelaunt war. Er legte uns viel rasanter als auf der Hinfahrt in die Kurven. Straßenbäume und Dörfer flogen nur so vorbei. In einem winzigen Örtchen zeterten sich vor uns Hühner in rettendes Buschwerk. Empörte Bauern starrten uns nach. Schon nach knapp vierzig Minuten Fahrt waren wir wieder zu Hause angelangt.
Wenn ein Traum in greifbare Nähe rückt, rollen einem nicht selten Steine über den Weg, die alles wieder in Frage stellen. Erst schien der bewusste Lehrer mit seiner Frau wochenlang wie vom Erdboden verschluckt. Unerreichbar. Kein Anrufbeantworter. Nichts. Dann gab unser Auto seinen Geist auf. Ein anderer gebrauchter Volvo musste her. Ich bevorzugte die Marke seit Jahrzehnten, weil ich aus Erfahrung wusste, dass man mit ein bisschen Glück auch älteren Schwedenkutschen der ausgelaufenen 240er Serie für wenig Geld noch jahrelang trauen konnte. Schließlich überfiel mich unser Zahnarzt mit einer Hiobsbotschaft, nachdem er mein Gebiss eingehend gemustert, von Zahnstein gereinigt und geringfügigen Schaden an zwei Plomben repariert hatte.
„Unter Ihrer Brücke oben links haben Sie eine nette kleine Zyste. Hier … schauen Sie mal auf den Monitor. Man sieht deutlich den Abfuhrkanal, aber keine nennenswerte Verdickung. Das bedeutet, dass Sie im Moment keine oder kaum Beschwerden haben. Tut das weh?”
Er drückte auf eine Art Knorpel im Zahnfleisch.
„Nicht der Rede wert”, mümmelte ich. Der Latexhandschuh um seine halbe Hand in meinem aufgesperrten Mund schmeckte nach Desinfektion.
„Sehr gut. Ausgezeichnet! Dann schlage ich vor, dass wir die Brücke kurz entfernen, um zu sehen …”
„Jetzt gleich?”, erschrak ich.
„Selbstverständlich, wann denn sonst? Denn sollte die Entzündung sich plötzlich ausbreiten, was früher oder später der Fall sein wird, bekommen Sie eine Backe mit Schmerzen, wie Sie sie noch nicht erlebt haben.”
Ich resignierte. „Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können.”
Das Ganze lief hinaus auf ein Reparaturangebot von dreitausendeinhundert Gulden, an dem sich meine Krankenzusatzversicherung mit kümmerlichen zehn Prozent beteiligen würde. Wie sich ergab, hatte der Entzündungsprozess einen der beiden abgeschliffenen Zähne, die meiner erst vor zwei Jahren eingesetzten Dreier-Brücke Halt gaben, weitgehend aufgeweicht. Der Zahn einschließlich Wurzel musste raus und eine neue vierteilige Prothese rein. Zum Glück befand ich mich in den Händen eines dentalen Künstlers, mit dem man von Mann zu Mann reden konnte. Den üblichen Mitleidbonus, den ich als privatversicherter Patient bei Ärzten normalerweise zu erhalten erhoffte, indem ich mich bescheiden gekleidet in die Praxis begab und dem Patientengespräch Hinweise auf akute finanzielle Sorgen beimischte, hatte er vermutlich bereits abgezogen. Er kannte Lied und Sänger inzwischen. Also mussten diesmal kräftigere Erwägungen und Fragen her. Was bekomme ich für die alte, fast nagelneue Brücke von der Zahntechnik zurück, gab es da einen Restgoldwert? Wie viel kostete die Behandlung ohne Quittung?
Nach fünf Minuten eingehenden Schacherns, dessen sich zwei Pferdehändler nicht zu schämen gebraucht hätten, einigten wir uns auf zweitausendvierhundert Gulden all-inclusive. Keine unbeachtliche Ermäßigung, aber in Sachen Motorrad war ich nahe daran aufzugeben. Skandinavien sollte offenbar nicht sein.
Dass meine Reisepläne gleichwohl keinen stillen Tod starben, verdankte ich abermals Ellen. Sie verfügte über ein kleines, in Obligationen und Aktien angelegtes Erbvermögen mütterlicherseits, das sie im Bedarfsfall zugunsten unserer Kinder oder dringender Ausgaben am oder im Haus einsetzte. Sie schoss mir den Großteil der unerwarteten zahnärztlichen Ausgaben vor, wodurch sich das Tor nach Skandinavien wieder öffnete. Tage darauf gelang es uns, einen Besichtigungstermin bei dem Biker-Lehrer an der belgischen Grenze zu vereinbaren.
Robert verstand auf Anhieb, dass ich über einen eventuellen Kaufvertrag zusammen mit Ellen beschließen wollte.
„Wenn es denn schon sein muss”, hatte Ellen nämlich beschieden, „dann soll es zumindest keine mit allerlei Mätzchen aufgedonnerte Maschine sein, sondern ein ehrliches, sauberes Motorrad, auf dem du dich sehen lassen kannst.”
„Als ob ich mich auf einen bonbonfarbenen Fahrsessel mit Schleifen setzen würde.”
„Bei allem Respekt, Fedor, in Geschmacksfragen bist du mit meinem Rat immer besser gefahren. Jeder kann zwar behaupten, dass er nicht farbenblind ist, aber manchmal bietet dein Äußeres wirklich Anlass zu Zweifeln.”
Per Bus am Zielort angekommen erwartete uns eine angenehme Überraschung. Der Lehrer und seine Frau, die uns empfingen, als ob wir alte Freunde waren, erwiesen sich als weitgereiste Gesprächspartner, mit denen wir erst nach einer guten Stunde mit Kaffee und Kuchen zur Sache kamen. Sie verstanden meine Vorliebe für Boxermotoren, doch schwärmten seit ihrer Tour durch die Alpenländer von den Vorzügen eines wassergekühlten Vierzylinders.
„Diese unerhörte Laufruhe. Keine Vibrationen. Du steigst auch nach vielen Stunden frisch wie ein Hühnchen aus dem Sattel.”
„Also mir klingen die Dinger immer wie wild gewordene Kaffeemahlmaschinen in den Ohren”, fuhr es mir heraus. Zum Glück lachten beide.
„Ach was, daran hat man sich im Nu gewöhnt, und dann stört es überhaupt nicht mehr. Kommt mit und seht euch unseren Stolz mal an.”
Wir begaben uns in die Garage, wo vor einem hässlichen metallic-giftgrünen Golf ein wahres Monstrum von einem Motorrad stand. Riesenhaft, in protzigem Knallrot mit nahezu jedem erdenklichen Zubehör einschließlich drei Koffern, Radio, Lautsprechern und CD-Spieler. Unverständlich, dass Faxgerät und Computer fehlten. Ellen und ich sahen uns verstohlen an. Ein Alptraum aus Stahl und Kunststoff auf Gussrädern!
„Toll”, sagte Ellen höflich, „und was kostet so ein Supergerät?”
„Wir hatten Glück, dass Mark uns direkt mit dem Voreigentümer unterhandeln ließ. Knapp zwanzigtausend Gulden. Mit allen Extras.”
Sie blickten stolz wie Schneekönige drein.
„Zwanzigtausend?”, fragte ich ungläubig. Soviel hätte ich nicht einmal für ein fabrikneues Auto ausgeben wollen. Ich äußerte mich natürlich verhaltener. „Donnerwetter, das will erst einmal erspart sein. Also alles, was recht ist, das wäre mir denn doch eine Nummer zu groß.”
„Ihr wollt ja auch nicht jedes Jahr zusammen auf dem Bike in den Urlaub fahren, wie ich verstanden habe. In unserer Situation dagegen ist Bequemlichkeit und Sicherheit oberstes Gebot.”
„Einverstanden”, reagierte ich mit einer gewissen Erleichterung, weil wir so das rote Ungeheuer vielleicht abhaken konnten. Mein Blick ging in die hinteren Ecken der Garage, wo ich den Boxer vermutete. Der Lehrer bemerkte es.
„Nee, Fedor, da müssen wir schon in den Schuppen.” Er schmunzelte. „Hier entlang.”
Wir folgten ihm an dem Golf vorbei durch einen angrenzenden langen Gang, an dessen Ende er eine nicht abgeschlossene weiße Tür öffnete. Ich erschrak.
In dem völlig verwahrlosten riesigen Garten gammelte zwischen meterhohem Unkraut und schnittbedürftigen alten Obstbäumen ein Holzschuppen vor sich hin, der vermuten ließ, dass sein Erbauer zu Zeiten gelebt hatte, als Wilhelm II. noch auf seinem Gut im holländischen Exil Bäume fällte. Das Einzige, was ich mir in diesem Haufen Brennholz in Sachen Motorrad vorstellen konnte, war eine Rostlaube auf brüchigen platten Reifen, in jedem Fall jedoch alles andere als ein fahrbarer Untersatz.
Als ob er Gedanken lesen konnte, sagte der Lehrer, während wir uns an dicken, hohen Brennnesseln vorbeischlängelten: „Keine Sorge, den Boxer habe ich erst nach unserem letzten Urlaub dort im Schuppen untergebracht. Stand vorher immer in der Garage. Entschuldigt das grüne Chaos hier, wir sind nebenberuflich im Sozialsektor tätig und haben leider zu wenig Zeit für den Garten.”
Wir näherten uns dem Schuppen. Er war offen, sein Inneres starrte uns schummrig an. Der Lehrer fummelte an einem Schalter herum, woraufhin eine Neonleuchte das Innere in gleißendes Licht tauchte.
Mir stockte der Atem, denn was ich erblickte, übertraf meine kühnsten Erwartungen. Da stand sie, inmitten von alten Holzkisten, halb von Lumpen bedeckten verbeulten Farbeimern und verrosteten Fahrrädern: eine Königin im Armenhaus. Ein schwarzsilbern schimmerndes Gedicht auf zwei verchromten Speichenrädern. Jawohl, Speichen statt Guss. Genau, aber wirklich haargenau die Maschine meiner Wünsche. Mit den für BMW-Boxer typischen, zur Fahrtrichtung quer gestellten beiden Zylindern, alles ohne jeden Schnickschnack.
Ich trat verzückt näher. Meine Hand fuhr sanft über die geribbelte schwarze Sitzbank und den Benzintank, verweilte am Lenker und streichelte dann die Scheinwerferrundungen. Es war fast ein erotisches Erlebnis, denn alles war da: die auf jeder Seite unten montierten Auspuffrohre sowie Sturzbügel zum Schutz der beiderseitig aus dem gewaltigen Motorblock ragenden Zylinderköpfe, der Kickstarter nebst elektrischem Anlasser, rundum die formschönen schwarzrotsilbernen Typenschilder R 100 R und nicht zu vergessen die berühmte, am Rahmen eingeklickte kurze Luftpumpe, die zur Standardausrüstung der damaligen Serien gehörte.
Ich brauchte Ellen nicht anzuschauen, um zu wissen, dass diese fast zwei Jahrzehnte alte und zugleich moderne Ausgabe meiner klassischen BMW aus den fünfziger Jahren auch ihren ästhetischen Vorstellungen genügte. Meine Suche war zu Ende. Zu zwei passenden Seitenkoffern und Nebelscheinwerfern würde mir Mark oder der Zubehörhandel verhelfen können.
Das Lehrerehepaar hatte mich schweigend gewähren lassen. Beide lächelten, als ich mich umdrehte.
„Es bleibt doch bei den fünftausendfünfhundert Gulden, Hans?