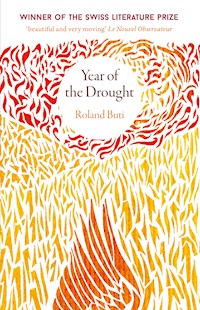Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Man findet hier die feinen Beobachtungen wieder, die in 'Das Flirren am Horizont' so sehr berührt haben.“ (Livre Hebdo) – Roland Butis neuer Roman über das Leben in allen Facetten Das beschauliche Leben des Landschaftsgärtners Carlo gerät in Aufruhr. Seine Frau hat ihn verlassen, die Tochter studiert jetzt in London. Agon, sein Hilfsgärtner aus dem Kosovo, eine sensible Seele in einem massigen Körper, wird aus heiterem Himmel zusammengeschlagen. Und dann ist plötzlich Carlos demente Mutter verschwunden. Gemeinsam mit Agon macht er sich auf die Suche und entdeckt nicht nur die Natur und die Menschen um ihn herum neu, sondern kommt in einem Grandhotel am Berg der ungeahnt glamourösen Vergangenheit seiner Mutter während des Zweiten Weltkriegs auf die Spur … Wir sind Roland Butis Figuren ganz nah. Ihre Gesichter, ihre Bewegungen werden uns vertraut. Wir leben und fühlen mit ihnen. Das ist Butis große Kunst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Das beschauliche Leben des Landschaftsgärtners Carlo gerät in Aufruhr. Seine Frau hat ihn verlassen, die Tochter studiert jetzt in London. Agon, sein Hilfsgärtner aus dem Kosovo, eine sensible Seele in einem massigen Körper, wird aus heiterem Himmel zusammengeschlagen. Und dann ist plötzlich Carlos demente Mutter verschwunden. Gemeinsam mit Agon macht er sich auf die Suche und entdeckt nicht nur die Natur und die Menschen um ihn herum neu, sondern kommt in einem Grandhotel am Berg der ungeahnt glamourösen Vergangenheit seiner Mutter während des Zweiten Weltkriegs auf die Spur … Wir kommen Roland Butis Figuren ganz nah. Ihre Gesichter, ihre Bewegungen werden uns vertraut. Wir leben und fühlen mit ihnen. Das ist Butis große Kunst.
Roland Buti
Das Leben ist ein wilder Garten
Roman
Aus dem Französischen von Marlies Ruß
Paul Zsolnay Verlag
Für Caroline
»Mir graut vor dem zukünftigen Termitenhaufen.
Und ihre Robotertugend widert mich an.
Ich jedenfalls war zum Gärtner geschaffen.«
Antoine de Saint-Exupéry, Brief an Pierre Dalloz, 30. Juli 1944
Die Eile, mit der ich die Wohnung verließ, die Treppen hinunterrannte, dann im Laufschritt die mit Fahrrädern und Kinderwägen vollgestopfte Eingangshalle des Wohnhauses durchquerte, ließ mich unwillkürlich an die überstürzte Flucht eines Eindringlings denken, den die Morgendämmerung überrascht hat.
Wir waren in dieses Mietshaus gezogen, weil es nur eine knappe Viertelstunde zu Fuß vom Krankenhaus entfernt lag, wo Ana im Schichtdienst arbeitete.
Sie hatte einiges mitgenommen, was ich nicht ersetzt hatte. Ich versuchte, mir in Erinnerung zu rufen, was vor ihrem Auszug hier oder da gestanden hatte, im Regal, auf dem Fenstersims, im Stauraum zwischen dem Gasherd und dem Unterschrank mit den Töpfen, und konnte ohne Schwierigkeiten das Dekor wieder zusammensetzen. Aber das Fehlen des Toasters, der langen Kochlöffelstiele in dem Steinkrug, des Wasserkochers ließ das Verbliebene ein wenig lächerlich erscheinen.
Die Proportionen der Küche hatten sich unter dem Einfluss eines sonderbaren Phänomens verändert. Sämtliche Geräusche darin kamen mir deutlich lauter vor. Zwischen den Gegenständen war ein ungewohnter Abstand eingezogen, als hätte sich der Ort, an dem wir sechzehn Jahre lang zweimal am Tag zusammen gegessen hatten, mit der Zeit ausgeleiert.
Mein Frühstück schlang ich jetzt im Penalty hinunter. Das alte Café des Viertels war vor einigen Jahren renoviert worden, um neue Kundschaft anzulocken, hatte jedoch seinen Namen behalten, Reminiszenz an die Zeiten, als die Mannschaft der Stadt noch in der ersten Liga spielte. Die Menschen schmoren ja gerne im eigenen Saft, aber die Leute, die sich diese Neugestaltung ausgedacht hatten, mussten schon eine besonders verschrumpelte Seele besitzen. Die Stühle aus Holzimitat, die kunstledernen Polster in Zartlila, das Maskottchen über dem Eingangsschild — alles wirkte schon jetzt alt und abgenutzt, und ich musste mich anstrengen, um in meinem morgendlichen Tran nicht wegzudämmern.
Ich war mit Agon hier verabredet, doch heute Morgen kam er zu spät.
Ich riss mich zusammen und gab mir Mühe, nur ja keinerlei Gemeinsamkeiten mit der Klientel an den umliegenden Tischen aufkommen zu lassen: von der Misslichkeit der Umstände gebeugte Alte, die in einer Atmosphäre wie in einem Wartezimmer gedämpfte Gespräche führten oder abwesend in der Zeitung lasen. Alle schienen den Augenblick zu fürchten, da der Arzt hereinkommen und ihnen die Brüchigkeit ihrer irdischen Existenz bestätigen werde.
Fahles Licht trübte die vom urbanen Inventar verstopfte Straße jenseits der Scheibe. Das Bushäuschen mit Glasdach, die roten und gelben Schikanen zur Verlangsamung des Verkehrs und die in der milchigen Feuchtigkeit verzerrten Arme der Straßenlaternen: das ganze Viertel wirkte wie zusammengefaltet — auch kein ausgesprochen lebendiger Anblick.
Ein paar Monate vorher hatte ich im National Geographic ein Interview mit einem Biologen gelesen, der die Ansicht vertrat, dass die Natur deshalb so unendlich vielfältig sei, weil jede Art ihren eigenen Regeln folgte. Vielleicht gilt das für die Menschen genauso? Ich liebe es, bei meiner Arbeit in den Gärten und Parks den Himmel über mir zu spüren. Wenn ich in einem Beet Unkraut gejätet, einen Rasen gemäht oder eine Hecke geschnitten habe und das Sonnenlicht jedes Detail plastisch hervortreten lässt, halte ich oft inne und betrachte mein Werk. Wenn ich hingegen in geschlossenen Räumen bin, habe ich oft den Eindruck, dass die Dinge nicht am richtigen Platz sind.
»Du erinnerst mich an einen Sträfling, der lebenslänglich seine Zelle nicht mehr verlassen darf«, hatte Ana eines Morgens mit zerknittertem Gesicht und zerzausten Haaren zu mir gesagt.
Ich verbrachte immer mehr Zeit damit, aus dem Fenster zu schauen: aus dem Küchenfenster, wenn ich in der Küche war, aus dem Wohnzimmerfenster, wenn ich im Wohnzimmer war, aus dem Schlafzimmerfenster, wenn ich im Schlafzimmer war. »Ist das ein Vorwurf?«, hatte ich gefragt. »Nein, ich mag zerstreute Männer. Die nehmen sich selbst nicht so wichtig. Und sind nicht so langweilig wie der Durchschnitt.« Eine sehr taktvolle Antwort, fand ich damals.
Doch sie erzählte mir nicht mehr von ihrem Arbeitsalltag, von den zufälligen Begebenheiten im Dienst, den Patienten, den Ärzten, die ihr und den anderen Schwestern wohlwollend oder arrogant begegneten. Wenn ich sie abends schlafend vorfand, erschöpft von den wochenlangen Schichtdiensten, dann roch sie nach Krankenhaus, eine hartnäckige Ausdünstung, die sich mit einer Dusche nicht abwaschen ließ. Ich drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Obwohl ihr Kopf in dem weichen Kissen lag, waren ihre Züge angespannt, als müsse sie sich regelrecht anstrengen, um nicht aufzuwachen.
Seit einigen Monaten erzählte sie mir nur noch von Todesfällen. Als wir das letzte Mal miteinander geschlafen hatten, hatte sie direkt danach gesagt: »Das habe ich jetzt dringend gebraucht. Gestern Nachmittag ist Jela gestorben.« Ich erinnere mich so genau daran, weil mir in diesen Moment aufging, dass wir nicht zusammenbleiben würden.
Sie lag mit gespreizten Beinen auf dem Bett, die zerwühlten Laken zwischen den Füßen. Wie sich ihr Haar nachts mit dieser unerhörten Fülle entfaltete, hatte mich schon immer fasziniert. Am Morgen hatte ich stets das Gefühl, sie so zu sehen, wie sie sein sollte. Und damals glaubte ich noch, dass dieser geheime Teil ihres Lebens, der wahrhaftigste vielleicht, nur mir gehörte.
Jela lag seit einem Motorroller-Unfall im Koma. Sie war so alt wie unsere Tochter Mina.
Ich ging in die Küche und holte mir ein Glas Leitungswasser, während Ana im Bett blieb und döste. Schräg einfallendes Licht durchflutete den Raum, ein schonungsloses Licht, das die gesamte Einrichtung mit voller Wucht traf. Eine in der Neonröhre gefangene Fliege surrte, schier wahnsinnig von der Hitze.
»Das ist schon der zweite Todesfall in einem Monat auf deiner Station?«, rief ich.
»Ja.«
»Vor zehn Tagen war der andere, stimmt’s?«
»Ja. Am Sonntag. Ein junger Mann.«
»Ich erinnere mich.«
»Er hieß Loran.«
Unwillkürlich fragte ich mich, ob jedes unserer Liebesspiele mit dem Tod eines ihrer Patienten zusammenfiel.
Morgen, Weiss!«
Sämtliche Köpfe im Penalty fuhren herum, und eine Stille trat ein, als Agon mit großen Schritten den Gang zwischen den Tischreihen durchmaß, die auf einmal zu kentern drohten. Er setzte sich mir gegenüber.
Agon sprach mich stets mit Nachnamen an. Das tat er bei berühmten oder in seinen Augen anderweitig wichtigen Leuten. Etwa so, wie wenn man jemanden mit »Chef« anredet. Dank regelmäßiger Beschäftigung und höchst vorzeigbarer Gehaltszettel konnte er auf eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz hoffen, eine C-Bewilligung mit endgültigem Bleiberecht. Seine Verbundenheit kannte keine Grenzen: Niemals würde er vergessen, wem er diesen kostbaren Sesam-öffne-dich zu verdanken hatte.
Die Kellnerin kannte er beim Vornamen. Florije brachte ihm seinen Kaffee und den Korb mit den frischen Croissants. Er leerte drei Tütchen Zucker in seine Tasse und rührte klimpernd mit dem Löffel um. Dabei lächelte er wie ein kleiner Junge über ein Musikspielzeug.
Mehrmals am Tag — bei der erstbesten Gelegenheit, häufig aus heiterem Himmel und ohne äußerlich nachvollziehbare Regeln — wird Agon zum Kind. Das dauert nie lange, aber die unverwüstliche Unschuld in diesem Schrank von einem Kerl erfüllt mich immer wieder mit Staunen.
»Hast du das Material?«, fragte ich ihn.
»Ist gestern am Bahnhof angekommen. Ich habe es auf den Hänger geladen.«
»Und, wie sieht es aus?«
»Die Stücke sind alle verpackt. Ich konnte nicht viel sehen.«
»Und die Montage?«
»Geht klar. Mein Cousin hat alles vorbereitet«, sagte er mit einem breiten Grinsen.
Seine Mimik, größer und ausgeprägter als beim Durchschnitt und eigentlich direkt proportional zu seiner restlichen Anatomie, wirkte immer ein wenig überzogen. Also genau die Kategorie von Mensch, in deren Gegenwart man sich schwertut, Ausflüchte zu finden.
Es gab nichts darauf zu erwidern. Der Hinweis auf einen seiner zahlreichen Verwandten, noch ein Mitglied seines Clans, war Garantie genug.
Dabei war er noch nicht allzu lange in meinen Diensten.
Er hatte geräuschvoll den Stuhl, den ich ihm bei seinem Vorstellungsgespräch angeboten hatte, etwas näher gerückt. Dann hatte er geredet und geredet, ohne ein einziges Mal Luft zu holen, und dabei die meiste Zeit mit den Händen über seinem Kopf herumgefuhrwerkt. Ich hatte diese Hände keine Sekunde aus den Augen gelassen, weil ich mich insgeheim vor dem Moment fürchtete, wo er sie womöglich ablegen und mir freundschaftlich auf die Schultern klopfen würde. Ich saß nur Zentimeter von seinem grob geschnittenen Gesicht mit den zwei glänzenden schwarzen Augen entfernt und spürte, wie er mich ganz allmählich in seinen Bann zog.
Am Ende stellte ich ihn ein, aber noch heute bin ich fest davon überzeugt, dass eigentlich ich an jenem Tag von meinem neuen Angestellten ausgewählt wurde.
»Ich werde nicht groß zupacken können«, sagte ich.
Mein unter dem Verband abstehender Zeigefinger zeichnete Linien ins Leere, während ich mein Croissant aß. Agon schaute unwillkürlich in die Richtung, in die ich zu weisen schien, irgendwo zwischen der Saaldecke und der Fensterfront zur Straße hinaus.
»Keine Sorge. Ich habe Bitil und Lastar gebeten, für einen Tag zu kommen.«
Am Vortag hatten wir einen Anruf von der Stadtverwaltung erhalten. Das war nicht ungewöhnlich. Anwohner hatten sich über die ausufernde Vegetation auf dem Nachbargrundstück beschwert, Bäume von an die zehn Meter Höhe oder mehr. Das üppige Grün beeinträchtigte die Leistung ihrer Sonnenkollektoren und griff bedrohlich auf den Gehsteig über. Der Grundstückseigentümer, ein alter Herr in den Achtzigern, sah keinerlei Veranlassung, seiner Bürgerpflicht nachzukommen und das Grün zurückzuschneiden. Wutschnaubend musste er von zwei kurz nach unserer Ankunft an den Ort des Geschehens beorderten Polizisten gebändigt werden, die ihn schließlich in seinem Haus einsperrten.
Behelmt und in Schutzmontur saß Agon angeschirrt in den Baumwipfeln und sägte Äste ab, die ich unten zerlegte. Jedes Mal, wenn ich mit der vollen Schubkarre an der Balkontür vorbei zum Anhänger ging, streckte mir der Alte die Zunge heraus und gab mir mit einer unmissverständlichen Armgeste zu verstehen, dass ich mich verpissen sollte. Zu guter Letzt ließ er auch noch die Hose herunter und drückte den Hintern an der Scheibe platt. Ich war so genervt, dass ich mir heftig in den Finger schnitt.
Agon leistete Erste Hilfe vor Ort. Er hat immer die komplette Notfallapotheke dabei. Er ist eben ein Gefühlsmensch durch und durch. Und wie alle echten Gefühlsmenschen, die ständig fürchten müssen, von ihren Emotionen überschwemmt zu werden, sucht er sein Heil im Pragmatismus und in greifbaren Resultaten.
Die Klingen der Baum- und Heckenscheren oder Sägeblätter reinigt er mit Verbandsmull, den er in Desinfektionsmittel tränkt, denn, so seine These, »was für die Menschen gut ist, ist es auch für die Pflanzen«. Mein Werkzeugdepot ist, seit er es benutzt, so sauber und desodoriert, dass es an einen OP-Trakt gemahnt. Um das Werkzeug vor Abnutzung zu schützen oder zum Reparieren benutzt er Heftpflaster, Verbandsmull, Gummibänder und Schienen — als handle es sich dabei um eine lebendige Verlängerung unserer Hände.
Agon klopfte auf den professionellen Krankenhausverband, um ihn auf seine Festigkeit zu prüfen.
»Kommt zumindest Luft durch?«
»Ich glaube schon.«
»Sauerstoff ist nämlich wichtig für die Heilung.«
»Er ist ein bisschen straff.«
»Überhaupt nicht.«
»Manchmal pocht es.«
»Ist normal. Es arbeitet innen drin, und straff muss es sein«, sagte er und lehnte sich zurück.
Wir saßen eine Weile schweigend. Der klägliche Anblick der schmutzigen Tassen, verstreuten Krümel und zerknüllten Papierservietten vor uns wurde allmählich lästig. Agon ließ den Blick mit einem abschätzigen Brummen durch das Penalty wandern.
»Bah! Komm, Weiss, packen wir’s …«
Wir gingen die Straße entlang bis zum Lieferwagen. Ein feiner Regen fiel beharrlich auf den klebrigen Asphalt und die wenigen grünen Enklaven. Doch ein Hauch von spätfrühlingshafter Schwere kündigte bereits den Sommer an.
Agon ging um den Hänger herum und überprüfte den Zug der Stricke, die die in Plastikfolie verpackte Ladung sicherten. Dann trat er einen Schritt zurück, um das Ganze zu bewundern, und fordert mich auf, es ihm gleichzutun.
»Und?«
»Wirklich beeindruckend.«
Er schien nur auf die Schmeichelei gewartet zu haben, seufzte zufrieden und fuhr fort: »Dabei ist es jetzt noch zerlegt. Die Teile sind nummeriert. Mein Cousin hat mir einen Plan gezeichnet.«
Er hatte eine alte Holzhütte aufgetan, die in kalten Wintern als Unterstand für Hirsche gedient hatte. Ich staunte nicht schlecht, dass es ein Land gab, wo die Menschen sich die Mühe machten, kleine, runde Holzhäuschen zum Schutz für das Hochwild anstatt für die Jäger zu bauen. Diese ansehnlichen Tiere gelten in den Bergen als Wächter des Waldes. Sie müssen zahlreich den Winter überstehen, damit es im Frühjahr reichlich Hasen, Fasane und Wildschweine gibt.
»Aber wenn man die ganzen Häuschen abbaut und woanders hinstellt?«, fragte ich.
»Es gibt sowieso keine Hirsche mehr. Die sind verschwunden. Mit dem Krieg. Jetzt sind nur noch die kleinen Tiere übrig. Die zu leicht sind, um Minen auszulösen.«
Bitil und Lastar, die zwei für den Tag angeheuerten Arbeiter, erwarteten uns schon vor Ort. Wir kamen gut voran. Mithilfe des von Agons Cousin gezeichneten Bauplans nahm das Hüttchen Gestalt an. Ganz traditionsgemäß kam es ohne Nägel, Schrauben oder sonstige Metallteile aus. Umrahmt wurde es von Heidelbeersträuchern zwischen Zwergerlen und Espen, die tags zuvor in einem Gemisch aus Erde und Kieselsteinen gepflanzt worden waren.
Die Kundin, Madame Razumovski, war mir von einer Agentur empfohlen worden, die sich darauf spezialisiert hatte, sehr reichen Ausländern, die einen Rückzugsort suchten oder sich einen Lebensabend in der Schweiz wünschten, bei der Einwanderung zu helfen. Die Agentur kümmerte sich um das komplette Paket: Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung, Wohnungssuche, Verhandlungen mit den Finanzbehörden, Kontaktherstellung mit den besten Geschäftsführern der besten Banken. Auch danach wachte die Agentur diskret über die Existenz ihrer Kunden. Manchmal nehmen sie meine Dienste in Anspruch, und so habe ich in meinem bescheidenen Rahmen Anteil an der Umsiedlung von Menschen am Beginn eines Jahrhunderts der Globalisierung.
Fern der Heimat hegen manche von ihnen den Wunsch, morgens beim Aufwachen ein verpflanztes Stückchen Natur von zu Hause unter ihrem Fenster vorzufinden: Die einen wollen Kamtschatka-Birken mit ihrer gebeugten Gestalt, flankiert von großen, glatten Sachalin-Tannen, und dazu blaues Geißblatt und Heckenrosen in einem sumpfigem Boden; wieder andere beruhigt es, stets eine Reihe majestätischer Ginkgobäume im Blick zu haben, die im Ruf stehen, unverwüstlich zu sein, umgeben von niedrigeren Harlekin-Weiden, Chinesischen Bonsai-Ulmen und einem Bambuswald in eher trocken-sandigem Untergrund.
Madame Razumovski brachte uns zur Essenszeit Orangenlimonade. Sie trug ein elegantes, enganliegendes Kostüm, das jede Partie ihres Körpers zu einem bestaunenswerten Detail machte. Aus einem bauchigen Krug, auf dem Wassertropfen glänzten, goss sie jedem von uns ein Glas ein und erkundigte sich dabei nach dem Fortgang der Arbeit. Es werde doch alles noch vor Einbruch der Dunkelheit fertig sein? Bitil und Lastar verbeugten sich vor lauter Dankbarkeit gleich mehrmals, bevor sie sich auf einem abseits gelegenen Rundholz niederließen, um in aller Ruhe ihre Limonade zu schlürfen.
Wie romantisch sich die Hütte in ihrem Garten ausnahm! Sie war ein echter Gewinn. Madame Razumovski bemühte sich, Interesse für Agons Wald-Geschichten zu zeigen. Als er jedoch zum Erzählen näher zu ihr trat, wich sie zurück. Er machte wieder einen Schritt auf sie zu, sodass sein Gesicht nur ein paar Zentimeter vor ihrem war, und sie machte drei Schritte zur Seite. Er rückte vor, um den Abstand zu verringern, sie entzog sich. Er ging erneut zum Angriff über, stellte sich groß und breit, mit feuchten Lippen, direkt vor sie. Sie wich aus. Da sie jedes Mal eine Bewegung zur Seite machte, beschrieben die beiden schließlich einen Kreis. Um sich eine Atempause zu verschaffen, füllte sie regelmäßig Agons Glas auf, und so hatte dieser, nachdem er die zahlreichen Legenden seiner Heimat heraufbeschworen hatte, den ganzen Krug Limonade leergetrunken.
Nicht einmal eine halbe Stunde später fing er an, sich zu krümmen und zu winden, und während wir die Zapfen in die zugehörigen Löcher steckten und uns um die Abdichtung kümmerten, verschwand er für eine Weile.
Den ganzen restlichen Nachmittag stimmte irgendetwas nicht. Er kräuselte die Unterlippe und zog eine verdrießliche, beleidigte Miene. Immer wieder suchte er mit den Augen den Himmel ab, an dem es eigentlich nichts Außergewöhnliches zu beobachten gab. Dabei war Agon überhaupt kein Träumer. Er sah die Dinge stets so, wie sie waren. Aber jetzt war er einfach genervt.
Gegen Abend setzten wir uns vor die fast fertige Hütte. Bitil und Lastar zündeten sich eine Zigarette an und verstauten das Werkzeug auf dem Hänger. Agon fummelte fieberhaft an seiner Kleidung herum, um die frischen, duftenden Holzspäne abzuzupfen, mit denen sie übersät war.
»Hör mal, du bist doch hoffentlich nicht so ins Haus gegangen, ohne zu fragen …«, sagte ich.
»Ich hab mehrmals gerufen, aber dann …«
Er klopfte sich auf den Bauch.
Ich hatte nicht gesehen, wie er im Laufschritt über die Terrasse geeilt war. Die Balkontür der Villa hatte offen gestanden, und da niemand Antwort gab, hatte er seine schmutzigen Schuhe ausgezogen und war auf Zehenspitzen hineingegangen, um die Toilette zu suchen.
»Das kannst du dir nicht vorstellen! Ein Klo so groß wie ein Wohnzimmer. Ich kam mir vor, als ob ich die ganze Zeit beobachtet würde …«
In dem Augenblick, als er die Toilette verließ, hatte Madame Razumovski vor ihm gestanden und vor Schreck aufgeschrien.
»Sie hat gesagt, ich hätte im Haus nichts zu suchen …«
»Kein Wunder. Sie hat sich erschrocken.«
»… dreckig, wie ich sei …«
Ich seufzte.
»… und dass sie mich hier nie wieder sehen wolle …«
Ich seufzte noch einmal.
»… und dass ihre Toilette jetzt verschmutzt sei.«
»Das wird schon wieder.«
»Es tut mir leid.«
»Schon gut. Macht nichts.«
Im nächsten Augenblick konnte ich ihm schon nicht mehr böse sein. Er hatte diese Eigenart, alles immer absolut persönlich zu nehmen. Ein bisschen wie ein Kind, bei dem immer gleich die ganze Welt ins Wanken gerät, wenn etwas passiert.
»Weißt du was?«, fragte ich.
»Wir tun morgen einfach so, als wäre nichts gewesen.«
Wir sahen den Wolken nach, die allein, zu zweit oder zu dritt in Richtung Berge zogen.
Unter dem Einfluss einer hartnäckig anhaltenden Verstimmung war Agons Muskulatur so verspannt, dass er auf der Rückfahrt im Auto weniger Platz einnahm als auf dem Hinweg. Sein Körper hatte sich zurückgezogen wie der einer Schnecke, die man mit einem Stöckchen kitzelt.
Wir setzten Bitil und Lastar an einer Kreuzung ab und winkten ihnen durch die beschlagene Scheibe nach. Offenbar waren sie Cousins. Sie bewohnten gemeinsam ein Zimmer in einem Wohnblock in der Peripherie. Mir waren sie ein Rätsel und sind es immer noch. Seite an Seite gingen sie davon, den Kopf zwischen den hochgezogenen Schultern, und verschwanden in dem fließenden, von Autoscheinwerfern flimmernden Licht.
»Soll ich dich heimbringen, bevor ich ins Lager fahre?«
»Ja.«
Ein feiner Regen setzte ein und zerschnitt den Horizont. Die Stadt war in unzählige schillernde Schwaden zerteilt. Agon fuhr schweigend und konzentrierter als sonst durch die nahezu leeren Straßen. Eine grelle, monotone Melodie, die von weit her zu kommen schien, erfüllte auf einmal das Fahrerhäuschen.
»Dein Telefon«, brummte Agon.
»Was?«
»Dein Telefon klingelt.«
Es ruckelte in den Falten meiner Hose, als hätte sich dort ein kleines Tier verfangen. Ich kramte es heraus und meldete mich.
Es war die Leiterin des Altenheims. Meine Gesichtszüge mussten sich merklich verändert haben, als ich es wieder zurücksteckte.
»Was ist los?«
»Meine Mutter ist verschwunden.«
»Wie, verschwunden?«
Agon verstand nicht.
»Sie wissen nicht, wo sie ist.«
»Mütter verschwinden nicht einfach so.«
»Da hast du recht. Aber meine ist ein bisschen speziell.«
»Wer sind ›sie‹?«
»Meine Mutter lebt in einem Seniorenheim. Du weißt schon, wo man sich um die alten Leute kümmert.«
»Das ist schlimm.«
Es war eine Feststellung, die keinen Widerspruch zuließ.
»Sie suchen sie seit heute Morgen.«
»Da gibt’s nichts zu diskutieren, das ist schlimm. Wir müssen hin.«
Er überlegte kurz.
»Wir stellen den Lieferwagen beim Lager ab und fahren hin.«
Nach einem Tag im Freien kamen wir uns in der Eingangshalle vor, als wären wir plötzlich in ein tiefes Loch gestürzt. Die in die Decke eingelassenen Lampen geizten mit Helligkeit. Die Heimleiterin kam uns entgegen, mit fahlem Gesicht und bleichem Haar, das auf ihrem Kopf zu einem festen Dutt geschlungen war.
»Gestern Nachmittag hat Ihre Mutter noch beim Blumenstecken mitgemacht.«
Sie deutete auf die im Halbdunkel vegetierenden Sträuße.
»Nach dem Abendessen hat sie im Salon ihren Tee getrunken und sich dann zurückgezogen. Aber heute Morgen ist sie nicht zum Frühstück heruntergekommen. Madame Jaquet … — das ist die Dame, die mit Ihrer Mutter das Zimmer teilt — Madame Jaquet hat zugegeben, dass Ihre Mutter sich gestern Abend zum Ausgehen angezogen und geschminkt hat. Dann ging sie und hat ihre Handtasche mitgenommen.«
Das Detail schien von Bedeutung zu sein, denn auf der sonst glatten Stirn der Heimleiterin erschien eine Falte. Diese verschwand jedoch schlagartig wieder, als ich näher trat und fragte, wie es denn möglich sei, das Seniorenheim zu verlassen, ohne dass jemand es bemerkte.
»War sie schon einmal über Nacht weg?«