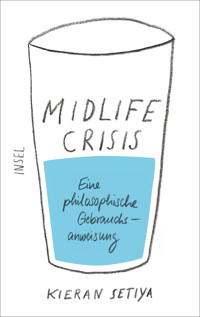21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hoffnung – den Zumutungen des Lebens zum Trotz Kieran Setiya zeigt, wie wir mithilfe der Philosophie den Zumutungen des Lebens begegnen und angesichts von Einsamkeit, Leid und Trauer nach Sinn suchen können. Im Grunde ist es fatal: Wir alle streben nach dem schönsten und besten Leben und zugleich müssen wir immer wieder schmerzhaft feststellen, dass die Wirklichkeit böse Überraschungen bereithält. Krankheit, Einsamkeit, Trauer, Scheitern, Ungerechtigkeit – überall begegnet uns menschliches Leid, vor dem wir die Augen nicht verschließen können. Kieran Setiya zieht daraus die Konsequenz für unser Dasein: Es gilt, uns diesen Zumutungen zu stellen und das Beste aus einem bitteren Los zu machen, das wir alle teilen: der Conditio humana. Dazu sollten wir vor allem lernen, das Leid zu akzeptieren, anstatt es zu beklagen. Gestützt auf Erkenntnisse antiker und moderner Philosophen führt uns Setiya behutsam und tröstend vor Augen, wie das gelingen kann und was es letztlich bedeutet, am Leben zu sein. Ein kluger wie persönlicher philosophischer Leitfaden, der in schweren Zeiten Hoffnung schenkt. ∗∗∗ »Eine wortgewandte, bewegende, geistreiche und vor allem nützliche Machtdemonstration der Philosophie, die uns hilft, die Stürme des Menschseins zu überstehen.« Oliver Burkeman, Bestsellerautor von ›4000 Wochen‹ »Das Leben mag hart sein, aber Kieran Setiya zeigt uns, wie wir besser darüber nachdenken können und wie uns das – trotz alledem – Hoffnung geben kann.« Katherine May, Bestsellerautorin von ›Überwintern‹ »Wie ein Gespräch mit einem aufmerksamen Freund.« ›The New York Times Book Review‹ »Best Book of the Year 2022«, gekürt von ›The New Yorker‹ und ›The Economist‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Im Grunde ist es fatal: Wir alle streben nach dem schönsten und besten Leben und zugleich müssen wir immer wieder schmerzhaft feststellen, dass die Wirklichkeit böse Überraschungen bereithält. Krankheit, Einsamkeit, Trauer, Scheitern, Ungerechtigkeit – überall begegnet uns menschliches Leid, vor dem wir die Augen nicht verschließen können.
Der Philosoph Kieran Setiya zieht daraus die Konsequenz für unser Dasein: Es gilt, uns diesen Zumutungen zu stellen und das Beste aus einem bitteren Los zu machen, das wir alle teilen: der Conditio humana. Dazu sollten wir vor allem lernen, das Leid zu akzeptieren. Gestützt auf Erkenntnisse antiker und moderner Philosophen führt uns Setiya behutsam und tröstend vor Augen, wie das gelingen kann und was es letztlich bedeutet, am Leben zu sein.
»Es gibt keine einfache Formel für ein gutes Leben. Aber ich kann Geschichten, Bilder und teils geborgte, teils eigene Ideen sowie das Bemühen anbieten, mich den Problemen (…) so ehrlich wie menschenmöglich zu stellen und aus den gewonnenen Erkenntnissen zu lernen.«
KIERAN SETIYA
DAS LEBEN IST HART
Wie Philosophie uns helfen kann, unseren Weg zu finden
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Du erinnerst mich an einen Menschen, der aus dem geschlossenen Fenster schaut und sich die sonderbaren Bewegungen eines Passanten nicht erklären kann; er weiß nicht, welcher Sturm draußen wütet und daß dieser Mensch sich vielleicht nur mit Mühe auf den Beinen hält.1
LUDWIGWITTGENSTEIN
Vorwort
Die Idee für dieses Buch hatte ich vor der Covid-19-Pandemie. Ich begann im Sommer 2020 mit der Arbeit und stellte das Buch in einer Kraftanstrengung innerhalb von achtzehn Monaten fertig, während rund um mich die Welt zerfiel. Ich bin ein Philosoph, der sich mit der Frage beschäftigt, wie ein Mensch leben sollte, und die Prüfungen des Lebens hatten nie schwerer gewirkt. Ich wollte mich bewusst damit auseinandersetzen.
Meine Beziehung zu Widrigkeiten hat sich mit zunehmendem Alter gewandelt. Die Mühsal des Lebens ist heute allgegenwärtig in meinem Leben und in dem der Menschen, die ich liebe. Trauerfälle, Krebs und chronische Schmerzen wirken sich darauf aus, wie wir die Welt sehen. In jüngeren Jahren gingen diese Erfahrungen beinahe spurlos an mir vorbei. Ich musste erst an das erinnert werden, was der Philosoph Ludwig Wittgenstein zu seiner Schwester Hermine sagte (ich zitiere ihn in dem Motto, das dem Buch vorangestellt ist): Die Menschen geben ihrem Leiden oft keinen Ausdruck und verbergen, dass sie mit Widrigkeiten kämpfen.
Meine Beziehung zur Philosophie hat sich ebenfalls gewandelt. Als Teenager liebte ich die abstrakten metaphysischen Ideen, welche die Grundlagen des Geistes und der Welt ausloten. Die Philosophie gab mir die Möglichkeit, dem gewöhnlichen Leben zu entkommen. Nach wie vor bewundere ich die Philosophie in ihren geheimnisvolleren Formen und würde sie stets gegen Kritik verteidigen. Eine Gesellschaft, die sich nicht mit Fragen dazu auseinandersetzen will, was wirklich ist und welcher unser Platz in der Wirklichkeit ist – und das schließt Fragen ein, welche die Wissenschaft nicht beantworten kann –, würde geistig vollkommen verarmen.
Aber Philosophie ist mehr und kann mehr sein als das. Wer sie studiert, übt sich in der Kunst der Argumentation und lernt, vertrackte Probleme zu sezieren und zu durchdringen. Genau das lernte ich an der Universität, und ich lehre es seit vielen Jahren mit Überzeugung. Doch mittlerweile wünsche ich mir eine Philosophie, die dem Leben näher ist. Als ich mein Abschlussexamen ablegte, fiel der Bericht der Prüfer überwiegend positiv aus. Ich habe all die netten Dinge vergessen, die der Bericht enthielt. Erinnern kann ich mich nur an eine kritische Bemerkung: Meine Vorstellungen, warnten die Prüfer, hätten »die Feuerprobe der unmittelbaren moralischen Erfahrung« noch nicht bestanden. Meine Freunde und ich fanden dieses Urteil amüsant. Aber ich wurde es nicht los. Es bedeutete weniger, dass die Erfahrung meine noch unausgereiften Theorien widerlegte, sondern vielmehr, dass diese Theorien zu weit von der Erfahrung entfernt waren.
Wie sähe eine Philosophie aus, die der Feuerprobe der unmittelbaren moralischen Erfahrung unterzogen würde? Die Frage ist beängstigend. Keine individuelle Erfahrung ist umfassend oder tiefgreifend genug, um stellvertretend für die Erfahrung aller Menschen zu stehen. Unsere Perspektive ist stets beschränkt und verzerrt und weist blinde Flecken auf. Es könnte gleichwohl eine Philosophie geben, die vom eigenen Leben spricht, selbst wenn sie sich auf Argumente und Gedankenexperimente, philosophische Theorien und Unterscheidungen stützt. Sie würde die Trennlinien zwischen dem argumentativen und dem persönlichen Essay ebenso verwischen wie die zwischen der Disziplin der Philosophie und der gelebten Erfahrung eines Menschen, für den Philosophie ein praktisches Werkzeug für die Auseinandersetzung mit den Widrigkeiten des Lebens ist. Das würde uns zur ursprünglichen Bedeutung des Begriffs »Philosophie« – Liebe zur Wahrheit – und zur Philosophie als Lebensart zurückführen.
In diesem Geist habe ich in aufgewühlten Zeiten dieses Buch geschrieben.
Einleitung
Das Leben ist hart, meine Freunde – an dieser Erkenntnis führt kein Weg vorbei.1 Manche von uns haben es schwerer als andere. In jedem Leben wird manchmal Regen fallen, aber während sich die Glücklichen vor dem Kamin trocknen können, müssen andere Stürme und Fluten überstehen, sowohl wörtlich wie im übertragenen Sinne. Wir leben mit den Nachwehen einer globalen Pandemie, mit Massenarbeitslosigkeit, einer eskalierenden Klimakatastrophe und dem wiedererwachenden Faschismus. Unter all diesem Unglück werden vor allem die Armen, die Verwundbaren und die Unterdrückten leiden.
Ich selbst habe Glück gehabt. Ich wuchs in Hull im Nordosten Englands auf, als diese Industriestadt ihre beste Zeit bereits hinter sich hatte. In meiner Kindheit gab es zwar dunkle Tage, aber ich verliebte mich in die Philosophie, bekam einen Studienplatz in Cambridge, ging für das Aufbaustudium in die Vereinigten Staaten und blieb dort.2 Heute genieße ich als Professor für Philosophie am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Wohlstand und Stabilität in einer illustren, wenn auch etwas exzentrischen Einrichtung. Ich besitze ein Haus, bin glücklich verheiratet und habe ein Kind, das klüger und mutiger ist, als ich jemals war. Ich habe nie gehungert und bin nie obdachlos gewesen, ich habe weder Gewalt noch Krieg am eigenen Leib erlebt. Aber niemand ist gefeit gegen Krankheit, Einsamkeit, Scheitern und Trauer.
Seit meinem siebenundzwanzigsten Lebensjahr leide ich unter chronischen Schmerzen. Sie sind beharrlich, von schwankender Intensität und rätselhaft, ein unablässiges Dröhnen, das meine Sinne betäubt. Manchmal fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren, und gelegentlich finde ich keinen Schlaf. Da meine Krankheit unsichtbar ist, isoliert sie mich: Kaum jemand weiß davon. (In Kapitel 1 erzähle ich mehr darüber.) Im Alter von fünfunddreißig Jahren schlitterte ich in eine verfrühte Midlife-Crisis.3 Das Leben erschien mir monoton und leer, eine Abfolge von Erfolgen und Fehlschlägen, die in Niedergang und Tod in der Zukunft mündeten. Vor acht Jahren wurde bei meiner Mutter eine früh auftretende Alzheimer-Demenz diagnostiziert. Eine Weile funktionierte ihr Gedächtnis nicht richtig, und irgendwann versagte es unvermittelt vollkommen. Ich trauere um einen Menschen, der noch am Leben ist.
Wo ich auch hinschaue, sehe ich großes Leid. Während ich diese Worte schrieb, lebten Millionen Menschen während der Covid-Pandemie einsam und verzweifelt in erzwungener Isolation. Viele hatten ihre Arbeit verloren oder konnten ihre Rechnungen nicht bezahlen. Familienangehörige und Freunde wurden krank oder starben, und es begann eine Epidemie der Trauer. Die Ungleichheit nahm massiv zu, und die Demokratie wirkte angeschlagen.4 Und ein weiterer Sturm zieht auf, da wir die Alarmglocken nicht hören, die den Klimawandel ankündigen.
Was können wir tun?
Es gibt kein Heilmittel für das menschliche Leid. Aber nachdem ich zwanzig Jahre lang Moralphilosophie unterrichtet und studiert habe, glaube ich, dass sie helfen kann. In diesem Buch erkläre ich, wie.
Trotz ihres Namens geht es in der »Moralphilosophie« um sehr viel mehr als um die moralische Pflicht. Wie Platon um 375 v. Chr. in Der Staat schrieb: »Denn es ist nicht von etwas Gemeinem die Rede, sondern davon, auf welche Weise man leben soll.«5 Das Feld der Moralphilosophie ist weitläufig und umfasst alles, was im Leben Bedeutung hat. Die Philosophen fragen, was gut für uns ist, welche Bestrebungen wir verfolgen und welche Tugenden wir uns aneignen oder bewundern sollten. Sie geben uns Anleitung und liefern uns Argumente. Sie formulieren Theorien dazu, wie ein Mensch sein Leben führen sollte. Ihre Aktivität hat auch eine akademische Seite: Die Philosophen untersuchen abstrakte Fragen und fechten die Thesen ihrer Kollegen an; sie führen Gedankenexperimente durch, in denen das Vertraute fremdartig wird. Die Moralphilosophie dient jedoch auch einem praktischen Zweck. Die längste Zeit wurde nicht klar zwischen philosophischer Ethik und »Selbsthilfe« unterschieden.6 Man ging davon aus, dass die philosophische Auseinandersetzung mit der Frage, wie man leben sollte, unser Leben besser machen sollte.
All dem stimme ich vollkommen zu. Aber oft setzt sich das Bemühen um ein gutes Leben ein schwerer zu fassendes Ziel: das beste oder ideale Leben. In Der Staat stellt sich Platon die Gerechtigkeit in Gestalt eines utopischen Stadtstaates vor, nicht als Kampf gegen Unrecht im Hier und Jetzt. In der Nikomachischen Ethik strebt Platons Schüler Aristoteles nach dem höchsten Gut, der eudaimonia – nach einem Leben, das nicht einfach gut genug ist, sondern das wir wählen sollten, wenn wir uns unser Leben aussuchen könnten.7Aristoteles war der Meinung, wir sollten die Götter nachahmen: »Wir sollen aber nicht den Dichtern folgen, die uns mahnen, als Menschen uns mit menschlichen und als Sterbliche mit sterblichen Gedanken zu bescheiden, sondern, soweit wir können, uns zur Unsterblichkeit erheben und alles tun, um unser Leben nach dem einzurichten, was uns das Höchste ist.«8 Seine Antwort auf die Frage, wie ein Mensch leben sollte, ist eine Vision von einem Leben ohne Mangel oder menschliche Bedürfnisse; man könnte es als aristotelische Version des Himmels bezeichnen.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, denken selbst jene, die nicht ganz so hohe Ansprüche haben, in der Regel nicht über das schlechte, sondern über das gute Leben nach.9 Sie konzentrieren sich auf Genuss statt auf Leid, auf Liebe statt auf Verlust, auf Erfolg statt auf Scheitern. Der Philosoph Shelly Kagan hat den Begriff des »Schlechtergehens« zur Beschreibung jener Elemente geprägt, die »direkt dafür sorgen, dass ein Leben einen ungünstigen Lauf nimmt«. In »typischen Gesprächen über das Wohlergehen«, erklärt er, »wird das Schlechtergehen weitgehend vernachlässigt«.10 Hier sehen wir eine Affinität zur »Macht des positiven Denkens«, zu der Aufforderung, uns nicht mit Prüfungen und Kümmernissen aufzuhalten, sondern von dem Leben zu träumen, das wir uns wünschen.11 Selbst die Stoiker der Antike, jene Philosophen, die sich ausdrücklich mit der Frage beschäftigten, wie die Widrigkeiten des Lebens bewältigt werden konnten, waren überraschend zuversichtlich. Sie glaubten, wir könnten ungeachtet der Umstände ein gutes Leben haben, und es hänge ausschließlich von uns selbst ab, ob das gelinge.12 In diesen Vorstellungen wird das Leid durch das Streben nach dem guten Leben unterdrückt.
Eine Prämisse meines Buchs lautet, dass diese Denkweise falsch ist. Wir sollten uns nicht vom Leid abwenden, und das beste Leben ist oft unerreichbar. Vielmehr stürzt uns das Streben danach nur ins Unglück.
Diese Denkweise erscheint Ihnen möglicherweise pervers oder pessimistisch. Aber wir müssen nicht das »beste Leben« führen, um den Widrigkeiten besser widerstehen zu können; und wir müssen uns den Tatsachen stellen. Vielleicht haben Sie die folgende Erfahrung gemacht: Sie erzählen einem Freund von einem Problem, mit dem Sie kämpfen, etwa einem Streit am Arbeitsplatz, einer Beziehungskrise oder einer gesundheitlichen Krise. Ihr Freund beschwichtigt Sie – »Keine Sorge, alles wird gut!« – oder gibt Ihnen Ratschläge. Doch diese Reaktion ist nicht tröstlich. Vielmehr fühlt sie sich wie Verleugnung an: Die Person weigert sich anzuerkennen, was Sie durchmachen. In solchen Augenblicken lernen wir, dass Beteuerungen und Ratschläge wie Verleugnung wirken können.
Noch schlimmer als Verleugnung ist der Drang, das menschliche Leid zu rechtfertigen. »Alles geschieht aus einem Grund.« Das klingt sehr schön, nur stimmt es nicht. Die Philosophen bezeichnen eine Argumentation, die rechtfertigt, was Gott mit den Menschen tut, als »Theodizee«. Die Theodizeen benennen das Problem des Bösen: Wenn Gott allmächtig und wohlwollend ist, woher kommt dann all das Böse in der Welt? Die Theodizee führt jedoch abseits der strikt theistischen oder doktrinären Anwendungen ein Eigenleben:13 Egal ob wir religiös sind oder nicht, wir beschwören das Problem des Bösen herauf, wann immer wir gegen etwas protestieren, das in unseren Augen nicht sein sollte, und wir bedienen uns einer Art von Theodizee, wenn wir sagen, dass nichts ohne Grund geschieht.
Die Theodizee ist nicht nur in intellektueller Hinsicht problematisch – keines der Argumente funktioniert –, sondern auch in ethischer. Es ist falsch, auf diese Art das eigene Leid oder das anderer Menschen zu rechtfertigen und das Mitleid oder den Protest zu unterdrücken. Dies ist die Moral der berühmtesten aller Theodizeen. Im Buch Hiob fordert der Satan Gott auf, die Treue des »untadeligen und rechtschaffenen« Mannes auf die Probe zu stellen, indem er Hiobs Söhne und Töchter tötet, seinen Besitz zerstört und seine Haut »mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel« bedeckt, sodass Hiob schließlich im Staub hockt und sich mit einer Tonscherbe den Schorf der getrockneten Geschwüre abschaben muss.14 Hiobs Freunde sind überzeugt, dass er sein Schicksal verdient hat und für irgendeine geheimnisvolle Sünde bestraft wird. Gott verurteilt sie, weil sie »nicht recht von mir geredet haben wie mein Knecht Hiob«. Hiob seinerseits beharrt auf seiner Unschuld. Obwohl er am Ende der Geschichte anscheinend erlöst wird – Gott gibt ihm doppelten Reichtum, »vierzehntausend Schafe, sechstausend Kamele, tausend Joch Rinder und tausend Esel« sowie sieben neue Söhne und drei neue Töchter –, kann die Theodizee nicht überzeugen.15 Es ist ein Hohn zu sagen, irgendein Ersatz könne Hiob für den Verlust seiner ersten Kinder entschädigen.
Die Lehre aus dem Buch Hiob ist nicht, dass die Tugend am Ende belohnt wird, sondern dass Hiobs Freunde im Irrtum waren, als sie Begründungen für sein Elend suchten. Hiob ist derjenige, der die Wahrheit ausspricht: Wir haben das Leid, das wir erdulden müssen, nicht verdient. Damit will ich nicht sagen, dass es keinen Gott gibt, obwohl ich selbst nicht an einen glaube. Vielmehr sage ich: Selbst wenn Gottes Existenz mit der allgegenwärtigen und anhaltenden Drangsal des menschlichen Lebens in Einklang gebracht werden kann, sollte das die Wut des Mitleids mit uns selbst und anderen weder mäßigen noch negieren.
Wir sind also Erben einer Tradition, die uns drängt, uns auf das Beste im Leben zu konzentrieren; gleichzeitig ist uns schmerzhaft bewusst, dass das Leben sehr schwer sein kann. Wenn wir die Augen öffnen, sehen wir überall menschliches Leid: Gebrechen, Einsamkeit, Trauer, Scheitern, Ungerechtigkeit und Absurdität. Wir sollten die Augen nicht davor verschließen, sondern genauer hinsehen. Wir sollten uns unsere Notlage bewusst machen.
Darum geht es in diesem Buch. Es enthält eine Karte, welche die Orientierung in schwierigem Terrain erleichtern soll – ein Handbuch der Drangsal von persönlichen Traumata bis zur Ungerechtigkeit und der Absurdität der Welt. Ich bringe Argumente vor und widerspreche in einigen Punkten anerkannten Philosophen. Aber es geht mir nicht einfach um die Diskussion über Widrigkeiten, sondern darum, wie wir mit ihnen umgehen können. Wie die Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch erklärt hat: »Ich kann nur in der Welt wählen, die ich sehen kann, und zwar ›sehen‹ im moralischen Sinne des Wortes, in dem ein klarer Blick das Resultat von moralischer Imagination und moralischer Anstrengung ist.«16 Weniger die Argumentation, sondern vielmehr die Beschreibung prägt unsere Vorstellung vom Leben und sagt uns, wie wir fühlen und uns verhalten sollen. Es ist anstrengend, das zu beschreiben, was wirklich da ist. Hier überschneidet sich die Philosophie mit Literatur, Geschichte, Memoiren und Film. Ich werde alles nutzen, was mir zur Verfügung steht.
Wie zuvor erwähnt, sind Moralphilosophie und Selbsthilfe seit Langem miteinander verflochten. Dieses Buch stützt sich teilweise auf diese Tradition. Die Auseinandersetzung mit den mangelhaften Bedingungen des Menschseins kann ihre schädlichen Auswirkungen abmildern und uns dabei helfen, ein sinnvolleres Leben zu führen. Dies ist jedoch kein Selbsthilfebuch, wenn wir unter Selbsthilfe »fünf Tipps zur Bewältigung der Trauer« oder eine Anleitung dazu verstehen, »wie man erfolgreich sein kann, ohne es zu versuchen«. Ich wende weder eine abstrakte Theorie noch die Lehren eines verstorbenen Philosophen auf die Schwierigkeiten des Lebens an. In diesem Buch geht es nicht um Wunschdenken oder einfache Lösungen, sondern um die geduldige Arbeit der Tröstung. Um den Dichter Robert Frost zu paraphrasieren: Der beste Ausweg aus dem menschlichen Leid ist immer mittendurch.17
Zwei Erkenntnisse helfen uns bei der Orientierung. Die erste lautet: Glücklich zu sein ist nicht dasselbe, wie ein gutes Leben zu führen. Wenn Sie glücklich sein wollen, kann die Auseinandersetzung mit Widrigkeiten von Nutzen sein oder nicht. Aber bloßes Glück sollte nie das Ziel sein. Glück ist eine Stimmung oder ein Gefühl, ein subjektiver Zustand: Man kann glücklich sein, während man in einer Lüge lebt. Nehmen wir das Beispiel von Maya, die dank an das Gehirn angeschlossener Elektroden ohne ihr Wissen in einer lebenserhaltenden Flüssigkeit treibt und jeden Tag mit einem Bewusstseinsstrom versorgt wird, der ein ideales Leben simuliert.18 Maya ist glücklich, aber dies ist kein gutes Leben. Die meisten Dinge, die sie zu tun glaubt, tut sie in Wahrheit gar nicht; das meiste von dem, was sie zu wissen glaubt, weiß sie in Wahrheit nicht; sie interagiert mit nichts und niemandem außer der Maschine, an der sie hängt. Einem Menschen, den wir lieben, würden wir so etwas nicht wünschen: in einem Behälter gefangen zu sein, für immer allein, zum Narren gehalten.
Die Wahrheit ist, dass wir nicht nach dem Glück suchen, sondern uns bemühen sollten, so gut wie möglich zu leben. Wie der Philosoph Friedrich Nietzsche sarkastisch bemerkte: »Der Mensch strebt nicht nach Glück, nur der Engländer tut das.«19 Es war ein Seitenhieb auf Denker wie Jeremy Bentham und John Stuart Mill, die erklärten, der Mensch müsse Lebensgenuss anstreben und Leiden vermeiden.
Ich will keineswegs sagen, dass wir versuchen sollten, unglücklich oder dem Glück gegenüber gleichgültig zu sein, aber der Wert des Lebens besteht nicht nur darin, wie es sich anfühlt. Unsere Aufgabe ist es, uns den Widrigkeiten zu stellen – und hier hilft uns nur die Wahrheit weiter. Wir müssen in der Welt leben, die wir vorfinden, nicht in der Welt, die wir uns wünschen.
Das zweite Leitprinzip besagt, dass wir in einem guten Leben weder Gerechtigkeit von Eigennutz noch uns selbst von anderen abkoppeln können. Sogar unsere isolierteste Beschäftigung mit unserem eigenen Leid, unserer Einsamkeit, unserer Frustration wird sich im Verlauf des Buchs als implizit moralisch erweisen. Sie ist mit dem Mitleid verwoben, mit dem Wert des menschlichen Lebens, mit den Ideologien von Scheitern und Erfolg, welche die Ungerechtigkeit des Lebens verschleiern. Eine aufrichtige Auseinandersetzung mit unserem eigenen Leid führt uns zur Sorge um andere, nicht zur narzisstischen Fixierung auf uns selbst.
Aber wir sollten das nicht überbewerten. In Der Staat beschreibt Platon einen gerechten Mann, dessen Ansehen ruiniert wird. Er wird fälschlich beschuldigt und vor Gericht gestellt, »gefesselt, gegeißelt, gefoltert, geblendet an beiden Augen«, und tut doch die ganze Zeit das Richtige.20 In Platons Augen verläuft das Leben dieses Mannes gut. Aristoteles ist anderer Meinung. Er erklärt, es sei eine Sache, sich richtig zu verhalten – er bezeichnet das als eupraxia –, und eine ganz andere, jene Art von Leben zu führen, die man sich wünschen sollte. Das von Platon beschriebene Justizopfer führt das erste, aber nicht das zweite Leben. Dieser Mann tut, was richtig ist, aber wir sollten uns nicht wünschen, wie er unter Bedingungen zu leben, unter denen wir einen furchtbaren Preis dafür bezahlen müssten, das Richtige zu tun.
Aristoteles’ Fehler ist nicht, dass er diese – durchaus sinnvolle – Unterscheidung vornimmt, sondern dass er sich auf das Leben konzentriert, das wir uns wünschen sollten, wenn wir uns unser Leben aussuchen könnten – anstelle des realistischerweise möglichen Lebens, das gut genug ist. Das gute Leben im Sinne dieses Buchs besteht darin, die Widrigkeiten des Lebens zu bewältigen und dabei genug wünschenswerte Aktivitäten zu finden. Die Philosophie kann weder Glück noch ein ideales Leben versprechen, aber sie kann dabei helfen, die Bürde des menschlichen Leidens zu erleichtern. Wir beginnen mit der Gebrechlichkeit des Körpers, beschäftigen uns mit Liebe und Verlust, gehen zur Struktur der Gesellschaft über und wenden uns schließlich dem »ganzen übrigen Kosmos« zu.21 Spoiler-Alarm: Wenn Sie wissen wollen, was der Sinn des Lebens ist, finden Sie die Antwort in Kapitel 6.
Im ersten Kapitel geht es um etwas weniger Hochtrabendes, nämlich um die Auswirkungen von körperlichen Behinderungen und Schmerzen. Ich werde erklären, inwiefern die schädlichen Auswirkungen von Behinderungen – und die zunehmende körperliche Einschränkung durch das Altern – allgemein falsch verstanden werden. Wie Aktivisten erklären, müssen körperliche Behinderungen das Leben nicht verschlechtern; wenn sie es tun, dann aufgrund von Vorurteilen und schlechten Abhilfemaßnahmen. Diese Erkenntnis wird durch die Fantasievorstellung von einem idealen Leben im aristotelischen Sinn verschleiert, das heißt von einem Leben, in dem es an nichts mangelt. Die Aktivisten haben recht: Dieses Ideal ist inkohärent. Wenn wir uns den Schmerzen zuwenden, stellen wir fest, dass die Philosophie an Grenzen stößt: Sie ist kein Schmerzmittel. Aber sie kann uns helfen zu verstehen, warum Schmerzen schlecht sind, und diese Frage ist sehr viel komplexer, als man meinen könnte. Die Benennung und Anerkennung des Schadens, den der Schmerz verursacht, ist tröstlich für jene, die darunter leiden – und macht Mitgefühl möglich.
Neben körperlichen Schmerzen gibt es auch den seelischen Schmerz, den uns Isolation, Verlust und Scheitern zufügen. In Kapitel 2 werden wir uns der Einsamkeit und dem Bedürfnis nach Gemeinschaft zuwenden, vom Problem des Solipsismus – der Vorstellung, dass nur das Ich existiert – bis zu der Idee, dass der Mensch ein soziales Tier ist. Wir werden feststellen, dass der von der Einsamkeit verursachte Schaden den Wert der Freundschaft erhöht, die ihrerseits den Wert anderer Menschen erhöht. Die Erkenntnis dieses Werts zeigt, dass Liebe mit Mitgefühl und Respekt verwandt ist. Deshalb lindern wir unsere Einsamkeit, indem wir auf die Bedürfnisse anderer eingehen.
Die dunkle Seite der Freundschaft – und der Liebe – ist, dass sie uns für Trauer anfällig macht. In Kapitel 3 werden wir die Dimensionen des Verlusts untersuchen, vom Ende einer Beziehung – ich werde mich mit einer hässlichen Trennung beschäftigen – bis zum Ende eines menschlichen Lebens. Wir werden sehen, dass die Liebe Trauer rechtfertigt, weshalb das Unglücklichsein ebenfalls Teil eines guten Lebens ist. Am Ende des Kapitels wenden wir uns einem sowohl emotionalen als auch philosophischen Rätsel zu. Wenn der Tod eines geliebten Menschen ein Grund zur Trauer ist, besteht dieser Grund dauerhaft. Er wird nie verschwinden. Sollten wir also unser Leben lang trauern? Ich werde die Grenzen der Vernunft in der Auseinandersetzung mit der Trauer ausleuchten und zeigen, dass die Praxis des Trauerns erreichen kann, woran die Vernunft scheitert.
In Kapitel 4 wenden wir uns dem persönlichen Scheitern zu. Hier werden wir wütenden Buddhisten, dem Fürsten Myschkin aus DostojewskisDer Idiot und dem Baseballspieler Ralph Branca begegnen. Ich werde erklären, warum uns der Reiz der vermeintlichen narrativen Einheit des Lebens zu »Gewinnern« und »Verlierern« macht. Wir sollten dieser Versuchung widerstehen und uns weigern, unser Leben als eine vereinfachte, lineare Geschichte zu erzählen oder dem Projekt größeren Wert als dem Prozess beizumessen. Aber auch hier stößt die Vernunft an Grenzen. Die von mir vorgeschlagene Neuausrichtung können wir nicht einfach erreichen, indem wir uns dazu entschließen. Wir müssen an uns arbeiten und die Ideologie bekämpfen, die den Wert des Lebens daran misst, was ein Mensch erreichen kann – ein Maßstab, der eine groteske Ungleichheit von Vermögen und sozialem Status ignoriert.
So können wir eine Brücke vom Scheitern in unserem eigenen Leben zur Frage der Ungerechtigkeit schlagen, mit der wir uns im letzten Drittel des Buchs beschäftigen. In Kapitel 5 werden wir uns ansehen, inwieweit John Bergers Postulat zutrifft, dass es »auf dieser Erde kein Glück ohne eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit« gibt.22 Gestützt auf PlatonsStaat und auf die Arbeiten der Philosophen Theodor Adorno und Simone Weil, werde ich erklären, warum die Ungerechten durchaus glücklich sein, aber nicht gut leben können. Diese Erkenntnis beruht nicht auf einem esoterischen Beweis, sondern auf etwas, das wir lernen, indem wir die Welt um uns herum »lesen« und uns mit den Widrigkeiten in unserem eigenen Dasein und in dem anderer Menschen auseinandersetzen.23 Der erste Teil des Buchs dient also einem moralischen Zweck und hilft uns, das menschliche Leid auf der persönlichen Ebene aufzuarbeiten und uns auf dieser Basis ein Bild von seiner übergeordneten Bedeutung zu machen. Das Kapitel endet mit unserer Verantwortung für Gerechtigkeit und den Wert jedes kleinen Schritts, den wir tun können, um ihr näherzukommen.
In den letzten Kapiteln des Buchs werfen wir einen Blick auf das Universum und auf die Zukunft der Menschheit. Ich werde erklären, wie Gerechtigkeit dem menschlichen Leben einen Sinn verleihen kann und dass dieser Sinn von uns abhängt. Hier kollidiert die existenzielle Frage der Absurdität mit dem Klimawandel: mit der Dringlichkeit des Handelns und der Bürde der Angst. Am Ende gelangen wir zur Hoffnung und fragen uns, warum sie eines der Übel des Lebens war, die Pandora in ihrer Büchse mitbrachte. In der Auseinandersetzung mit meiner eigenen Ambivalenz finde ich ein Einsatzgebiet für die Hoffnung.
Letzten Endes geht es in diesem Buch darum, das Beste aus einem bitteren Los zu machen: der Conditio humana. Ich gebe Orientierungshilfen im Umgang mit Widrigkeiten – vom Umgang mit Schmerzen bis zur Suche nach neuen Freunden, von der Trauer um die, die wir verloren haben, bis zum Scheitern mit Würde, vom Preis der Ungerechtigkeit bis zur Suche nach einem Lebenssinn. Es gibt keine einfache Formel für ein gutes Leben. Aber ich kann Geschichten, Bilder und teils geborgte, teils eigene Ideen sowie das Bemühen anbieten, mich den Problemen, mit denen wir konfrontiert sind, so ehrlich wie menschenmöglich zu stellen und aus den gewonnenen Erkenntnissen zu lernen. Die Philosophie ist weder müßige Spekulation noch eine Maschine, die ausschließlich aus Argumenten zusammengesetzt wird. Auf den folgenden Seiten werden Sie Argumentationen und vieles andere finden, allesamt Worte, die dazu dienen, die Bedingungen des Menschseins auf eine Art darzustellen, die das Wünschen lenkt. Es geht nicht darum, das abstrakte Denken abzuwerten. Aber auch die Philosophen haben Gefühle.
In der Einleitung seines Buchs Der Begriff der Moral sprach der britische Philosoph Bernard Williams eine Warnung aus, an die ich mich oft erinnere: »Über Moralphilosophie zu schreiben ist in jedem Fall riskant, und zwar nicht nur aus den Gründen, aus denen es riskant ist, über schwierige Themen zu schreiben (oder auch überhaupt zu schreiben), sondern aus zwei ganz bestimmten Gründen. Der erste ist, daß die Begrenztheit und Unzulänglichkeit der eigenen Einsicht hier viel eher und deutlicher zum Vorschein kommen als auf irgendwelchen anderen Gebieten der Philosophie. Und der zweite ist, daß man Gefahr läuft, die Leser – wenn sie einen ernst nehmen – bei wirklich wichtigen Fragen in die Irre zu führen.«24 Ich gebe ihm recht, aber die Alternativen sind schlechter: Unpersönlichkeit und Trivialität. Die Philosophen, die sich mit der Conditio humana beschäftigen, müssen sich bei der Beschreibung der Welt selbst preisgeben. Ich befürchte, das gilt auch für mich in diesem Buch – obwohl ich, wenn ich sage, dass ich mich fürchte, in Wahrheit sagen will: Ich hoffe.
EinsGEBRECHEN
Niemand vergisst den Augenblick, in dem zum ersten Mal ein Arzt aufgibt und zugibt, dass er nicht weiterweiß – dass ihm keine weiteren Untersuchungen oder Behandlungsmöglichkeiten mehr einfallen – und dass wir auf uns allein gestellt sind. Für mich kam dieser Augenblick im Alter von siebenundzwanzig Jahren, aber viele von uns werden diese Erfahrung irgendwann in ihrem Leben machen, wenn sich herausstellt, dass sie an einer Krankheit leiden, die sie in ihrem Leben einschränken oder sogar zum Tod führen wird. Die Verwundbarkeit des Körpers ist Teil der Conditio humana.
Ich weiß nicht mehr, welchen Film wir uns angesehen hatten, aber ich weiß, dass wir im The Oaks waren, einem alten Kino am Stadtrand von Pittsburgh, als ich plötzlich einen stechenden Schmerz in der Nierengegend verspürte, gefolgt von einem starken Harndrang. Ich lief zur Toilette, und obwohl ich mich anschließend besser fühlte, tat die ganze Leistengegend weiterhin weh. Nach einigen Stunden gingen die Schmerzen erneut in Harndrang über, der mich gegen ein Uhr morgens weckte. Ich ging auf die Toilette … aber wie in einem schlechten Traum änderte das Wasserlassen nichts. Die quälende Spannung hielt an, unempfänglich für jedes Feedback meines Körpers. Ich verbrachte eine Nacht halluzinatorischer Schlaflosigkeit auf dem Fußboden des Badezimmers und ließ von Zeit zu Zeit Wasser in dem vergeblichen Bemühen, den somatischen Alarm abzuschalten.
Am folgenden Tag suchte ich als Erstes meinen Hausarzt auf, der eine Harnwegsentzündung vermutete und Antibiotika verschrieb. In der Harnprobe wurden weder Viren noch Bakterien gefunden, und auch die Tests auf ausgefallenere Erkrankungen fielen negativ aus. Die Schmerzen ließen nicht nach. Von da an ist der zeitliche Verlauf unklar. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, und die medizinische Bürokratie machte alle Versuche zunichte, meine Krankengeschichte von Pittsburgh ans MIT zu übermitteln, als ich elf Jahre später umzog.
Aber die wichtigsten Episoden werde ich nicht vergessen. Da war zunächst eine urodynamische Untersuchung, bei der ein Katheter gesetzt wurde, worauf ich große Mengen an Flüssigkeiten trinken und in eine Maschine urinieren musste, die Fließrate und Funktion maß. Normal. Dann kam eine Zytoskopie, bei der ein sehr jugendlich wirkender Urologe ein altmodisches Zytoskop wie eine ausziehbare Radioantenne quälend langsam Schritt für Schritt durch meine Harnröhre schob. Es fühlte sich an, als wäre etwas nicht in Ordnung, aber das Resultat war einmal mehr negativ: keinerlei Symptome von klinischem Interesse, keine sichtbare Verletzung oder Infektion in der Harnblase oder auf dem Weg dorthin. Es muss ein hektischer Morgen in der Klinik gewesen sein, denn als die Zytoskopie keinen Hinweis auf eine Erkrankung brachte, vergaßen mich der Arzt und die Krankenschwester. Ich zog mich an, verließ die Klinik und machte mich auf den Weg zu meinem Arbeitsplatz im grotesken, bombastischen Penis der Pitts Cathedral of Learning, jenem schaurigen Wolkenkratzer, der das Kernstück des Campus der University of Pittsburgh bildete. Während ich unbeholfen die Forbes Avenue entlanghumpelte, tropfte aus meinem Penis Blut in meine Unterhose.
Die letzte Untersuchung in Pittsburgh fand bei einem weiteren Urologen statt. Ich hatte mich mittlerweile an »meine Symptome« gewöhnt und schaffte es, trotz der Beschwerden Schlaf zu finden. Ich war in der Lage, mein Leben zu bewältigen, und nahm das Surren des Schmerzes als Hintergrundgeräusch hin. Der Urologe riet mir, mich nicht unterkriegen zu lassen. »Ich finde keine Erklärung für das Gefühl«, sagte er. »Es scheint keine klare Ursache zu geben. Leider ist das nicht ungewöhnlich. Versuchen Sie, es nach Möglichkeit zu ignorieren.« Er stellte ein Rezept für niedrig dosiertes Neurontin aus, ein krampf- und schmerzlösendes Mittel, das mir das Schlafen erleichtern sollte, und schickte mich nach Hause. Ich bin immer noch nicht sicher, ob er das Medikament nicht einfach als Placebo verschrieb. Es schien zu helfen, aber nach ein paar Jahren setzte ich es ohne erkennbare Auswirkungen ab.
Etwa dreizehn Jahre lang änderte sich nichts an meinem Zustand. Keine Diagnose, keine Therapie. Ich ignorierte die Schmerzen, so gut ich konnte, und stürzte mich in die Arbeit. Unter großer Anspannung ertrug ich das gelegentliche Aufflammen des Schmerzes, das mir den Schlaf raubte und mich in meinen täglichen Aktivitäten einschränkte. Die anderen Familienmitglieder hatten ebenfalls mit Widrigkeiten zu kämpfen. Im Jahr 2008 wurde bei meiner Schwiegermutter Eileiterkrebs in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert. Die Mutter meiner Frau ist die Schriftstellerin und Kritikerin Susan Gubar, die gemeinsam mit Sandra Gilbert den feministischen Klassiker The Madwoman in the Attic geschrieben hat, in dem sie die Frage stellt: »Ist der Schreibstift ein metaphorischer Penis?«1 Susan ist eine Naturgewalt und verarbeitete ihre Krankheit literarisch: Mit brutaler Präzision schilderte sie die quälende »Säuberungsoperation« zur Entfernung der sichtbaren Tumoren, gefolgt von einer Chemotherapie, der schmerzhaften Einführung von Drainageschläuchen, die eine postoperative Infektion nicht lindern konnten, und die folgende Ileostomie. In ihrem Buch Memoir of a Debulked Woman nimmt sie auf Autoren und Künstler Bezug, die mit Krankheiten zu kämpfen hatten, darunter Virginia Woolf, die in ihrem Essay »On Beeing Ill« das Schweigen der Literatur zu diesem Thema kritisiert hatte.2 Woolf selbst behandelte das Thema mit der für sie charakteristischen Schicklichkeit. »Nach ihrem Buch zu urteilen, hatte sie offenbar keine Gedärme«, klagte die Schriftstellerin Hilary Mantel, die in »Meeting the Devil« eine brutale Operation geschildert hat, die sie über sich ergehen ließ.3 Susan korrigiert in ihrem Buch Woolfs Unterlassung mit unverblümten Schilderungen ihrer qualvollen Versuche, sich nach der Operation, bei der mehr als dreißig Zentimeter Darm entfernt worden waren, zu entleeren. Sie beschreibt ihre Furcht davor, sich in der Öffentlichkeit zu besudeln, das »Schmerzensbett«, an das sie siebzehn Tage lang gefesselt war, weil die Drainage nicht funktionierte, die aus dem künstlichen Darmausgang tröpfelnden Exkremente und die anhaltende Behinderung durch den Krebs und die Therapie.4 »Mehr als ein halbes Jahr nach der letzten Chemotherapie«, schreibt sie, »waren meine Füße immer noch taub, und ich konnte mich nur wenige Minuten auf den Beinen halten, bevor Schmerzen und Erschöpfung einsetzten.« Trotz alledem hat sie dank eines experimentellen Medikaments, das wirkte, nachdem eine dritte Runde der Chemotherapie versagt hatte, entgegen aller Wahrscheinlichkeit bisher überlebt.
Unterdessen wurde bei ihrer Tochter, meiner Frau Marah, eine Dermoidzyste im linken Eileiter gefunden – jene Art Zyste, der Zähne und Haare wachsen können –, die operativ entfernt werden musste. Marah hat ein hohes Risiko für Brust- und Eierstockkrebs, da sie eine BRCA2-Genmutation von ihrer Mutter geerbt hat, und muss sich regelmäßig Früherkennungsuntersuchungen unterziehen. Mein Schwiegervater musste am offenen Herzen operiert werden, und daheim in England wurde bei meiner Mutter eine frühe Alzheimer-Erkrankung festgestellt.
Ich liste diese schweren Prüfungen nicht auf, um zu sagen, dass meine Familie besonders schwer getroffen wurde – sozusagen eine Familie von Hiobs –, sondern um zu zeigen, dass dies normal ist. Wir alle sind zeitweise mit Krankheit und Beeinträchtigungen konfrontiert. Und jeder kennt Menschen, die unter Krebs, einer Herzkrankheit oder chronischen Schmerzen leiden. In den Zeiten von Covid-19 haben Freunde und Verwandte von uns gelitten oder sind gestorben, und das oft in Isolation. Wir können die Fragilität unserer Gesundheit und all dessen, was von ihr abhängt, unmöglich ignorieren. Selbst die robustesten Menschen müssen irgendwann altern und erfahren, dass ihre Fähigkeiten schwinden, da sie aus der Bevölkerungsgruppe ausscheiden, die von Aktivisten einst als die Gruppe der »zeitweilig körperlich Tüchtigen« bezeichnet worden ist. Jeder, der hofft, alt zu werden, sollte sich auf Behinderungen einstellen. Wenn wir nicht erwarten, dass unser Leben ideal sein muss, versuchen wir nicht, diese Tatsachen und den Körper zu ignorieren. Stattdessen fragen wir, wie wir mit dem Körper leben können, in dem wir stecken und der im Lauf der Zeit seinen Dienst versagen wird.
EINE DER GRUNDLEGENDEN Erkenntnisse der neueren Medizinphilosophie ist, dass wir die Worte achtsam wählen müssen. Ausgehend von der Vorstellung, dass Gesundheit das richtige Funktionieren des Körpers und seiner Teile ist, setzt sich die Einschätzung durch, dass Krankheit – eine Kategorie der Fehlfunktion – nicht dasselbe ist wie Kranksein, also die negativen Auswirkungen der Krankheit auf das konkrete Leben.5 Die Krankheit ist biologisch; das Kranksein ist zumindest teilweise »phänomenologischer« Natur, das heißt eine Frage des Lebensgefühls. Die Philosophen bezeichnen die Frage, ob Krankheiten das Leben verschlechtern oder nicht, als »kontingent«. Wie gut ein Mensch leben kann, wenn sein Körper nicht richtig funktioniert, hängt von den Auswirkungen der Krankheit ab, die überall vom Glück und den sozialen Bedingungen beeinflusst werden. Hat er ungehinderten Zugang zu Medikamenten, so geht eine schwere Krankheit wie Typ-1-Diabetes möglicherweise nicht mit einem quälenden Kranksein einher; hat er hingegen keine Krankenversicherung, so kann ihn eine unbedeutende Infektion oder die Ruhr töten. Die Folge ist, dass das Kranksein je nach Wohlstand, ethnischer Zugehörigkeit und Staatsangehörigkeit noch ungleichmäßiger verteilt ist als die Krankheit.
Behinderungen, seien es lebenslange oder mit dem Alterungsprozess einhergehende Einschränkungen, sind eine noch subtilere Frage. Seit einigen Jahrzehnten bemühen sich die Theoretiker um die Entwicklung eines gesellschaftlichen Verständnisses dessen, was es bedeutet, körperlich behindert zu sein. In ihrem Buch Extraordinary Bodies versucht die Literaturkritikerin Rosemarie Garland-Thomson, »die Behinderung aus der Sphäre der Medizin zu holen und jener der politischen Minderheiten zuzuordnen«.6 Diese Minderheiten setzten die Verabschiedung des Americans with Disabilities Act in den Vereinigten Staaten und des Disability Discrimination Act in Großbritannien durch. Der Kampf für die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung ist ein Kampf für Bürgerrechte.
Es hat eine Weile gedauert, bis diese Vorstellungen in meinem Bereich der Philosophie aufgegriffen wurden, aber die Philosophin Elizabeth Barnes stimmt ihnen in einem neueren Buch zu: »Körperlich behindert zu sein bedeutet nicht, dass man einen fehlerhaften Körper hat, sondern einfach, dass man einen Minderheitenkörper hat.«7 Garland-Thomson und Barnes sind nicht in allen Punkten einer Meinung: Sie schätzen die »Metaphysik« der Behinderung unterschiedlich ein.8 Aber beide Autorinnen – sowie viele Theoretiker und Aktivisten in diesem Bereich – sind sich darin einig, dass körperliche Behinderungen das Leben nicht generell verschlechtern müssen, wenn sie nicht mit Vorurteilen und mangelnden Anpassungen an die Erfordernisse der Betroffenen einhergehen. So wie das Leben als Homosexueller in einer homophoben Kultur kann das Leben eines behinderten Menschen in einer Gesellschaft, die nicht auf seine Bedürfnisse eingeht, schlechter sein als das von Menschen, die nicht unter diesen Bedingungen leben, aber das ist weder naturgegeben noch unvermeidlich, sondern hat seine Ursache im Versagen der Gesellschaft. Eine körperliche Behinderung ist an sich kein Hindernis für ein gutes Leben.
Dieses Postulat sorgt für Verwirrung und stößt auf Widerstand. Philosophen behandeln Behinderungen oft als Paradigma von Verletzung oder Leid.9 Und Menschen mit vollkommen funktionsfähigem Körper empfinden die Vorstellung, taub, blind oder gehbehindert zu sein, möglicherweise als beängstigend. Aber obwohl sie leicht falsch gedeutet werden kann, ist die Behauptung der Aktivisten richtig: Wenn die Lebensumstände entsprechend angepasst werden, muss eine körperliche Behinderung eine Person nicht daran hindern, ein Leben zu führen, das so gut ist wie das der meisten Menschen.
Wenn es sich bei einer körperlichen Behinderung um eine offenkundige Fehlfunktion des Körpers handelt, hat sie keine Ähnlichkeit mit dem Kranksein, sondern mit einer Krankheit. Eine körperliche Fehlfunktion ist eine biologische Einschränkung, und ihre Auswirkungen auf die Lebenserfahrung sind kontingent, hängen also von den Umständen ab. Das bedeutet, dass eine körperliche Behinderung an sich nicht schlecht für uns sein kann. Wenn sie unser Leben verschlechtert, so deshalb, weil sie sich darauf auswirkt, wie wir tatsächlich leben. Eine umfassendere Deutung finden wir in der daoistischen Parabel vom Glück des Bauern, die ich erstmals in Jon J. Muths wunderbarem Bilderbuch Zen Shorts las.10 Als das Pferd des Bauern davonläuft, haben seine Nachbarn Mitgefühl mit ihm. »So ein Pech!«, sagen sie. »Mag sein«, antwortet der Bauer. Das Pferd kehrt in Begleitung von zwei weiteren Pferden zurück. »So ein Glück!«, sagen die Nachbarn. »Mag sein«, antwortet der Bauer. Sein Sohn bricht sich bei dem Versuch, eines der nicht gezähmten Pferde zu reiten, ein Bein. »So ein Pech!«, sagen die Nachbarn. »Mag sein«, antwortet der Bauer. Aufgrund des Beinbruchs kann sein Sohn nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden. »So ein Glück!«, sagen die Nachbarn. »Mag sein«, antwortet der Bauer …
Es kommt also immer darauf an. Ob eine körperliche Behinderung das Leben eines Menschen besser oder schlechter macht, hängt davon ab, wie sie sich auswirkt. Und viele Daten bestätigen, dass Behinderungen selbst in der gegenwärtigen Welt keine furchtbaren Auswirkungen haben: Menschen mit Behinderungen stufen ihr Wohlbefinden nicht signifikant geringer ein als Menschen ohne Behinderungen. »Zahlreiche Forschungsergebnisse belegen, dass Menschen mit verschiedensten Behinderungen normalerweise nicht das Gefühl haben, ihr Leben nicht genießen zu können«, heißt es in einer neueren Studie, in der die vorhandene Literatur ausgewertet wurde.11
Trotzdem hält die Verwirrung an. Es ist unbestreitbar, dass einem Menschen, der auf einen Rollstuhl angewiesen, blind oder taub ist, wertvolle Dinge vorenthalten bleiben: die Freude an einer Bergwanderung, der Anblick der Landschaft, das Zwitschern der Vögel. In diesem Sinne schadet ihm die Behinderung. Wie uns die Parabel vom wechselnden Glück des Bauern zeigt, mag es kollaterale Vorteile geben, aber wie können Behinderungen wie diese unter ansonsten gleichen Bedingungen das menschliche Leben nicht verschlechtern? Geschieht nicht genau das, wenn man uns etwas Gutes wegnimmt?
Die Verwirrung beruht auf Missverständnissen über das Wesen des guten Lebens, die auf Aristoteles zurückgehen. Nicht nur, dass Aristoteles das ideale Leben in den Mittelpunkt rückt, jenes Leben, das man wählen sollte, wenn man alles selbst entscheiden könnte, oder dass er jegliche Behinderung als unvereinbar mit einem guten Leben betrachtet. In seinen Augen ist das beste Leben jenes, das »nirgends einen Mangel offen läßt«.12 Das Glück ist »erstrebenswerter als alle anderen Güter zusammen«, und ihm kann nichts hinzugefügt werden.13 Würde etwas von der eudaimonia fehlen, erklärt Aristoteles, so wäre es eine Verbesserung, würde man dieses Etwas ergänzen; aber dieses Leben ist bereits das beste. Das entspricht seiner Vorstellung von einem einzigen idealen Leben, das um eine einzige Aktivität kreist – nämlich um die Kontemplation oder Betrachtung, wie sich herausstellt, obwohl wir nach Lektüre der ersten neun Bücher der Nikomachischen Ethik erwarten würden, dass es das Leben des erfolgreichen Staatsmannes wäre.
Die zeitgenössischen Autoren, die sich auf Aristoteles berufen, um für das Projekt der Selbsthilfe zu werben, lassen seine Monomanie unter den Tisch fallen. Ein typisches Beispiel ist der Psychologe Jonathan Haidt: »Indem Aristoteles sagt, Glücklichsein (eudaimonía) sei eine der Tugend