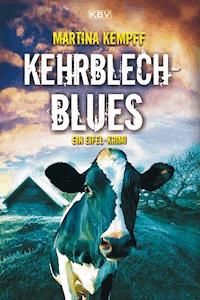8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Starke Frauen, dunkle Zeiten
- Sprache: Deutsch
»Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen!«
Juni 1219. Im Auftrag des Papstes stürmen zehntausend Kreuzfahrer die französische Stadt Marmande, um die ketzerische Glaubensgemeinschaft der Katharer niederzumetzeln. Doch Clara, die Tochter des Herrschers von Toulouse, überlebt wie durch ein Wunder. Angekommen am königlichen Hof in Paris versucht sie Blanka, die Frau des Thronfolgers, dafür zu gewinnen, dem Terror gegen die Katharer ein Ende zu bereiten. Aber Blankas Gemahl hat geschworen, die Ketzer mit allen Mitteln zu bekämpfen. Die Eintracht zwischen den beiden Frauen wird auf eine schwere Probe gestellt, und schließlich müssen sie im Moment größter Gefahr eine folgenschwere Entscheidung treffen …
Dieser historische Roman erschien vormals unter dem Titel "Die Kathedrale der Ketzerin".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen!«
Juni 1219. Im Auftrag des Papstes stürmen zehntausend Kreuzfahrer die französische Stadt Marmande, um die ketzerische Glaubensgemeinschaft der Katharer niederzumetzeln. Doch Clara, die Tochter des Herrschers von Toulouse, überlebt wie durch ein Wunder.
Angekommen am königlichen Hof in Paris versucht sie Blanka, die Frau des Thronfolgers, dafür zu gewinnen, dem Terror gegen die Katharer ein Ende zu bereiten. Aber Blankas Gemahl hat geschworen, die Ketzer mit allen Mitteln zu bekämpfen.
Die Eintracht zwischen den beiden Frauen wird auf eine schwere Probe gestellt, und schließlich müssen sie im Moment größter Gefahr eine folgenschwere Entscheidung treffen…
Dieser historische Roman erschien vormals unter dem Titel »Die Kathedrale der Kertzerin«.
Über Martina Kempff
Martina Kempff ist Autorin, Übersetzerin und freie Journalistin. Sie war unter anderem als Redakteurin bei der Berliner Morgenpost und als Reporterin bei Welt und Bunte tätig, bevor sie beschloss sich künftig dem Schreiben von Büchern zu widmen. Ihre historischen Romane zeichnen sich durch hervorragende Recherche und außergewöhnliche Heldinnen aus. Martina Kempff lebt im Bergischen Land.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Martina Kempff
Das Leid der Ketzerin
Historischer Roman
Für Gisela Leuer
Das neue Jahrhundert wurde von Sturmglocken eingeläutet. Die religiösen Bewegungen registrierten es wie ein Seismograf. Unruhen und Umwälzungen erfassten die Königreiche und Städte in ganz Europa … Nirgends mehr regierte ein König oder Fürst isoliert von den anderen … Im Languedoc rangen die Könige von Aragon, Frankreich und England um Macht und Einfluss, dazu die einheimischen Fürsten wie die Grafen von Toulouse und der Provence; eine kastilische Königstochter regierte mit fester Hand in Frankreich. Wechselnde Ehebündnisse und erfüllte oder enttäuschte Anwartschaften auf dieses oder jenes Erbe hielten das Machtkarussell in Bewegung. Die Herren heirateten wiederholt und die Damen ebenso und machten alles zu verwickelt, als dass es in Kürze dargestellt werden könnte. Doch mit jeder Ehe verknoteten sich die regionalen oder überregionalen Machtverhältnisse neu: ein chaotisches System, über das niemand einen vollständigen Überblick besaß und das sich irgendwie selbst regierte.
Johannes Fried »Das Mittelalter«
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Personen
Prolog
1. Trennung
2. Entscheidung
3. Aufbruch
4. Irrungen
5. Tod
6. Liebe
7. Abwege
8. Intrigen
9. Gier
10. Sinneswechsel
11. Aussöhnung
Epilog
Nachwort
Zeittafel
Glossar
Quellen
Impressum
Personen
Blanka von Kastilien
französische Königin, Gemahlin Ludwigs VIII.
Clara
uneheliche Tochter von Graf Raimund VI. von Toulouse, Hofdame von Blanka
Ludwig VIII.
französischer König, Gemahl Blankas
Graf Theo bald von Champagne
wichtigster Vasall Ludwigs VIII. und ein begnadeter Troubadour
König Philipp II. August von Frankreich
Vater Ludwigs VIII.
Königin Ingeborg
Philipps verstoßene und später wieder in Gnaden aufgenommene Gemahlin
Graf Raimund VI von Toulouse
Herr über Okzitanien und Claras Vater
Graf Raimund VII. von Toulouse
Claras Bruder und Gegenspieler des französischen Königs
Felizian
ein Katharer
Lisette
die Doppelgängerin der Königin
Antoine
Steinmetz und Lisettes Ehemann
Etienne
ein Troubadour aus Okzitanien
Ermine
eine Perfecta
Pierre Isarn
Katharer-Bischof von Carcassonne
Peter von Braine (Mauclerc)
Herzog der Bretagne mit angelsächsischen Kontakten und Widersacher des Königshauses
Johanna
Tochter Graf Raimunds VII. von Toulouse
Alexander
Perfectus und Erzieher Johannas
Franz von Assisi
Prolog
Barone und Damen und kleine Kinder,
Männer und Frauen, alle nackt und tot,
In Stücke zerhauen mit blutigen Schwertern.
Herausgerissne Lebern und Herzen
liegen umher, wie zum Vergnügen verteilt.
Rot glänzt der Boden, als sei blutiger Regen gefallen,
Die Stadt versinkt in Feuer und Asche.
Anonymer zeitgenössischer Troubadour
über das Massaker von Marmande
Ende Mai 1219
Bist du von allen guten Geistern verlassen?«
Raimund von Toulouse packte die Tochter, die ihm siebzehn Jahre zuvor eine seiner Gespielinnen mit den Worten: »Nimm den Balg oder ich ertränke ihn«, in den Arm gedrückt hatte, und schüttelte sie.
»Hier herrscht Krieg, Clara!«, brüllte der Graf. »Was fällt dir ein, den sicheren französischen Hof zu verlassen und zu uns in den gefährlichen Süden zu kommen?«
»Simon von Montfort ist doch tot«, wisperte Clara. »Ich dachte, damit ist alles vorbei.«
»Nichts ist vorbei!«, donnerte Graf Raimund. Er zog seine gewaltigen Pranken zurück, die sich in Claras Schultern gegraben hatten. »Du musst augenblicklich nach Paris zurück!«
Clara warf einen flehenden Blick auf ihren Halbbruder, der in einem ordentlichen Ehebett gezeugt und nach dem Vater benannt worden war. Bei ihrer Ankunft hatte er ihr zugeflüstert, wie wunderschön sie doch erblüht sei. Das großartige Gefühl, am Grafenhof von Toulouse willkommen zu sein, hätte Clara gern weiter ausgekostet. Die Heftigkeit des Vaters erschreckte sie. Er hätte die so lange abwesende Tochter nicht schütteln, sondern in die Arme schließen sollen!
»Darf ich nicht zu Hause bleiben?«
Sie biss sich auf die Lippen. Die Frage klang eine Spur zu weinerlich. Wahrscheinlich, weil sie nicht ganz von Herzen kam. Claras Zuhause war schließlich der französische Königshof in Paris, an dem sie seit zehn Jahren in der Obhut der Kronprinzessin Blanka von Kastilien lebte. Die vierzehn Jahre Altere ersetzte Clara gewissermaßen die so früh aus ihrem Leben entschwundene Mutter.
Aber Blanka war auch Mutter vieler eigener Kinder, von denen andauernd eines starb. Woran sie sich offenbar nicht gewöhnen konnte. Als kürzlich ihr neunjähriger Liebling Philipp das Zeitliche gesegnet hatte, ihre größte Hoffnung für Englands und Frankreichs Throne, war sie für acht Wochen in ihren Gemächern verschwunden, hatte Claras Gesellschaft abgelehnt und sich nur von ihrem geliebten Gemahl Kronprinz Ludwig trösten lassen. So gründlich, dass sie danach wieder guter Hoffnung und somit in einer Sphäre war, in die Clara ihr nicht folgen konnte.
Am Königshof war es überhaupt traurig und langweilig geworden. Viele Gefährtinnen hatten geheiratet und die meisten der früher so fröhlichen jungen Männer das Kreuz geschultert, um irgendwelche Häretiker im benachbarten Okzitanien auszurotten, in Graf Raimunds und somit auch Claras Heimatland. Das Unbehagen, auch kirchentreue Christen ins Jenseits zu schicken, war der frohen Aussicht gewichen, Ablass für Sünden zu erhalten, ohne sich auf eine gefahrvolle Reise ins Heilige Land begeben zu müssen.
»Wir sind mittendrin, Clara, und es wird immer schlimmer«, meldete sich jetzt ihr Halbbruder Raimund zu Wort. »Simons Sohn Amaury wütet wie sein Vater und wird nicht ruhen, bis wir allesamt vernichtet sind. Wir können froh sein, Toulouse zurückerobert zu haben.«
»Wie unverantwortlich von meiner Nichte Blanka, dich ziehen zu lassen!«, schimpfte der alte Graf. Er fuhr sich durch den kurzen eisengrauen Schöpf, bis dieser wie ein Stachelkranz sein Haupt krönte. Am liebsten hätte er sich jedes Haar einzeln ausgerissen. Das würde aber auch nichts an dem traurigen Gedanken ändern, seine Tochter nur bei jenen in Sicherheit zu wissen, die sein Land und ihn zerstören wollten.
Clara senkte die Lider.
»Blanka weiß nicht, dass ich hier bin«, flüsterte sie fast unhörbar.
»Du hast dich ohne Erlaubnis vom Hof entfernt?«
Clara hob trotzig das Kinn.
»Und du beschützt ohne Erlaubnis Häretiker?«, fragte sie herausfordernd zurück.
Ihr Vater holte mit der rechten Hand aus. Clara zuckte zusammen. Sie rechnete mit einem Schlag, der sie in die hinterste Ecke des Saals befördern würde, doch der Graf stapfte mit zitternder hocherhobener Hand an ihr vorbei und riss die Tür auf.
»Schick sie augenblicklich zu den Franzosen zurück!«, brüllte er seinen Sohn an und knallte die Tür hinter sich ins Schloss.
Eine Stunde später saß Clara bereits wieder auf der schwarzen Stute, mit der sie am frühen Morgen in Toulouse eingetroffen war.
»Wo sind die Männer, die dich hergebracht haben?«, fragte Raimund, der ihr Pferd vor der Burg am Zügel hielt.
Clara atmete tief das süße Aroma der weißlichen Blüten des Geißblatts ein, das sich an einer Hecke vor dem Gemäuer der Burg in die Höhe rankte. Zu späterer Stunde wird es noch betörender duften, kamen mit einem Mal Erinnerungen an laue Frühlingstage ihrer Kindheit auf. Das Geißblatt im Mai roch noch stärker als der Lavendel im Juli.
»Nun, wo sind sie, deine Ritter?«, hakte Raimund ungeduldig nach.
Sie würde der Frage nicht entkommen können. Beziehungsreich sah sie vom Pferd auf ihren Bruder hinab und ließ ihr Schweigen für sich sprechen.
Raimunds schönes dunkles Antlitz verdüsterte sich.
»Das darf nicht wahr sein!«, brachte er ungläubig hervor. »Du hast getarnten Kreuzrittern die Möglichkeit geboten, in Toulouse einzureiten?«
Genau das hatte sie getan, und sie begann sich deswegen schuldig zu fühlen. Aber über Freund und Feind hatte sie sich keine Gedanken gemacht, als sie am Königshof nach männlichem Schutz für ihre Reise Ausschau gehalten hatte. Sie hatte vor allem Blankas Sorge hervorrufen, die Kronprinzessin für die vermeintliche Gleichgültigkeit ihr gegenüber strafen wollen. Zudem hatten die dunklen und kalten Pariser Wintermonate wieder einmal Sehnsucht nach südlicher Wärme und fröhlicher Leichtigkeit in ihr aufkommen lassen. In ihr, die in die leuchtenden Farben des Südens hineingeboren war, hatte das graue Einerlei jenseits des Cité-Palasts Schwermut aufkommen lassen. Das nach Fäulnis riechende Wasser der Seine ekelte sie ebenso an wie der Regen, der den gesamten März über unaufhörlich Kot, tote Ratten und faulenden Unrat durch die Gassen der Stadt geschwemmt hatte. Selbst wenn südlich der Garonne keine liebende Mutter ihrer harrte: Der Familiensitz in Toulouse war ihr als überaus erstrebenswertes Ziel erschienen.
Clara interessierte sich nicht für Politik und verstand nichts davon. Sie wusste nur so viel, dass sich England standfest weigerte, französisch zu werden, und sich irgendwelche Ketzer dem Papst widersetzten und deshalb umgebracht werden sollten. Mit ihrem Leben, ihren Wünschen, ihrer Sehnsucht und ihrer Zukunft hatte dies alles nichts zu tun.
Hatte es aber doch, wie sie zu ihrem Entsetzen nach der Ankunft in Toulouse feststellen musste. Kaum war sie mit ihren fünf Begleitern durch die Tore der Stadt geritten, wendeten diese plötzlich ihre Mäntel und wiesen die mit einem roten Kreuz auf der rechten Schulter bestickten Innenseiten vor. Mit höflichem Hohn dankten sie der Grafentochter für den Schutz, den ihr Name ihnen gewährt hatte, und sprengten in die Stadt davon.
»Du hast unsere Feinde zu uns gebracht?«, hakte Raimund nach. Seine sonst so klangvolle Stimme war schneidend scharf.
»Wer anders hätte mich denn begleiten sollen?«, gab Clara spitz zurück. »Unser Haus hat offensichtlich keine Freunde mehr im Norden. Auch deshalb wollte ich zu meiner wirklichen Familie zurückkehren. Hätte ich mich etwa ganz allein auf den Weg machen sollen?«
»Du hättest gar nicht erst kommen dürfen.«
»Das werde ich auch nie wieder tun!«, fauchte Clara. »Nie wieder werdet ihr eure Augen auf mich richten, auf die Schwester, die Tochter, die wie eine räudige Katze aus dem Haus ihrer Geburt gejagt wird! Ich wünschte mir nicht einmal, ich wäre tot, denn ihr würdet mein Hinscheiden gewiss nicht beklagen, sondern feiern!«
Sie brach in Tränen aus.
»Steig ab, Clara«, sagte Raimund leise. Sie schüttelte den Kopf und schluchzte weiter: »Wo ich nicht gewünscht werde, mag ich nicht verbleiben.«
Raimund sog die Luft tief ein, ohne der duftenden Lieblichkeit des Geißblatts gewahr zu werden.
»Das sollst du auch nicht. Ich will nur von Angesicht zu Angesicht mit dir reden, Clara«, gab er tonlos zurück. »Du hast offenbar weder die geringste Ahnung von diesem Krieg noch von den Gefahren, in die du andere gebracht und dich selbst begeben hast. Wahrscheinlich weißt du nicht einmal, dass ich letztes Jahr diese Stadt gemeinsam mit allen Bewohnern sechs Wochen lang erbittert gegen die Kreuzfahrer verteidigt habe.« Seine Stimme wurde lauter: »Kreuzfahrer! Hah! Sag mir doch: Wie christlich sind denn Ritter, die Christenmenschen abschlachten?«
Clara schüttelte abermals den Kopf. Mit dieser Frage konnte sie überhaupt nichts anfangen.
»Ketzer«, murmelte sie unsicher, an grauenerregende finstere Gestalten denkend, die in Mondnächten dem Teufel huldigten und ihm jene kleinen Kinder zum Opfer darbrachten, deren Blut sie zuvor getrunken hatten. Böse Menschen, die mit der Macht des Kreuzes bekämpft werden mussten.
»Wir sind keine Ketzer, Clara, wir lassen nur jeden, der hier ehrlich leben und arbeiten will und keinen anderen stört, in Ruhe. Das nimmt uns die Kirche übel. Sie fürchtet um ihre Macht und ihren Zehnten und hat unserem ganzen Landstrich den Krieg erklärt.«
Seine Worte verwirrten Clara nur noch mehr. Sie schwieg. Raimund hob sie aus dem Sattel, küsste sie sanft auf den Scheitel und fuhr fort: »Dir ist ganz offensichtlich unbekannt, was tatsächlich auf dem Spiel steht und was den Papst bewogen hat, zu diesem …«, er machte eine kleine Pause und brachte dann zwischen zusammengebissenen Zähnen erbittert hervor: »… Kreuzzug … aufzurufen.«
Mit beiden Beinen wieder auf festem Grund stehend, meldete sich in Clara abermals die Widerspenstigkeit, welcher Blanka sie so oft geziehen hatte.
»Der Heilige Vater wird seinen Grund dafür gehabt haben, unseren Vater zwei Mal zu exkommunizieren!«, gab sie bockig zurück. Trotz – oder vielleicht wegen – seiner harten Worte bewunderte sie diesen Bruder, der von eindrucksvollerer Gestalt und feinerem Wesen war als jeder Ritter, den sie kannte. Er durfte sie nicht für dumm halten, und so setzte sie hinzu: »Der Heilige Vater ist Gottes Stellvertreter auf Erden und macht keine Fehler, oder zweifelst du das etwa an?«
»Wenn dem so wäre, würde ich es ganz bestimmt nicht dir verkünden«, erwiderte Raimund, rief einen Ritter herbei und flüsterte ihm etwas zu. Dann nahm er seine Schwester an die Hand.
»Das Leben ist weder einfach noch gerecht, Clara«, sagte er, als er sie zu einer steinernen Bank an der Burgmauer geleitete und sich neben ihr darauf niederließ. Er blickte über das erblühte Land, über die ausgedehnten Weinberge, auf denen unzählige ameisengroße Menschen an den Reben arbeiteten, über das Tal, in dem die Pastel-Pflanze Färberwaid blühte, aus deren Blättern sich Indigo gewinnen ließ, jenes blaue Gold, das in die ganze Welt gesandt wurde und Toulouse zu großem Reichtum verholfen hatte. Reichtum, an dem der Mann in Rom ebenfalls teilhaben wollte.
»Auch du bist ganz sicherlich schon mal von einem Menschen enttäuscht worden«, sagte Raimund. Clara dachte an Blankas Zurückweisung und nickte heftig.
»Siehst du. Der Heilige Vater ist auch nur ein Mensch. Er kann weder in die Zukunft sehen noch abschätzen, wie sich die Welt entwickeln wird. Als er vor zehn Jahren zum Kreuzzug gegen die Albigenser aufrief, hat er bestimmt nicht damit gerechnet, dass sämtliche Bewohner von Béziers abgeschlachtet werden würden, sogar jene, die in Gottes Kirche Asyl gesucht hatten.«
Clara blickte entsetzt auf. »Waren das alles Ketzer?«
Raimund lachte bitter. »Alle siebentausend Bewohner der Stadt und die Landbewohner, die in ihr Schutz gesucht hatten? Natürlich nicht. Es waren Christen wie du und ich. Die Barone aus Frankreich hatten zunächst auch noch Skrupel. Sie fragten bei der römischen Kirche an, wie sie denn die Ketzer von den Christen und Juden unterscheiden könnten, da in der Stadt doch alle friedlich miteinander lebten und arbeiteten. Da forderte ein Stellvertreter von Gottes Stellvertreter deine so genannten Kreuzritter auf, solch kleinliche Bedenken abzulegen und die gesamte Bevölkerung abzuschlachten, Männer, Frauen, Kinder. Gott werde die Seinen schon erkennen und für sie sorgen, hat er gesagt. Und dann gab es kein Halten. Alle wurden ermordet. Beziérs besteht nicht mehr. Und Toulouse droht das gleiche Schicksal, wenn wir den Kreuzfahrern das Tor öffnen, so wie du es getan hast.«
Clara schüttelte sich. Wo war sie nur hineingeraten! Sie sprang auf.
»Ich will hier weg!«, stieß sie hervor.
»Dafür sorge ich gerade.«
Raimund stand auf und winkte den Ritter herbei, der, von drei Männern flankiert, näher trat.
»Es tut mir Leid, Clara, ich kann dir kein größeres Gefolge mitgeben. Aber du begreifst sicherlich, dass hier jeder wehrbare Mann gebraucht wird. Gute Reise, meine Schwester, Gott segne dich und schütze dich vor Schaden und deiner Unwissenheit!«
In Gedanken versunken, achtete Clara weder auf die Landschaft um sich herum noch auf den Sonnenstand. Daher entging ihr, dass die Männer statt der streng nördlichen Richtung eine nordwestliche einnahmen. Die Getreuen des jungen Raimund nutzten ihren Auftrag, um eine vordringlichere Aufgabe zu erledigen: nämlich drei der fünf Kreuzritter einzufangen, die am Mittag zwei Häuser in Toulouse niedergebrannt und ein Dutzend Frauen und Kinder ermordet hatten. Einer der Kreuzträger hatte sein Ende unter einem brennenden Balken gefunden; ein anderer war bei der Flucht aus der Stadt von einem uralten Mann aufgehalten worden, der sich seinem Pferd einfach in den Weg geworfen hatte. Während der Greis von Pferdehufen zertrampelt wurde, stürzte sich eine wütende Menge auf den einstmals so fröhlichen Pariser Höfling, von dem wenige Minuten später nur noch ein blutender Rumpf übrig blieb. Die anderen drei Kreuzritter hatten entkommen können, und auf sie war ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt.
Claras Begleiter waren überzeugt, die Franzosen würden sich zum königlichen Heer absetzen, und gaben ihren Pferden die Sporen. Sie wussten, dass sich Kronprinz Ludwig von Paris aus in südwestliche Richtung in Marsch gesetzt hatte, um selbst endlich auch dem päpstlichen Gebot zum Kreuzzug gegen die Häretiker nachzukommen.
Ludwigs Vater, der französische König Philipp II. August, hatte sich bislang noch weitgehend aus dem zehnjährigen Streit zwischen Papst und Häretikern herausgehalten und trotz Drängen des Papstes abgelehnt, am ersten Kreuzzug gegen die Ketzer teilzunehmen. Schließlich hatten ihm seine Feldzüge gegen den englischen Johann ohne Land mehr Kopfschmerzen bereitet als die Albigenser, in seinen Augen ungefährliche schwärmerische Trottel und die ganze Aufregung nicht wert, die um sie gemacht wurde. Allerdings hatte er gleich den Häretikern – wenn auch aus anderen Gründen – ebenfalls einiges am Verhalten des Papstes auszusetzen, der ihn selbst ja schon einmal exkommuniziert und damit sein Land an den Rand eines Abgrundes getrieben hatte.
Mit einzelnen Päpsten hatte er gewisse Probleme, doch die Autorität des Heiligen Stuhls stellte er nicht grundsätzlich infrage. Als Johann ohne Land vor seinem Tod die Unverfrorenheit besaß, dem Papst England zu übereignen, starb zwar König Philipps Traum von einem französisch regierten Albion, nicht aber der von einer gehörigen Ausweitung seines Reichsgebietes. Und so reizte ihn jetzt die Aussicht, mit heiligem Segen das einstige Septimanien, um das schon Karl der Große und dessen Erben erbittert gekämpft hatten, der französischen Krone einzuverleiben. Zudem klang Krieg gegen die Ketzer erhebender als Eroberungsfeldzug und würde sich den raffgierigen französischen Baronen, deren Unterstützung er brauchte, wesentlich besser verkaufen lassen, da reiche Beute mit und in den Burgen der ketzerfreundlichen Okzitanier zu erwarten war.
»Die Grafen von Toulouse sind seit jeher gefährlich. Einer hat einst gar das gesamte Karolingerreich zusammenbrechen lassen«, verkündete König Philipp in Gegenwart seines Sohnes Ludwig. Dieser erklärte sich sofort bereit, dem derzeitigen Grafen von Toulouse, einem Oheim seiner Gemahlin Blanka, die Stirn zu bieten. Der böse alte Raimund sollte dafür büßen, Ketzern, die das römische Christentum bedrohten, Zuflucht zu gewähren. Er sollte seine Länder verlieren, somit auch den Gewinn aus allen reichen Gaben der südlichen Erde, und sämtlicher Ämter enthoben werden. Mit dem Segen des Papstes, zehntausend Bogenschützen und sechshundert Rittern brach Ludwig frohgemut gen Süden auf.
Clara begann unruhig zu werden, als ihre Begleiter nach Einbruch der Dämmerung keine Anstalten machten, eine passende Unterkunft für die Nacht zu finden. Auf der Hinreise hatte sie in Klöstern, Herbergen, Bauernhöfen und einmal in einer Scheune geschlafen, aber immer ein Dach über dem Kopf gehabt. Doch ihr Drängen stieß bei den Männern auf taube Ohren und ihre Hinweise aufpassende Gebäude wurden ignoriert. So musste sie sich mit einem Nachtlager am Fuße eines Machandelbaums unter freiem Himmel neben einem Fluss begnügen, den sie auf der Hinreise nicht wahrgenommen hatte. Wahrend sie sich in ihren Reisemantel einwickelte, schwor sie sich, eine solche Behandlung in der nächsten Nacht keinesfalls zu dulden. Lange noch starrte sie in den Sternenreichen Himmel, den sie im verräucherten Paris nie so klar gesehen hatte, und grübelte darüber nach, wie sie ihre Begleiter in der nächsten Nacht dazu bringen könnte, eine Herberge aufzusuchen.
Doch an die nächste Nacht würde sich Clara später ebenso wenig erinnern können wie an die Angreifer, die am Tag darauf in der Hitze des Mittags am Rande eines in früher Blüte befindlichen Lavendelfeldes mit erhobenen Lanzen und blanken Schwertern plötzlich das kleine Grüppchen umzingelten. Der Angriff erfolgte rasend schnell. Als Clara vom Pferd stürzte, spürte sie einen brennenden Schmerz in der Brust, und dann wurde es am helllichten Tag stockfinstere Nacht um sie.
Eine Fliege brummte um ihren Kopf. Clara öffnete verwirrt die Augen. Sie lag auf einem weichen Bett in einer winzigen Kammer. Durch die Fensterluke stahl sich ein schmaler Sonnenstrahl und tauchte eine schwarz gekleidete alte Frau in staubiges Licht.
»Sei nicht traurig, Gott der Herr ist mit dir, mein Kind«, sagte sie, strich Clara wie segnend über die Stirn und hob vorsichtig ihren Kopf an.
»Du musst jetzt etwas trinken, warte, ich helfe dir beim Aufsetzen. Langsam, langsam, du bist immer noch sehr geschwächt.«
»Wo bin ich? Was ist geschehen?«, krächzte Clara kaum verständlich, nachdem sie den an ihre Lippen gereichten Becher geleert hatte. Sie blickte an sich hinab. Noch nie hatte sie im Bett Kleidung getragen, schon gar kein dunkles Linnen. Warum sollte sie denn trauern? Sie schlug nach der dicken schwarzen Schmeißfliege auf ihrer Brust. Laut summend entfleuchte das Insekt.
»Du bist in Sicherheit. In Marmande bei guten Menschen«, erwiderte die Frau freundlich lächelnd. Behutsam half sie Clara in das Kissen zurück und strich die Bettdecke glatt. Mit ihren gichtigen Fingern stülpte sie dann den leeren Becher blitzschnell über die Fliege, die sich auf dem kleinen Tisch aus dunklem grob gezimmertem Holz neben dem Bett niedergelassen hatte. Verwundert beobachtete Clara, wie vorsichtig die alte Frau den Becher über den Rand des Tischleins schob, auf ihre Handfläche setzte und dann zur schmalen Fensterluke schritt, wo sie das eklige kleine Tier davonfliegen ließ.
»Jetzt ist das Insekt hoffentlich in Sicherheit«, sagte die Frau. »Wie du. Die Männer des Königs glaubten dich tot und haben dich in die Garonne geworfen. Ganz in der Nähe fischten zwei unserer Credentes. Die haben dich aus dem Wasser herausgezogen. Es ist ihnen gelungen, dich an der Belagerung vorbei hierher zubringen. Eine gute Frau hat dich gepflegt. Und mich herbeigerufen, um dir das Consolamentum zu spenden, wenn du es denn wünschst. Ich bin eine Perfecta. Du siehst, ich trage das Johannes-Evangelium bei mir.«
Sie deutete auf die schmale Schriftrolle, die an ihrem Gürtel baumelte.
Männer des Königs? Clara mühte sich, den Worten der Alten Sinn zu entnehmen. Marmande, Credentes, Perfecta, Belagerung, Consolamentum – wie die unschlagbare Fliege in der Kammer schwirrten ihr diese unbekannten Begriffe im Kopf umher. Was war mit der Welt geschehen, die sie bislang gekannt hatte?
»Wo sind meine Männer?«, fragte sie und setzte unsicher hinzu: »Die des Grafen von Toulouse?«
In den von vielen Fältchen umrahmten blassblauen Augen der Alten erschien ein Leuchten.
»Gott schütze unseren Retter, den edlen Grafen von Toulouse«, sagte sie, ohne auf Claras Frage einzugehen. »Ohne ihn könnten wir die Lehre der liebenden Gottheit nicht verbreiten und keine Seelen mehr für den Eintritt in das Licht der himmlischen Sphäre vorbereiten.«
»Mein Vater«, murmelte Clara, richtete sich mühsam wieder auf und hob die Rechte, um sich zu bekreuzigen. Rasch griff die Alte nach ihrer Hand.
»Lass ab vom Zeichen des Satans«, riet sie freundlich. Clara sah sie verständnislos an, sank wieder in das Kissen zurück und schloss die Augen.
Sie wusste immer noch nicht, was geschehen war, wer sie angegriffen hatte, wie viel Zeit vergangen war, wo sie sich befand, was mit ihrem Gefolge geschehen war und warum sie sich nicht bekreuzigen sollte. Und warum die alte Frau das Leben einer Fliege gerettet hatte, eines Insekts, das vermutlich nur dazu erschaffen worden war, um Menschen zu quälen. Doch jetzt umgaben sie Ruhe und Frieden. Sobald sie zu Kräften gelangt war, würde sich schon alles aufklären. Sie würde die vertraute Welt wieder finden und sich dem nächsten Zug anschließen, der nach Paris reiste.
Schon am nächsten Tag erfuhr sie, dass an eine Reise nicht zu denken war. Das Heer des Königs hatte Marmande umzingelt, und es war nur eine Frage der Zeit, wann auch diese Stadt fiel. Dies also war der Krieg, von dem sie nichts verstand, von dem Raimund gesprochen hatte und der irgendwie mit dem Kreuzzug gegen die Häretiker zusammenhing, zu dem der Papst aufgerufen hatte. Ein Krieg, der sie nie interessiert hatte und der ganz plötzlich sehr viel mit ihr zu tun hatte. Wie nur war sie da hineingeraten?
»Sie werden uns alle töten – wie damals in Béziers«, bemerkte die junge Frau, die Clara versorgte, mit einer Gleichmut, als spräche sie über das Wetter. Sie hob ein Kleinkind auf, das in die Kammer gekrabbelt war, und legte es sich an die Brust.
»Béziers!« Wo siebentausend Menschen ohne Rücksicht auf ihren Glauben abgeschlachtet worden waren, erinnerte sich Clara an Raimunds Worte. Ihr wurde schwarz vor Augen. Sie versuchte aufzustehen. Ihre Stimme überschlug sich: »Das ist doch die Hölle! Das dürfen wir nicht geschehen lassen! Wir müssen hier sofort weg!«
»Ja, meine Freundin, bald werden wir wieder daheim sein, im Himmelreich. Aber leg dich doch hin, du bist noch zu schwach.«
»Ich will nicht sterben!«
»Bete und finde Ruhe! Nur durch den Tod kannst du die Macht des Satans brechen, der dich im Fleisch gefangen hält. Diese unzulängliche böse Welt gehört ihm, nicht Gott dem Herrn, dem am Wohl aller Seelen gelegen ist, der Mitgefühl, wahre Hingabe und Verwandlung unseres Wesens fördert. Fürchte den Tod nicht, meine Freundin. Er wird dir die Erlösung bringen, das wahrhaftige Leben im Reiche des Herrn. Lass dir von der alten Martha das Consolamentum erteilen, auf dass auch du nicht wieder auf diese Welt des Leidens und Elends zurückkehren musst.«
Clara schwieg. Die junge Frau sprach wirres Zeug. Doch auch die Alte hatte seltsam geredet. Die Menschen, die ihr das Leben gerettet hatten, schienen sich in einer anderen Welt zu befinden, ein sehr befremdliches Bild von Gott zu haben und den eigenen Tod zu begrüßen. Wahrscheinlich hatten diese bösen Ketzer sie verblendet.
»Warum nur liefert ihr die Häretiker den Männern des Königs nicht einfach aus?«, schlug sie flüsternd vor. »Dann könnt ihr gewiss euer Leben und das der unschuldigen Kinder retten!«
Die junge Frau starrte Clara einen Augenblick lang an, lächelte dann sanft und bemerkte gedehnt: »Ja, das sind wohl Namen, die man uns gibt und die uns nichts bedeuten: Häretiker, Katharer, Albigenser, Ketzer, Bogumilen, Textores, aber wir sind überhaupt nichts Besonderes und verdienen nicht, mit solch vielfältigen Bezeichnungen belegt zu werden. Wir mühen uns schlichtweg darum, gute Menschen zu sein, rechtschaffen zu handeln, den Nächsten zu lieben, andächtig zu beten und fleißig zu arbeiten. Schwer genug in diesen bösen Zeiten.«
Damit entschwand sie leise aus der Kammer und überließ Clara ihrem Entsetzen, in einem Ketzerhaus gelandet zu sein. Ketzerhaus, wiederholte sie den Gedanken; das klang viel schlimmer, als es sich anfühlte. Früher hätte sie sich darunter eine dunkle Höhle mit bedrohlichen Gestalten, krächzenden Raben, umherhuschenden schwarzen Katzen und Abbildern des Satans vorgestellt. Sie sah sich in der ungeschmückten Kammer mit den weiß gekalkten Wänden und dem bunten Teppich auf dem Boden um und schüttelte den Kopf. Diese barmherzigen Menschen, die sich zwar nicht bekreuzigten, aber sie, eine völlig Fremde, liebevoll pflegten und sich Umstände damit machten, einer Fliege das Leben zu retten, sollten eine vergleichbare Bedrohung für die Christenheit darstellen wie die grausamen Muselmanen?
Und doch muss ich hier weg, dachte Clara, fort aus dem Ketzerhaus und aus diesem Marmande. Ich gehöre doch zum Hof des Königs! Seine Ritter sollen mich nicht töten, sondern beschützen! Aber Männer des Königs haben mich in die Garonne geworfen. Sie wussten eben nicht, wer ich bin, hielten mich für eine Ketzerin. Aber wer bin ich wirklich? Weiß ich es denn selbst? Ich bin die Tochter des Grafen von Toulouse. Und Königin Blankas Hofdame, ihr Schützling. Das geht offenbar nicht zusammen. Ich muss fort von hier – zu Ludwigs Männern. Der Kronprinz, den man den Löwen nennt, ist Blankas Gemahl; er wird mich schon hier herausholen und in Sicherheit bringen.
Sie sprang aus dem Bett, doch die Beine versagten ihr den Dienst. Nach zwei Schritten vom Bett zur Tür stolperte sie über ihre eigenen Füße, brach zusammen und riss im Fallen einen schweren Wasserkrug vom Sims.
Die junge Frau stürzte herbei.
»Du musst dich schonen«, sagte sie und schob mit dem Fuß die Scherben beiseite.
»Nein!«, schrie Clara. »Ich gehöre nicht hierher! Ich muss gehen, und ich werde gehen! Sofort!«
Ihre Augen flackerten, wie von wildem Feuer gespeist. Schwer auf die Schulter der viel kleineren jungen Frau gestützt, tat sie einen weiteren Schritt zur Tür. Dann lagen beide Frauen auf dem Boden.
»Sofort«, sagte die junge Frau leicht keuchend »sollten wir auf später verschieben.«
Sie sprach noch etwas, doch ihre Worte gingen in einem dumpfen Dröhnen unter, das sich mit einem Mal in ein ungeheures Getöse verwandelte. Bersten, Krachen, ohrenbetäubendes Pfeifen. Dazwischen aus unzähligen Kehlen Geheul von Mensch und Tier. Es kam näher, schien in einen einzigen höllischen Schrei zusammenzufließen, der das Mark in den Gliedern erstarren ließ. Als wäre der Himmel auf die Erde gekracht, erbebte der Boden unter den beiden Frauen, die sich angstvoll aneinanderklammerten und entsetzt zu der von einem Feuerschein erhellten Fensterluke blickten, durch die bereits erste Funken stoben.
»Mein Kind!«, schrie die junge Frau. Sie riss sich von Clara los und stürzte, den Rock fast bis zur Mitte gerafft, aus der Kammer.
Wäre Zeit für einen Gedanken gewesen, hätte Clara an ein Wunder geglaubt. Ohne auf die eben noch so nachgiebigen Beine zu achten, sprang sie auf, hetzte in den schmalen dunklen Gang und gelangte, wie getragen von drängenden Körpern, die steilen Stufen hinunter zum Ausgang.
Sie wusste nicht, wohin, ließ sich vom Strom der Flüchtenden mitreißen. Sie wankte, konnte aber nicht fallen und wurde wie ein welkes Blatt von einer zur anderen Seite getrieben. Beißender Rauch fraß sich in ihre Kehle; sie hustete, stolperte wieder und wurde schließlich rücklings in eine kleine Nische gedrängt. Raues Mauerwerk riss ihr die Haut an Armen und Handflächen auf, als sie, dem Chaos ausgeliefert, gegen die Wand gepresst wurde.
Brennende Pfeile flogen über die Köpfe, prallten gegen Mauern und stürzten in die Menge. Bilder wie aus Fieberträumen. Grelles Licht wechselte mit Dunkelheit; Krachen, Prasseln und Zischen betäubte die Ohren, ätzender Gestank und Geruch verbrennenden Fleisches stieg Clara in die Nase.
»Rette mich, Gott! Ich will nicht sterben!«
Sie schloss die Augen, öffnete sie erst wieder, als der Druck der Leiber etwas nachließ. Taumelnd trat sie einen Schritt vor.
Etwas kam auf sie hernieder und prallte vor ihr auf den Stein. Blut spritzte ihr ins Gesicht. Durch einen rötlichen Schleier blickte sie erstarrt auf das winzige auseinander geborstene Häuflein Mensch, ein Kleinkind, vielleicht das ihrer Pflegerin.
Ihr eigener Schrei hallte Clara noch in den Ohren, als ein Mann mit blankgezogenem erhobenem Schwert auf sie zustürmte. Über seinem Kettenhemd trug er den Waffenrock des Königs. In Erwartung des todbringenden Schlages schloss Clara wieder die Augen. Sie spürte einen Luftzug, hörte das Aufschlagen der Klinge auf Stein – und ihren Namen. Sie hob die Lider.
»Clara!«
Der Topfhelm verfremdete die gedämpfte Stimme, doch die violetten Augen, die sich hinter den Metallschlitzen ungläubig weiteten, würde sie überall wieder erkennen.
»Theo«, keuchte sie und streckte dem Mann die Arme entgegen. »Theo! Rette mich!«
Und dann sank sie zusammen.
1Trennung
Blanka von Kastilien ist uns sofern, so hoch in der Perspektive, dass sie uns in einem Märchenlicht erscheint. Sie entwirrte mit ihren sehr langen Fingern den Knäuel einer endlosen Konspiration. Für uns ist Blanka ein Mythos, ein Symbol der Stärke und der Gnade, eine bewegende Statue mit einer eisernen Krone. Blanka – weiß– von Kopf bis Fuß. Mit Schleiern aus Marmor und gehauen aus einem Marmor, der leicht wie ein Schleier ist. Ein Block von Transparenz. Hartes Wasser; fließender Kristall von weißem Schaum begleitet. Blanka ist die Frau ohne Farben, von denen sie die Zeit gereinigt hat. Eine Art Lilie aus Stein.
Jean Cocteau
14. Juli 1223
Es war keine fröhliche Zeit. Die Spielleute wagten sich nur an getragene Melodien, und bis auf Theobald von Champagne, der zu jeder Zeit den richtigen Ton zu treffen verstand, waren alle Troubadoure verstummt.
In Mantes, kaum einen Tagesritt von Paris entfernt, rang König Philipp August im dreiundvierzigsten Jahr seiner Herrschaft mit dem Tod. Der Monarch, der sich sein Leben lang allen Niederlagen gegen weltliche und kirchliche Mächte widersetzt hatte, griff nach der Hand seines Sohnes Ludwig. Wochenlang hatte dieser am Sterbelager des Herrschers ausgeharrt, seines innig geliebten Vaters.
»Fürchte Gott«, empfahl dieser dem Sohn mit schwacher, aber deutlicher Stimme. »Sei gerecht zu deinem Volk, schütze es vor den Anmaßungen der Hochmütigen, richte über Hoch und Niedrig, Arm und Reich.«
Er hustete. Ludwig hob eine Hand. »Ich flehe dich an, mein Vater, schone deine Kräfte!«, bat er. Der Hauch eines Lächelns zeigte sich in den Mundwinkeln des Königs, während es in dessen Brust weiterrasselte.
»Du, mein Sohn«, flüsterte er, »hast mir niemals Kummer bereitet. Dafür danke ich dir.«
Er schloss die Augen und hätte in friedlicher Stille sterben können, hätte sich nicht der Kehle eines in entfernter Ecke knienden Mönchs ein markerschütternder Schrei entrungen.
»Der Satan!«, kreischte er. »Ich sehe ihn! Ich rieche ihn! Spürt ihr es denn nicht? Er ist hier unter uns! Er holt den König!«
Entgeistert sprang ein Kardinal auf den Kuttenträger zu. Der wand sich in Krämpfen auf dem Boden und wehrte sich der Ergreifung mit ungeheurer Kraft. Außer Ludwig, der völlig entrückt dem wächsern werdenden friedlichen Antlitz seines Vaters volle Aufmerksamkeit schenkte, starrte jeder im Raum auf den Mönch, dessen Augen sich so verdreht hatten, dass nur noch das Weiße sichtbar war.
»Der heilige Dionysios!«, keuchte der Mönch. »Er naht. Groß ist er, von heiligem Licht umgeben. Seine Augen funkeln wie Sterne. Er kämpft mit dem Herrn der Finsternis. Er entreißt ihm den König! Er rettet ihn! Gott sei gepriesen!«
Ein letztes Zucken, und dann befand sich der Mönch jenseits jeglichen weltlichen und kirchlichen Eingreifens.
Der Kardinal nahm jedem der Anwesenden – außer Ludwig, natürlich – den Schwur ab, über die Vision des Ordensmannes Stillschweigen zu bewahren.
Dennoch verbreitete sich die Kunde von der wundersamen Rettung des Königs in allerletzter Sekunde wie ein Lauffeuer. Aus allen Himmelsrichtungen strömte das Volk in die Kathedrale von Saint-Denis, um den Schutzheiligen der Kirche für seinen Sieg über den Teufel zu lobpreisen und zu ehren. Welcher der Anwesenden seinen Eid gebrochen hatte, war nicht mehr nachzuvollziehen und den Kirchenmännern angesichts einer noch nie da gewesenen Flut an Spenden auch durchaus gleichgültig.
Im großen, nahezu dunklen Saal des Cité-Palasts wähnte sich Graf Theobald allein. Er griff zur Drehleier und sang leise:
»Stuhl Petri vergoldet,
dank des Königs Vergehen;
die Wege des Herrn
sind schwer zu verstehen.«
Eine Bewegung schräg vor ihm ließ ihn innehalten. Sein Blut gefror, als sich aus dem Schatten der Wand eine weibliche Gestalt löste. Wie würde ihn Blanka, Herrin seines Herzens, für dieses Lied schelten, ihn vielleicht sogar des Hofes verweisen!
»Kühne Worte, mein Herr«, erklang eine Stimme, die er noch nie gehört hatte. Er sprang auf. Die Frau, tief verschleiert und erheblich fülliger als Blanka, forderte ihn wieder zum Sitzen auf und ließ sich mit einem Seufzer neben ihm nieder.
»Sagt, was bedeutet Euch des Königs Vergehen?«, fragte sie, als eröffnete sie ein Gespräch belanglosen Inhalts.
Theobald erschrak. Jeder wusste um die große Sünde des Königs, aber keiner benannte sie: Viele Jahre zuvor hatte der Monarch seine zweite Gemahlin Ingeborg am Tag nach der Hochzeitsnacht ohne Angabe von Gründen verstoßen, in einem Turm eingesperrt und Jahre später ohne kirchlichen Segen Agnes von Meran geheiratet. Was dem ganzen Land einen jahrelangen Kirchenbann beschert hatte – aber darüber durfte keinesfalls gesprochen werden. Schließlich hatte sich der König dem Druck der Kirche gebeugt, Agnes fortgeschickt, die darüber starb, und Ingeborg reumütig wieder anerkannt. Als rechtmäßige Königin lebte sie fortan räumlich getrennt von ihrem Gemahl, mal in Orleans, aber meistens in Corbeil. Nur sehr selten zeigte sie sich am Pariser Hof.
Theobald fing sich.
»Sein Tod geht mir sehr nah«, sagte er rasch. »Der geliebte Herr, unser König, ist vergangen. Das ist leider nicht zu leugnen.«
Die Frau neben ihm gab ein Geräusch von sich, das wie leises Lachen klang.
»Ihr seid findig, Graf Theobald«, sprach sie. »Das gefällt mir.« Mit leiser Schärfe setzte sie hinzu: »Obgleich Ihr Euch gerade erst der gleichen Sünde schuldig gemacht habt wie einst der selige König. Was hat Euch Eure Gemahlin angetan? Oder wart Ihr ihrer einfach nur überdrüssig?«
Theobalds Unbehagen wuchs. Wer war diese Frau? Woher wusste sie, dass er zwei Tage zuvor in Troyes seine Gemahlin Gertrud verstoßen hatte? Kunde davon konnte Paris noch nicht erreicht haben. Blanka sollte es aus seinem Mund erfahren; nur deshalb war er schnell wie ein Pfeil aus seiner Hauptstadt an den Hof geeilt. Erst wenn ihn die angebetete Herrin, wie zugesagt, später am Tag empfing, würde er sie über diesen Wechsel in seinem Leben aufklären. Mit der Versicherung, seine Liebe gehöre nur ihr allein und sein Herz könne nicht zwei Herrinnen dienen. Was zwar durchaus zutraf, aber für seine Entscheidung weniger ausschlaggebend gewesen war als die Tatsache, dass seine Ehefrau Gertrud, Tochter des Albert von Egisheim, Graf von Metz, nicht, wie erhofft und erwartet, die Grafschaft ihres Vaters mit in die Ehe eingebracht hatte.
»Zu armselig bin ich, um den Sinn Eurer Rede zu erfassen, hohe Frau«, erwiderte er. »Doch gestattet mir die Frage: Wer verbirgt sich unter diesem Schleier der Trauer, die unsere Herzen jetzt mit so eisernem Griff umfangen hält?«
Die Frau erhob sich.
»Gestattet mir die Frage, mein Graf: Welche edle Dame gedenkt Ihr jetzt zu heiraten, da Ihr von Eurer Gemahlin geschieden seid?«
Theobald stand ebenfalls auf, griff zu seiner Drehleier und sang: »Von Traurigkeit künden verschleierte Lider, verborgene Schönheit, dem Lichte zuwider …«
»Ihr seid ein kecker und virtuoser Troubadour, Graf Theobald«, unterbrach ihn die Fremde und legte einen schwarz behandschuhten Finger auf seine vollen Lippen. »Und versteht vorzüglich, von ungenehmen Fragen abzulenken. Wahrlich, ein würdiger Nachfolger des Wilhelm von Aquitanien. Doch wie dieser werdet auch Ihr großes Unglück über alle Frauen in Eurem Leben bringen. Das ist nicht Eure Schuld, das ist Eure Natur.«
Sie wandte sich um. Ihr hoheitsvoller Abgang gestattete ihm keine weitere Frage. Er klemmte die Drehleier unter den Arm, folgte der Unbekannten in respektvollem Abstand und verließ den Saal, in dem sich, von beiden unbemerkt, immer noch ein Mensch im Dunkel einer Fensternische aufhielt.
Mich, dachte Clara in stiller Beglückung, mich wird er heiraten! Wie gut, dass ich ihm heimlich gefolgt bin! Bald hat all mein Sehnen ein Ende. Ich habe es immer gewusst: Seine Liebeslieder, der unerreichbaren Kronprinzessin gewidmet, gelten in Wahrheit allesamt mir! Theo liebt mich, hat mich immer geliebt, schon seit unserer gemeinsamen Kindheit am Hof, und hat nur auf Drängen seiner schrecklichen Mutter diese alte hässliche Gertrud geheiratet.
Wohlig streckte sie sich auf der Fensterbank aus und gab sich süßen Träumen hin. Bald würde sie mit Theobald als Gräfin in der Champagne leben, nach dem Tod seines Oheims Sancho vielleicht gar Königin von Navarra werden, einen wundervollen Hof führen, dem geliebten Gatten viele Nachkommen schenken und endlich wissen, wohin sie gehörte, eine Heimat haben!
Das war der Plan Gottes; deswegen hatte er vor vier Jahren Theo geschickt, um sie aus der Hölle von Marmande zu retten.
Die Wege des Herrn waren demnach nicht immer so unergründlich, wie es hieß!
Und wie viel sie mit Theo verband! Gemeinsam waren sie als kleine Kinder an den Hof König Philipps gekommen, waren beide von der schönen milden Blanka als deren besondere Gefährten auserkoren worden. Vereint hatten sie darunter gelitten, wenn sich ihnen die damalige Kronprinzessin entzog, um Zeit mit ihrem Gemahl oder ihren leiblichen Kindern zu verbringen. Beide hatten sich in Gefahr begeben, um sich Blankas Zuneigung zu sichern – Theo hatte sich nach seinem gewonnenen Erbfolgekrieg in der Champagne für den Kreuzzug gegen die Häretiker gemeldet und sie sich auf eine gefahrvolle Reise in die Kriegswirren des Südens begeben.
Ein kleines Zittern durchlief Claras Körper. Hier gab es einen gewaltigen Unterschied. Theobald hatte gewusst, dass er sein Leben aufs Spiel setzte, es einer höheren Sache weihte; sie hingegen war wie ein verzogenes kleines Kind nur davongelaufen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und war dann aus dem vermeintlich sicheren Schoß ihrer Familie in einen blutigen Krieg gestoßen worden, der sie fast das Leben gekostet hätte.
Rasch betete sie ein Ave Maria, in der Hoffnung, die fürchterlichen Bilder bannen zu können, die stets wieder in ihr aufstiegen. Die sie seit vier Jahren im Wachen und Träumen verfolgten und derer sie nicht Herr werden konnte.
Hoch lodernde Flammen, dichte Qualmwolken, verstümmelte Leichen, der zerschmetterte Kindskörper zu ihren Füßen, scheuende Pferde, deren Hufe verzweifelt Flüchtende zermalmten, und rasende Kreuzritter, die wahllos auf alles einschlugen, was sich ihren Schwertern darbot.
Nie hatte ihr der eigene Name süßer in den Ohren geklungen als an jenem Ort der Verdammnis. Theo hatte schnell gehandelt, sich seines Waffenrocks entledigt, ihn ihr übergestreift und sie auf die Schultern genommen. Sie hatte die Augen zugekniffen, als ihr Retter sie durch das Gemetzel der brennenden Stadt zur Garonne hinuntertrug und in einen winzigen Kahn legte. Als sie die Augen wieder öffnete, starrte sie auf ihre blutüberströmten Hände, denen drei Fingernägel fehlten; derart verzweifelt hatte sie sich in Theos Kettenhemd gekrallt. Sie fiel in Ohnmacht. Den Schmerz verspürte sie erst später.
Wie von Ferne hatte sie als Nächstes die Stimme des Kronprinzen vernommen: »Bring sie augenblicklich zu Blanka, meiner geliebten Frau.«
Blanka. Ein Name, der Rettung und Heimat verhieß.
Von der Reise selbst blieb ihr nur Theobalds zärtliche Sorge in Erinnerung. Mehr vor ihm liegend als sitzend, schmiegte sie sich während des Rittes an ihn, genoss die Wärme, die er ausstrahlte, die Sicherheit des kräftigen Körpers, das Kitzeln seiner borstigen Barthaare in ihrem Nacken, sogar die Stöße, die auf unebenen Pfaden beide Leiber auf dem Ross gleichzeitig erschütterten und einander noch näher brachten. Wie sorgsam er sie auf den Bergstrecken davor bewahrte, vom Pferd zu gleiten, wie aufmerksam er darauf achtete, ihren Kopf vor der Sonne zu schützen.
Auch nach dem Absitzen wich er nie von ihrer Seite, wechselte selbst die Verbände ihrer Hand, sang sie in den Schlaf und ruhte des Nachts neben ihr. Unvergesslich die Stunde, da sie in einer hügligen Region an einem frischen Quell haltgemacht und er ihr Wasser aus der Wölbung seiner Hände angeboten hatte. Beim Gedanken an seine Haut unter ihren Lippen lief Clara noch stets ein wohliger Schauer über den Rücken.
Die goldene Fibel, die ihm Blanka bei der Ankunft in Paris zum Dank für seine tapfere Tat überreichte, trug er seitdem unablässig.
Schwierigkeiten im eigenen Land hatten Theobald kurz nach der Rückkehr aus dem Süden in die Champagne zurückgerufen. Clara vergoss bittere Tränen, als sie von der durch seine Mutter erzwungenen Eheschließung erfuhr. Wenn er in den darauf folgenden Jahren am französischen Hof erschien, versäumte er jedoch nie, ihr eine Aufmerksamkeit mitzubringen, und schürte so das Feuer, das von ihrer Einbildungskraft ohnehin kräftig gespeist wurde. Als Theobald im vergangenen Jahr mündig geworden war und somit die Regentschaft über sein Erbe von seiner Mutter übernommen hatte, fürchtete sie schon, ihn verloren zu haben. Und war umso gerührter, als er mit neuen Gesängen für seine Dame Blanka sowie abermals mit kleinen Angebinden und freundlichen Worten für deren Hofdame Clara regelmäßig in Paris einritt.
Sie hing an seinen Lippen, wenn er ihr versicherte, welch besonderes Einvernehmen doch zwischen ihnen herrsche und wie sehr die gemeinsame Vergangenheit und die Verehrung für Blanka sie miteinander verbinde. Wie sehr er sich freue, in ihr am königlichen Hof eine solch verwandte Seele gefunden zu haben. Seine Worte hütete sie wie eine Kostbarkeit. Jedes Lächeln in ihre Richtung bewies ihr seine respektvolle Gewogenheit, jedes ihr gewidmete Wort drückte inniges Entgegenkommen aus, und jede freundliche Geste bezeugte ihr seine Liebe.
Sie bedauerte jedoch, zu hoch in seiner Achtung zu stehen, als dass er eine wirkliche Annäherung wagen würde. Seine Ehe erschien ihr kein unüberwindliches Hindernis. Bekümmerten Blicks äußerte er sich gelegentlich über diese scheußliche Verbindung, die ihm als Unmündigen aufgenötigt worden und keinesfalls willkommen gewesen sei. Nie hatte er etwas Freundliches über seine Gemahlin zu berichten. Warum verstieß er sie nicht einfach? Claras Vater, der im Jahr zuvor verstorbene Raimund von Toulouse, war fünfmal verheiratet gewesen, hatte zwei Frauen verstoßen und nebenbei nicht nur mit Claras Mutter, sondern mit einer Vielzahl anderer Frauen Kinder gezeugt. Edlen Herren wurde solches nachgesehen.
Clara fragte sich, wie sie Theobald wohl dazu bringen könne, sich ein Herz zu fassen und ihr endlich offen seine Liebe zu erklären. Wie nur konnte sie ihm helfen, sich von seinen Hemmungen zu befreien und die Schüchternheit ihr gegenüber abzulegen? Wie ihm ihr liebendes Herz bloßlegen, ihm unmissverständlich zeigen, mit welcher Wonne sie seine versteckte Botschaft aufnahm? Weshalb fehlte dem ansonsten so beherzten Troubadour der Mut, sich zu seiner wahren Liebe zu bekennen?
Sie hatte zwar Blicke und Gesten sprechen lassen, doch der noble Graf hatte diese vor lauter Respekt wohl nicht in seinem Sinne zu deuten gewagt. Jetzt blieb ihr nur noch ein Weg zur Erlösung, der unmittelbare; sie selbst musste die Worte aussprechen, ihm unmissverständlich die eigene Liebe enthüllen.
Doch dafür benötigte sie eine Gelegenheit, ihm allein und vom restlichen Hof ungestört gegenüberzustehen, angesichts der ständigen Betriebsamkeit in den öffentlichen Räumen ein großes Problem. Zudem ziemte es einer Hofdame nicht, sich ohne andere weibliche Gesellschaft mit einem Mann zu unterhalten. Doch dann fiel ihr seine Neigung ein, neue Gesänge im hohen Saal des Cité-Palasts zu erproben, und so legte sie sich auf die Lauer.
Als sie ihn also eine Woche nach des Königs Grablege in Saint-Denis mit der Drehleier unterm Arm durch den langen Gang schlendern sah, eilte sie noch vor ihm dorthin, hockte sich mit klopfendem Herz in eine Fensternische und wartete auf den Augenblick, der ihr Leben und das Theobalds für alle Zeiten verändern würde.
Dass kurz nach ihr ein anderer Mensch den Saal betrat, verdross sie ungemein. Im Gegensatz zu Theobald kannte sie die verschleierte Frau. Das begriff sie aber erst, als diese den Troubadour zur Rede stellte. Es war Königin Ingeborg, die Witwe des verstorbenen Königs, ebenjene Gemahlin, die dieser am Tag nach der Hochzeit verstoßen und erst viele Jahre später wieder anerkannt hatte.
Blanka, deren Eltern schon neun Jahre zuvor im fernen Kastilien verstorben waren, liebte diese Frau aus dem fernen Dänemark wie eine Mutter und hatte sie mit Clara häufig aufgesucht. Ingeborgs Stimme war unverkennbar. Selbst dreißig Sommer im Süden hatten nicht vermocht, ihrer französischen Aussprache das Klirren des harten nordischen Winters auszutreiben.
Weit in ihre Fensternische zurückgezogen, verfolgte Clara den Wortwechsel zwischen dem geliebten Mann und der einstmals ungeliebten Königin Ingeborg. Niemals hatte der König gegenüber irgendeinem Menschen ein Wort verlauten lassen, weshalb er – bleich wie der Tod und zitternd wie Espenlaub – am Tag nach der Hochzeitsnacht und ihrer Salbung zur Königin befohlen hatte, die schöne rotblonde Dänenprinzessin, um die er so ausdauernd geworben hatte, fortzuschicken. Niemand kannte den Grund, weshalb sie in einen Turm gesperrt wurde. Noch immer kursierten darüber Gerüchte am Hof, von denen das abenteuerlichste der Königin unterstellte, ein Hermaphrodit zu sein.
Mit dieser Begründung aber hätte der König seine Ehe annullieren lassen und den Kirchenbann vermeiden können, unter dem sein Volk heftig gelitten hatte. Jahrelang hatten die Menschen in Frankreich auf alle heiligen Sakramente verzichten müssen. Auf das Läuten der Kirchenglocken, mit deren Hilfe man sich den Tag, die Arbeit, die Gebetszeit einteilte und von Todesfällen oder Feiertagen Kenntnis erhielt. Alles geriet aus den Fugen, weil der erste Mann im Land vor der ihm gerade angetrauten Frau erschaudert war und sie fortgeschickt hatte.
Womit nur hatte die Dänin den König, der anfangs so überaus entzückt von ihr gewesen war, in der Hochzeitsnacht erschreckt? Was war in der Zweisamkeit der ehelichen Kemenate vorgefallen?
Wahrscheinlich hat sie fürchterlichen Unsinn geredet, überlegte Clara, wie ja jetzt auch. Weshalb sollte ausgerechnet Theo großes Unglück über alle Frauen in seinem Leben bringen – jener Mann, der ihr das eigene gerettet und ihm Sinn gegeben hatte!
Aber immerhin hatte die Königinwitwe, die mehr erfasste als andere Menschen – wie Blanka vielfach bewundernd behauptete –, von seiner Scheidung und voraussichtlichen Wiederverheiratung gesprochen, wahrlich ein Grund zum Jubeln. Wen anders sollte Theo erwählen als sie selbst? Sie, die sich mit allen Banden der Menschheit an ihn geknüpft fühlte. Bestimmt hatte er diesen Plan von langer Hand vorbereitet. Clara hüpfte vor Erwartung der seligen Stunde das Herz im Leibe. Es war ein großer Tag in ihrem Leben.
Das war es auch, obgleich er gänzlich anders endete, als sie sich ausgemalt hatte. Noch am selben Abend sollte sie erfahren, wie sehr sie sich in dem Mann und seinen vermeintlichen Gefühlen für sie geirrt hatte. Nur wenige Stunden nach dem belauschten Gespräch im Königssaal würde sie einen Pfad betreten, der sie von Grund auf ändern und fortan ihr eigenes Leben sowie das vieler anderer Menschen bestimmen sollte.
Blankas erste Hofdame, Agnes von Beaujeu, eine enge Freundin Claras, verneigte sich vor ihrer Herrin, die offenbar in tiefes Nachdenken versunken auf ihrem gepolsterten Sessel saß.
»Graf Theobald bittet untertänigst um die Gnade, empfangen zu werden.«
Blanka öffnete die Augen, verscheuchte die Wehmut aus ihrem Blick, bedachte Agnes mit einem freundlichen Lächeln und nickte.
»Er möge eintreten.«
Der heitere Theobald würde ihr mit seinen albernen Liedern jetzt gut tun. Er verstand es, Gedanken über Tod und Trennung zu verjagen, und könnte in ihr vielleicht ein wenig Freude auf die Festlichkeiten in Reims erwecken, wo sie und ihr Gemahl in zwei Wochen gekrönt und gesalbt werden sollten. Ihm könnte es gelingen, ihre Angst zu vertreiben, den vom Hof in sie gesetzten Erwartungen nicht gerecht und mit den umfänglichen Vorbereitungen nicht beizeiten fertig zu werden. Es bekümmerte sie, um den König, der ihr wie ein Vater gewesen war, nicht angemessen trauern zu können, da es zu viel zu regeln gab.
Sie lächelte Theobald aufmunternd zu, als sich dieser galant vor ihr verneigte, die Drehleier hob und mit wohlklingender Stimme zu singen begann:
»So schön in der Trauer, das Herze mir bebt,
in seliger Hoffnung, mir Eures Ihr gebt.
Mein liebloses Weib hab fort ich geschickt,
verlasse Euch nimmer, wenn huldvoll Ihr nickt.«
Blanka nickte nicht huldvoll. Ihre schönen Bronzeaugen verengten sich.
»Graf Theobald!«
Er erschrak. Sprach ihn Blanka förmlich an, war sie ernstlich verärgert. Nichts fürchtete er mehr.
»Was untersteht Ihr Euch!«
Sie sprang von ihrem Sessel und deutete mit vor Zorn zitternder Hand auf einen gleichartigen daneben.
»Soeben beehrte mich die edle Königin Ingeborg. Dort hat sie gesessen, sie, der großes Unrecht zugefügt wurde. Und da wagt Ihr es, mir unter die Augen zu treten und mit einem lächerlichen Lied die Verstoßung Eurer edlen Gemahlin kundzutun?«
Oft hatte Theobald die Süße der Stimme Blankas besungen. Derart vom Zorn Junos geprägt, hatte er sie allerdings noch nie vernommen.
»Verschwinde! Fort! Geh mir aus den Augen, du schändlicher Verräter!«
Clara, die frohen Herzens vor Blankas Kemenate angekommen war, hielt erschrocken inne und sah den Hofbeamten neben der Tür aus großen hellgrauen Augen an.
»Graf Theobald«, flüsterte der. »Er scheint den Unmut der hohen Frau Königin auf sich gezogen zu haben, der Bejammernswerte.«
»Nein!«, schrie Clara. Sie vergaß jegliche Etikette, stieß die Tür auf, hob die Hände und rief: »Verzeih ihm, Blanka, er kann nichts dafür; folgt er doch nur den Befehlen seines Herzens!«
Theobald sandte ihr einen so dankbaren Blick zu, dass ihr eigenes Herz gänzlich dahinschmolz. Ihre Knie zitterten derart, dass sie mit beiden Händen am Türrahmen Halt suchte und somit für niemanden ein Durchkommen war.
Theobald fiel vor Blanka auf die Knie.
»Gnade«, flüsterte er. »Schickt mich nicht fort, Herrin. Verzeiht mir! Meine Freundin Clara spricht wahr. Die Liebe hat Besitz von mir genommen, ihr kann ich nirgendwo entkommen.«
Innerlich fluchte er über den Reim, der ihm wie zwangsläufig über die Lippen gekommen und seiner ehrlichen Verzweiflung nicht angemessen war. Unüberlegt setzte er rasch hinzu: »Weshalb ich um Euren gnädigen Segen für meine Wiederverheiratung bitte.«
Claras Finger krallten sich in das Holz des Türrahmens. Weiß traten ihre Knöchel hervor. Rote Flecken breiteten sich auf ihrem Gesicht aus, und sie vermeinte, vor Glück sterben zu müssen.
»Erhebe dich, Unseliger«, forderte ihn Blanka auf und setzte ohne Umschweife hinzu: »Verrate uns doch, welche Dame du erwählt hast.«
Theobald erhob sich ungelenk wie ein Greis. Lange starrte er unverwandt in die eiskalt gewordenen Augen der geliebten Königin. Dann seufzte er tief, verlagerte den Blick auf die neben ihr stehende Hofdame und improvisierte tonlos: »Die edle Jungfer Agnes von Beaujeu, hohe Herrin, soll die Meine werden, so ihr verehrter Herr Vater das gestattet, Ihr und Euer Gemahl uns Euren Segen dazu gebt und sie selbst auch nichts sehnlicher erwünscht.«
Die sanftmütige Agnes von Beaujeu starrte ihn genauso fassungslos an wie er sie.
Ablehnen!, flehte sein Blick, den sie anders deutete. Heftig nickend gab sie stumm ihre Zustimmung. Keine Frau mit Sinn und Verstand hätte den Antrag dieses schönen Troubadours aus allerbestem Haus, des bedeutendsten Vasallen des Königs, ablehnen können. Überaus geschmeichelt verdrängte Agnes die Frage, weshalb er ihr nicht schon früher den Hof gemacht hatte.
Die Ratlosigkeit in Blankas Blick entschädigte Theobald beinah für seine zweifellos folgenreiche Voreiligkeit. Rasch nahm er die Gestalt der soeben zur Braut Erkorenen in Augenschein und befand, es gäbe hässlichere Frauen; zum Beispiel die just verstoßene.
Niemand achtete auf Clara, die an der Türschwelle in sich zusammengesunken war, verzweifelt nach Luft schnappte und wie von Sinnen war.
Sie hätte später nicht mehr sagen können, wann sie wieder zu Verstand gekommen und wie sie aus dem Palast auf die Straßen von Paris entflohen war. Die Dämmerung hatte schon fast eingesetzt, als sie vor einem Hindernis zu einem taumelnden Halt kam. Sie blickte nach oben. Noch in ihrem Wahn befangen, vermeinte sie, vor ihr rage ein gewaltiges Schiff auf der Seine empor. Sie fiel auf die Knie und dankte Gott, ihr ein Wasserfahrzeug gesandt zu haben, das sie weit fort von der Stätte ihres Unglücks und ihrer Schmach bringen könnte.
»Noch ist die Kirche nicht geweiht, Schwester«, hörte sie eine freundliche männliche Stimme hinter sich. »Manche glauben, Gott lasse sich erst nach Worten und Taten des Priesters in einem Haus nieder, wo er den Gläubigen anhört. Für mich hingegen ist Gott überall und immerdar. Er bedarf keines eindrucksvollen Gebäudes, um unsere Gebete aufzunehmen, und schon gar keiner kostspieligen Steinmetzarbeiten. Doch solange du dich nicht von der Kunstfertigkeit der Farben und Linien ablenken lässt, wird er dir auch hier unter dem künftigen Rosenfenster die Zwiesprache nicht verweigern.«
Verwirrt hob Clara den Kopf. Ihr Blick traf erst auf freundliche braune Augen, folgte dann dem nach oben gestreckten Arm des Mannes, der auf ein riesiges rundes Loch im Bug jenes Schiffes wies, das Clara jetzt als den Rohbau der großen Kathedrale auf der Insel mitten in der Seine erfasste.
Zwischen den Streben in der runden Luke bewegte sich ein Schwärm dunkler Insekten. Dies ist der Tag der Irrtümer, ging ihr durch den Kopf, als sie dankbar die ihr nun dargebotene Hand des Mannes ergriff, um sich daran hochzuziehen.
»Ich kenne dich«, sagte er, »auch wenn ich deinen Namen nicht weiß. Verzeih mir, aber die Frage in deinem Gesicht ist mir schon auf der Versammlung vor einigen Jahren aufgefallen. Ich wollte dich ansprechen, aber das wäre ungehörig gewesen. Danach habe ich dich nie wieder bei den Unseren gesehen.«
»Die Frage?« Clara war fest entschlossen, von nun an jedem möglichen Missverständnis augenblicklich nachzuspüren. Sie beauftragte ihr Gehirn, ordentlich zu arbeiten. Im kreisrunden Loch der im Bau befindlichen unerhört riesigen Kirche schwirrten keine Insekten umher, sondern hier waren Männer damit beschäftigt, buntes Glas einzupassen, um das verblüffend runde Rosenfenster zu gestalten, auf das sich Blanka, die Schutzherrin des Baus, ungemein freute. Clara atmete tief durch, dankbar, wieder bei Sinnen zu sein.
»Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich und was soll ich hier?«, antwortete der Mann und schob den orientalisch anmutenden schwarzen Filzhut in den leicht gebräunten Nacken. »Dem, der es zu lesen versteht, steht diese Frage deutlich auf deiner Stirn geschrieben. Zu lange war ich selbst ein Suchender, als dass ich eine Gleichgesinnte nicht erkennen würde.«
Clara wischte sich rasch über die Stirn, als stünde dort tatsächlich eine Kohleschrift. Sie konnte sich an den jungen Mann nicht erinnern, wohl aber sehr gut an die einzige Versammlung fremder Menschen, in die sie zwei Jahre zuvor zufällig hineingeraten war und die sie zutiefst verstört hatte.
»Damals wollte ich doch nur in aller Ruhe beten«, sagte sie. »Aber in der kleinen Kapelle waren zu dieser ungewöhnlichen Zeit so viele Menschen.« Sie runzelte die Stirn. »Die haben auch gebetet. In einer richtigen Kirche«, setzte sie bestimmt hinzu. Sie konnte sich noch gut entsinnen, wie befremdlich sie diese Gebete gefunden hatte, wie erstaunt sie gewesen war, als plötzlich gar eine Frau gewagt hatte, das Wort zu ergreifen. Keiner hatte sie empört zurechtgewiesen, und sogar die Männer hatten dem Weib andächtig gelauscht. Sie wusste noch genau, mit welchem Entsetzen sie aus der Kapelle geflüchtet war, als ihr aufging, dass diese Menschen so sprachen wie damals die beiden dunkel gekleideten Frauen in Marmande. In der Nacht draufhatten sie Albträume von Marmande gequält und in den Tagen danach trieb sie ihr schlechtes Gewissen um. Sie hätte der römischen Kirche das böse Treiben in der Nähe des Palasts nicht verschweigen dürfen. Erst, als es ihr halbwegs gelungen war, das Erlebte aus ihrem Gedächtnis zu streichen, wagte sie es wieder, zur Beichte zu gehen.
Der schwarz gekleidete junge Mann lächelte vergnügt und bemerkte: »Warum nicht auch in einer Kirche, wenn man Gott doch allerorten anbeten kann. Wir treffen uns an vielen Stätten. Gern auch in Kirchen, denn dort sind wir meistens vor Verfolgung sicher.«
Entsetzt stellte Clara fest, dass sie immer noch die fremde Hand hielt. Sie entzog sie dem Mann und fauchte: »Häretiker!«
»Das hast du doch schon damals gemerkt«, erwiderte er, ohne jeglichen Vorwurf in der Stimme. »Du hättest uns verraten und dadurch reich werden können. Warum hast du darauf verzichtet?«