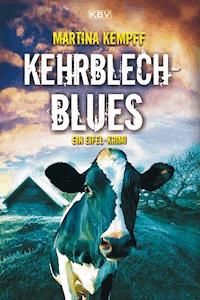Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Flucht vor dem Leben: "Die Frau, die nichts tut" von Martina Kempff jetzt als eBook bei dotbooks. Liebe bringt die Menschen nicht zueinander, sondern entzweit sie – davon ist Iris Meander seit ihrer Kindheit überzeugt. Deshalb versucht sie, den Menschen aus dem Weg zu gehen und genießt ihr einsames Dasein auf einer Insel in Finnland. Als sie beginnt, rastlos zu werden, sucht sie die Anonymität in den pulsierenden Großstädten Berlin und Amsterdam, doch auch hier muss sie flüchten – diesmal vor der Liebe … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Die Frau, die nichts tut" von Martina Kempff. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Liebe bringt die Menschen nicht zueinander, sondern entzweit sie – davon ist Iris Meander seit ihrer Kindheit überzeugt. Deshalb versucht sie, den Menschen aus dem Weg zu gehen und genießt ihr einsames Dasein auf einer Insel in Finnland. Als sie beginnt, rastlos zu werden, sucht sie die Anonymität in den pulsierenden Großstädten Berlin und Amsterdam, doch auch hier muss sie flüchten – diesmal vor der Liebe …
Über die Autorin:
Martina Kempff ist Schriftstellerin, Übersetzerin und freie Journalistin. Wie auch ihre Romanheldin verbrachte sie viele Jahre an verschiedenen Orten der Welt: Bereits als Kind lebte sie in San Francisco und Helsinki und später entdeckte sie Griechenland, die Niederlande sowie die Eifel. Nun hat sie das Bergische Land für sich als Heimat gewählt. Nach vielen veröffentlichten Historischen Romanen sowie Eifelkrimis, ist Die Frau, die nichts tut ihr erster zeitgenössischer Roman, in dem sie ihre vielfältigen Erfahrungen als Berliner Journalistin eingebracht hat.
***
Neuausgabe November 2015
Dieses Buch erschien bereits 2005 unter dem Titel Die Eigensinnige bei Piper Verlag GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2002 Weitbrecht Verlag in K. Thienemanns Verlag Stuttgart/Wien
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Agentur Mitte/Roland Huwendiek
Titelbildabbildung: Thinkstock/Ysign
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-776-2
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Die Frau, die nichts tut an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Martina Kempff
Die Frau, die nichts tut
Roman
dotbooks.
Für Sigrid, die von Anfang an dabei war, und für Christine,
1 HOLLAND
Ausgerechnet Finnland! Warum hatte die Freundin meiner Mutter keinen Indonesier geheiratet? Oder einen Griechen? Als ich von der Reling der Finnhansa über die endlos graue Fläche der Ostsee blickte, konnte ich mir Finnland mühelos als ein ständig von Schnee und Eis überzogenes Land vorstellen. Bei strahlendem Spätsommerwetter hatten wir Lübeck verlassen. Aber binnen weniger Stunden stand ich schon in dicker Winterjacke auf Deck und fuhr der kalten Jahreszeit entgegen.
Nein, ein Grieche hätte nichts genutzt, schließlich gab es in seinem Land nur wenig Wald. Wenig Wald, wenig Holz, also wenig Arbeit für meinen Vater. Wenn man sein Herumhobeln überhaupt als Arbeit bezeichnen konnte. Seine Mutter hatte für die künstlerischen Ambitionen ihres Sohnes nur ein Wort gekannt: erschütternd. Nicht etwa, dass seine Werke die Welt oder den Betrachter erschüttert hätten, nein, erschütternd war die Tatsache, dass Wilhelm Meander mit der Bildhauerei seinen Lebensunterhalt bestreiten wollte.
Vieles hatte Großmama Meander erschüttert. Zum Beispiel, dass mein Vater eine holländische Halbindonesierin geheiratet hatte. Am meisten aber hatte sie seine Weigerung erschüttert, die Tradition des Hauses Meander fortzusetzen und nach Gründung der Bundeswehr wieder Offizier zu werden. Wenn mein Vater entgegnete, er hätte sich in den Jahren bei der Wehrmacht geschämt, eine deutsche Uniform zu tragen, legte meine Großmutter zur Strafe eine ihrer Platten mit Marschmusik auf. Als Reaktion darauf stellte mein Vater in der angrenzenden Werkstatt die Kreissäge an. Ich genoss den Höllenlärm, weil ich dann aus voller Kehle schreien konnte. Das trug mir zwar Prügel von der Großmutter ein, aber dann kam der schönste Teil des Tages. Meine zierliche Mutter, die fast nie den Mund aufmachte, stürzte ins Zimmer und entriss mich der Großmutter. Sie drohte ihr, sie umzubringen, wenn sie noch einmal Hand an mich legte, und nahm mich mit in ihr Heiligtum. Während wir die steile Treppe zum Dachboden hinaufkletterten, hörten wir die Großmutter noch toben: »Die Halbwilde muss raus!« Dass sie damit meine Mutter meinte, begriff ich erst, als ich älter war und erfuhr, dass meine Mutter in einem weit entfernten Land geboren war. In einem Land, wo immer die Sonne schien, wo niemand laut wurde und alle Menschen fröhlich waren.
Im Heiligtum meiner Mutter saßen wir unter der Dachschräge im Schneidersitz auf Bambusmatten. Meine Mutter zündete ein Räucherstäbchen an, wickelte mich in bunte Stoffe und zog aus einem zerbeulten Koffer kleine Stofftütchen mit wohlriechenden Gewürzen. Manchmal hängte sie auch ein Laken über eine Leine, richtete einen Lichtstrahl darauf und kroch dahinter. Mit ihren Fingern und kleinen Gegenständen erzählte sie mir dann eine Schattenspielgeschichte. Sie hatte meinen Vater einmal gebeten, ihr richtige Wajang-Puppen zu machen, aber er meinte, ihm würden nur großformatige Werke liegen.
Um die mächtigen Baumstämme, aus denen er bizarre Formen gestaltete, in die Werkstatt zu wuchten, hatte er sogar ein riesiges Stück Außenmauer entfernt und ein Garagentor eingesetzt.
Immer, wenn wir allein waren, sprach meine Mutter niederländisch mit mir und ich begriff es als Auszeichnung, mich mit ihr in einer Sprache zu unterhalten, die meine Großmutter und mein Vater weder verstanden noch billigten. Sie hatten ihr sogar ausdrücklich verboten, mit mir in ihrer Muttersprache – oder in ihrem Fall Vatersprache – zu reden, und zwar mit der Begründung, dass dies meinem Deutsch abträglich sei. Ich könnte genauso gut gleich Plattdeutsch lernen. Dies war der einzige Punkt, in dem sich meine sonst immer fügsame Mutter den Autoritäten im Haus widersetzte. Sie sagte mir, sie wolle nicht den gleichen Fehler begehen wie ihre Mutter, deren Mann ihr ebenfalls verboten hätte, in ihrer eigenen Sprache mit ihrer Tochter zu sprechen. Heute bin ich meiner Mutter sehr dankbar, dass ich auf diese Weise fast akzentfrei Niederländisch sprechen gelernt habe.
Da mein Vater mit seinen Bildhauerarbeiten kein Geld verdiente, waren wir von Großmama abhängig. Sie erinnerte uns gern daran.
»Die erste Generation erwirbt es, die zweite vermehrt es, und du, die dritte, verschleuderst es!«, warf sie meinem Vater eines Abends beim Essen vor und wies auf das Fischfleisch, das noch zwischen den Gräten steckte, die mein Vater auf den Resteteller gelegt hatte. Er würde sich ja gern irgendwo als ungelernter Handwerker anstellen lassen, meinte mein Vater, aber diese Worte erschütterten Großmama so sehr, dass ihr mächtiger Leib zu beben begann.
»Nur über meine Leiche! Ich werde doch nicht zulassen, dass ein Sohn von mir niedere Arbeiten verrichtet. Noch dazu ein Offizier!« Sie beförderte das Grätenstück auf ihren Teller und harkte mit der Gabel die Fischfasern heraus. Erlernt habe er aber nur das Kriegshandwerk, entgegnete mein Vater, was ihm ein donnerndes »Eben!« und die Aufforderung einbrachte, sich augenblicklich bei der Bundeswehr zu melden. Dafür wäre er inzwischen viel zu alt, erwiderte mein Vater.
»Du Verschwender!«, rief Großmama, und um ihm deutlich zu machen, dass sie damit nicht nur sein vergeudetes Leben meinte, zeigte sie ihm triumphierend die Fischausbeute auf der Gabel, bevor sie diese zum Mund führte und den Bissen schluckte.
Dann geschah alles ganz schnell. Großmama lief rot an, hustete und würgte. Aus herausquellenden Augen starrte sie uns erschüttert an, klopfte sich mit dem Zeigefinger an die Kehle, machte noch ein paar entsetzliche Geräusche und starb. Alle drei blieben wir wie gelähmt am Tisch sitzen. Das Normale wäre wohl gewesen, dass wir irgendwas getan hätten. Aber meine Großmutter hatte, von Erziehungsprügeln abgesehen, nie auch nur den geringsten körperlichen Kontakt geduldet. Selbst in einer solch extremen Situation war es undenkbar, ihr wild auf den Rücken zu klopfen, ihr ein Glas Wasser an den Mund zu halten, ihr von hinten den Brustkorb zuzudrücken oder gar zu versuchen, sie auf den Kopf zu stellen.
»Und jetzt?«, fragte meine Mutter verzagt, nachdem Großmama mit einem letzten Donnern vom Stuhl fiel.
***
Ein Jahr nach Großmamas Tod musste mein Vater einsehen, dass er von dem ererbten Kapital seine Familie auf Dauer nicht würde ernähren können. Auch seine Versuche, sich als Handwerker zu etablieren, schlugen fehl.
»Wir müssen das Haus verkaufen«, verkündete er eines Abends.
»Und wo sollen wir dann wohnen?«, wollte meine Mutter wissen.
»Indonesien!«, platzte ich heraus.
Ich konnte mir gut vorstellen, den Rest meines Lebens in einem warmen Land auf Bambusmatten zu sitzen und nichts zu tun, als fröhlich zu sein. Damals war ich elf Jahre alt.
Meine Mutter schüttelte traurig den Kopf und erklärte mir, dass wir als Deutsche nicht ohne weiteres in so einem Land leben könnten.
»Hast du da denn keine Familie?«, fragte ich verwundert. »Deine Mutter war doch Indonesierin!«
Ich erfuhr, dass meine Großmutter mütterlicherseits nach ihrer Eheschließung gezwungen worden war, den Kontakt zu ihrer indonesischen Familie abzubrechen. Mein Großvater hatte schon genügend Probleme damit, als Vertreter der Kolonialmacht eine Eingeborene geheiratet zu haben.
»Warum kommen deine Eltern nie zu uns?«, fragte ich. »Sie leben doch in Holland. Warum fahren wir nie hin?« Ich rechnete damit, dass meine Mutter mir auf diese Fragen ihr übliches Das verstehst du nicht! entgegnen würde. Diesmal antwortete sie aber gar nicht, sah nur meinen Vater an und bemerkte: »Vielleicht geht es jetzt. Es ist schließlich beinah ein Vierteljahrhundert her ...«
»Sie haben nie auf deine Briefe geantwortet«, meinte mein Vater und fügte hinzu: »Vielleicht leben sie gar nicht mehr. Oder sie sind umgezogen.«
»Dann wären die Briefe zurückgekommen.«
»Was ist beinah ein Vierteljahrhundert her?«, fragte ich.
»Das verstehst du nicht.«
»Du würdest also gern wieder in Holland leben?«, fragte mein Vater.
»Versuchen könnten wir es.«
»Aber Iris müsste dann da zur Schule gehen.«
»Iris spricht Niederländisch.«
»Indonesien!«, drängelte ich. »Da scheint immer die Sonne!«
»Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee«, überlegte meine Mutter. »Mama kann für uns ja den Kontakt zu ihrer Familie wiederherstellen. Heute ist es in Holland schließlich kein Makel mehr, indonesische Verwandte zu haben. Im Gegensatz zu ...« Sie brach ab.
»... deutschen«, vervollständigte mein Vater ihre Überlegung grimmig.
»Außerdem braucht man in Indonesien nicht viel zum Leben«, setzte meine Mutter hinzu.
Das gab wohl den Ausschlag.
Innerhalb weniger Tage hatte mein Vater das Haus mitsamt Inhalt verkauft. Unsere persönlichen Sachen wurden eingelagert und mit drei Koffern stiegen wir in den Zug Richtung Amsterdam.
Es wurde eine sehr ungemütliche Reise. Mein Vater sprach kein Wort, sondern verkroch sich hinter der Zeitung. Meine Mutter starrte unablässig aus dem Fenster, trommelte mit den Fingern und gab mir auf meine vielen Fragen keine Antwort.
In Amsterdam quartierten wir uns in einem schäbigen Hotel am Bahnhof ein. Meine Mutter griff als Erstes zum Telefonbuch.
»Nicht anrufen«, sagte mein Vater. »Da können sie dich schneller abwimmeln. Am besten, du stehst vor ihrer Tür.«
»Und wenn sie mich einfach wegschicken?«
»Das musst du riskieren.«
Inzwischen war ich fest davon überzeugt, dass meine Mutter einst etwas Fürchterliches verbrochen haben musste. Zaghaft fragte ich sie, was sie denn getan habe.
»Deinen Vater geliebt«, sagte sie und zog aus ihrer Tasche ein altes Schwarzweißfoto mit zackigem Rand. Darauf war eine kahlköpfige junge Frau zu sehen.
»Das bin ich«, sagte meine Mutter und fasste sich an ihr langes schwarzes Haar, als wollte sie sichergehen, dass es wirklich nachgewachsen war. »Die Nachbarn haben mir nach dem Krieg den Kopf geschoren. Das wurde mit jeder Moffengriet gemacht, so nannte man Mädchen, die sich mit den Deutschen einließen. Meine Eltern haben sich für mich geschämt und mich rausgeworfen. Also bin ich nach Hamburg gegangen und habe deinen Vater gesucht. Du kannst dir vorstellen, wie erschüttert Großmama Meander war, als ich vor der Tür stand.«
Es war alles sehr kompliziert für mich. Meine Mutter war von ihren Eltern verstoßen worden, weil sie einen deutschen Besatzungsoffizier geliebt hatte, ihre Mutter hatte sich von der eigenen Familie trennen müssen, weil sie einen Niederländer geliebt hatte, ihr Vater hatte durch diese Ehe Probleme mit seiner Verwandtschaft gekriegt, und meinem Vater war ständig vorgehalten worden, dass er eine Halbwilde geheiratet hatte. Entgegen der landläufigen Behauptung brachte Liebe die Menschen also nicht zueinander, sondern entzweite sie. Ich beschloss mich niemals zu verlieben.
Wir ließen meinen Vater im Hotel zurück und machten uns auf den Weg. Nachdem wir eine Gracht überquert hatten, bog meine Mutter in eine schmale Seitenstraße ein, von der viele Gassen abgingen. Begeistert deutete ich auf einen riesigen Karren, der, durch ein Fahrrad angetrieben, auf zwei Rädern über das Kopfsteinpflaster rumpelte. Der mühsam strampelnde Fahrer konnte kaum über den mit Möbeln voll beladenen Wagen hinwegschauen. »Ein Bakfiets«, sagte meine Mutter und zog mich weiter.
»Du darfst deine Großeltern nicht duzen«, murmelte sie plötzlich.
»Aber wir sind doch verwandt!«, warf ich ein.
»Das hat damit nichts zu tun. In Holland siezt man alle älteren Menschen, das ist eine Frage des Respekts. Sie sollen nicht denken, dass ich dich schlecht erzogen habe.«
»Siezt du sie auch?«, wollte ich wissen.
»Natürlich.«
Wir eilten an schmalen aneinander gelehnten zwei- oder dreistöckigen Häusern mit winzigen Läden vorbei. Verglichen mit den breiten Straßen, den mächtigen Mietskasernen und herrschaftlichen Villen Hamburgs war ich in Puppenland gelandet.
»Amsterdam ist keine Großstadt«, stellte ich fest.
»Das ist der Jordaan. Der war immer schon ein Dorf«, bemerkte meine Mutter.
Sie blieb vor einem kleinen dreistöckigen Backsteinhaus stehen, das sich ein wenig zur Seite lehnte.
»Hier ist es«, sagte sie tonlos und deutete auf die polierte dunkle Holztür.
»Kluizenaar« las ich von einem Messingschild ab. Sie verbesserte meine Aussprache und schüttelte den Kopf, als es mir einfach nicht gelingen wollte den komplizierten »ui«-Laut nachzuahmen, der irgendwo zwischen »au« und »eu« ein nur holländischen Zungen mögliches Dasein fristet.
Zweimal bewegte sie ihren Finger auf die Klingel zu, beim dritten Mal half ich nach und legte meine Hand auf ihren Finger.
»Schnell weg«, flüsterte meine Mutter und versuchte mich von der Tür fortzuziehen. Ich war nicht zu Klingelstreichen aufgelegt. Ich wollte nach Indonesien.
Langsam öffnete sich die Tür. Meine Mutter ließ mich los. Eine schmale, winzige Frau mit eisgrauem Knoten sah uns aus fast schwarzen Augen an. Sie holte bei meinem Anblick tief Luft und sagte dann etwas mir völlig Unverständliches: »Gott sei Dank, sie ist weiß!«
»Wer ist es, Surja?«, kam eine tiefe Stimme aus dem Hintergrund.
»Wilhelmina«, sagte meine neue Großmutter. »Und ihre Tochter.«
Hinter der zierlichen alten Dame tauchte ein Hüne mit schlohweißem Schopf und stahlblauen Augen auf. Unsicher wandte ich mich nach meiner Mutter um. Sie stand mitten auf der Straße und zitterte am ganzen Leib. Eine Hupe ertönte.
Ich ging zu meiner Mutter und zog sie auf den schmalen Bürgersteig zurück.
»Komm, Mama, sag Guten Tag!«, drängelte ich und schob sie zur Tür. Wahrscheinlich wäre es nie zu einer Umarmung gekommen, wenn meine Mutter nicht auf der Schwelle gestolpert und gegen ihre Mutter gefallen wäre, die wiederum gegen den Hünen kippte. Er fing beide auf und einen Augenblick lang blieben sie so stehen. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie nicht umfallen würden, ließ mein Großvater die beiden aneinander geklammerten Frauen stehen. Beide hatten stumm zu weinen begonnen.
»Komm, mein Kind«, sagte er zu mir, nahm mich an der Hand und führte mich in ein winziges Hinterzimmer.
»Wie heißt du?«
»Iris Meander, Mijnheer«, erwiderte ich höflich. Er schmunzelte und sah sofort weniger Furcht erregend aus.
»Du kannst mich Opa nennen, Iris.«
»Opa«, sagte ich, »Opa.« Ich stellte mich vor das Fenster, blickte in den Garten und sang »Opa.«
»Iris«, entgegnete er und sang dann auch: »Iris.«
Ich wandte mich um und trat einen Schritt auf ihn zu.
»Opa!«
»Iris!«
Er kam einen Schritt näher
»Opa!«
Ich stand direkt vor ihm
»Iris!«
Er hob mich hoch, drückte mir einen lauten Kuss auf die Wange. Dann ließ er mich los und setzte sich in einen zerschlissenen Ledersessel. Es war Zeit für ein Gespräch. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen.
»Werden Sie Mama bestrafen, Opa?«
»Warum sollte ich das wohl tun?«
»Weil ... weil sie nicht brav war?«, schlug ich vor.
»Wenn sie brav gewesen wäre, dann gäbe es dich nicht, meine kleine Iris, und wer würde mich dann Opa nennen? Soll ich sie dafür bestrafen, dass es dich gibt?«
»Dafür vielleicht nicht«, sagte meine Mutter, die jetzt neben ihrer Mutter ins Zimmer trat. »Aber ich habe Iris nicht allein gemacht.«
Augenblicklich verfinsterte sich das Gesicht meines Großvaters.
»Das ist ja das Schlimme«, grummelte er.
Sie umarmte ihren Vater nicht, reichte ihm nicht einmal die Hand.
»Ich bin nicht die Jungfrau Maria.«
»Wollt ihr euch nicht erst begrüßen?«, fragte meine neue Oma und schlug ihre winzigen Hände zusammen. »Lass dich ansehen, mein Kind! Was für eine schöne weiße Haut du hast!«
Noch nie hatte ich einem Erwachsenen gegenübergestanden, der genauso groß war wie ich. Im Vergleich zu Großmama Meander war mir meine Mutter schon immer wie eine Elfe vorgekommen, aber neben meiner Oma wirkte sie geradezu stattlich. Vor allem jetzt. Hoch aufgerichtet, mit den Händen in den Hüften, funkelte sie ihren Vater an. So hatte sie auch ausgesehen, wenn sie mich Großmamas prügelnden Händen entrissen hatte.
»Ihr habt sicher Hunger«, sagte Oma verzweifelt, drückte mich kurz an sich und wandte sich an meine Mutter: »Komm mit in die Küche, Willi.«
»Wir haben keinen Hunger«, fauchte meine Mutter ihren Vater an.
»Willi?«, fragte ich. »Mama heißt doch Mina.«
»Nur in Deutschland«, sagte meine Mutter, »Großmama Meander wollte das so. Schließlich heißt dein Vater Wilhelm.«
»Wie der dumme Kaiser. Jedenfalls warst du vernünftig genug, ihn nicht mitzubringen«, sagte die tiefe Stimme.
»Den Kaiser?«, fragte ich.
»Richtig«, sagte mein Großvater. »Man braucht keinen Kaiser, wenn man ein Königshaus hat.«
»Das von einem Herrn namens Wilhelm begründet wurde und übrigens auch halb deutsch ist. Wie meine Tochter«, gab meine Mutter zurück.
»Darum haben sich die hohen Herrschaften im Krieg ja auch nach England abgesetzt und uns im Stich gelassen«, brummte mein Großvater.
»Eine Exilregierung war dem Land nützlicher als eine handlungsunfähige Königin in den Händen der Sieger.«
Noch nie hatte ich meine Mutter so oft jemandem widersprechen hören. »Sieger!«, trompete mein Großvater. »Wer hat denn den Krieg verloren!«
»Wir«, meldete ich mich, froh, endlich etwas verstanden zu haben.
Plötzlich war es ganz still im Raum.
Schließlich stieß mein Opa einen tiefen Seufzer aus.
»Gut, dass du mich daran erinnerst, kleine Iris, ich hatte es beinahe vergessen.«
Genauso hatte mein Vater mit seiner Mutter Gespräche über den Krieg beendet, wenn sie das Loblied ihres Mannes sang, der den Heldentod gefunden hatte. Mein Vater musste sie nur daran erinnern, dass wir verloren hatten. Ich war froh, dass diese Taktik auch bei meinem Opa funktionierte, denn ich wollte endlich das Gespräch auf Indonesien bringen.
Das war ein Fehler. Aber wie hätte ich damals auch wissen sollen, dass es in jenem warmen Land, wo angeblich niemand laut wurde und alle fröhlich waren, auch Krieg gegeben hatte? Dass zwei Brüder meiner Mutter in Indonesien ums Leben gekommen waren? Der ältere, der sich auf die holländische Seite geschlagen hatte, starb in einem japanischen Konzentrationslager. Der jüngere, der zu jugendlichen indonesischen Widerstandskämpfern gehört hatte, war 1945 bei der Schlacht um Surabaya von einer britischen Kugel getroffen worden.
»Lasst uns nicht von Indonesien sprechen«, flüsterte meine zierliche Oma. »Das bricht mir das Herz.«
Da sie so aussah, als ob alles bei ihr leicht brechen könnte, traute ich mich nicht, sie nach der Adresse ihrer Verwandten in Indonesien zu fragen.
Außerdem begriff ich, wie viel wichtiger es zunächst war, dass meine Mutter sich ihren Eltern wieder annäherte. Erstaunlich fand ich, dass keine Seite fragte, was die andere in den vergangenen zwanzig Jahren erlebt hatte, sondern dass über lauter fremde Menschen gesprochen wurde. Mich hätte viel mehr interessiert, warum meine Großeltern einen Teppich auf dem Esstisch liegen hatten und warum meine Oma jedes Mal wieder die Kekstrommel schloss, nachdem sie uns ein Stück Gebäck daraus angeboten hatte. Bitterkoekjes nannte sie die Kekse, aber sie schmeckten trotz ihres Namens süß und nach Mandeln.
»Wisst ihr, was aus Rosa geworden ist?«, fragte meine Mutter leise.
Sie hatte sich auf einer Holzbank niedergelassen, jenem Sitzmöbel, das am weitesten von meinem Großvater entfernt stand. Vater und Tochter hatten sich kein einziges Mal berührt.
»Rosa!«, rief meine Oma. »Stell dir vor, die hat sich letzte Woche bei uns gemeldet!«
»Sie hat also überlebt«, flüsterte meine Mutter.
»Du kannst sie gerne fragen, wie«, entgegnete Opa mit eisiger Stimme.
»Wilhelm hat sie nicht verraten! Ich habe ihm nie was gesagt.«
»Wir wissen, wer es war. Die Brouwers von nebenan«, erklärte meine Großmutter.
»Die vom Lebensmittelladen?«, fragte meine Mutter ungläubig. »Das waren doch so nette Menschen! Eure Freunde! Die haben uns immer Bonbons gegeben. Rosa auch.«
»Ja, und dann haben sie das Kind mit einem süßen Gruß Richtung Gaskammer geschickt, weil es ihnen opportun erschien, sich mit den Besatzern auf guten Fuß zu stellen. Geschäftsinteressen haben sie das später genannt«, bemerkte mein Großvater.
»Und was macht Rosa jetzt?«
»Gut geht es ihr«, lächelte Oma. »Sie hat nach dem Krieg einen finnischen Industriellen geheiratet. Ihre beiden Töchter sind schon fast erwachsen. Sie hat einen sechsjährigen Sohn und dachte, das wäre der letzte Nachzügler, aber jetzt hat sie schon wieder ein Kind gekriegt. Darum ist sie in Amsterdam.«
»Aber sie ist genauso alt wie ich!«, rief meine Mutter bestürzt.
»Wo steht geschrieben, dass man mit über vierzig kein Kind mehr kriegen kann?«, fragte ihre Mutter. »Sie wohnt zurzeit im Hotel Americain. Sie wird sich bestimmt sehr freuen, wenn du anrufst.«
Auf die Frage, wie lange wir in Amsterdam zu bleiben gedächten, antwortete meine Mutter, dies hänge von diversen komplizierten Umständen ab.
»Du könntest ja so lange mit Iris in deinem alten Mädchenzimmer schlafen«, schlug meine Oma vor.
»Und wo schläft dann Papa?«, wollte ich wissen.
»Der Mof ist auch hier?«, fragte mein Großvater.
Meine Mutter zuckte zusammen.
»Er ist mein Mann.«
»Dann ist dein Platz bei ihm.«
»Er ist auch der Vater eurer Enkelin.«
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich einem Nazi die Hand schüttle?«
»Er war nie ein Nazi.«
»Das sagen sie alle.«
»Er ist ein Künstler.«
»Das war Hitler auch.«
»Er hat die Nazis gehasst, er hat die Uniform gehasst ...«
»...aber er ist in ihr durch unsere Straßen marschiert. Er hätte sie ja ausziehen und sich der Widerstandsbewegung anschließen können, wenn er die Nazis so sehr gehasst hat. Aber er hat lieber Holland besetzt und Züge nach Auschwitz geschickt.«
»Wir haben den Krieg verloren«, erinnerte ich meinen Großvater, aber diesmal wirkte die Taktik nicht. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er meinen Vater nicht sehen wollte. »Wenn ich dich neben ihm auf der Straße sehe, werde ich dich nicht kennen.«
»Dann wird sich in meinem Leben eben nichts ändern«, bemerkte meine Mutter kühl. »Und in eurem auch nichts.«
Mein Großvater stand auf, verließ ohne ein Abschiedswort das Zimmer und polterte die steile Holztreppe im Gang hinauf. Oma hatte wieder zu weinen begonnen und warf uns einen verzweifelten Blick zu.
»Du hast ihm so gefehlt, Willi.«
»Ach ja? Wo war er denn, als ich ihn gebraucht habe? Die Ehre der Familie war ihm wichtiger als ich. Er hat zugesehen, als mir das Haar geschoren wurde. Zugesehen und genickt! Komm, Iris, wir gehen.«
Im Gang fiel meiner Mutter ein, dass sie ihre Handschuhe im Wohnzimmer vergessen hatte.
»Ich hole sie«, bot ich mich an und rannte zurück. Mein Blick fiel auf die Kekstrommel. Ich öffnete sie, stibitzte ein Bitterkoekje und steckte es mir schnell in die Rocktasche. Ob ich es meinem Vater mitbringen oder selber essen wollte, weiß ich nicht mehr. Aber hätte ich diesen Keks nicht genommen, wäre in meinem Leben wahrscheinlich vieles anders gelaufen.
***
Auf dem Weg zurück zum Hotel versuchte ich zu verstehen, was vorgefallen war.
»Opa ist ein schlechter Verlierer«, erklärte ich schließlich.
»Wie meinst du denn das?«, fragte meine Mutter.
»Wir haben den Krieg doch verloren. Aber er ist immer noch böse.«
»Opa hat den Krieg nicht verloren.«
»Aber wenn er gewonnen hat ...«
»Er hat ihn auch nicht gewonnen. Er ist befreit worden.«
»War er denn gefangen?«
»Das ganze Land war von den Deutschen besetzt, Iris, darum mag dein Opa deinen Papa nicht. Und darum bleiben wir im Hotel.«
Mir dämmerte, dass Oma Meander bei ihren Kriegserzählungen einiges ausgelassen hatte.
Meinen Vater fanden wir in äußerst schlechter Laune vor. Er wollte Amsterdam so schnell wie möglich verlassen. Der Wirt im Lokal gegenüber habe ihm kein Bier ausgeschenkt, sondern erklärt, er solle es doch da trinken, wo es ihm sicherlich besser schmecke – in Deutschland. Ein Gast habe ihn angepöbelt und ihn aufgefordert, irgendein Fahrrad zurückzugeben. Daraufhin beschloss mein Vater an einen Ort zu gehen, wo nicht geredet wurde. Er wollte sich im Rijksmuseum einige Kunstwerke ansehen. Jeder, den er nach dem Weg fragte, schaute erst zum Himmel, wies dann in eine bestimmte Richtung und sagte auf Deutsch: »Immer geradeaus.« Erst im Hafengebiet sei ihm aufgegangen, dass er immer weiter nach Osten geschickt worden war.
»Irgendwann wäre ich wohl in Deutschland angekommen«, bemerkte er bitter und wollte dann wissen, ob wir eine indonesische Adresse mitgebracht hätten.
»Ich könnte mich in einem Land wohl fühlen, wo man über die Holländer schimpft!«
»Warum hast du deine Uniform damals nicht ausgezogen?«, fragte ich meinen Vater.
Er sah erst mich, dann meine Mutter an und sagte: »Ich war kein Held.«
»Das hat Großmama auch immer gesagt. Aber ihr Mann, dein Papa, das war ein Held.«
»Das würde ich deinen neuen Großeltern aber nicht verraten.«
Meine Mutter glättete ein Papierbällchen, das sie die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte.
»Ich habe hier die Telefonnummer meiner alten Freundin Rosa«, sagte sie.
Mein Vater blickte überrascht auf.
»Das jüdische Mädchen, das ihr versteckt hattet?«
Meine Mutter nickte.
»Ich würde sie so gern wieder sehen, aber ich habe Angst. Vielleicht hasst sie mich jetzt.«
***
Es stellte sich heraus, dass Rosa Koivisto meine Mutter genauso gern wieder sehen wollte. Sie schlug uns vor, am Abend in ihr Hotel am Leidseplein zu kommen und dort gemeinsam zu essen. Sie hätte überhaupt nichts dagegen, meinen Vater kennen zu lernen.
»Nur wäre es ihr lieber, wenn du englisch mit ihr sprichst«, sagte meine Mutter zu meinem Vater. »Sie kann zwar Deutsch, spricht es aber nicht gern, weil es sie an die Männer mit den Stiefeln erinnert.«
Mein Vater schüttelte verwundert den Kopf. »Bei deiner Freundin hätte ich es ja verstanden, wenn sie mich als Deutschen rundweg ablehnt. Mein Gott, wer Auschwitz überlebt hat!«
»Du meinst, meine Eltern hätten ja, abgesehen von einigen Unannehmlichkeiten und Hunger, nicht wirklich unter den Deutschen gelitten?«, meinte meine Mutter spitz.
Ich stand vor dem Spiegel in unserem Hotelzimmer und versuchte zu ergründen, warum meine Oma gleich zweimal meine weiße Haut gelobt hatte. Jetzt im Spätsommer war sie leicht gebräunt, wenn auch nicht so schön braun wie die meiner Mutter, die nie in die Sonne ging. Ich strich mir das glatte dunkelbraune Haar aus der Stirn und sah mir in meine etwas länglichen Augen. Im Gegensatz zu den braunen meiner Mutter und den blauen meines Vaters hatten meine eine unbestimmte Farbe. Ein Klassenkamerad hatte sie einmal als »Maikäferscheiße« bezeichnet. Das hatte mich beinahe so verletzt wie Großmama Meanders ständiger Ausruf: »Wann kriegt das Kind endlich eine Nase?«
***
»Warum können wir nicht hier wohnen?«, fragte ich meinen Vater, als wir beim Hotel Americain ankamen. Mit seinen Türmchen und Erkern sah es sah aus wie ein Märchenschloss frisch von der Walt-Disney-Leinwand.
»Zu teuer«, murmelte mein Vater. »Zum Essen gehen wir lieber woanders hin.« Das war aber nicht möglich. Nach der Begrüßung erklärte Rosa Koivisto, sie müsse immer wieder ins Zimmer hinauf, um nach ihren Söhnen zu sehen.
»Stimmt, du hast ja ein Baby!«, sagte meine Mutter.
»Das Baby ist bei dem Kindermädchen gut aufgehoben«, bemerkte ihre Freundin. Sie zog die dichten Brauen über den dunklen Augen zusammen. »Ich mache mir mehr Sorgen um Nikki. Er ist etwas schwierig, vor allem seit Raimos Geburt.«
Als sie sich durch ihr blondes langes Haar fuhr, stieg mir ein angenehmer Aprikosen-Vanille-Geruch in die Nase. Später sollte ich feststellen, dass nicht nur dieser Duft dafür sorgte, dass Männer Rosa zum Anbeißen fanden. Sie war eine aufregend schöne Frau, schien sich dessen aber nicht bewusst zu sein. Ihr Mann wirkte neben ihr unscheinbar. Er sah aus wie ein blasser, alt gewordener Schuljunge, der aus seiner Kleidung und seinem Gesicht herausgewachsen zu sein schien, aber noch keinen Ersatz gefunden hatte.
»Wie alt ist Nikki, Mevrouw?«, fragte ich.
»Sechs, Iris. Und du darfst mich ruhig Tante Rosa und meinen Mann Onkel Jari nennen. Schließlich waren deine Mutter und ich fast Schwestern.« Solange sich meine Mutter mit Rosa auf Niederländisch unterhielt, konnte ich folgen, aber als wir uns zu Tisch setzten, wurde das Gespräch auf Englisch fortgesetzt. Jari Koivisto fragte mich auf Deutsch, was ich essen wollte.
»Ein Salat genügt. Sie ist es nicht gewohnt so spät zu essen«, log mein Vater, der für sich und meine Mutter eine Suppe bestellte. Ich sah ihn im Kopf rechnen, als für das Ehepaar Koivisto nach der Suppe noch ein Hauptgericht aufgetragen wurde.
»Wollt ihr wirklich nicht noch was essen?«, fragte Rosa. »Es schmeckt hier vorzüglich!« Wieder beteuerten meine Eltern, dass sie bereits gegessen hätten und satt wären. Dabei wusste ich, dass meine Mutter außer einem Frühstücksbrötchen und den rationierten Keksen der Oma den ganzen Tag lang nichts zu sich genommen hatte. Verstohlen fasste ich mir in die Rocktasche. Das Bitterkoekje war noch da.
»Darf ich mitkommen und das Baby sehen?«, fragte ich Rosa, als sie vor dem Dessert noch einmal aufstand.
»Aber gern«, lächelte sie mich an. Als wir auf den Fahrstuhl warteten, fragte sie mich plötzlich: »Würdest du gern in Finnland leben?«
Wenn man auf Indonesien eingestellt ist, kommt so eine Frage völlig unerwartet. Ich starrte sie sprachlos an. »Wir sprechen gerade darüber. Dass dein Papa bei meinem Mann arbeiten könnte. Er findet es eine gute Idee.«
»Ist es da nicht furchtbar kalt?«, fragte ich.
»Nur im Winter.« Damals wusste ich noch nicht, dass ein finnischer Winter sieben Monate dauern konnte. »Und es gibt eine deutsche Schule. Du musst also nicht gleich noch eine Sprache lernen.«
»Englisch«, sagte ich. »Ich will Englisch lernen.« Damit ich in Zukunft vor solchen Überraschungen gefeit war.
»Sprachen sind immer gut«, nickte Rosa, »Finnisch ist sehr schwer, aber in Helsinki wird auch viel Schwedisch gesprochen. Das wirst du bestimmt schnell lernen.«
Schon als wir aus dem Fahrstuhl stiegen, hörten wir das Geschrei. Rosa wurde blass. Sie rannte den langen Flur entlang und riss eine der letzten Türen auf. Ich folgte ihr auf den Fersen. Dies versprach spannender zu werden, als mit hungrigem Magen anderen Leuten beim Essen zuzusehen.
Uns begrüßte ein Chaos. Der Teppichboden war mit leeren Fläschchen, ausgequetschten Tuben und zerdrückten Tütchen übersät. Mitten in einer ekelhaften Masse, offenbar der vermischte Inhalt der Behälter, stand auf einer benutzten Windel ein kleiner Junge mit den blondesten Haaren, die ich je gesehen hatte. Er richtete eine Haarspraydose auf eine junge Frau, die ein Baby im Arm hielt, dessen Windelzipfel nach unten hingen. Alle drei schrien.
»Nikki'«, brüllte Rosa. Sie entriss dem Kindermädchen das Baby, legte es in ein kleines Bett und trat auf Nikki zu, dabei bemüht, nicht in die immer mehr auseinander fließende Masse zu treten. »Gib das her!«
Der kleine Junge dachte nicht daran. Er sprühte. Rosa schrie. Offensichtlich hatte ihr Sohn sie ins Auge getroffen. Das Klopfen an der Wand wurde lauter. Jetzt sah ich auch die Lippenstiftzeichnung neben dem Stich von Amsterdam. Die grobe, aber ziemlich realistische Skizze einer Kloschüssel, aus der ein kleiner runder Kopf ragte. Das Kindermädchen versuchte verzweifelt, sich Gehör zu verschaffen.
»Ich musste Raimo doch wickeln ... und da hat Nikki, da hat Nikki ...«
Ich stellte mich an den Rand der glitschigen Masse, fasste mir in die Rocktasche und hielt Nikki das Bitterkoekje hin.
»Willst du einen Keks?«, fragte ich gelassen. Ich hatte im Haus meiner Großmutter gelernt, dass man einem Sturm am erfolgreichsten mit Ruhe begegnete.
Der Junge ließ die Haarspraydose in das eklige Gemisch plumpsen, nahm den Keks und biss hinein.
Ich beugte mich vor, hob ihn hoch, setzte ihn auf einen Stuhl und zog ihm die besudelten Socken aus.
»Wie heißt du?«, fragte er kauend.
»Iris«, antwortete ich. »Was meinst du, sollen wir jetzt ins Badezimmer gehen und da noch mehr Sauerei machen?«
»Ja!«, rief er, schlang seine Ärmchen um meinen Hals und ließ sich von mir ins Badezimmer tragen.
Inzwischen hatte Rosa jemanden von der Hotelleitung an der Tür abgewimmelt und das Kindermädchen beauftragt, die Schweinerei auf Boden und Wänden so gut wie möglich zu entfernen.
»Wir machen jetzt Regen im Haus«, sagte ich, setzte Nikki in die Badewanne und steckte den Stöpsel hinein. Aus dem Flur holte ich einen Regenschirm, spannte ihn auf und drückte ihn Nikki in die Hand. »Was meinst du, wie schön das prasselt!« Ich stellte die Dusche an. Eine Überschwemmung im Badezimmer erschien mir als die kleinere Katastrophe. Aus dem Raum nebenan sammelte ich zwei leere Plastikflaschen auf, in denen sich Haarshampoo und Gesichtslotion befunden hatten, sowie eine ausgedrückte Rasierschaumtube. Ich warf alles zu Nikki in die Badewanne. »Die sind noch nicht ganz leer«, rief ich ihm zu, froh, eine Beschäftigung für ihn gefunden zu haben.
»Du hast ein gutes Händchen mit kleinen Kindern«, sagte Rosa, als sie ins Badezimmer kam, um sich ihr Auge auszuspülen.
»Ich wollte immer gern einen kleinen Bruder haben«, sagte ich.«
»Ja!«, rief Nikki, »ich bin der kleine Bruder! Nicht Raimo!« Eine kleine Hand zog an meinem Rock. Ich beugte mich vor.
»Ich hasse Raimo«, flüsterte er. »Er stinkt!« Ich hielt mir die Nase zu und nickte.
»Ich muss unten Bescheid sagen«, meinte Rosa plötzlich. »Aber ich kann jetzt doch nicht weg.«
»Geh nur, Tante Rosa«, sagte ich. »Ich bleibe hier und spiele mit Nikki. Und wenn ihr unten fertig seid, holt ihr mich einfach hier ab.«
***
Wenige Minuten später machten sich meine Eltern mit mir auf den Weg in unser Hotel.
»Wir müssen etwas essen«, sagte meine Mutter.
»Ich konnte ja nicht wissen, dass sie auf ihre Rechnung anschreiben lassen«, entschuldigte sich mein Vater. »Ich habe immerhin auch versucht zu bezahlen ...«
»Als Wiedergutmachung?«, fragte meine Mutter spitz.
»Es wird Zeit, dass wir Holland verlassen. Du bist hier so anders. Als ob du dich für mich schämst. Wir sollten Jaris Angebot annehmen. So eine Chance wird einem nicht zweimal geboten.«
»Aber Finnland ...« Meine Mutter blickte zweifelnd. »Da ist es kalt und dunkel.«
»Nur im Winter«, meldete ich mich.
»Ich bin nicht für den Winter gemacht«, flüsterte meine Mutter.
»Wo werden wir da wohnen?«, fragte ich.
»Im Winter in einer kleinen Einliegerwohnung bei Koivistos und im Sommer in ihrem Landhaus an einem See. Finnland hat viele Seen und große Wälder. Mehr als genug Holz. Ich kann mir eine Werkstatt auf Jaris Industriegelände einrichten.«
»Und dafür bezahlt er dich?«, fragte ich ungläubig.
»Natürlich nicht«, sagte meine Mutter. »Wir werden dafür bezahlt, dass wir bei den Koivistos im Haus und in der Fabrik mitarbeiten. Ich helfe Rosa im Haushalt und dein Vater kümmert sich um alle anfallenden Reparaturen und kriegt einen Job in der Fabrik.«
»Du wirst ein Dienstmädchen?«, fragte ich ungläubig und hoffte, dass mich meine Mutter verbessern würde.
»Arbeit ist keine Schande.«
»Wie schön, dass du dich mit dem kleinen Nikki so gut verstehst«, setzte mein Vater hinzu. Ich begriff, dass jetzt auch ich mein Scherflein zum Familieneinkommen beizutragen hatte. Mit zwölf Jahren war meine Kindheit zu Ende.
***
Wenige Tage später stand ich an der Reling der Finnhansa und trauerte dem verlorenen Traum von Indonesien nach. Ich hielt mein Gesicht in den eiskalten Wind, in der Hoffnung, er würde meine trüben Gedanken wegblasen. Wir sollten dankbar sein, dass uns eine Zukunft geboten würde, hatte mir mein Vater am Vorabend gesagt. Seine Worte hatten mich zutiefst erschreckt. Eine Zukunft war mir bis dahin als etwas Selbstverständliches erschienen, aber plötzlich nahm sie bedrohliche Züge an. Ich stellte sie mir als einen Moloch mit vielen Mündern vor, die mich zu verschlingen drohten, weil aus ihnen Worte kamen, die ich nicht verstand. Ich saß zwischen Nikki und meinem Vater am Kapitänstisch und hörte, wie sich Jari mit dem Kapitän auf Finnisch unterhielt. Mein Vater sprach englisch mit Rosa und meine Mutter schwieg in den beiden Sprachen, die mir vertraut waren.
Als das Hauptgericht aufgetragen wurde, glaubte ich zunächst, die Bedienung habe sich geirrt und zu früh das Dessert gebracht. Auf einer Platte befand sich ein runder Kuchen mit brauner Kruste. Eine finnische Spezialität, sagte Rosa zu meiner Mutter auf Niederländisch und hob die obere Kruste wie einen Deckel ab. Entsetzt schlug ich mir die Hand vor den Mund. Lauter kleine Fische lagen auf einer fettigen Masse. Sie sahen sehr lebendig aus.
»Kalakukko«, strahlte Rosa. »Fischkuchen, eine finnische Spezialität.«
»Wir ... wir essen keinen Fisch«, stotterte meine Mutter.
»Großmama ist daran gestorben«, erläuterte ich.
Neben mir wurde es lebendig. Nikki hatte sich über den Tisch gelehnt und mit den Fingern einen Fisch aus der Masse gezogen.
»Nikki«, rief seine Mutter.
Das war die Gelegenheit, den ekligen Fischen zu entkommen. Ich stand auf und schob meinen Stuhl zurück.
»Komm, Nikki«, sagte ich und griff nach der anderen Hand des Jungen. »Wir werfen den Fisch zurück ins Meer.«
Wir rannten aus dem Speisesaal zur Reling. Ich hatte damit gerechnet, dass der Junge den Fisch in hohem Bogen über Bord werfen würde. Stattdessen ließ er ihn ganz langsam fallen und blickte ihm nach.
»Das geht ganz einfach«, sagte er und fügte hinzu: »Jetzt ist er wirklich tot.«
»Toter als tot geht nicht«, klärte ich ihn auf.
»Aber er ist verschwunden. Richtig weg«, bemerkte Nikki befriedigt.
Später brachte ich ihn in der Kabine, die ich mit ihm teilte, zu Bett und ging zu meinen Eltern in den Salon. Aber da sich niemand mit mir beschäftigte und jeder wieder fremd sprach, langweilte ich mich. Ich beschloss, draußen noch ein bisschen herumzulaufen.
Als ich zur Kabine zurückkehrte, um meine Jacke zu holen, sah ich schon im Gang, dass etwas nicht stimmte. Die Tür war angelehnt und durch ein Handtuch vor dem Zuschlagen geschützt. Ich stürzte ins Zimmer. Nikkis Bett war leer.
Plötzlich hörte ich durch die offene Tür das leise Zuschnappen eines Schlosses. Ich sprang hinaus und sah Nikki. Er kam aus der angrenzenden Kabine seiner Eltern und hielt den kleinen Raimo im Arm. Als er mich sah, ließ er das Baby beinahe fallen.
Ich entriss es ihm.
»Was machst du da?«, fuhr ich ihn an.
»Raimo hat Hunger!«, jaulte er mit einer Kleinjungenstimme. »Ich auch. Ich will in die Küche ...«
»Wo ist der Kabinenschlüssel deiner Eltern?«, fragte ich, während mir durch den Kopf ging, dass Nikki keinen Fisch gegessen, aber einen über Bord geworfen und das ganz einfach gefunden hatte.
Er deutete zur geschlossenen Kabinentür.
»Hab ich dringelassen. Gibst du uns jetzt was zu essen?«
Das Baby war inzwischen wach geworden und schrie.
»Raimo muss ins Bett. Und du auch. Ich gehe zu deinen Eltern. Sie müssen jemanden holen, der die Tür aufmacht.«
»Kannst du das nicht tun?«, fragte Nikki bettelnd.
Nichts ist geschehen, verdrängte ich einen entsetzlichen Verdacht, außer dass Nikki seinen Eltern den Kabinenschlüssel geklaut und das Baby aus dem Bettchen geholt hat. Ich war für Nikki verantwortlich, und es lag in meiner Macht, das Ganze ungeschehen zu machen. Dann würde sich niemand beunruhigen und wir könnten alles vergessen.
»Geh in die Kabine und bleib drin!«, fuhr ich Nikki an. »Ich kümmere mich um alles.«
Ich schloss unsere Kabinentür wieder ab und ging mit dem brüllenden Baby auf dem Arm auf die Suche nach einem Steward. Der glaubte mir ohne weiteres, dass ich mit dem Baby in der Nachbarkabine gewesen wäre, als die Tür zugeschnappt war.
»Nächstes Mal besser aufpassen«, sagte er auf Deutsch, als er mir die Tür aufschloss. Das Baby schrie weiter, als ich es in sein Bett legte. Ich stopfte ihm den Schnuller in den Mund und kehrte in den Salon zurück.
»Ist es so kalt draußen?«, fragte meine Mutter. »Du hast richtig rote Bäckchen!«
Ich ließ den Kabinenschlüssel der Koivistos unter den Tisch fallen.
Am nächsten Tag benahm sich Nikki so vorbildlich, dass Rosa immer wieder meinen guten Einfluss auf ihren Sohn lobte. Ich war froh, dass ich den Vorfall für mich behalten hatte und Nikki dankte mir mein Schweigen durch besondere Anhänglichkeit.
Er stand neben mir und hielt meine Hand, als am nächsten Vormittag unser Schiff durch die dem Hafen von Helsinki vorgelagerten Schären fuhr. An einer Stelle gestattete die schmale Fahrrinne einen nahen Blick auf eine Ruine.
»Das ist die ehemalige Seefestung Suomenlinna, oder Sveaborg auf Schwedisch«, erklärte uns Rosa und fragte mich etwas später: »Weißt du jetzt, warum man Helsinki ›die weiße Stadt im Norden‹ nennt?«
Ich nickte. Das Schiff steuerte auf die Schmalseite des lang gestreckten Südhafens zu. Von unserer Warte an der Reling konnten wir das bunte Treiben auf dem Marktplatz verfolgen. Rosa deutete auf die repräsentativen Fassaden dahinter und zählte auf: »Rathaus, Reichsgericht, schwedische Botschaft, Palast des Staatspräsidenten.« Diese Gebäude überragte im Hintergrund ein eindrucksvoller, schlichter Dom mit Säulen und grünen Kuppeln. Ich atmete auf. Der erste Eindruck von Helsinki war anheimelnd und der Hafen freundlicher als der in Hamburg. Vielleicht war Finnland gar nicht so übel.
Später sollte ich lernen, dass diese Skyline dem in Berlin geborenen Carl Ludwig Engel zu verdanken war, einem Schüler von Schinkel. Er hatte es in St. Petersburg zu großem Ansehen gebracht und Anfang des 19. Jahrhunderts vom Zaren den Auftrag erhalten, die neue Hauptstadt seines Großfürstentums Finnland mit klassizistischen Bauwerken auszustatten. Nur ein Bauwerk stach krass aus diesem mitteleuropäischen Panorama heraus.
»Was ist das?«, fragte ich Rosa und deutete auf das dunkelrote Mauerwerk eines beinahe bedrohlich aussehenden Gebäudes, das auf einem Felsen thronte. Auf dem Hauptturm glitzerte eine goldene Zwiebelspitze.
»Die orthodoxe Kathedrale«, erklärte Rosa. »Sie erinnert uns daran, dass Finnland einmal Bestandteil des russischen Kaiserreiches gewesen ist.«
»Finnland war auch besetzt?«, fragte ich.
»Ja, und nicht nur von den Russen, sondern viele Jahrhunderte lang von den Schweden. Beide Länder haben immer wieder um Finnland gekämpft.«
»Warum?«, wollte ich wissen.
»Das wirst du in deiner neuen Schule lernen«, wich Rosa aus. Ich dachte an das ganze internationale Kuddelmuddel, mit dem ich in den letzten Tagen konfrontiert worden war, an all die Länder, die andere überfallen, bekriegt und besetzt hatten. Ich dachte an den Hass in den Augen meines Großvaters, als er von meinem Vater gesprochen hatte.
Nein, es waren nicht Länder, die andere Länder überfielen, sondern Menschen. Menschen, die nicht zu Hause geblieben, sondern wie wir in die Fremde gezogen waren.
»Haben die Deutschen auch Finnland besetzt?«, fragte ich.
»Nein«, erwiderte Rosa.
»Dann hassen sie uns hier also nicht«, bemerkte ich befriedigt.
Rosa schenkte mir einen seltsamen Blick. Mein Vater mischte sich ein.
»Eins solltest du dir für die Zukunft merken, Iris. Menschen, die uns mögen, weil wir Deutsche sind, werden nicht unbedingt die Menschen sein, die wir mögen.« Während wir von Bord gingen, fragte ich mich, ob das nun bedeutete, dass ich die Menschen zu mögen hatte, die uns hassten. Mein Großvater hasste Deutsche, aber trotzdem mochte ich ihn. Vielleicht war alles weniger kompliziert, wenn man an einzelne Personen anstatt an ein ganzes Volk dachte.
2 HELSINKI
»Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass wir leider auch Kommunisten in Iris' Klasse haben«, sagte der Direktor der Deutschen Schule zu meinem Vater. Wir waren etwas zu spät zu meinem Einschulungstermin erschienen, weil unterwegs eine Möwe einen weißen Klacks auf mein frisch gewaschenes Haar hatte fallen lassen.
»Ein gutes Omen, das bringt Glück«, behauptete mein Vater und zog mich in ein Lokal. Er bestellte einen Kaffee, während ich in der Toilette versuchte, den Möwendreck aus meinem Haar zu spülen. Obwohl mein Vater beteuerte, dass man nichts mehr sähe, wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich mit Scheiße auf dem Kopf meine neue Schule betrat.
»Kommunisten?«, fragte jetzt mein Vater. »Na, so was! Haben Sie etwa auch Katholiken?«
»Ich sage das nur, weil Iris einer gewissen Propaganda ausgesetzt sein könnte. Das ist sie aus Westdeutschland ja nicht gewöhnt.«
»Finnland ist doch kein Ostblockstaat!«, erwiderte mein Vater.
»Finnland ist ein Land zwischen West und Ost«, erklärte der Direktor.
»... aber Ihrer Meinung nach etwas mehr zwischen Ost?«, fragte mein Vater.
»Finnland ist das Loch in der Hallstein-Doktrin«, sagte der Direktor.
»Was verstehen Sie darunter?«, erkundigte sich mein Vater.
»Dass normalerweise die Bundesrepublik keine diplomatischen Beziehungen zu einem Staat aufnimmt, der Kontakte zur Ostzone unterhält, hier aber diplomatische Vertreter von beiden deutschen Staaten akkreditiert sind.«
»Soweit ich weiß, haben wir auch einen Botschafter in Moskau«, meinte mein Vater.
»Das ist was anderes. Adenauer hat mit der UdSSR diplomatische Beziehungen aufnehmen müssen, damit Kriegsgefangene freigekauft werden konnten. Außerdem ist Russland eine der vier Siegermächte. In den anderen Ostblockstaaten hat die Bundesrepublik keine Botschafter.«
»In Finnland auch nicht, habe ich gehört.« Der Direktor nickte zum Fenster. »Weil es offiziell weder zur Zone noch zu uns diplomatische Beziehungen gibt. Aber da gegenüber ...« Er deutete aus dem Fenster, »... befindet sich das deutsche Generalkonsulat, eine Handelsvertretung im Rang einer Botschaft. Die ist übrigens auch für unsere Schule zuständig. Die Deutsche Schule steht allen offen. In Iris' Klasse ist zum Beispiel der Sohn eines ungarischen Diplomaten. Er ist auch erst zwölf, hat aber schon ganz deutliche politische Vorstellungen. Kommunistische«, setzte er hinzu.
»Wie beklagenswert«, bemerkte mein Vater. »Aber machen Sie sich um meine Tochter keine Sorgen. Sie steht fest auf dem Boden unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung.«
Als Zwölfjährige konnte ich mit dieser Standortbestimmung wenig anfangen, dafür umso mehr mit Bela, dem ungarischen Diplomatensohn. Er war der Einzige, mit dem ich mich ein wenig anfreundete. Wie ich war auch er ein Fremdkörper in einer Klasse, die hauptsächlich aus Finnen und Schwedischfinnen bestand. Eine Klassengemeinschaft, wie ich sie aus Hamburg kannte, gab es hier nicht. Die finnischsprachigen Finnen saßen zusammen und blieben in der Pause unter sich. Gleiches galt für die kleinere Gruppe der Schwedisch sprechenden Finnen. Ferner gab es in der Klasse noch einen Dänen, der kein Finnisch, aber Schwedisch sprach und bei den Schweden geduldet wurde, sowie einen Amerikaner, der immer für sich blieb und damit keine Probleme hatte. Das einzige andere deutsche Mädchen in der Klasse, Rita, hatte ihren Namen zum finnischen Riitta verändert. Sie war in Finnland geboren, fühlte finnisch und sich dadurch verpflichtet, mich zu ignorieren. In ihrer Gegenwart kam es mir immer so vor, als ob sich der Möwendreck als sichtbares Zeichen in meine Kopfhaut eingebrannt hätte. Riitta nahm auch am muttersprachlichen und am schwedischen Unterricht der Finnischfinnen teil, während Bela und ich zu diesen Zeiten Freistunden hatten. Wenn wir nicht herumalberten, nutzte ich die Freistunden, um an meinem Englisch zu arbeiten. Obwohl meine Klasse auch erst seit zwei Jahren Englischunterricht hatte, sprach selbst der Schlechteste besser Englisch als der Beste in meiner Hamburger Schulklasse.
»Für die meisten ist es nach Finnisch, Schwedisch und Deutsch die vierte Sprache, und die fällt einem immer am leichtesten«, tröstete mich Rosa.
»Dann ist es besser, wenn ich erst Schwedisch und dann Englisch lerne?«, fragte ich sie.
»Versuch es lieber mit Finnisch. Schwedisch wird nur hier an der Küste gesprochen. Wenn wir im Sommer auf unser Landhaus fahren, wirst du Finnisch brauchen.«
Wir wohnten bereits seit zwei Monaten in der Koivisto-Villa im nördlichen Stadtteil Munkkiniemi, direkt an der breiten Meeresbucht Lasjalahti. Der riesige Garten war von dem felsigen Ufer lediglich durch eine schmale Promenade getrennt. Vom Garten aus gelangte man in unsere Schlafzimmer im Tiefparterre neben der Sauna, die vor allem mein Vater mit Leidenschaft benutzte. Manchmal schämte ich mich, wenn er nur in eine Dampfwolke gehüllt mit Geheul aus der Tür stürzte und sich in den eiskalten Swimmingpool warf, den schon an manchem Oktobermorgen eine dünne Eisschicht bedeckte. Eine Treppe führte hinauf zu unserem Wohnzimmer, das sich neben der Küche befand. Von da aus ging ich über die Hintertreppe hinauf zu dem Flur im Obergeschoss, an dem Nikkis Zimmer lag.
Auch für ihn hatte jetzt die Schulzeit begonnen und seine Eltern hofften, dass er in der Schule die Disziplin erlernen würde, die ihm zu Hause abging. Aber er schien im Gegenteil nur ein erweitertes Feld für seine Streiche gefunden zu haben. Keine Woche verging, in der nicht Eltern oder Lehrer anriefen und sich über ihn beklagten. Einmal hieß es sogar, er terrorisiere die ganze Klasse. Schließlich wurde ein Kinderpsychologe eingeschaltet. Der wusste wenig Rat, da sich Nikki in seiner Gegenwart von der besten Seite zeigte und sehr einsichtsvoll erschien. Der kleine Junge erzählte mir stolz, wie er den Erwachsenen reingelegt hätte.
»Der Mann wollte in meinen Kopf gucken«, sagte er. »Aber er ist doof. Er denkt, ein Kopf ist aus Glas. Ich sage ihm, was er hören will. Zum Beispiel, dass ich Raimo liebe.« Er verzog das Gesicht. »Und dann muss ich immer malen. Das mache ich gern. Ich male dann immer etwas, das ich vor mir sehe. Seine Füße zum Beispiel, wenn die auf dem Schreibtisch liegen. Oder ich male ein Bild ab, das an der Wand hängt. ›Mal etwas, das du dir vorstellst‹, sagt er dann immer, und ich antworte, dass ich immer nur das male, was ich sehe.«
Sogar ich konnte erkennen, dass Nikki künstlerisches Talent hatte. Er malte sehr viel und wurde von seiner Umgebung auch dazu angeregt, weil er sich dann nämlich ruhig verhielt. Aber seine Bilder sahen nicht aus wie die von anderen Kindern. Er malte fotografisch, auch wenn die Perspektive nicht immer hinhaute, wie mein Vater sagte. Der war sehr beeindruckt, dass ein Sechsjähriger in der Lage war, eine Hand abzumalen, und prophezeite ihm eine große künstlerische Zukunft.
Wenn Rosa und Jari über ihr Sorgenkind klagten, pflegte mein Vater zu erwidern, man müsse mit Künstlern Nachsicht haben. Das galt natürlich auch für ihn.
Ich bin nie dahinter gekommen, welche Aufgaben er damals in Jaris Fabrik wahrzunehmen hatte. Er fuhr jeden Morgen dorthin und kehrte am Abend meistens mit Jari zurück. Seine Werkstatt auf dem Fabrikgelände habe ich nie besichtigt, aber beim Abendessen erzählte er uns ausführlich von seinen Problemen. Anfangs war er ziemlich verzweifelt, weil er nur Nadelholz zu sehen kriegte. »Das ist viel zu großnervig und splittert«, klagte er. »Man kann daraus Bretter machen, Möbel und Häuser, aber doch keine Kunst! Ich brauche hartes Holz.« Er war überaus glücklich, als er dahinter kam, dass es im Süden des Landes auch noch Laubbäume gab, Birken, Ahorn, Ulmen, Linden, Erlen und Pappeln zum Beispiel.
Ich kenne nur ein einziges seiner Werke aus jener Zeit. Er hatte es Rosa und Jari für ihren Garten geschenkt. Jari hatte einen Ahornbaum fällen müssen, der den Blumenbeeten zu viel Licht nahm, und meinem Vater das Holz überlassen.
»Die Ahornseele«, nannte Vater das fertige Kunstwerk. Es war über zwei Meter hoch und sollte nach seinen Worten die Essenz des Baums darstellen. Ich fand es eine gespenstische Arbeit. Sie erinnerte mich sehr an Fotos von entlaubten Baumstrünken nach dem Abwurf einer Atombombe. Vater hatte das Holzstück mit wetterfesten Materialien behandelt und es danach ans Kopfende des Swimmingpools gestellt. Um ganz sicherzugehen, dass die Seele des Baums der Witterung standhielt, wollte mein Vater die Plastik mit Teer überziehen. Ich war froh, dass Jari ihn davon abhielt.
»Der Baum ist in den Garten zurückgekehrt«, verkündete Vater, aber ich teilte seine Ansicht nicht. Mir lief jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn mein Blick auf Vaters Kunstwerk fiel. Vor allem bei Sonne, wenn einer der stilisierten dicken Zweige, der in eine Art Klauenhand auslief, einen bedrohlichen Schatten auf den Boden des stillen Wassers im Swimmingpool warf. Dieser Schatten wirkte wie ein Vorbote des Unheils.
***
Meine Befürchtung, dass Mutter als Dienstmädchen ausgebeutet werden würde, erwies sich als unbegründet. Koivistos behandelten uns nicht wie Domestiken, sondern wie Hausgäste. Es gab eine Putzfrau, einen Gärtner, eine Waschfrau, einen Chauffeur sowie eine Köchin für offizielle Anlässe. Obwohl meine Mutter alle Pflichten einer Haushälterin übernommen hatte, wurde sie immer als Rosas im Haus wohnende Freundin vorgestellt und saß auch bei offiziellen Abendessen mit am Tisch. Mein Vater war dann zwar auch eingeladen, aber nach den ersten beiden Malen drückte er sich.
»Die Trinksitten sind mir zu kompliziert«, erklärte er mir. »Ich blicke da nicht durch und benehme mich dauernd daneben.«
Er erläuterte mir, dass es eisenstarre Regeln gäbe, wer wann zu wem »skål« sagen müsse oder es umgekehrt keinesfalls sagen dürfe. »Wenn Rosa ein Essen gibt, ist sie zum Beispiel verpflichtet, jedem anwesenden Herrn im Laufe des Essens einmal zuzuprosten«, fuhr er fort. »Bei einer großen Tafel wird sie durch das ständige Lauern auf den passenden Moment davon abgelenkt, sich mit ihrem direkten Nachbarn in ein Gespräch zu vertiefen. Sie muss eine Strichliste im Kopf führen und aufpassen, dass sie niemanden vergisst. Damen dürfen nicht trinken, wenn sie wollen, sondern erst zum Glas greifen, wenn ein Herr ihnen zutrinkt. Bei meinem ersten Essen wusste ich das nicht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, meiner Tischnachbarin zuzuprosten, und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum sie ihr volles Weinglas nicht anrührt.« Heute glaube ich, dass Vater die finnischen Tafelsitten nur als Entschuldigung vorschob. In Wirklichkeit war er es leid, andauernd englisch sprechen zu müssen und dann auch noch mit der Nase darauf gestoßen zu werden, dass die Finnen das besser konnten. Er fand es sicher schon schlimm genug, dass Mutter jetzt ganz offen nur noch niederländisch mit mir sprach und er nichts dagegen unternehmen konnte, weil dies eine der beiden Umgangssprachen im Hause Koivisto war. Ich hatte inzwischen begonnen, Finnisch zu lernen, und fragte ihn, ob er nicht mitmachen wolle, aber er winkte mit dem Hinweis auf sein Alter und die besonderen Schwierigkeiten der finnischen Sprache ab. Rosa gab zu, dass die finnische Sprache gewöhnungsbedürftig sei. Das markige minä rakastan sinua – ich liebe dich – habe in ihren Ohren zuerst auch eher nach einer Kriegs- denn einer Liebeserklärung geklungen.
»So wie euer holländisches ik hou van jou«, brummte mein Vater und haute einer imaginäre Gestalt etwas um die Ohren.
»Und was ist mit eurem Schmetterling?«, fragte Rosa in perfektem Deutsch.
»Was ist damit?«, fragte mein Vater zurück, sichtlich erfreut, dass sich Rosa der Sprache bediente, die sie nie wieder hatte sprechen wollen.
»Schmet-ter-ling!«, trompetete Rosa. »Für ein zartes, zerbrechliches Geschöpf können auch nur die Deutschen einen derart martialischen Begriff erfinden.«
»Wir können ja wieder englisch sprechen«, schlug mein Vater schüchtern vor.
Er hatte inzwischen Kontakt zu Auslandsdeutschen aufgenommen, die sich jeden Sonnabend in einem Hotelrestaurant trafen.
»Was redet ihr da?«, fragte meine Mutter.
»Deutsch!«, fuhr er sie an.
»Ich meine, worüber.«
»Zum Beispiel über DDR-Flüchtlinge. Wir haben seit letzter Woche drei neue Landsleute.«
Ein Mitarbeiter der westdeutschen Handelsvertretung hatte berichtet, dass sich drei Boxer aus Cottbus abgesetzt hätten. Sie waren für einen Länderkampf nach Finnland gekommen und hatten sich mit einem letzten Sieg von ihrem alten Vaterland verabschiedet.
»Im Generalkonsulat wurden Sofortfotos gemacht, neue Pässe ausgestellt und dann wurden die Männer schnell in eine Maschine nach Stockholm gesetzt«, erzählte Vater. Sein Informant habe ihm empört mitgeteilt, dass alle drei Amateurboxer in der DDR die gleiche Adresse gehabt und als Schlosser zwar Gehalt bekommen, diesen Beruf aber nie ausgeübt hätten.
»Kein Wunder, dass sie gegen die Finnen gewonnen haben, wenn sie nichts anderes tun als Boxen! Amateursport!« Vater hatte auch erfahren, dass das DDR-Schiff »Völkerfreundschaft« den finnischen Hafen meistens mit ein paar Mann weniger an Bord verließ und dass zwei DDRler sogar einmal von der polnischen »Batory« gesprungen und ans finnische Ufer geschwommen waren.
»Hoffentlich im Sommer!«, sagte Mutter zitternd und fragte, ob solche Vorfälle nicht Probleme zwischen der DDR und Finnland schufen.
»Die finnische Polizei ist schlau«, berichtete mein Vater. »Sie sagt der DDR-Behörde zu, die Ausreißer sofort einzufangen. Aber ihr wisst ja, was sofort in Finnland bedeutet...«
Wir nickten alle ergeben. Rosa hatte einmal erklärt, dass ihr die finnische Langsamkeit am meisten zu schaffen mache. Auf Jaris Einwand, dass Südländer auch nicht gerade die Schnelligkeit erfunden hätten, erwiderte sie, dass man im Süden zwar langsam, aber auch fröhlich und zugänglich sei. Umständliche Langsamkeit gepaart mit Introvertiertheit sei für temperamentvolle Menschen schwer erträglich.
»Gott hat uns die Zeit gegeben, von Eile hat er nichts gesagt«, antwortete Jari.
»Die finnische Polizei«, sagte jetzt mein Vater, »tritt also erst in Aktion, wenn die Flüchtlinge über alle Berge sind.«
***
Wenn Mutter gefragt wurde, wie ihr Finnland gefalle, flog ein asiatisches Lächeln über ihr Gesicht, und sie erklärte leise, dass sie dieses Land sehr schön fände. Soviel ich weiß, hat sie im ersten Halbjahr das Haus nur verlassen, um in den Garten zu gehen. Manchmal sah ich sie stundenlang am Zaun stehen und auf die Bucht hinausschauen. Wenn ich mich neben sie stellte, sah ich, wie ihr Blick immer an jener schmalen Stelle fest hing, wo sich die Bucht zum Meer hin öffnete. Sonst deutete nichts darauf hin, dass sie von Flucht träumte.
Die Erwachsenen, der Psychologe eingeschlossen, hielten es für ein Wunder, dass ich mit dem ansonsten so schwierigen Nikki mühelos zurechtkam. Wenn sie mich nach meinem Geheimnis fragten, hob ich die Schultern. Ich konnte ihnen schlecht sagen, dass es darin bestand, nichts zu tun. Die Selbstverständlichkeit, mit der davon ausgegangen worden war, dass ich mich um Nikki kümmern sollte, hatte mich geärgert. Ich schwor mir, kein bisschen mehr zu tun als unbedingt nötig. Ich frühstückte mit ihm und nach der Schule saß ich in seinem Zimmer und las, während er malte, Schulaufgaben machte oder spielte. Ich kann mich nicht erinnern, jemals mit ihm gespielt zu haben. Ihm schien es zu genügen, dass ich mich im selben Zimmer mit ihm aufhielt. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, weil es ein viel schönerer Raum war als mein halbdunkles winziges Schlafzimmer im Tiefparterre.
Schon in Hamburg hatte ich gern gelesen, aber in Helsinki wurde ich zu einer besessenen Leseratte. Rosa und Jari hatten mir erlaubt in ihrer Bibliothek herumzustöbern und ich freute mich über die niederländischen und deutschen Bücher, die ich dort entdeckte. Ich konnte es kaum erwarten, bis mein Englisch, Finnisch und Schwedisch mir erlauben würden, die anderen Schätze zu heben.
»Wir haben beschlossen, Nikki auch auf die Deutsche Schule zu geben«, verkündete Rosa eines Abends. Ich erschrak. Jetzt würde der Junge nicht nur den gleichen Schulweg haben, sondern sich wahrscheinlich auch in den Pausen an mich hängen. Ein kleines Kind an meiner Seite würde mich noch mehr in die Außenseiterrolle drängen.
»Aber er kann kein Deutsch«, warf ich ein.
»Das wird er da lernen«, meinte Rosa unbekümmert, »der Psychologe ist auch der Meinung, dass es Nikki gut täte. Auf deiner Schule herrscht mehr Disziplin als auf seiner.«
Auch mehr als auf meiner Hamburger. Wer zum Beispiel am Montagvormittag die langweilige Morgenandacht zu schwänzen versuchte, wurde aufgeschrieben und bestraft. Die Lehrer ließen nicht viel mit sich reden, und das lag wahrscheinlich daran, dass viele Schüler plötzlich ganz schlecht Deutsch sprachen, wenn sie etwas angestellt hatten. Manchmal flog während des Unterrichts ein finnisches Wort durch die Klasse und alles begann zu kichern. Die meisten Lehrer vermuteten unanständige Kommentare dahinter und handelten dementsprechend. Auch wenn es nur ein kräftiges »Kartoffeln mit Speck!« war, der erste Zwischenruf, den ich verstand. Der Rufer verteidigte sich, er habe den anderen nur mitgeteilt, was es heute in der Schulkantine gäbe.
»Das stimmt!«, rief ich aufgeregt dazwischen. Der Lehrer warf mir einen unendlich traurigen Blick zu.