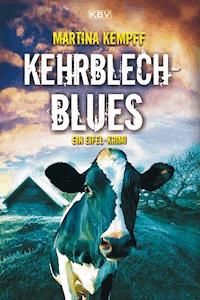10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer 741: Ein prunkvoller Reisezug begleitet Bertrada auf dem Weg nach Saint-Denis, wo Pippin, der Sohn Karl Martells, sie zur Hochzeit erwartet – doch er heiratet die falsche Frau. Jahre später wird diese Grafentochter dennoch zu einer der mächtigsten Frauen des Frühmittelalters. Dank ihres Mutes und ihres diplomatischen Geschicks wird sie zur Königin und ihrem Sohn Karl eine kluge Ratgeberin. Doch verbirgt sich hinter »Berta mit dem großen Fuß« auch eine leidenschaftliche Frau, die sich für schwere Demütigungen fürchterlich rächt – und dabei mitunter auf die unkontrollierbaren Mächte der Magie zurückgreift.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Juliane Weidener
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
6. Auflage 2009
ISBN 978-3-492-96093-9
© 2005 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagabbildung: Rogier van der Weyden (»Portrait of a young woman«, Bricleman, Berlin)
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Die vertauschte Braut
Armut, Schmutz und Elend waren Vater Gregorius nicht fremd. Aber noch nie hatten seine Augen solch ein Geschöpf gesehen, wie jenes, das an diesem warmen Spätsommerabend des Jahres 741 die Holzpforte zum Klostergarten der Abtei aufgestoßen hatte.
Es schien weder Mann noch Frau zu sein, war vielleicht überhaupt kein menschliches Wesen. Als sei es den Tiefen der Erde entstiegen, von Gluten gegerbt, von Kohle gebeizt, durch Schlamm gezogen, von Wurzeln zerkratzt und Flechten umschlungen, stand es stumm in der Toröffnung. Wirre Zotteln in allen Herbstfarben verdeckten fast gänzlich sein Gesicht, und unter dem schmutzsteifen Überwurf schauten statt der Füße zwei riesige unförmige Klumpen wie aus verkrusteter Erde hervor.
»Jesus Christus, Allmächtiger!« entfuhr es dem Abt, den das leise Quietschen der Pforte aus einem Gespräch mit der Klosterstifterin herausgerissen hatte.
»Darunter verbergen sich bestimmt keine Hufe, mein lieber Freund«, sagte die hagere Frau, die dem Blick des Abtes gefolgt war. Sie trat auf das Wesen zu, wechselte vom Lateinischen ins Deutsche über und fragte: »Wie heißt du, mein Kind, woher kommst du und wohin des Weges?«
»Gestatte mir zunächst die Frage, edle Frau, ob dieses Anwesen die Abtei zu Prüm beherbergt«, kam die Replik in wohlgesetztem Latein. Die Heiserkeit der Stimme täuschte nicht darüber hinweg, daß die Kreatur zweifelsfrei weiblichen Geschlechts, offenbar von vornehmer Abstammung und noch dazu ziemlich jung war.
Höflich bestätigte die Klosterstifterin Bertrada von der Burg Mürlenbach, die von allen nur Frau Berta genannt wurde, daß dies so sei, und bat die Fremde noch einmal um ihren Namen. Das Wesen teilte mit zwei vor Schmutz starrenden Händen den struppigen Gesichtsvorhang und blickte aus hellgrünen Augen, die sich in dem rußigen Gesicht seltsam klar ausnahmen, an der Klosterstifterin und dem Abt vorbei in den blühenden Garten.
Ihrer Antwort: »Flora« folgte ein Seufzer. Der Abt und die Klosterstifterin sprachen gleichzeitig:
»Was führt dich hierher?«
»Wer ist dein Vater?«
Der langgezogene Seufzer ging in ein fast unverständliches Murmeln über: »Hunger.«
Frau Berta sah den Abt an. Hatte er die Fremde vielleicht verstanden? Er hob die Schultern. »Ungarn?« brummte er fragend. Die Klosterstifterin trat einen Schritt näher, legte die Hand ans Ohr und fragte: »Heißt du Flora von Ungarn?«
Die Fremde nickte und sank unversehens zu Boden. Vater Gregorius streckte zwar die Arme aus, ließ sie aber dann hilflos wieder fallen und sandte der älteren Frau einen verzweifelten Blick zu. Doch diese hatte bereits einen jungen Mönch herbeigewinkt, der, einen Holzkarren mit Erde hinter sich herziehend, neugierig näher gekommen war.
»Du kannst hier ab- und wieder aufladen«, erklärte Frau Berta und deutete auf die reglose Figur am Boden. »Und da ich sie nicht allein in den Karren schaffen kann, wirst du mir helfen.«
»Aber…«, begann der Abt.
»Ich weiß, ehrwürdiger Vater, den Körper einer Frau dürft ihr nicht berühren, aber der Herrgott hat meines Wissens nichts von Lumpen gesagt. Sofern er überhaupt etwas von eurem Umgang mit Frauen gesagt hat…« Sie bückte sich, hob den Umhang leicht an, der die Gestalt jetzt gänzlich bedeckte, und sagte zu dem jungen Mönch: »Unter Schichten verkrusteten Tuchs mag sich irgendwo der Fuß verbergen, aber vertrau mir, er ist deinem Zugriff entzogen, und du wirst der Sünde nicht näher sein, wenn du mir hilfst, diesen Haufen verfaulter Lappen zu bewegen.« Sonst erzähle ich dem Väterchen Abt noch, weshalb ihr abends so gern am Flußufer lustwandelt, dachte sie grimmig.
Erst vor einer Woche war wieder eine der angelsächsischen Frauen bei ihr erschienen und hatte um Arbeit im Mürlenbacher Längshaus nachgesucht, ja, sie geradezu angefleht, gegen Speise und Unterkunft dort Altartuch oder Kleidung anfertigen zu dürfen. Spinnen, nähen, färben, weben, sticken, waschen – alles sei ihr lieber, als für Brot, Wein, Bier oder ein paar Münzen weiterhin den Mönchen am Flußufer zu Willen zu sein. Warum sie denn nicht in ihre Heimat zurückkehre, hatte die Klosterstifterin gefragt. Die Frau aus Albion hatte ihr Gesicht verhüllt. Sie könne ihrer Familie nie wieder unter die Augen treten. Als ehrbare Pilgerin habe sie ihr Vaterland verlassen, als Hure werde sie in der Fremde sterben. Frau Berta hatte der Frau, die ganz sicher nicht zum Frondienst geboren war, einen Platz in der Färberei ihres Mürlenbacher Genitiums, der Tuchmacherei, zugewiesen.
So geht das nicht weiter! dachte Frau Berta. Ich muß Erzbischof Bonifatius bei seinem nächsten Besuch unbedingt die Not der Frauen aus seiner Heimat schildern. Nein, ich darf gar nicht daran denken, daß er vielleicht sogar mitschuldig an ihrem Los ist. Warum schwärmt er auch vor den Leuten so heftig von Rom! Das führt doch diese unglückseligen Frauen erst auf den Weg ins Verderben! Wie einfältig zu glauben, einer alleinreisenden Frau genüge der Schutz des Herrn, wenn ihr unterwegs so viele Männer begegnen! Diesen Pilgerreisen Einhalt zu gebieten wird dem guten Bonifatius wohl weitaus schwerer fallen, als vor staunenden Heiden eine heilige Eiche zu fällen! Eine Angelsächsin ist diese Flora von Ungarn jedenfalls nicht, dafür ist ihr Latein zu wohlklingend. Und für eine Rompilgerin hat sie sich zu weit nach Norden verirrt und ist viel zu vornehmer Herkunft. Solch gepflegtes Latein spricht man nur in den besten Familien. So wie in meiner. Außerdem würde keine edle Frau ohne erfahrenen Begleitschutz nach Rom ziehen. Allerdings ist mir auch noch keine edle Frau begegnet, die derart abscheulich zugerichtet ist und so erbärmlich stinkt. Daneben ist ja meine Pferdescheune nach dem Bierfest der Knechte ein Hort des Wohlgeruchs! Aber ich finde schon noch heraus, was oder wer sich unter diesen Hüllen verbirgt!
»Los!« befahl Frau Berta ungeduldig und packte selbst mit an, wo sie die Schultern der weiblichen Gestalt vermutete. Der Mönch kippte die Erde aus, fahndete mit abgewandtem Gesicht nach den Füßen und half, die bewußtlose Frau in den Karren zu heben.
Vater Gregorius hatte sich inzwischen ohne ein weiteres Wort entfernt. Er mochte zwar der Abt des Klosters sein, aber wenn die Abteistifterin in Prüm weilte, wußte selbst der ergebenste Mönch, wer dann tatsächlich den Ton angab. Was sehr ärgerlich war, da Frau Berta vor zwanzig Jahren ihren Anteil von Prüm und Rommersheim ja eigentlich der Abtei gestiftet hatte. Gut, die Abgaben wurden jetzt ans Kloster entrichtet, aber es lag nun mal nicht in Frau Bertas Natur, sich von etwas Geschenktem auch tatsächlich zu trennen. Wieder einmal ärgerte sich Vater Gregorius, daß sein Vorgänger ihr ein Mitspracherecht bei allen Entscheidungen zugesagt hatte, und daß er selbst einfach zu schwach war, sich dieser resoluten Edelfrau zu widersetzen. Es war außerordentlich demütigend, daß er ihre Anordnungen widerspruchslos entgegennahm und auch noch befolgte! Immer wieder hatte er die Feder gespitzt, um sich bei der höchsten Stelle, nämlich beim Hausmeier, über die Einmischung dieser überaus weltlichen Edelfrau zu beschweren, hatte das Schreiben dann aber doch nicht abgefaßt. Frau Bertas Güter reichten von den kahlen Hängen des Eifelgaus bis an die üppig begrünten Moselberge. Eine Witwe mit so viel Grundbesitz verfügte über erheblich mehr Macht als der arme Abt eines eher unbedeutenden Klosters. Warum hatte sie nicht wie andere vornehme Witwen irgendwo ein Frauenkloster gegründet? Da hätte sie sich selbst als Äbtissin einsetzen und die Novizinnen tyrannisieren können! Vater Gregorius stieß einen tiefen Seufzer aus, als er die Tür zum kleinen Skriptorium öffnete. Bonifatius hatte recht. Es wurde höchste Zeit, daß sich die fränkische Kirche endlich der römischen anschloß! Schließlich hatten Frauen in einem römischen Männerkloster nichts zu suchen. Mulier taceat in ecclesia. Nicht zum ersten Mal bedauerte Vater Gregorius, daß der Arm des Papstes nicht weit genug reichte. Aber vielleicht würde sich das mit Hilfe des Bonifatius bald ändern. Der sah in der römischen Kirchenverfassung, in der Unterordnung aller einzelnen Kirchen, also auch der fränkischen, unter Bischöfe und der Bischöfe wiederum unter den Papst die einzige Rettung vor einer Verwilderung der Sitte und Lehre der Geistlichen und des Volkes. Bei seinem letzten Besuch hatte er Vater Gregorius gefragt, ob er sich zutraue, in Prüm alle Bischöfe Austriens für kurze Zeit zu beherbergen. Er erwäge nämlich, hier eine Kirchenversammlung abzuhalten, ein sogenanntes Konzil. Eine unerhörte Initiative, hatte Vater Gregorius damals gedacht. Aber als ihm kurz danach zu Ohren kam, daß einer seiner Mönche den Streit mit dem Ehemann einer Halbfreien wahrhaftig mit einem Schwert ausgetragen hatte, konnte er Bonifatius nur recht geben: Es wurde Zeit, der Kirche Zucht und Ordnung beizubringen. An das allnächtliche Treiben am Ufer der Prüm durfte er gar nicht denken. Und Frauen sollten wissen, wo sie hingehörten. In der Bibel war das klar und deutlich formuliert. Jetzt war es an der Zeit, allgemein verbindliche Gesetze zu schaffen.
Frau Berta, die Klosterstifterin, war leicht brüskiert, daß sich der Abt wortlos verabschiedet hatte, doch sie vergaß die Verletzung der Etikette schnell. Ihre Gedanken kreisten um die fremde Frau. Aber selbst, wenn sie nicht anderweitig beschäftigt gewesen wäre, hätte sie sich nie vorstellen können, daß Vater Gregorius ihr gegenüber einen Groll hegte. Sie war es gewohnt, daß man auf ihr Wort hörte und es befolgte. Schließlich hatte sie dafür gesorgt, daß es Menschen und Mönchen in Prüm gut ging. Sie hatte die Rodung und Bestellung des Bodens überwacht, die Seifensiederei, die Kornmühle, die Netzmacherei, eine Weinkelterei und Bierbrauerei eingerichtet und die kleine Siedlung am Hang erbauen lassen. Nicht nur den Gebeten der Mönche war es zu verdanken, daß der Spelt, die Weizensorte, die in der Prümer Kalkmulde gedieh, schon im Mai so hoch stand, daß sich ein Hase darin verstecken konnte.
Frau Bertas Blick streifte das Hospital der Abtei, in dem einige arme Männer mit körperlichen Gebrechen untergebracht waren. Bei der Gründung des Klosters hatte sie darauf bestanden, daß die Einkünfte aus ihrem Gut Wesselsdorf den Unterhalt dieser bedauernswerten Wesen begleichen sollten. Diese Männer nahmen den Mönchen mancherlei Arbeit ab: Sie säuberten das Klostergelände, entfernten menschliche und tierische Exkremente, flickten die Palisaden, läuteten die Glocken, pflegten die Kranken und hielten bei Bedarf auch Totenwache. Frau Berta erwartete keine Dankbarkeit für ihre wohltätigen Werke, fand es aber auch nicht zu viel verlangt, daß man ihr dabei keine Steine in den Weg legte.
Jetzt ging sie neben dem Mönch und seiner Fuhre her und schüttelte den Kopf, als er vor dem Eingang zum Hospital anhielt und die Tür mit dem Fuß aufstoßen wollte.
»Diese Lumpen bedecken eine edle Frau«, sagte sie knapp und wies mit einem Nicken zum Gästehaus der Vornehmen.
Die edle Frau kam zu sich, als eine Magd gerade die letzte verkrustete Stofflage von ihrem Fuß zu reißen versuchte. Der Schrei drang sogar bis in die Kirche, wo sich die Mönche zum Abendgebet versammelt hatten. Frau Berta schalt ihre unachtsame Magd und gab Befehl, ein Becken mit warmem Wasser zu füllen und getrocknete Kamilleblüten hineinzugeben. Die Lappen, die mit den Fußen förmlich verwachsen zu sein schienen, sollten erst einmal aufgeweicht werden. »Und bring gleich eine dünne Fleischsuppe und einen Kanten Brot mit«, fügte die Herrin hinzu. Die Fremde mochte hungrig sein, sah aber keinesfalls so aus, als hätte sie viele Monate der Entbehrungen hinter sich. Nachdem nämlich die vor Schmutz starrenden Hüllen entfernt worden waren, hatte sich Frau Berta die junge Frau genau angesehen. Der Körper war nicht ausgemergelt, sondern schlank und wohlgeformt. Die Achselhaare zeugten ebenso von Gesundheit wie Haut und Fingernägel, und ihre kräftigen Zähne waren ebenfalls ein Zeichen dafür, daß die Fremde an gute Ernährung gewohnt war. Kratzer und Risse auf den Händen waren Spuren der allerjüngsten Vergangenheit. Es war unschwer zu erkennen, daß diese Hände keine harte Arbeit kannten.
»Flora von Ungarn«, sprach sie mit der sanften Stimme, die ausschließlich Kindern, Kranken, Alten und den mit Mühsal Beladenen vorbehalten war. »Hast du einen Wunsch?«
Auf der Klosterstifterin ruhte jetzt ein Blick, in dem sie nicht nur Dankbarkeit las, sondern noch etwas anderes. Neugier, Genugtuung, Wissen, dachte sie betroffen. Aber was für ein Wissen sollte das sein?
»Ich danke dir, edle Frau, ein Bett wäre mir jetzt lieb«, vernahm sie wieder die heisere Stimme. »Meine Reisegesellschaft wurde vor Monaten überfallen. Ich habe als einzige überlebt, bin weit gewandert und müde. Morgen antworte ich dir gern auf alle Fragen.«
»Vielleicht sollten wir erst noch den… den Reisestaub entfernen«, sagte Frau Berta in jenem Ton, der sonst nur für lügende Mönche bestimmt war. Diese Frau war keinesfalls monatelang unterwegs gewesen.
»Es ist kein Reisestaub«, erwiderte die Fremde mit verblüffender Ehrlichkeit. »Ich habe mich selbst so zugerichtet, mich in verschlammten Flußbetten gewälzt, Gesicht und Haare mit Ruß und Erde verschmiert, um unbehelligt an mein Ziel zu kommen.«
»Nach Prüm?«
Die Frage, schärfer als beabsichtigt, wurde mit fast unverschämter Gelassenheit beantwortet:
»Ich habe in meiner Heimat viel von deinen guten Werken gehört, edle Frau, und ich bin gekommen, um dir dabei zu helfen.«
Nein, im Lande Ungarn wird keiner etwas von meinen guten Werken vernommen haben, dachte Frau Berta. Man mag mich da als Tochter Irminias, der Stifterin des Klosters von Echternach, und des Seneschalls Hugobert kennen. Vielleicht auch als Schwester der Plektrud, jener Frau, die mit dem Hausmeier, dem major domus Pippin II. verheiratet war und der man Herrschsucht nachsagt, nur weil sie für ihre Kinder sorgen wollte.
Arme Schwester, die so heftig gegen den Sohn der Konkubine ihres Mannes gekämpft hat, gegen diesen Karl, dem einige jetzt den Beinamen »Martell«, der Hammer, gegeben haben. Arme Plektrud, die diesem Emporkömmling letztlich doch alle Macht überlassen mußte, arme Plektrud, die erfahren mußte, daß ich, ihre Schwester, diesem Mann auch noch geholfen habe, den Hammer niedersausen zu lassen! Aber was hätte ich damals bei Amel tun sollen? Den Neustriern mußte schließlich Einhalt geboten werden! Meiner Familie zuliebe habe ich mich vor Karls Dank verborgen – und deshalb nicht verhindern können, daß seine Männer das Gerücht ausstreuten, ein Engel hätte dem Hausmeier beigestanden. Das hat er schamlos ausgenutzt: Wenn Gott auf seiner Seite steht, kann er sich den Papst dienstbar machen. Schändlich, wie dieser sich vor ihm geduckt hat! Ach, was müssen es für Zeiten gewesen sein, als noch richtige Könige an der Macht waren und wirklich regierten! Leider habe ich sie nie erlebt. Wer hat schon gemerkt, daß Theuderich IV. vor vier Jahren gestorben ist? Wer hatte denn überhaupt mitbekommen, daß dieser König auf den Thron gehoben wurde – als willenloses Geschöpf seines Hausmeiers! Hoffentlich wird dieser elende Karl Martell bald zur Hölle fahren. Krank genug soll er ja sein, heißt es.
Gut, vielleicht hat man in Ungarn sogar etwas von der Gründung unseres Klosters in Prüm gehört, aber es wird weder Kunde von meinen Werkstätten für Frauen noch von meinem Hospital bis dorthin gedrungen sein. Wer ist dieses Mädchen? Und warum lügt sie mich an?
Wahrscheinlich wäre selbst diese robuste Edelfrau, die sonst nur wenig schrecken konnte, in Ohnmacht gefallen, hätte ihr die Fremde wahrheitsgemäß Auskunft gegeben. Darüber dachte die junge Frau nach, als sie wenig später gesäubert, mit Ölen gesalbt, gesättigt und von den Fußlappen befreit in einem Bett lag. Aber sie konnte der Klosterstifterin unmöglich ihre wahre Herkunft verraten. Diese Schande mußte sie ihrer Familie ersparen. Es hatte ihr furchtbar auf der Zunge gebrannt, denn noch nie zuvor hatte sie ein Geheimnis für sich behalten können. Alle Kraft nahm sie zusammen, um sich nicht zu verraten.
»Ich bin’s, Bertrada von Laon, deine Enkelin, nach dir benannt, und ich suche Schutz in jenem Kloster, das du mit meinem Vater aus Dankbarkeit gegründet hast, als ich geboren wurde.« Sie sprach diese Worte jetzt laut aus. Niemand konnte sie hören, denn zum ersten Mal in ihrem Leben schlief sie allein in einem Zimmer. Noch bis vor zwei Wochen hatte sie sich mit Leutberga ein Bett geteilt. Ihr ganzes bisheriges Leben lang. Leutberga, die Tochter ihrer Amme, ihr so nah wie eine Schwester, näher noch, denn sie hatten beide als Milchschwestern an Mimas Brust gelegen. Leutberga, mit der sie die Rollen getauscht hatte und die mittlerweile schon längst in Saint Denis eingetroffen sein mußte. Oder nach Laon zurückgekehrt war. Wie würde man Bertradas Verschwinden erklären, was ihren Eltern sagen? Tränen rannen Bertrada die Wangen hinunter, als sie an ihre Eltern dachte. Wann hatte sie sie zuletzt gesehen? Vor fünf Wochen? Oder sechs? Waren nicht schon über hundert Jahre vergangen, seitdem sie mit Leutberga das Gespräch der Eltern belauscht hatte? Es schien einer gänzlich anderen Zeit anzugehören, einem gänzlich anderen Leben.
Leutberga hatte damals herausgefunden, daß Graf Fulco, der Abgesandte des Hausmeiers Karl Martell, als Brautwerber für dessen jüngeren Sohn Pippin ins Schloß gekommen war. Bisher hatte der Graf von Laon jeden abgewiesen, der um die Hand seiner Tochter Bertrada angehalten hatte, auch Bewerber aus sehr edlen Familien Austriens, Neustriens, Burgunds, Patrimoniums und Aquitaniens. Würde Charibert von Laon auch dem mächtigsten Mann der Welt eine Absage erteilen? Dem Mann, der zwar lediglich der Sohn einer Nebenfrau Pippins war, der es aber immerhin geschafft hatte, sämtliche legitimen Nachfahren auszuschalten, zum Hausmeier aufzusteigen und zum eigentlichen Herrn des gesamten Frankenreiches zu werden?
»Er ist kein König«, hörten Bertrada und Leutberga an jenem Abend den Grafen zu seiner Frau sagen, »aber er hat Könige ernannt und abgesetzt, er hat Friesland und Südburgund erobert, und er wird nicht locker lassen, bis er auch Aquitanien und Bayern unterworfen hat. Er hat die Araber vertrieben, unser Abendland gerettet und eine taktisch kluge Politik mit den Langobarden in die Wege geleitet.«
Der Blick des Grafen blieb an der Truhe neben der Tür hängen. Kam von dort nicht ein leises Rascheln wie von Seide? Ein belustigtes Lächeln spielte um seine Mundwinkel, aber er sprach unbeirrt weiter: »Doch wie groß Karl Martells Macht wirklich ist, zeigte sich, als er es ablehnte, für den Papst gegen die Langobarden zu kämpfen, obwohl ihm Gregor die Schlüssel zum Petrusgrab und ein Glied der Kette Petri gesandt hat. Karl beließ es bei einem freundlichen Dankeschön.«
Hört doch auf mit eurer Politik! dachte Bertrada gelangweilt. Was interessieren mich denn der Papst, die Langobarden, die Araber und Aquitanien! Sprecht doch jetzt endlich über etwas wirklich Wichtiges, über den Sohn dieses Karl Martells, den ich vielleicht heiraten soll! Ist er schön? Klug? Wird er zulassen, daß ich mit auf die Jagd gehen darf?
»Hätte Karl Martell Rom beigestanden, dann hätte ihn der Papst wenigstens als Schutzherrn des Patrimoniums Petri anerkannt«, bemerkte Gräfin Gisela. »Ich weiß nicht, ob die Weigerung wirklich so klug war.«
»Die Ablehnung war klug formuliert«, gab der Graf zurück. »Er versicherte dem Papst, die römische Kirche stets zu schützen, aber ihretwegen werde er keinen Krieg führen, bei dem er zur Übertretung des fünften Gebotes gezwungen sei. Recht hat er, was geht uns auch der Streit zwischen Römern und Langobarden an?«
Richtig! jubelte Bertrada innerlich. Kommt endlich zur Sache! Sie verzog das Gesicht und kniff Leutberga in den Unterarm, als ihr Vater fortfuhr: »Es ist bereits das zweite Mal, daß sich Karl Martell gegen die Wünsche des Papstes stellt, denn auch die Besetzung der fränkischen Bischofssitze behält er sich immer noch vor. Dabei würde Rom so gern selbst darüber entscheiden wollen, wer nun wo Bischof wird!«
»Ich erinnere mich.« Die Gräfin nickte. »Behauptete Papst Gregor nicht, die fränkischen Bischöfe könnten besser reiten und jagen als die Messe lesen?«
»Sie kommen schließlich aus den besten Adelsfamilien!« bestätigte der Graf lachend. »Doch was antwortete Karl? Darin stünden sie den päpstlichen in nichts nach. Es sei nicht seine Schuld, daß deren Jagdreviere immer häufiger in das Hoheitsgebiet der Langobarden gefallen seien. Mangele es aber der päpstlichen Tafel an einem feinen Stück Auerochs, würden es sich die fränkischen Bischöfe zur Ehre anrechnen, diesen zu liefern. So ein Kerl ist dieser Karl. Wenn Bertrada keine Einwände hat, wird sie den Sohn dieses Mannes heiraten.« Er beugte sich auf seinem Stuhl vor, tat, als wollte er die Seidenbänder an seinen Unterschenkeln zurechtziehen, und nickte vergnügt, als er von dort die edelsteinbesetzte Spitze eines hellen Lederschuhs hinter der Truhe hervorlugen sah.
Die Gräfin brachte einen letzten Einwand vor: »Du willst unsere Tochter einem Mann verbinden, der von einer Friedelfrau abstammt? Kannst du das denn deiner Mutter antun? Immerhin ist sie die Schwester der rechtmäßigen Gemahlin seines Vaters!«
»Vergiß nicht, daß sie auch die Frau war, die Karl Martell in der Schlacht bei Amel mit einem unbezahlbaren Rat zum entscheidenden Sieg über die Neustrier verholfen hat …«
»Das ist ein Gerücht«, unterbrach die Gräfin. »Karls Krieger behaupten, ein Engel habe ihm verraten, wo sich die Feinde gesammelt hatten, und ihm empfohlen, seine Krieger, mit Zweigen und Ästen bedeckt, langsam heranrücken zu lassen. Darum heißt der Hügel jetzt doch Engelsberg! Keiner hat deine Mutter mit Karl gesehen. Und wenn sie ihm doch geholfen haben sollte, dann bestimmt mit knirschenden Zähnen. Wir sollten sie auf jeden Fall um ihre Einwilligung zu dieser Heirat bitten.«
»Meine Mutter weilt in Prüm und tut ihr gutes Werk«, gab der Graf mit Bitterkeit zurück. »Am Geschick ihrer Familie ist ihr wenig gelegen. Sonst hätte sie uns in den vergangenen zehn Jahren ja vielleicht einmal aufgesucht und nicht nur so selten Briefe geschickt. Meine Mutter Bertrada ist eine harte, unversöhnliche Frau, ganz anders als ihre Enkelin, unsere fröhliche Bertrada.«
»Sollte unsere Tochter nicht Ehefrau und Mutter von Königen werden und die Welt verändern?« murmelte Gisela von Laon versonnen.
Der Graf lachte. »Ich hätte dir das nie erzählen dürfen, meine Liebe. Aber daran siehst du, daß sich auch Hexen irren können.«
Bertrada wußte, worauf ihr Vater anspielte. Sie hörte sich gern die Geschichte jener Vollmondnacht kurz nach ihrer Geburt an. Graf Charibert hatte auf dem Weg nach Prüm zur Klosterstiftung an einem Flußufer haltgemacht. Kaum hatte er sich zum Schlafen hingelegt, als plötzlich eine sehr alte gebeugte Frau mit langem weißem Haar erschien und sich mühsam am erloschenen Lagerfeuer niederließ, ohne um Erlaubnis zu bitten. Sie bedeutete dem Grafen näherzurücken und malte mit einem langen Stock seltsame Zeichen in die Asche. »Deine Tochter wird leben. Sie wird Gemahlin und Mutter von Königen sein und die Welt verändern«, krächzte sie.
Der Graf hatte seiner Frau und seiner Tochter erzählt, daß die Alte dann so plötzlich wieder zwischen den Bäumen verschwunden sei, daß er glaubte, ihr Erscheinen nur geträumt zu haben – wären da nicht die Zeichen in der Asche gewesen. Verschwiegen hatte er beiden allerdings den letzten bedrohlich klingenden Satz der Hexe: »Aber sie wird eine von uns werden.«
Er hatte versucht, diese Bemerkung aus seinem Gedächtnis zu tilgen – jedoch vergeblich. Sie verfolgte ihn immerzu. Er betete, fastete und beschwor Gott sowie alle Heiligen, seine Tochter vor heidnischem Tun zu bewahren, sie vor dem Satan und seinen Hexen zu schützen. Und er war zutiefst erleichtert und dankbar gewesen, als in den folgenden Jahren nichts darauf hinwies, daß eine andere Welt als die christliche über Bertrada Macht ausübte. Ihr Gemüt war fröhlich und unbekümmert, sie betete inbrünstig zum Gott der Christenheit, zeigte keine Neigung, sich an der Wahrsagerei zu versuchen oder in der Dunkelheit herumzustreichen. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, daß sie, von Dämonen begleitet, auf einem scheußlichen Tier durch den nächtlichen Himmel ritt. Sie plauderte jedes Geheimnis aus und interessierte sich mehr für Pferde als für Kräuter. Sie fürchtete sich im Wald, und ihre Haut wies keinerlei seltsame Behaarung oder Hexenzeichnung auf. Allerdings gab es tatsächlich eine wunderliche Besonderheit an seiner Tochter: Ihr linker Fuß war eine halbe Handbreit länger als der rechte. Der Graf legte größten Wert darauf, daß dies nicht allgemein bekannt wurde. Er ließ seiner Tochter von Anfang an stets ein gleiches Paar Schuhe anfertigen. Die Spitze des rechten Schuhs wurde mit Wolle ausgestopft.
Den ersten Teil der Prophezeiung hätte der Graf natürlich gern geglaubt, und so unwahrscheinlich war er auch gar nicht. In seiner Tochter floß schließlich sehr edles Blut, da er und seine Frau Geschlechtern von Königen entstammten, die ihre Linie bis auf das sagenhafte Haus Troja zurückführten. Doch unter den zahlreichen Bewerbern, die in den vergangenen Jahren um Bertradas Hand angehalten hatten, befand sich kein Anwärter auf einen Thron. Ewig durfte er seine Tochter nicht zu Hause behalten. Schließlich war sie schon fast zwanzig, auch wenn sie sich wie ein kleines Kind hinter die Truhe gehockt hatte, um ihre Eltern zu belauschen.
»Ich weiß, daß du uns zuhörst, Bertrada!« rief er schließlich. »Zeig dich und setz dich zu uns.«
»Warum findest du nur immer alles über mich heraus«, murmelte Bertrada seufzend, als sie sich erhob. Sie stolperte über ihr langes Kleid und versetzte Leutberga einen kleinen Tritt. Mit eingezogenem Kopf schlich diese verärgert aus dem Zimmer. Immer wenn es spannend wurde, verdarb Bertrada alles.
»Weil ich mich um dich sorge und für deinen Schutz verantwortlich bin«, erklärte Charibert von Laon fröhlich. »Jedenfalls bis jetzt. Du hast ja gehört, um was es geht. Wenn du zustimmst, übertrage ich diese Pflicht auf Pippin, den Sohn des Hausmeiers Karl.«
»Erzähl mir von ihm«, forderte Bertrada ihren Vater auf und ließ sich zu seinen Füßen auf dem Löwenfell nieder, das er vor Jahren von einer weiten Reise mitgebracht hatte und das als Prunkstück des Familiengemachs galt.
Viel hatte Charibert nicht zu berichten. Obwohl er sich als Beisitzer des Hausmeiergerichts gelegentlich in Saint Denis aufhielt, hatte er Pippin in den letzten Jahren dort nicht zu Gesicht bekommen. »Die vergangenen fünf Jahre hat er am Hof des Langobardenkönigs Liutprand verbracht. Dieser hat ihn auf Karl Martells Anerbieten gewissermaßen an Kindes Statt angenommen, da er selbst keine Erben hat.«
»Wie kann man nur sein Kind in die Fremde geben!« rief Gisela empört.
»Meine Liebe, erstens war er da schon kein kleines Kind mehr, und zweitens war auch dies eine der weitsichtigen Entscheidungen Karl Martells«, bemerkte Charibert. Taktvoll unterließ er es, Gisela daran zu erinnern, daß sie ihre Tochter am liebsten dem Sohn des noch viel weiter entfernt lebenden Kaisers von Byzanz geben würde. »So machte er sich nämlich einen aufstrebenden wichtigen Herrscher zum Verbündeten und konnte ihm gleichzeitig dafür danken, daß er ihn beim Kampf gegen die Sarazenen unterstützt hatte. Außerdem ist es kein Geheimnis, daß sich Pippin und sein älterer Bruder Karlmann schon als Kinder befehdet haben. Der Gedanke, einen räumlichen Abstand zwischen den Geschwistern herzustellen, mag dabei ebenfalls eine Rolle gespielt haben. So konnte sich die Feindschaft zwischen beiden nicht weiter verschärfen, und es gab ihnen Gelegenheit, nach den Trennungsjahren einen neuen Anfang zu finden.«
»Was sind das denn für Menschen, diese Langobarden?« erkundigte sich Bertrada. »Sind das nicht rechte Barbaren?«
»Vom Ursprung her sind es Germanen«, erläuterte der Graf. »Vor zweihundert Jahren lebten sie noch in einer Gegend, die manche Ungarn nennen, sind dann über die Alpen gezogen und haben ein Gebiet nach dem anderen erobert. Sie sind sehr fleißig und geschäftstüchtig, haben den Handel in einem verarmten Gebiet zum Erblühen gebracht, finden sogar noch Zeit für die Künste, und ihre Könige gelten als gerecht. Diese tragen übrigens kurze Haare – im Gegensatz zu unseren alten Herrschern«, sagte der Graf lachend. »Pippin hat man als allererstes nach Landessitte das Haupthaar geschoren.«
Bertrada verzog das Gesicht.
»Es ist inzwischen bestimmt nachgewachsen«, versicherte Charibert versöhnlich. »Schließlich ist er seit Monaten wieder in Saint Denis. Seinem Vater geht es schlecht, er fühlt sein Ende nahen, so heißt es, und auch deshalb müssen wir eine schnelle Entscheidung treffen. Karl Martell hat sein Reich geordnet, jetzt will er noch seinen jüngsten Sohn mit einer standesgemäßen Braut versehen.«
Bertrada stand auf und blickte an sich herab.
»Ihr sagt immer, daß ich für eine Frau sehr hochgewachsen bin«, erklärte sie. »Ich habe gehört, daß Pippin manchmal auch ›Pippin der Kurze‹ genannt wird. Ich möchte keinen Mann, zu dem ich nicht aufsehen kann.«
»Als Kind war er natürlich kurz im Vergleich zu seinem älteren Bruder Karlmann«, erzählte Charibert, »und dieser machte sich ein Vergnügen daraus, ihn in den gemeinsamen Kinderjahren so zu nennen. Der Beiname haftete Pippin auch am Langobardenhof an, wo man darüber Spottlieder sang. Bis zu jenem Tag, an dem er eine wahre Heldentat vollbrachte.«
Der Graf schwieg und sah Frau und Tochter belustigt an. »Jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche, aber ich warne euch, es geht um viel Blut.«
»Hat er eine Räuberbande getötet?« fragte Bertrada atemlos. Ihr lief ein Schauer über den Rücken. Sie hatte noch nie einen Räuber gesehen, aber aufgrund von Erzählungen in ihrer ganzen Jugend in Angst vor diesen finsteren Gesellen gelebt und sich bei jedem Ausritt in den Wald gefragt, ob sie das Opfer eines Überfalls werden würde. Wenn dieser Mann eine solche Bande ausgelöscht haben sollte, würde sie auf alle Zeiten zu ihm aufschauen können, ganz gleich, wie es um seine Statur bestellt war.
»Viel, viel schöner…« Der Graf verstummte.
»Vater…!« Bertrada trat auf ihn zu und setzte sich auf seinen Schoß, wie sie es als kleines Mädchen getan hatte. Sie schlang die Arme um seinen Hals und flüsterte ihm ins Ohr: »Erzähl!«
Er drückte seine Tochter kurz an sich und forderte sie dann auf, sich zu ihrer Mutter zu setzen.
Er sprach nicht sofort, weil ihn plötzlich ganz andere Gedanken überwältigten:
Wie schnell sie erwachsen geworden ist, wie furchtbar, wie grausam. Da habe ich jahrelang vergeblich um ein Kind gebetet, sogar erwägen müssen, Gisela zu verstoßen, um mir eine fruchtbare Friedelfrau zu nehmen, und bin darüber immer mehr gealtert. Und als wir schließlich aufhörten, an Wunder zu glauben, kam Bertrada unerwartet zu uns. Und nun ist sie unmerklich zu einer Frau herangewachsen, die ich nun weggeben muß. Die einem anderen und dessen Sippe gehören wird, um diese der Nachwelt zu erhalten. Sie wird eine von uns werden.
Mit einigem Unbehagen schob der Graf diese letzte Erinnerung von sich.
»Vater?« fragte Bertrada unsicher, als er immer noch schwieg.
»Ist es die Hitze, Charibert?« erkundigte sich seine Frau besorgt. Sie stand auf und trat an den Holztisch, der unter der schmalen Maueröffnung stand. Vorsichtig tauchte sie die Spitze ihres lang herabfallenden Ärmels in die silberne Schale, in der ein paar Kräuter im Wasser schwammen.
»Was habt ihr denn?« fragte Charibert betont munter, während seine Frau ihm mit dem feuchten Stoff zärtlich die Stirn netzte. »Ich wollte doch nur die Spannung steigern. Pippins Heldentat. Also hört gut zu: Bei einer Tierhatz am Langobardenhof hat sich ein Löwe in den Nacken eines Stieres verbissen und kommt nicht mehr los. In respektvollem Abstand umringen die Jäger die Tiere, gefesselt von dem Anblick, der sich ihnen bietet, aber zu mutlos, um einzugreifen. Da tritt Pippin vor. Er zieht sein Schwert und trennt mit einem einzigen Streich sowohl den Kopf des Löwen als auch den des Stieres vom Rumpf. Danach ruft er: ›Das, meine Edlen, nennt Pippin der Kurze einen kurzen Prozeß!‹ Na, was sagt ihr dazu?«
Die beiden Frauen schwiegen enttäuscht. Sie hatten mehr erwartet. Eine Geschichte, in der es um Menschen ging, um Räuber, um Sarazenen, um die Rettung von Reisenden vor feuerspeienden Drachen oder anderen Ungeheuern. Heldentaten, bei denen blutrünstige Dämonen vertrieben oder Bundesgenossen aus einem finsteren Verlies befreit wurden, kurz bevor sich ebenfalls eingekerkerte hungrige Bären auf sie stürzten, hätten auch mehr hergegeben.
»Seitdem«, fuhr der Graf unbekümmert fort, »trägt er diesen Titel als Ehrennamen. Im übrigen ist er, Bertrada, wie alle seines Geschlechts, eher hochgewachsen zu nennen. Vermutlich werdet ihr also Riesenkinder zur Welt bringen. Willst du ihn nun heiraten?«
»Wird er denn Zeit für mich haben oder dauernd umherreisen? Als künftiger Hausmeier ist er doch bestimmt sehr beschäftigt!«
Eigentlich wünschte sie sich einen Mann wie ihren Vater, der fast immer zu Hause war und die meiste Arbeit anderen überließ.
»Vielleicht freut er sich ja, wenn du mit ihm reist. Natürlich wird er nach dem Tod seines Vaters viel zu tun haben. Als es noch einen König gab, war der major domus Führer der berittenen Leibgarde und hat sich um die Erziehung der Prinzen gekümmert. Heute ist er Herr der Gutsverwaltung, der Gerichte, der Finanzen und aller anderen wesentlichen Einrichtungen des Reiches. Eigentlich regiert er, ist ein richtiger Unterkönig.«
»Ein richtiger König wäre mir lieber.«
»Vorsicht«, sagte Charibert lachend. »Dämpfe deinen Ehrgeiz, Bertrada! Als der Hausmeier Grimoald vor fast hundert Jahren versuchte, seinen Sohn Childebert zum König krönen zu lassen, wurden beide hingerichtet!«
»Damals gab es ja auch noch einen anständigen Merowingerkönig«, warf Gräfin Gisela ein. »Einen Vorteil hätte es allerdings, wenn du Pippin heiratest. Er soll sich oft in Saint Denis aufhalten, und das ist ja wirklich nicht weit von hier.«
Bertrada nickte. Die Nähe zum Elternhaus machte Pippin für sie um einiges begehrenswerter, als es ein richtiger König am Ende der Welt je hätte sein können.
Der Graf kam mit dem Abgesandten des Hausmeiers überein, den Verlobungsbund kurz zu halten. Dafür sprachen das Alter der Brautleute, der gesundheitliche Zustand von Pippins Vater – nach Karl Martells Ableben warteten auf den Sohn schließlich große Aufgaben – und die Tatsache, daß die Abstammungsverhältnisse keiner Klärung bedurften. Ein Bote wurde nach Saint Denis geschickt, um Pippin über die Ankunft seiner Braut zu unterrichten und ihm für die reichen Gaben zu danken, die seine Bewerbung begleitet hatten. Im Hause des Grafen von Laon wurden Vorbereitungen für die Reise und für Bertradas Zukunft getroffen.
Doch zwei Tage vor dem angesetzten Aufbruch stürzte der Graf ausgerechnet von jenem hochgezüchteten Hengst, den er seinem künftigen Schwiegersohn als Geschenk hatte mitbringen wollen, und brach sich ein Bein. Da inzwischen das Gefolge des Bräutigams eingetroffen war, das Bertrada nach Saint Denis geleiten sollte, lehnte Charibert von Laon eine Verlegung des Hochzeitstermins ab. »Ein gegebenes Versprechen bricht man nicht«, sagte er und forderte seine Frau auf, Bertrada zu begleiten.
Gisela Gräfin von Laon, die schon einmal erlebt hatte, wie ihr Gemahl nach einer Verletzung nur knapp dem Tod entronnen war, weigerte sich jedoch. Sie vertraute ihren eigenen Heilkünsten mehr als denen der Ärzte. Gern hätte sie auch ihre Tochter auf diesem Gebiet einiges gelehrt, aber Bertrada hatte immer wieder zu erkennen gegeben, daß sie Heilpflanzen langweilig fand. Das kränkte die Mutter, die sich viel auf ihre botanischen Kenntnisse zugute tat. Um die Tochter doch noch auf die Natur einzustimmen, hatte Gisela bei ihrem Mann um Unterstützung nachgesucht, aber den schien es eher zu freuen, daß seine Tochter kein Interesse für die Welt der Kräuter an den Tag legte.
»Sie versteht viel von Pferden. Welcher Vater kann so etwas schon von seiner Tochter behaupten?«
Für Gisela war das wie ein Schlag ins Gesicht. »Sag doch gleich, daß du lieber einen Erben gehabt hättest!« fuhr sie ihren Mann an. Kein Gedanke hatte Charibert ferner gelegen. Betroffen sah er seine Frau an. Er nahm ihre beiden Hände in seine und schüttelte den Kopf.
»Nein«, murmelte er. »Aber es ist wohl an der Zeit, daß ich dir erzähle, was mir die Hexe damals außerdem noch gesagt hat. Zum Glück hat sie sich auch in dieser Hinsicht geirrt.«
Mit Tränen in den Augen winkten die Eltern der Tochter nach, als sie nach Tagesanbruch in die von zwei edlen Stuten getragene, mit Samt ausgeschlagene vergoldete Sänfte stieg, die Pippin seiner Braut als Reisefahrzeug geschickt hatte. Am Hof des Grafen hatte das ungewöhnliche Transportmittel mit dem Baldachin großes Aufsehen erregt, aber Bertrada war darüber alles andere als glücklich gewesen.
»Bei dieser Hitze in einem geschlossenen Bett unterwegs!« hatte sie gemurrt. »Warum kann ich nicht reiten wie die anderen auch? Ich bin noch nie in einer Sänfte gereist.«
»Du hast ja auch noch nie geheiratet«, hatte ihr Vater spöttisch erwidert. »Du bist doch nur zwei, höchstens drei Tage unterwegs! In Saint Denis kannst du wieder nach Herzenslust ausreiten. Pippin soll sich sehr darüber gefreut haben, daß du eine begeisterte Reiterin bist. Deshalb hat er dir auch den arabischen Wallach geschickt.«
Auf dem nun Leutberga saß, wie Bertrada voll Groll feststellen mußte. Nicht daß sie ihrer Freundin ein solch edles Reittier nicht gegönnt hätte, aber Leutberga wußte das Erlebnis überhaupt nicht zu schätzen. Reiten war ihr in jedem Fall ein Greuel, sie würde sich viel lieber im Ochsenkarren ziehen lassen oder zu Fuß gehen. Wütend zupfte Bertrada an dem Satinschleier herum, der ihr Gesicht verbarg und bis zu den Hüften reichte. Die Vorhänge der Sänfte hatte sie zur Seite geschlagen. Sie wollte wenigstens sehen, wohin sie getragen wurde.
»Ein bißchen mehr Würde!« fauchte ihr eine Stimme ins Ohr. Mima, Leutbergas Mutter, die neben der Sänfte herschritt, durfte es sich erlauben, so respektlos mit der Tochter des Grafen von Laon zu sprechen. Obwohl offiziell nur Bertradas Amme, genoß sie eine Sonderstellung im Schloß, die sich selbst die anderen Bediensteten nur hinter vorgehaltener Hand erklärten. Daß sich Bertrada und Leutberga verblüffend ähnlich sahen, mußte an der Milch liegen und an der Tatsache, daß sie von Anfang an unzertrennlich gewesen waren. Maria Magdalena, wie Mima eigentlich hieß, hatte als Halbfreie ihre Tochter einen Monat vor Bertradas Geburt zur Welt gebracht. Es ging das Gerücht, der Graf habe einmal von der schönen jungen Bäuerin höchstselbst den Korb mit Eiern entgegengenommen, den sie regelmäßig im Schloß abzuliefern pflegte. Kurz danach habe ihr Mann bei Nacht und Nebel den schwerverschuldeten Hof und seine schwangere Frau einfach im Stich gelassen. Mima kam zum Schloß, entband dort und erhielt im Tausch für ihre Milch und die Betreuung Bertradas die Genugtuung, daß ihre Tochter wie ein Mädchen aus edler Familie aufwuchs. Alles, was Bertrada tat oder lernte, kam auch Leutberga zugute. Die Tochter der Halbfreien trug Leinenstrümpfe und Kleider aus Seide, die mit bunt gefärbten Lederstreifen zusammengehalten wurden. Rosetten und Dreiecke aus Goldfäden schmückten die weiten Ärmel, und ihre zierlichen Füße steckten in dünnen Lederschuhen mit Riemen und silbernen Schnallen. Sie besaß sogar ein geflochtenes Kästchen, in dem sie ihre Schmuckstücke verwahrte. Keine Frage, Mimas Tochter hatte es weit gebracht. Bestimmt würde sie in Saint Denis einen Freier finden, der sie über ihren Stand erheben könnte.
Mima selbst war einer neuen Verbindung auch nicht abgeneigt, und da ihr Mann sie offensichtlich verstoßen hatte, stand dem nichts im Wege. Obwohl sie sich bereits dem vierzigsten Lebensjahr näherte, war sie immer noch schön genug, um einem Herrn als zweite oder dritte Frau dienen zu können. Als höchstes Ziel konnte sie eine Friedelehe anstreben. Die Aussichten standen nicht schlecht: Graf Fulco, der Abgesandte Pippins, hatte bereits angedeutet, sie bei sich und seiner Familie aufnehmen zu wollen.
»Mach deinem Vater keine Schande«, flüsterte sie Bertrada noch zu, ehe sie schnellen Schrittes nach vorn strebte, den Rappen des Abgesandten im Blick.
Am Vormittag des ersten Tages kam der Zug nur langsam voran, da die große Hitze dieses Sommers vor allem die Fußbegleitung erschöpfte. Als die Reisegesellschaft in einer Waldlichtung Schutz vor der sengenden Mittagssonne suchte, stieg Bertrada schweißüberströmt aus der Sänfte. Der Abgesandte führte sie zu einer Decke, die man auf dem Waldboden ausgebreitet hatte, und reichte ihr einen Becher, den er aus einem Lederschlauch mit Wein füllte. Bertrada atmete erleichtert auf, als sie den Schleier zurückschlug. Geschäftig breitete Mima den Inhalt ihres Proviantkorbes aus. Leutberga glitt stöhnend vom Pferd, band es an einen Baum und ließ sich neben Bertrada nieder. Der Rest der Schar hielt respektvoll Abstand.
»Es behagt mir gar nicht, daß uns die Strecke die nächsten anderthalb Tage durch Wälder führt«, begann der Abgesandte.
»Das ist doch immerhin besser, als auf der staubigen Landstraße der prallen Sonne ausgesetzt zu sein«, bemerkte Bertrada.
»Dafür sind wir im Wald eher wilden Tieren und Gesindel ausgesetzt«, gab Mima zu bedenken.
Graf Fulco nickte. »Kunde von unserem Zug dürfte auch Räubern zu Ohren gekommen sein …«
»…für die eine reiche Grafentochter, die mit dem Sohn des Hausmeiers vermählt werden soll, eine einträgliche Geisel darstellt«, unterbrach ihn Leutberga, fröhlich nickend. Mima warf ihrer Tochter einen strafenden Blick zu.
»Doch wie können wir uns schützen?« fragte die Amme.
»Meine Männer werden wachsam sein und die Sänfte von allen Seiten beschirmen. Mehr können wir nicht tun.«
Mima reichte erst Bertrada, dann dem Abgesandten Brot und Käse. »Für Bertrada könnten Räuber tatsächlich ein ansehnliches Lösegeld fordern«, sagte sie langsam, »Leutberga hingegen ist nichts wert …«
»Und da sie sich auch ziemlich ähnlich sehen…« spann der Abgesandte den Gedanken weiter.
»…und wenn wir die Kleider tauschen, ich auf meinem Pferd sitze und Leutberga in der Sänfte…«, setzte Bertrada aufgeregt hinzu.
»…würde niemand merken, daß die falsche Braut getragen wird«, schloß Mima triumphierend.
»Dann bringen die Räuber aber doch mich um!« klagte Leutberga.
»Nein, auch um dich kann verhandelt werden«, erklärte der Abgesandte. »Karl Martell wird dich für dein Opfer so reich entschädigen, daß du dich vor Freiern nicht mehr retten kannst.«
»Und du wirst getragen«, lockte Bertrada. »Darum hast du mich doch beneidet.«
»Aber was werden die Räuber mit mir machen!« jammerte Leutberga.
»Es ist ja gar nicht gesagt, daß wir welchen begegnen«, meinte der Abgesandte, der inzwischen so nahe an Mima herangerückt war, daß seine Knie gegen ihre Beine drückten.
Bertrada sah voll Verlangen auf Leutbergas dünnes Leinenkleid. Niemand verlangte von ihr, einen langen faltenreichen Mantel darüberzuziehen oder bei dieser Hitze Strümpfe zu tragen. Dem unverlobten Mädchen genügte ein schlichtes Band im Haar, sie brauchte keinen Schleier und keine Kopfbedeckung wie eine Frau, die einem Mann anverlobt war.
Leutberga rieb sich die Stelle, die ihr nach dem langen Ritt am meisten schmerzte.
»Und ihr alle werdet mich wie die Tochter des Grafen von Laon behandeln?« fragte sie.
»Du wirst die Tochter des Grafen von Laon sein«, bestätigte der Abgesandte. »Bis wir wieder aus dem Wald heraus sind.«
Ohne weitere Absprache standen Bertrada und Leutberga gleichzeitig auf und verschwanden gemeinsam im Gebüsch. Graf Fulco nutzte die Gelegenheit, die Festigkeit von Mimas Brüsten zu überprüfen. Spielerisch schlug sie ihm auf die Finger. »Nicht jetzt«, flüsterte sie, erwiderte jedoch seinen begehrlichen Blick.
Wenig später wurde die Reise fortgesetzt. Niemandem fiel auf, daß die Mädchen die Rollen vertauscht hatten. Das mochte auch daran liegen, daß Bertrada auf das Haarband verzichtet hatte und ihre langen dunkelblonden Haare ein wenig ins Gesicht fallen ließ. Leutberga hatte ihre eigenen Schuhe anbehalten, da die Füße in der Sänfte ohnehin nicht zu sehen waren. Bertrada ging davon aus, daß sich niemand gemerkt hatte, welche Fußbekleidung die Tochter der Amme getragen hatte. Der Größenunterschied zwischen den beiden war hoch zu Roß nicht merkbar.
Anfangs genoß es Leutberga noch, Bertrada herumzukommandieren. Sie forderte sie auf, ihr bestimmte Beeren zu pflücken, derer sie am Wegesrand gewahr wurde, verlangte von ihr, ein Tuch in einem Wasserlauf anzufeuchten oder ihr einen Becher Wein zu besorgen. Doch Mima setzte diesem Treiben bald ein Ende. Sie riet Bertrada, sich an den Schluß des Zugs zu setzen und sich von der Sänfte fernzuhalten. Bertrada folgte diesem Rat nur zu gern. Sie brannte darauf, ihr neues Pferd wirklich kennenzulernen, und das war im Schrittempo einfach nicht möglich. In einem unbeobachteten Moment ließ sie sich weit zurückfallen. Sie wollte an den Bach zurückkehren, wo sie Leutbergas Tuch befeuchtet hatte, sich dort kurz abkühlen und dann im Galopp wieder zu ihrer Reisegesellschaft aufschließen. Angst vor Räubern oder Tieren hatte sie nicht mehr. Bisher waren sie keiner Schreckensgestalt begegnet, und Gesindel scheute bekanntlich den hellichten Tag.
Am Bach band sie das Pferd neben einem Holunderbusch an einen Baum, legte ihre Kleidung auf einen kleinen Felsblock und kletterte vorsichtig über Steine die Böschung hinunter. Sie mußte sich ein kleines Stück am Ufer entlangtasten, ehe sie eine geeignete Stelle zum Einstieg fand. Das Wasser reichte ihr bis über die Knie. Ein Freudenjauchzer entfuhr ihr, als ihre Haut das eiskalte Element spürte. Sie schloß die Augen, holte tief Luft und tauchte ganz ein.
Der Reiter, den ein lauter Ruf an den Bach gelockt hatte, hielt die fächerförmig ausgebreiteten Haare auf der Wasseroberfläche zunächst für ein seltsames Gewächs. Erst auf den zweiten Blick erkannte er, was sich darunter verbarg. Er stieg ab, hockte sich hin und wartete, bis das Geschöpf wieder auftauchte. Etwas weiter entfernt sah er auf einem Felsen ein Bündel Kleider liegen. Bertradas Pferd wäre hinter dem Holunderstrauch ohnehin seinen Blicken entzogen gewesen, wenn er überhaupt für etwas anderes als das Wesen im Wasser Augen gehabt hätte. Jetzt erhob es sich und entpuppte sich als äußerst wohlgeformte junge Frau mit langen schlanken Beinen. Sie warf das nasse dunkle Haar über die Schultern, formte die Hände anmutig zu einem Gefäß und bückte sich vor, um aus dem Bach zu trinken. Wie ein Diamantregen liefen glitzernde Wassertropfen über die helle Haut den Rücken hinab. Der Beobachter schrak auf, als er plötzlich an der Schulter berührt wurde. Wie bedauerlich, daß sein Herr und Freund ihn so schnell eingeholt hatte! Er hatte ihn nicht einmal nahen hören, so sehr hatte ihn die weibliche Gestalt im Bach in ihren Bann geschlagen. Jetzt würde er ihm bei dieser Unfreien, denn nur um eine solche konnte es sich handeln, den Vortritt lassen müssen. Aber sein Herr machte ihm schnell klar, daß er keineswegs zu teilen gewillt war. »Verschwinde und warte an der Weggabelung auf mich!« flüsterte er, und sein Ton duldete keinen Widerspruch.
Bertrada wandte sich um und blickte die Böschung hinauf. Ihre Augen weiteten sich, und ihre Hände erwiesen sich als zu klein, um ihre Blöße auch nur notdürftig zu bedecken. Sie wich rückwärts weiter in den Bach zurück. Als sie das Gleichgewicht verlor und stürzte, blieb sie bäuchlings im Wasser liegen und klammerte sich an einen Stein. Lange Zeit verharrte sie so, ohne den Blick von den braunen Augen des Fremden abzuwenden. Löse dich auf, löse dich auf, sprachen ihre Augen, diesen Gefallen aber tat der Mann ihr nicht.
»Komm heraus, du Schöne«, sagte er belustigt. »Wir wissen beide, daß es für dich kein Entrinnen gibt.«
Sie schüttelte den Kopf und hielt den Stein weiter fest umklammert.
»Gut, dann werde ich dich holen!«
Bertrada wandte den Blick ab, als er sich zu entkleiden begann. Sie hatte noch nie einen nackten Mann gesehen und hoffte wider besseres Wissen, daß ihr dies auch jetzt erspart bliebe. Sie starrte auf die rauhe Oberfläche des Steins, den sie immer noch angstvoll umklammert hielt, und begann laut zu beten. Kräftige Hände packten sie, rissen sie hoch und trugen sie die Böschung hinauf. Sie hielt die Augen fest geschlossen, stellte sich vor, daß es die Hände eines Engels waren, der sie forttragen und vor diesem bösen Menschen in Sicherheit bringen würde. Aber als dann die Tannennadeln in ihren Rücken stachen, konnte sie sich nicht mehr vormachen, daß ein höheres Wesen sie auf den Waldboden gebettet hatte. Und dann spürte sie auch die Nadeln nicht mehr.
»Welch ein vorzügliches Zeichen, eine Jungfrau!« drang ein Ruf an ihre Ohren. Sie öffnete endlich die Augen. Der Mann hatte die bis zum Knie reichende Tunika übergestreift und den Gürtel mit Schwert und Messer wieder angelegt. Er war an ihr Kleiderbündel getreten und strich sanft über den Stoff. »Wer immer deine Herrin sein mag, sie sorgt gut für dich«, rief er ihr zu, als wäre nichts geschehen, und legte eine Silbermünze auf das zusammengefaltete Leinenkleid. Fröhlich winkte er der schönen Badenixe zu und verschwand zwischen den Bäumen.
Bertrada war wie gelähmt. Sie konnte nicht aufstehen und hätte hinterher auch nicht sagen können, wie lange sie auf dem Waldboden liegengeblieben war oder woran sie in dieser Zeit gedacht hatte. Es mußten Stunden vergangen sein, denn als sie die Augen wieder öffnete, drang schon abendlich gefärbtes Sonnenlicht durch das Blätterdach des Waldes. In der Ferne hörte sie Rufe.
»Leutberga! Leutberga!«
Warum suchte man nach Leutberga? Dann erst fiel ihr der Rollentausch wieder ein. Mühsam setzte sie sich auf und blickte voll Abscheu auf ihren Körper. Sie versuchte auf die Beine zu kommen, doch die Knie versagten ihr den Dienst. Auf ihrem Kleiderbündel, in unerreichbarer Ferne, glitzerte etwas Silbernes. Er hatte sie geschändet und auch noch dafür bezahlt! Welch eine Demütigung!
Nein, nichts ist passiert, sagte sie sich hartnäckig. Ich habe mich im Bach abgekühlt, bin danach am Ufer eingeschlafen und hatte einen bösen Traum. Ich werde mich jetzt ankleiden und auf die Rufe antworten.
Doch so sehr sie sich auch mühte, sie konnte sich einfach nicht einreden, ein Waldgeist hätte das Silberstück auf ihre Kleidung gelegt. Sie mußte den Tatsachen ins Auge sehen: So entehrt konnte sie unmöglich vor ihren Bräutigam, einen künftigen Hausmeier des Frankenreichs, treten, so besudelt nicht zu ihrer Reisegesellschaft oder zu ihren Eltern zurückkehren. Stand nicht sogar die Todesstrafe auf Unzucht vor der Ehe?
»Leutberga!«
Die nahende Stimme des Abgesandten überschlug sich. Man durfte sie nicht finden! Unbekleidet, geschändet, blutend – sie würde die Schmach nicht überleben. Den Körper dicht am Erdboden, kroch sie mit halbgeschlossenen Augen ein paar Armlängen weiter und verbarg sich unter den ausladenden Blättern einer Gruppe von Farnen. Dort blieb sie regungslos liegen, ließ die kleinen Lebewesen des Waldes unbehelligt über ihren Leib und durch ihre Haare wandern und zwang ihren Körper, nicht auf Stich, Biß oder Brennen zu antworten. Tannenzapfen, Kieselsteine, modernde Blätter und dornige Zweige drückten sich in ihre Haut. Bertrada stützte den Kopf auf die Hände und blickte starr geradeaus durch ein großes Spinnennetz, das schon zahlreichen Käfern, Mücken und anderem Getier zur Falle geworden war. An einer Stelle war es zerrissen, wohl durch Bertradas Einzug in das Farnbett. Die vielbeinige Weberin hatte auf der Lauer gelegen. Eilig krabbelte sie Bertradas Arm hinauf und setzte von ihrer Hand aus auf das Blatt über. Bertrada, die noch bis vor wenigen Stunden einen unüberwindlichen Ekel vor Spinnen empfunden hatte, verzog keine Miene, als die haarigen Beine kurz ihre Wange streiften. Ihr Körper war ihr völlig fremd geworden. Was immer nun mit ihm geschah, berührte sie nicht mehr.
Die Rufe wurden immer lauter, Stimmengewirr näherte sich.
»Hier ist ihr Pferd! Angebunden! Sie muß in der Nähe sein.« Die Stimme des Abgesandten klang mit einemmal erheblich zuversichtlicher. Dann ein Schrei aus Mimas Kehle:
»Kommt alle her! Hier sind ihre Kleider! Und eine Silbermünze!«
Bertrada hörte und spürte Schritte in ihrer unmittelbaren Nähe. Durch das Spinnennetz beobachtete sie, wie zwei niedliche kleine Schnallenschuhe an ihr vorbeieilten. Leutberga hatte also die Sänfte verlassen. Aber nicht für lange, dachte Bertrada betroffen, als sie ihre Freundin laut rufen hörte: »Leutberga, wo bist du? Antworte doch! Leutberga!«
War die Maskerade denn nicht vorbei? Die Grafentochter, die Verlobte Pippins, war allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz vielleicht von Räubern entführt oder von wilden Tieren angefallen worden. Jetzt hätten Mima, Leutberga und der Abgesandte den Rollentausch eingestehen und alle Kräfte in Bewegung setzen sollen, um Bertrada aufzufinden. Warum taten sie es nicht? Eine aufwendige Suche nach der verlorengegangenen Tochter einer Amme würde es nicht geben, da war sich Bertrada ganz sicher. In ihrem Zustand wollte sie auch gar nicht gefunden werden, aber es schmerzte sie, daß zwei Menschen, die ihr so nahestanden, augenscheinlich bereit waren, sie im Stich zu lassen. Jetzt war sie, die Grafentochter, ein Niemand. Leutberga hatte ihre Rolle übernommen und war doch immer nur die Ammentochter.
Am Flußufer starrte der Abgesandte auf die Münze. »Irgend jemand hat sie gekauft, verschleppt… ihr wohl Sklavenkleidung angezogen«, sagte er dumpf. »Eine andere Erklärung gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie ich meinem Herrn diese Nachricht überbringen soll.«
»Das Pferd!« rief Mima. »Welcher Räuber würde ein so wertvolles Pferd zurücklassen?«
»Welcher Räuber zahlt für seine Beute?« gab der Abgesandte zurück. Es war alles sehr rätselhaft. Er drückte Mima an sich, nutzte die Gunst der unbeobachteten Minute und wagte einen Kuß. Mima wehrte sich nicht.
»Wir müssen dafür sorgen, daß Bertrada nie wieder auftaucht«, flüsterte sie dem Abgesandten ins Ohr. »Dann wird alles gut, vertrau mir, es gibt einen Weg …«
Dankbar nickte Graf Fulco. »Ich werde es dir reich lohnen«, sprach er. Er verschwendete keinen Gedanken daran, daß er sich damit in Mimas Hand begab. Es ging ihm jetzt nur noch darum, sein Leben zu retten. Denn er wußte, daß dieses verwirkt war, wenn sich herausstellte, daß die ihm anvertraute Grafentochter verschwunden war.
Nachdem sich die Suchenden wieder entfernt hatten, richtete sich Bertrada mühsam auf. Als sie sich umsah, erschien es ihr plötzlich gar nicht mehr so seltsam, daß man sie nicht entdeckt hatte: Niemand mit Verstand würde sich einem so großen Waldameisenhügel nähern! Sie mußte ihn auf dem Weg in ihr Farnbett fast gestreift haben! Rasch stand sie auf, entfernte sich schnell von der gefährlichen Stelle und setzte sich auf den Fels am Bachufer, wo vor wenigen Minuten noch ihre Kleidung gelegen hatte.
Was sollte sie tun? Was konnte sie nackt und bloß und bar jeglicher Mittel überhaupt tun? Aber warum sollte sie überhaupt etwas tun? Nach dieser Schande blieb ihr nur der Tod. Und der würde schon schnell genug kommen, denn sie war dem Wald schutzlos ausgeliefert.
2
Aufbruch
Sie erwachte mit einem Ruck, als sie ihren Namen hörte. Die Männerstimme, die ihn ausgesprochen hatte, redete erregt in der vertrauten fränkischen Mundart ihres Vaters weiter: »Ihr seid also jetzt mit meinem Haus verwandt, Frau Berta! Übertragt den Haß gegen meinen Vater nicht auf mich, seinen Nachfolger als Hausmeier hier in Austrien, und es wird Euer Schade nicht sein.«
Bertrada öffnete die Augen einen Spalt, schloß sie aber sogleich wieder, denn das Licht schmerzte. Es drang durch ein kleines Fenster unter der Zimmerdecke und flutete unmittelbar auf das Kopfende ihres Lagers. Zu lange hatten Haare, Schmutz, die schwarze Farbe von getrocknetem Fledermausblut, Kohle und Holunder um ihre Lider sowie das Blätterwerk des Waldes die Helligkeit von ihr ferngehalten. Aber der kurze Augenblick hatte genügt, um zwei Menschen an der Tür auszumachen, einen dunkel gekleideten Mann mit wirren schwarzen Haaren und eine magere Frau mit hoher Haube. Es mußte bereits Mittag sein, wenn die Sonne schon so hoch stand.
»Drohungen, lieber Verwandter, bewirken bei mir eher das Gegenteil«, vernahm sie die kalte Stimme ihrer Großmutter. »Ich lehne Euch allein deshalb nicht ab, weil Eure Erziehung im Kloster zu Echternach uns in Prüm zu mehr Hoffnungen berechtigt als die Eures Bruders bei den Langobarden oder in der liederlichen Umgebung Neustriens.«
»Eure Enkelin ist jetzt mit meinem Bruder verheiratet, also wird er zu gegebener Zeit Eure austrischen Gebiete in Besitz nehmen«, gab der Mann zu bedenken.
»Da mit meinem Ableben vorerst nicht zu rechnen ist, so Gott will…«, ihre Stimme klang, als hätte Gott keine andere Wahl, als sich ihrem Willen zu beugen, »…werde ich, Herr Karlmann, mich nicht mit Mutmaßungen darüber aufhalten, was Bertradas Ehemann Pippin irgendwann einmal mit meinen Besitztümern zu tun gedenkt.«
Bertradas Ehemann? Die junge Frau im Bett stieß einen kleinen Laut aus. Schritte näherten sich dem Lager, eine kühle trockene Hand legte sich auf ihre Stirn. Bertrada hielt die Augen geschlossen. Sie wollte mehr hören. Herr Karlmann? Der Bruder Pippins? Wie konnte Pippin verheiratet sein, da seine Braut doch verschwunden war? Ich bin die, von der ihr sprecht, und ich habe niemanden geheiratet! Sie öffnete den Mund und gleich danach die Augen, als ihr ein von Kräutersud durchtränkter Lappen auf die Lippen gelegt wurde.
»Wie geht es dir, Flora von Ungarn?« Frau Berta hatte ins Lateinische übergewechselt. Sie saß jetzt auf einer Bank neben dem Bett und ließ das Tuch in eine Schüssel neben sich fallen.
Bertrada antwortete nicht. Sie starrte gebannt auf den Mann, der sich ebenfalls dem Bett genähert hatte.
Hätte er bei einem Ausritt in Laon ihren Weg gekreuzt, wäre sie zu Tode erschrocken und hätte wohl angenommen, den Leibhaftigen vor sich zu sehen. Doch seitdem waren Äonen vergangen. Ihr Blick hatte in der Zwischenzeit weit Schlimmeres ertragen müssen als ein vom Wetter gegerbtes scharfgeschnittenes Gesicht, dessen linke Hälfte durch eine flammendrote Narbe verunstaltet war, die sogar eine Schneise durch den krausen bläulichschwarzen Bart geschlagen hatte. Aus ihrer Perspektive konnte Bertrada unter dem Gestrüpp buschiger Brauen dunkelbraune Augen erkennen. Diese musterten sie gründlich und schienen dabei sogar freundlich zu lächeln. Das nahm dem Gesicht sofort den furchterregenden Ausdruck. Bertrada lächelte schwach zurück.
»Becher und Krug«, befahl Frau Berta, als wäre Karlmann ein Gehilfe. Er trat an einen grobgezimmerten Holztisch, ergriff einen Becher und starrte auf die beiden kleinen Krüge, die dort in tönernen Wasserschüsseln kühl gehalten wurden.
»Erst Bier, dann Met«, ordnete Frau Berta an und half Bertrada, sich aufzusetzen. Etwas Weiches fiel ihr ins Gesicht. Als sie danach griff, erkannte Bertrada, daß sich die spröden verklebten Strähnen wieder in ein sanftes Vlies verwandelt hatten. Es war unglaublich! Sie faßte rasch nach, fuhr sich durch die Haare, schüttelte den Kopf, daß die Locken flogen, und wickelte rasend schnell eine Strähne nach der anderen um die Finger, als verbündete sie sich mit jedem einzelnen Haar.
»Sie ist von Sinnen«, bemerkte Karlmann.
Bertrada hielt inne und starrte ihn böse an.
»Gut. Sie versteht unsere Sprache«, bemerkte Frau Berta befriedigt und hielt ihr den Becher hin. »Schaut sie Euch genau an. Sie ist mit Sicherheit von edler Herkunft. Erkennt Ihr sie?«
Bertrada mied seinen Blick.
»Nein«, sagte Karlmann. »Aus Austrien ist sie nicht.«
»Aus Ungarn aber auch nicht. Wie heißt dein Vater, Flora?«
Bertrada nahm einen tiefen Schluck und schloß die Augen.
»Was werdet Ihr mit ihr machen?« fragte Karlmann.
»Ich werde sie nach Mürlenbach mitnehmen. Wenn sie lesen und schreiben kann, wird sie bei mir ein Auskommen haben. Ich habe dringende Korrespondenz zu erledigen.«
»Zum Beispiel an meinen Bruder«, sagte Karlmann. »Ihr könnt ihm in einem einzigen Brief zum Tod unseres Vaters kondolieren, zur Hochzeit gratulieren, Erfolg bei der Verwaltung Neustriens wünschen und sich seine Einmischung in unsere austrischen Angelegenheiten verbitten.«
»Willst du bei mir bleiben, Flora?« fragte Frau Berta, als hätte sie Karlmann nicht gehört.
Bertrada öffnete die Augen und nickte.
»Schön!« erklärte Frau Berta. »Dann soll dich die Magd jetzt weiter versorgen. Ich schaue später wieder nach dir.« Sie erhob sich von der Bank. »Und Ihr, Herr Karlmann, erzählt mir jetzt alles über die prächtige Hochzeit meiner Enkelin.«
Zu Bertradas Bedauern schloß sich die Tür hinter dem Paar. Eine Magd huschte ins Zimmer. Bertrada senkte die Lider und widerstand der Versuchung, sich noch einmal durch ihr Haar zu fahren. Sie mußte nachdenken, und dabei war nichts hinderlicher als eine geschwätzige Dienstbotin. Eine Dienstbotin wie Mima, die Mutter von Leutberga.
Sie hat es wirklich getan! Leutberga hat mir mein Leben weggenommen! Sie ist tatsächlich als Bertrada von Laon in Saint Denis eingezogen und hat Pippin an meiner Stelle geheiratet! Die Tochter meiner Amme ist jetzt Gemahlin des Hausmeiers! Glaubt sie wirklich, daß sie sich auf Dauer für mich ausgeben kann? Wir sehen uns zwar sehr ähnlich, doch der Betrug wird spätestens dann ans Licht kommen, wenn sie meinen Eltern begegnet oder anderen Menschen, die mich sehr gut kennen! Oder wenn sie sich durch eine Dummheit selbst verrät. Was wird dann geschehen? Wird man wieder nach mir suchen? Ob Leutberga jetzt wohl meine Schuhe anziehen wird? Dann muß sie in jeden davon Wolle hineinstecken, in den linken etwas mehr als in den rechten. Warum hat mich die Großmutter nicht auf meinen Fuß angesprochen? Es wird ja nicht allzu viele Frauen mit ungleichen Füßen geben. Wahrscheinlich hat Vater seiner Mutter nie davon erzählt. Ich glaube, er mag sie nicht und hat ihr ohnehin nicht viel mitgeteilt. Außerdem hat er immer großen Wert darauf gelegt, daß ich dies vor aller Welt verberge. Aber jetzt schäme ich mich nicht mehr wegen meines größeren linken Fußes, glaube nicht mehr, daß mich Gott damit strafen will. Die Muhme hat mich eines anderen belehrt. Die Muhme …
Tränen stiegen Bertrada in die Augen, als sie an die Alte dachte, der sie ihr Leben verdankte. Dabei hatte sie sterben wollen und es sich ganz einfach vorgestellt: sie würde am Bach liegenbleiben und irgendwann tot sein.
Doch als sie raschelndes Laub und das Knacken trockener Äste hörte, setzte sie sich auf, zog die Knie an den Leib und schaute angstvoll um sich. Sie dachte an den Wilddieb, der auf Anordnung ihres Vaters dem hungrigen Bären im Käfig des Schloßkellers vorgeworfen worden war. Sie selbst hatte sich das Schauspiel nicht angesehen, aber Leutberga hatte ihr mit behaglichem Gruseln berichtet, es seien noch Schreie aus einem Blutklumpen gekommen, der schon gar nichts Menschliches mehr an sich hatte. Bertrada wollte nicht bei lebendigem Leib von einem wilden Tier zerfleischt werden, nicht spüren, wie ihr die Glieder abgerissen wurden, nicht qualvoll verrecken, sondern sanft in die andere Welt hinübergleiten. Sie begann laut zu beten. Gott, der ihren nächtlichen Schlaf behütete, sollte sie gnädig der ewigen Ruhe zuführen!
Heiseres Husten drang an ihre Ohren. Kühe konnten wie Menschen keuchen, Bären vielleicht auch? Bertrada kniff wieder die Augen zusammen. Sie hatte nichts, um sich zu wehren, und ergab sich in ihr Schicksal. Doch selbst ein abgerichteter Bär würde kein erschüttertes »Gott behüte!« ausstoßen können, und so hob sie langsam wieder die Lider. Vor ihr stand eine gebeugte Gestalt in einem lehmfarbenen Umhang. Erst bei den nächsten Worten erkannte Bertrada, daß zwischen Nase und Kinn eine Öffnung klaffte, rot und zahnlos.
»Was ist dir geschehen, Kind, wo sind deine Kleider?«