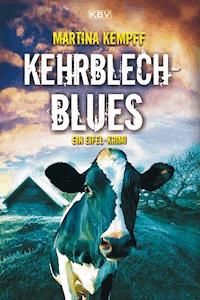8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bis in die hinterste Eifel muss die Großstädterin Katja Klein reisen, um endlich ihren Bruder kennenzulernen. Schließlich findet sie ihn – erschlagen in einer Blutlache. Wie soll sie beweisen, dass sie dem Mann noch nie zuvor begegnet ist? Furchtlos beginnt die Journalistin selbst zu ermitteln und taucht so immer tiefer in die Abgründe ihrer unbekannten Familiengeschichte ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
2. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-96097-7
© 2009 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Zen Shui / PhotoAlto Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Kaiser Wilhelm II. über die Eifel:
»Welch ein wundervolles Jagdrevier, nur schade, dass hier Menschen leben.«
Tag 1, Freitag, frühmorgens
Der mannshohe hölzerne Josef trägt einen mauvefarbenen Umhang über seinem hellen Nachthemd und schaut mit gütigem Lächeln auf das Christkind, das allen Babypuppen meiner Kindheit gleicht. Jetzt allerdings wirkt es wie ein Objekt des Grauens: Es starrt genauso blicklos gen Himmel wie der Tote, der neben Josef und Maria liegt. Der Ochse dahinter dezimiert laut mampfend einen Heuberg; der Esel erleichtert sich ungerührt im Stroh.
»Die meisten Gewalttaten«, sagt der zerzauste belgische Bereitschaftspolizist, der sich mir als Marcel Langer vorgestellt hat, »spielen sich in der Familie ab.« In seinen freundlich geäußerten Worten schwingt Mitleid mit.
»Aber ich kenne den Toten überhaupt nicht!«, rufe ich entgeistert. »Ich habe doch grad erst erfahren, dass er mein Halbbruder ist!«
»Ich nehme Sie ja auch nicht wegen Mordverdachts fest«, sagt der Polizist, sich das Wörtchen »noch« offenbar verkneifend, »muss Sie aber bitten, sich uns zur Verfügung zu halten.« Er mustert meinen Personalausweis. »Was hat Sie überhaupt aus Berlin in die Eifel geführt?«
»Mein Bruder«, murmele ich, »ich wollte ihn nur kennenlernen.«
Ich starre auf den Toten, dessen Hinterkopf auf dem Krippenboden wie von einem zu Boden gefallenen dunkelroten Heiligenschein eingerahmt ist. Im Stroh dahinter liegt ein riesiger scharfkantiger Eisbrocken, der sich bei näherer Betrachtung als Bergkristall herausstellt. Mit viel Blut daran. Schlechtes Karma für eine Karriere als Heilstein, geht mir durch den Kopf; hier sind wohl ganz andere Schwingungen aktiv gewesen.
»Nicht anfassen!«, fährt mich der Polizist an, als ich mich nach dem glänzenden Stein bücke.
»Bestimmt ganz schön schwer«, sagt der Kollege und mustert mich beziehungsreich. Klar, schwer bin ich auch. Uns Dicken traut man alles zu. Wir verlieren eben nicht nur beim Essen die Beherrschung, sondern ergreifen spontan jeden herumliegenden Bergkristall, um damit Schädel einzuschlagen.
»Sichere den Tatort und ruf endlich den Staatsanwalt in Eupen an!«, knurrt Langer und wendet sich wieder an mich.
»Am Tag vor dem Mord an Ihrem Bruder, den Sie angeblich gar nicht kennen, tauchen Sie hier in der Eifel auf und finden ausgerechnet ihn rein zufällig am nächsten Morgen erschlagen in der Krippe vor?«
»So in etwa«, flüstere ich. »Ich glaub, ich bin im falschen Film.«
»Das sollten Sie mir in aller Ruhe erklären«, fordert er.
Ich deute auf die Hinterwand des Hotels Balter. Nach diesem Schock benötige ich dringend etwas Süßes.
»Das ist bundesdeutsches Gebiet«, bemerkt er zögernd und fährt sich durch verwuscheltes dunkles Haar mit vereinzelten Altersfäden.
»Aber auf dem Handy kriege ich dort nur ein belgisches Netz«, widerspreche ich.
»So haarscharf abgrenzen kann man das wohl nicht«, meint er müde. »Und das müssen wir in diesem Fall vielleicht auch nicht tun. Obwohl ich in Uniform eigentlich nicht in Deutschland ermitteln darf. Aber ich brauche unbedingt einen Kaffee. Und da drüben«, er nickt zu einem Café auf der gegenüberliegenden Straßenseite hin, »im belgischen Old Smuggler ist es jetzt viel zu voll.«
Der hintere Gastraum des Hotels ist leer. Und Angriff die beste Verteidigung.
»Sie machen es sich sehr leicht, Herr Polizeiinspektor«, fahre ich Langer an, als wir uns an einem kleinen Tisch vor einem mit Kakteen, Bügeleisen und Porzellanfiguren geschmückten Fenster gegenübersitzen, »die fremde Touristin zum Opfer zu machen …«
»Halt!«, unterbricht der Polizist. »Das Opfer ist Belgier. Kaffee?« Eine drahtige Kellnerin mit Schreibblock strebt auf uns zu.
»Ja! Und ein großes Stück Schokoladentorte. Bitte.«
Das letzte Wort schiebe ich für die Kellnerin nach. Als sich die Tür hinter ihr schließt, fahre ich fort: »Wer schuldlos zum Täter gemacht wird, ist ein Opfer. Und diese Rolle habe ich gründlich satt! Damit Sie Bescheid wissen, Herr Langer, ich habe vorgestern meine Mutter beerdigt, meinen Arbeitsplatz sowie meinen Freund verloren und wurde obendrein noch aus meiner Wohnung vertrieben! Ich finde, mein Soll an Schicksalsschlägen ist für diese Woche gedeckt. Ich lasse mir nicht auch noch den Mord an einem langhaarigen, schmuddeligen Mann anhängen, der mein Bruder sein soll und den ich überhaupt nicht kenne!«
Aber dessen Leiche ich aufgefunden habe, weil ich an offenen Pforten einfach nicht vorbeigehen kann, setze ich für mich hinzu.
»Ich möchte Ihnen nichts anhängen, sondern einen Mord aufklären«, sagt Langer freundlich. »Sollten Sie ihn doch begangen haben, könnte Ihre schlimme Vorgeschichte vor Gericht durchaus als strafmindernd gewertet werden. Und sind Sie unschuldig, haben Sie möglicherweise etwas beobachtet, das uns zum Täter führen kann. Also fangen Sie am besten von vorn an.«
Als Journalistin hätte ich lange gezögert, einem Polizisten mein Herz auszuschütten, aber ich bin keine Journalistin mehr, befinde mich in einer verzweifelten Lage und habe außerdem noch nie einen derart charmanten Akzent mit einem so liebenswert geröchelten R gehört wie den dieses belgischen Polizisten. Der zwar aussieht, als wäre er soeben aus dem Bett gefallen, mich aber aus recht wachen Augen mustert.
»Meine Mutter ist vor einer Woche gestorben«, beginne ich, sehe die dichten schwarzen Augenbrauen hochschnellen und setze hastig hinzu: »Im Krankenhaus. Es war ein natürlicher Tod.«
»Wohl kaum«, kommt eine Stimme von der breiten Falttür. Langers Kollege tritt mit einem jungen Mann ein. »Gerd Christensen ist eindeutig erschlagen worden. Michael Balter hier, der Inhaber der Krippana, sagt, der Stein sei aus den Geschäftsräumen entwendet worden.«
»Es handelt sich um einen Bergkristall«, verbessert Balter mit eindringlich sanfter Stimme, »und der fördert normalerweise Durchblutung und Sauerstoffversorgung.«
Er lässt diese Aussage auf uns wirken, ehe er fortfährt: »Wer immer es war, hat den Bergkristall aus der Ausstellung fortgeschafft, ohne Licht zu machen. Ich habe mir soeben die Aufnahmen der Überwachungskamera angesehen. Als die Putzfrau um kurz vor zwanzig Uhr das Licht ausmachte, war der große Bergkristall noch da. Die Tageslichtaufnahmen vom frühen Morgen sind zwar schwach, aber man kann deutlich erkennen, dass der Stein fehlt. Die Putzfrau habe ich telefonisch schon herbestellt. Wann ist der arme Christensen überhaupt ermordet worden?«
Marcel Langer seufzt erlöst, als uns die drahtige Kellnerin Kaffee und Kuchen vorsetzt. Süchtig, denke ich voller Sympathie, als er sofort zur Tasse greift und sie fast auf einen Zug leert. Ich stürze mich auf den Kuchen. Unterzuckerung kann ich mir jetzt keinesfalls leisten.
»Den genauen Todeszeitpunkt kann nur der Gerichtsmediziner feststellen«, bringt Langer nuschelnd hervor, während er sich mit der Hand ein paar Kaffeetropfen vom unregelmäßig geschnittenen Schnauzbart wischt, »aber dem ersten Anschein nach ist er wohl schon gestern Abend umgebracht worden.«
Ich verschlucke mich fast an meinem Schokoladenkuchen. »Dann kann ich es ja gar nicht gewesen sein!«, rufe ich krümelsprühend. »Ich habe ihn doch erst heute früh entdeckt.«
»Sie sind zum Tatort zurückgekehrt, um damit später mögliche Spuren Ihrerseits zu erklären«, stellt Langer ungerührt fest. »Ein alter Trick.«
Die drahtige Kellnerin meldet das Eintreffen von Frau Mertes, der Putzfrau. Voller Hoffnung, die Ermittler würden sich jetzt auf eine andere Verdächtige stürzen, drehe ich mich um. An der halb offenen Falttür steht ein zierliches Persönchen in Kittelschürze, Größe 34, höchstens. Total ungeeignet, um mit einem riesigen Bergkristall auf eine Leiter zu steigen und von der oberen Sprosse aus einen drei Köpfe größeren Mann zu erschlagen.
Langer wirft mir eine Zeitung auf den Tisch und bittet mich zu warten. Als er sich erhebt und damit den Blick auf den grünen Marmorsockel hinter sich freigibt, von dem mich ein großer grüner Marmorfrosch höhnisch anzugrinsen scheint, schlage ich lustlos das »Grenz-Echo« auf. Hier starren mich zwei Seiten Todesanzeigen an. Sofort denke ich an meine Mutter. Über deren Tod ich die Öffentlichkeit nicht unterrichtet habe, weil die sich dafür nicht interessiert hätte.
Als meine Mutter vor einer Woche im Sterben lag, konnte man mir nicht rechtzeitig Bescheid sagen, weil ich mein Handy ausgeschaltet hatte, um mich ungestört bei meinem Freund auszuweinen: Der Verlag hatte mir gerade die Arbeitsstelle gekündigt. Im Zuge allgemeiner Einsparungen benötige die Zeitschrift leider keine Moderedakteurin mehr, hieß es.
Als ich dies meinem Freund in seinem Büro mitteilen wollte, erfuhr ich, dass er künftig keine Freundin mehr benötige. Nach vierzehn Jahren sei ihm die außereheliche Beziehung zu mir einfach zu stressig geworden. Er habe seiner Frau alles gebeichtet und werde nun wieder zum anständigen Familienvater mutieren.
Später erfuhr ich im Krankenhaus, dass meine Mutter in genau dieser Stunde gestorben war. Zwischen uns war alles gesagt worden – bis auf eins: Den Namen meines Vaters würde sie mit ins Grab nehmen. Jedenfalls dachte ich dies, als ich an ihrem Totenbett stand und irgendwie froh war, ihr die Hiobsbotschaften meiner Kündigung und der Beendigung meines unanständigen Verhältnisses nicht mehr aufbürden zu müssen.
Ich bin Einzelkind. Meine Mutter hatte nie geheiratet. Sie war als junge Schwangere aus der Eifel nach Berlin gezogen und hatte den Kontakt zu ihrer streng katholischen Familie abgebrochen. Ich wusste nicht einmal ganz genau, aus welcher Gegend sie stammte. Sonst hätte ich mich bestimmt schon frühzeitig auf die Suche nach meinem Erzeuger gemacht. Ich hätte diesen Herrn gern darüber informiert, was er meiner Mutter angetan hatte, die in der Großstadt nie heimisch geworden war. Immerzu sang sie Lieder von Wäldern, Ginster und schneebedeckten Hängen, blieb aber in Berlin, um mir eine Zukunft zu ermöglichen. Wenn ich sie enttäuscht haben sollte, ließ sie sich das nicht anmerken. Sie klagte nie darüber, dass ich ihr keine Enkelkinder geschenkt habe.
Manchmal denke ich, dass sie Kinder ebenso wenig mochte wie ich. Meine Abneigung hatte sich schon im Grundschulalter gefestigt. Wie hätte ich Gleichaltrige auch mögen sollen, wenn sie Abzählverse erfanden wie »Katjas Mutter putzt die Treppe, du fällst über deine Schleppe« oder »Katja drückt den Feudel aus, du bist nass und darum raus«. Meine Mutter war froh, als Reinemachefrau in der Schule einen festen Arbeitsplatz zu haben, auch wenn dies ihre Knie schwer belastete. Ich drückte ihr nicht nur den Feudel aus, sondern half ihr, sooft es mir möglich war, bei der Arbeit, damit sie schneller fertig wurde und wir zusammen Mittag essen konnten.
Als meine Mutter zwei Monate zuvor ins Krankenhaus kam, forderte sie mich auf, ihre Wohnung aufzulösen. Ich sollte das behalten, was ich haben wollte, den Rest loswerden und ihr versprechen, den Umschlag mit der Aufschrift »Für Katja. Nach meinem Tod zu öffnen« auch wirklich erst nach ihrem Tod einzusehen.
An diesem Abend legte ich den Umschlag vor mich auf den Tisch. Er war sehr dick und schwer. Zweimal griff ich zur Schere, um ihn aufzuschlitzen, aber jedesmal schreckte ich wieder davor zurück. Wenn ich diesen Umschlag öffnete, war meine Mutter wirklich tot. Solange er geschlossen blieb, konnte ich mir einbilden, dass sie im Krankenhaus in ihrem Bett lag und auf meinen Besuch wartete.
Gegen Mitternacht fiel mir ein, dass ich seit dem Frühstück nichts mehr zu mir genommen hatte. Normalerweise wäre ich hocherfreut gewesen, keinen Gedanken an Essen verschwendet zu haben. Als Moderedakteurin mit Übergewicht kannte ich den Blick, mit dem mich Fashion-Designer beim Interview heimlich musterten, und ich konnte sogar ihre Gedanken lesen: Elefantengröße 48, schade, dabei hat sie so ein hübsches Gesicht.
Handys gab es noch nicht, als ich mich in den Mann verliebte, der sich von seiner Frau trennen wollte, sobald die Kinder aus dem Haus waren. Als das Handy aufkam, hielt meine eigene Mobilität mit jener der Telekommunikation nicht Schritt. Dafür hatte sich das Ritual bei mir zu sehr gefestigt. Nicht der Mann selbst, sondern das Festnetz-Telefon blieb der Lebensmittelpunkt. Und bei mir befand es sich ganz in der Nähe der Lebensmittel: auf dem Kühlschrank. Damit ich schnell zu einer Portion Schokoladeneis greifen konnte, wenn er, wie so oft, in letzter Minute telefonisch absagte. Und die Wartezeiten am Telefon ließen sich vor dem gut gefüllten Kühlschrank auch besser überbrücken.
Natürlich meldeten sich immer wieder Küchenpsychologen zu Wort, die der Ursache meines Übergewichts auf den Grund gehen wollten. Denen teilte ich fröhlich mit, diese sei natürlich in meiner Kindheit zu suchen. Meine Mutter hatte Schokoladeneis-Entzug als Erziehungsmittel eingesetzt, dem Essen dadurch eine besondere Bedeutung eingeräumt und so den Grundstein für meine Ess-Störung gelegt. Das konnte ich ihr nicht übel nehmen, denn in der armen Eifel, in der sie aufgewachsen war, muss sie oft Hunger gelitten haben, übrigens eine der wenigen Andeutungen, die sie über ihre Herkunft losließ. Wenn Nichtessen als Strafe dient, wird einer so normalen Angelegenheit wie Nahrung die Rolle der Belohnung zugewiesen und erhält Gewicht. Was sich bei mir als solches niederschlug.
Essen ist auch heute keine normale Angelegenheit für mich. Deshalb verwöhne ich mich nach anstrengenden Tagen gern mit besonders ausgefallenen kulinarischen Kombinationen. Ich muss gar nicht schwanger sein, damit mir bei dem Gedanken an saure Heringe mit Quitten-Schlagsahne das Wasser im Mund zusammenläuft.
Mein Fett ist mein Panzer, meine Figur ein Statement, und ich denke nur ans Abnehmen, wenn ich den Reißverschluss meiner Jeans nicht zuziehen kann. Ein Garderobenwechsel auf Größe 50 ist einfach zu zeitraubend. Oder war es, solange ich meinen Job noch hatte.
Etwas wehmütig denke ich an meine früheren Sorgen. Jetzt würde ich mir einen Garderobenwechsel nicht mehr leisten können. Es müssten schon andere Zeiten kommen, ehe eine beinahe fünfzigjährige Moderedakteurin eine neue Anstellung findet. Eine einstige Moderedakteurin, die zudem noch unter Mordverdacht steht.
Was ich vor zwei Tagen noch nicht wusste, als ich den dicken Umschlag anstarrte und zum Kühlschrank schritt. Doch der Anblick des Telefons verdarb mir den Appetit. Ich stellte es in den Flur. Eine beinah feierliche Handlung, mit der ich mich von meinem Lebensmittelpunkt verabschiedete.
Marcel Langers Räuspern reißt mich aus der Rückschau. Der Polizist zieht die dunkelblaue Uniformjacke aus, enthüllt dabei ein ziemlich zerknittertes hellblaues Hemd mit zwei Sternen sowie den Aufschriften Police und Polizei, dankt der Kellnerin für den nächsten Kaffee und lässt sich wieder mir gegenüber nieder.
»Haben Sie die Täterin?«, frage ich nicht sehr hoffnungsvoll.
»Das wird sich herausstellen«, erwidert er, sieht mich beziehungsreich an und schweigt.
»Konnte sie Ihnen denn weiterhelfen?«, hake ich nach. Schließlich bin ich Journalistin.
»Über den Fortgang der Ermittlungen darf ich Ihnen nichts sagen«, kommt der Satz, der mich schon als junge Zeitungsvolontärin zur Verzweiflung gebracht hatte.
»Wie soll ich mich denn verteidigen, wenn ich nichts weiß?«, platze ich ungehalten heraus, greife nach dem Keks, der seinen Kaffee begleitet, und reiße die Plastikverpackung auf. Ich bin immer noch hungrig, aber es scheint unangebracht, in dieser Lage ein Rührei mit Thüringer Würstchen, nur leicht angebratenem Speck, Ahornsirup und einem Hauch von Kapuzinerkresse zu bestellen.
»Bis zur Gerichtsverhandlung ist noch Zeit«, sagt er, als wäre ich ganz zweifelsfrei die Täterin. Ich mustere ihn fassungslos.
»Haben Sie niemanden, der Ihnen das Hemd bügelt?«, maskiere ich mein Entsetzen.
»Nein«, antwortet er ungerührt, zupft an seinem verkrumpelten Kragen und fragt, woran meine Mutter gestorben sei.
Am Heimweh nach der Eifel, hätte ich beinahe geantwortet, nenne aber dann doch lieber den komplizierten medizinischen Namen ihrer todbringenden Erkrankung. Ich erwarte eine Nachfrage, aber er nickt nur.
»Genau wie mein Vater«, sagt er leise und wirkt in seinem verknitterten Hemd und der schief hängenden dunkelblauen Krawatte auf einmal menschlich – und genauso verwaist wie ich. Gern hätte ich ihn nach seinem Vater gefragt, ob dieser auch so gelitten und er als Sohn das voller verzweifelter Hilflosigkeit miterlebt hat, aber wie das Rührei scheint diese Frage fehl am Platz, und so berichte ich von meinem Erbe.
»Ich habe dann diesen Umschlag meiner Mutter aufgerissen«, sage ich, erzähle, wie das dicke Bündel D-Mark-Scheine herausfiel und ich sofort zu heulen begonnen hatte. Meine Mutter, die gerade das Nötigste zum Lebensunterhalt und für meine Ausbildung verdient und danach eine Mindestrente bezogen hatte, die an keinem Bettler hatte vorbeigehen können, ohne ihm etwas zuzustecken, musste mehr als nur an der Butter gespart haben, um mir diese Summe zu hinterlassen. Ich zählte das Geld und rechnete schnell um. Vierzehntausend Euro. Zusammen mit der Abfindung, die vom Verlag zu erwarten war, konnte ich mich damit eine Zeitlang über Wasser halten. Natürlich würde ich umziehen müssen. Für eine arbeitslose Journalistin war eine Miete von knapp tausend Euro unerschwinglich.
»Tausend Euro Miete!«, unterbricht mich Langer erschüttert. »Und so was ist in Berlin normal?«
»Was ist schon normal?«, fahre ich ihn an. »Eine Leiche zum Frühstück?«
»Ich könnte noch gar nichts essen«, gibt er zurück und greift nach dem Kekspapier. Das Knistern zwischen seinen Fingern unterstreicht den unausgesprochenen Vorwurf.
»Nervennahrung«, murmele ich. »Im Umschlag war übrigens nicht nur Geld.«
Sondern auch ein Bündel Briefe. Sie waren mit einem Gummiband zusammengehalten und trugen alle die gleiche Handschrift und den gleichen Absender: Karl Christensen aus Kehr/Büllingen in Belgien.
Ich hatte keine Ahnung, dass meine Mutter mit einem Belgier in Kontakt gestanden hatte. Aber schon der erste Brief klärte mich auf. Dieser Karl Christensen freute sich, dass Anna ihre Tochter Katharina genannt hatte. Sie erinnere sich sicher noch, dass seine Mutter so hieß. Er hoffe sehr, dass diese Katharina irgendwann vor seiner Tür stehen und ihn mit Vater anreden würde. Vielleicht könnte sie das Kind ja später mal zu ihrer Mutter nach Hallschlag schicken. »Sie muss ihr ja nicht sagen, wer der Vater ist, sondern kann auf einem Nachmittagsspaziergang zufällig an meinem Haus vorbeikommen.«
Ich las nicht weiter, sondern holte sofort meinen Atlas. Nach einigem Suchen fand ich Kehr in der Eifel. Ein winziger Punkt genau auf der Grenze zwischen Belgien, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die grün gefärbte Staatsgrenze wie auch die gestrichelte Landesgrenze verliefen so, dass im Atlas nicht eindeutig zu erkennen war, zu welchem Staat oder Bundesland der Ort gehörte. Aber der Briefmarke nach zu urteilen war dies Belgien. Hallschlag, wo meine Großmutter wohnte und meine Mutter offensichtlich herkam, lag genau daneben auf deutscher Seite. Sofort überlegte ich, ob die unterschiedliche Staatsangehörigkeit dem Glück der beiden im Weg gestanden haben mochte. In Belgien spricht man doch Französisch oder Flämisch …
»Nicht bei uns in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, wir sprechen Deutsch, wie der Name schon sagt«, belehrt mich Langer, tippt auf die Polizei-Aufschrift seines Hemds und setzt hinzu: »Ihr Französisch, Frau Klein, ist wahrscheinlich besser als meins, und Flämisch kann ich überhaupt nicht.«
»Bitte ein Camembert-Brötchen«, rufe ich der Kaffee-Kellnerin hinterher und stimme Langer zu, dass meine Eltern wohl auch keine sprachlichen Probleme gehabt hätten. Meine Eltern. Habe ich noch nie gesagt. Erst jetzt, da es sie nicht mehr gibt, verleihe ich ihnen diesen Titel.
»Was die Sprache so alles verrät«, flüstere ich und setze hastig hinzu, dass in Berlin Dativ und Akkusativ häufiger verwechselt würden als in Karl Christensens Briefen. Die anderen seltsamen Idiome verschweige ich dem Polizeiinspektor. Ich will ihn ja nicht beleidigen. »Wir kommen parat«, war eine der Lieblings-Formulierungen meines Erzeugers; die streikende Melkmaschine »war in Panne«. Meine Großmutter »holte gar nichts von zu Hause mit«, als sie ein paar Monate nach dem Tod meines Großvaters zu einer gewissen Fine Mertes auf die Kehr gezogen sei. Nach Hallschlag fahre er, »für zu karten«, und dort »habe ich oft kalt, wenn ich an früher denke«. Die Infinitivkonjunktion »um zu« schien ihm ganz fremd zu sein. Für zu arbeiten, für einzukaufen, für zu bauen, für sicherzugehen, dass man im Alter noch was hat.
»Sie sind dann also hergekommen, für zu sehen, woher Sie abstammen?«, fragt Langer.
Ich verdonnere die Besserwisserin in mir zum Schweigen.
»Für auszuspannen, erst mal«, passe ich mich leise an und erzähle, wie ich die Poststempel der Briefe zu entziffern versuchte. Der letzte stammte aus dem Herbst jenes Jahres, in dem ich elf Jahre alt wurde. Karl Christensen teilte meiner Mutter mit, wie sehr ihn die Begegnung in Berlin mitgenommen habe. Die kleine Katja sei seinem Sohn Gerd wie aus dem Gesicht geschnitten. Er hoffe aber, dass sie besser mit anderen Kindern auskomme als sein Sohn, der leider keine Spielkameraden finde.
Eine Begegnung in Berlin? Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass mir meine Mutter jemals einen Mann vorgestellt hätte. Schon gar nicht meinen Vater.
Der mich gesehen, den ich aber als solchen nicht wahrgenommen hatte. Weshalb hat meine Mutter mir diesen Mann, meinen Vater, der ganz offensichtlich ein Teil meines Lebens hatte sein wollen, vorenthalten? Bis jetzt war ich immer davon ausgegangen, dass er sie im Stich gelassen, möglicherweise sogar aus ihrer Heimat vertrieben hatte. Dass er ein verantwortungsloser Hallodri gewesen ist, der ihre Zukunft zerstört hat. Anna Klein war nach meiner Wahrnehmung das Opfer gewesen.
Nach nur ein paar Zeilen Lektüre änderte sich dieses Bild gründlich. Und der einzige Mensch, den ich mein ganzes Leben lang gekannt habe, nimmt plötzlich fremde Züge an. Hatte sich meine Mutter etwa aus der Not der ungewollten Schwangerschaft eine Tugend gebastelt, nämlich den vermeintlichen Sinn ihres Lebens? Den sie mit niemandem teilen wollte, eifersüchtig für sich behielt? Dann habe ich sie bestimmt gewaltig enttäuscht.
In einem Brief bedauerte er, dass dieses Wesen, das »seinen Lenden entsprungen« war – bei dieser Formulierung wurde mir der Mann sofort unsympathisch –, so fern von ihm aufwuchs.
Mit dem nächsten Satz wurde er mir allerdings wieder sympathischer. Er beschwor meine Mutter nämlich, endlich Geld von ihm anzunehmen. Er bestehe ja nicht mehr darauf, als Erzeuger in den Akten zu erscheinen. Er werde sich auch an die Abmachung halten, das Geheimnis zu bewahren, obwohl er den Grund nicht mehr einsehe: Keiner ihrer Verwandten lebe mehr in der Gegend, nachdem ihre Mutter einen Monat zuvor in Fine Mertes’ Haus für immer friedlich eingeschlafen sei.
Ich fragte mich, ob meine Mutter auf diese Weise vom Tod der eigenen Mutter erfahren hatte.
»Deine Großmutter ist schon lange tot.«
Das hatte ich ihr abgenommen, wie so vieles andere auch. Zum Beispiel ihre sehr vage Andeutung, dass ich das Ergebnis einer Vergewaltigung sein könnte. Und nicht, wie ich erst jetzt erfuhr, ein Kind der Liebe. Wie wenig ich meine Mutter doch gekannt habe! Wie schamlos sie mich doch belogen hat! Aber den Mann, von dem die andere Hälfte meiner Gene stammte, den wollte ich endlich kennenlernen.
Ich bewunderte meinen Erzeuger, der über ein Jahrzehnt lang meiner Mutter unermüdlich Briefe geschrieben hatte, wissend, dass er keine Antwort erhalten würde. Keine Liebesbriefe hatten mich je so gerührt, obwohl von Liebe nie die Rede war.
Ich rief die Auslandsauskunft an und erfuhr, dass es unter der angegebenen Adresse keinen Karl, sondern nur einen Gerd Christensen gab. Ich ließ mich verbinden.
»Hallo?«
»Guten Abend, ich heiße Katja Klein, rufe aus Berlin an und hätte gern mit Herrn Karl Christensen gesprochen.«
»Der ist vor zwei Jahren gestorben«, antwortete eine frostige Stimme. »Um was geht es?«
»Um eine sehr persönliche Angelegenheit.«
»Die hat sich mit seinem Tod ja wohl erledigt. Oder ist es etwas, was ich wissen sollte? Ich bin sein Sohn.«
Und ich seine Tochter.
»Nein, ich glaube nicht. Mein Beileid. Ich hoffe, er hat nicht gelitten.«
»Ich wüsste wirklich nicht, was Sie das anginge. Guten Abend.«
Er legte auf.
Marcel Langers Augenbrauen sind wieder hochgeschnellt.
»Also standen Sie doch im Kontakt mit Ihrem Bruder!«
»Das nenne ich nicht Kontakt, sondern eine Abfuhr«, gebe ich wütend zurück. Was ist eigentlich in mich gefahren, mein Innenleben vor einem unausgeschlafenen Polizisten derart auszubreiten? Der nur darauf wartet, dass ich irgendetwas Belastendes von mir gebe. Der jetzt im Geiste eine Linie von dieser Abfuhr zu einem Mord zieht.
Ich erwäge etwas Versöhnliches über den mir unbekannten Bruder nachzuschieben, werde aber von Langers Kollegen unterbrochen, der soeben den Gastraum betritt.
»Eupen ist da.«
»Die föderale Polizei«, übersetzt Langer für mich, »Staatsanwaltschaft und Spurensicherung.« Er winkt den Kollegen weg: »Ich komme gleich. Frau Klein ist mit ihrer Aussage noch nicht fertig.«
Aussage. Beichte wäre wohl ein besseres Wort gewesen. Nicht Mord-Beichte. Lebensbeichte. Mit der ich trotz meines Ärgers gleich fortfahre: »Jedenfalls hat mich mein Vater auf der Grünen Woche in Berlin gesehen. Davon gibt es sogar einen Schnappschuss.« Ich ziehe das Foto aus meiner Handtasche und schiebe es Langer hin. Er vertieft sich in den Anblick des von Vater und Mutter umrahmten pummligen Mädchens unter einem Schild, das Ardenner Schinken, Bier und Spezialitäten aus der belgischen Eifel anpreist.
Ich deute auf die zwei prall gefüllten Plastiktüten zu unseren Füßen. »Hier hat meine Mutter mit unfairen Mitteln nach Essen gejagt«, sage ich.
Die Grüne Woche, diese internationale Fressbörse, war unser Urlaubsersatz und ein bedeutend größerer winterlicher Höhepunkt als Weihnachten. Wir lebten und sparten in den Sechzigern und Siebzigern darauf hin, uns jeden Januar durch die Hallen am Funkturm fressen zu können. Deftiges aus deutschen Landen und Exquisites aus exotischen. Mit einem harmlosen Trick gelang es uns in meinen frühen Kinderjahren immer wieder, mehr als die kostenlosen Happen zu ergattern. An besonders verlockenden Ständen ließ ich meine Kulleraugen rollen und tat, als ob ich nach der ausgestellten Ware greifen wollte. Meine Mutter schlug mir auf die Finger und schimpfte, worauf ich sofort zu weinen ansetzte. In den meisten Fällen zeigten die Standbetreuer ein Herz für Kinder, ermahnten meine Mutter, nicht so streng zu sein, und überreichten mir irgendein ausgestelltes Produkt. Dem Foto nach zu urteilen, hat sie sich am Eifelstand nicht mit Kleinigkeiten abgegeben.
Sogar jetzt meldet sich bei mir wieder so etwas wie Wut. »Bestimmt hat meine Mutter meinem Vater gar keine Gelegenheit gegeben, mich zu sehen, sondern wir sind ihm auf der Grünen Woche rein zufällig begegnet«, sage ich.
»Seltsam, dass schon damals für die Eifel geworben wurde«, meldet sich Langer ungläubig. »Man hat sich früher doch geschämt, von hier zu kommen, aus Preußisch-Sibirien. Sogar Kaiser Wilhelm sagte mal, die Eifel wäre ein trefflich schönes Land, gäbe es da nicht dieses hinterlistige Bergvölkchen – und damit meinte er uns.«
Kaiser Wilhelm? Für wie alt hielt er mich?
»Anfang der Siebziger war Willy Brandt Bundeskanzler«, belehre ich ihn und erzähle, wie ich versucht habe, mich in die Situation von Karl Christensen zu versetzen. Aus der Lektüre der Briefe wusste ich, dass ihm meine Mutter nie geantwortet hatte. Nur zufällig kreuzte sie seinen Weg auf der Grünen Woche. Endlich hatte er die einmalige Gelegenheit, seine Tochter zu verwöhnen. Und immer wieder flehte Karl Christensen meine Mutter an, in die Eifel zurückzukehren. Wie hatte er sich das denn vorgestellt? Da er auch ständig seinen Sohn Gerd, »ein schwieriger Junge, ganz anders als andere, gleichzeitig faul und ehrgeizig und fürs Landleben ungeeignet«, erwähnte, war er wohl kaum in der Lage, meine Mutter zu einer ehrbaren Frau zu machen. Aber nie schrieb er von einer anderen Frau, schon gar nicht von seiner eigenen. Dafür umso mehr von meinem Halbbruder. Später klagte er darüber, dass sich der Junge so gar nicht für den Hof interessiere und seinen Kopf dauernd in Bücher stecke, weil die anderen Kinder mit ihm nicht spielen wollten.
Das Leben sei immer noch recht hart am Fuße der Schneifel, berichtete er, aber zum Glück gebe es ja die Grenze, und der Schmuggel verschaffe den meisten Leuten nach wie vor ein zumindest kleines Auskommen. Obwohl es manchmal schwierig sei, den Kaffeeduft in den Särgen zu halten und die Schweine mit Korn ruhigzustellen …
Ich breche meine Erzählung ab. Unklug, so etwas einem Polizisten zu verraten. Einem schmuggelnden Vater traut man eher eine mordende Tochter zu. Marcel Langer scheint meine Gedanken zu lesen. Er macht eine wegwerfende Handbewegung.
»Längst verjährt«, sagt er, »meine deutschen Verwandten haben damals auch wegen Schmuggels im Knast gesessen. Wie jeder Bürger der Kehr, der heute über siebzig ist. Gilt nicht als Makel, die Leute waren hungrig und hatten den Muckefuck satt. Aber reden Sie doch weiter. Sie haben die Briefe gelesen. Was geschah dann?«
»Dann kam der nächste Schicksalsschlag. Wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde ich aus meiner Wohnung vertrieben.«
»Und haben sich mit dem Geld Ihrer Mutter ein schönes Hotelzimmer geleistet«, stellt Langer fest.
»Nein«, erwidere ich. »Als ich auf das Bündel Scheine blickte, die meine Mutter so mühsam zusammengetragen haben musste, erschien mir der Gedanke unerträglich, für ein Nachtlager mehr Geld auszugeben, als meine Mutter in einer Woche verdient hatte. Das Bezirksamt richtete uns Vertriebenen Notlager in meiner alten Grundschule ein.« Ich seufze. »In der Turnhalle.«
»Oje«, Langers Betroffenheit klingt echt. »Böse Erinnerungen.«
»Was wissen Sie schon davon!«
»Viel«, erwidert Langer leise. »Ich war ein äußerst schmächtiger Knabe.«
Zum ersten Mal betrachte ich ihn voller Wohlwollen. »Dann wissen Sie wirklich Bescheid«, gebe ich zu. Ohne es auszusprechen, hängen wir beide ein paar Sekunden lang schrecklichen verbindenden Erinnerungen nach. An missglückte Bodenübungen, an Martergeräte, die uns der Lächerlichkeit preisgegeben hatten, an die Demütigung, beim Volleyball als Letzte irgendeiner Gruppe zugeordnet zu werden, die dann laut aufstöhnte.
»Tja«, breche ich das durchaus angenehme Schweigen, »da lag ich auf einem Klappbett und sah über mir die hochgezogenen Ringe, an denen ich einst verzweifelt gestrampelt hatte. Mit dem Gedanken an diese Ringe muss ich eingeschlafen sein, denn im Traum legten sie sich mir um den Hals und schnürten mir die Luft ab. Die Turnlehrerin sah streng zu mir auf: ›Ringe um die Wahrheit!‹ Als mich meine Mutter mit dem Schrubberstiel aus meiner unglücklichen Lage befreite, plumpste ich zu Boden und wachte auf. Es war fünf Uhr früh, und ich beschloss, keine Minute länger im Muff meiner eigenen Vergangenheit zu verweilen. Meine Mutter hatte von Bergen und Wäldern gesungen. Ich brauchte jetzt einen Ort, an dem ich tief durchatmen konnte. Wo ich mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen konnte. Eine Kehrtwendung war dringend angesagt. Kehr. Warum nicht Kehr?«
Plötzlich fällt mir wieder ein, weshalb ich diesem Mann gegenübersitze. Doch nicht, weil wir in einer Selbsthilfegruppe unsere Turnstundentraumata aufarbeiten wollen! Wieder wütend über meine Offenherzigkeit, starre ich den Polizisten an. »Ich wollte nur aus der Opferrolle der letzten Tage raus – und schwupps, kaum bin ich hier, werde ich zur Täterin abgestempelt.«
»Bisher hat Sie niemand angeklagt. Dies ist nur eine erste Vernehmung. Erzählen Sie doch bitte weiter, Frau Klein. Das ist alles sehr interessant.«
Ich erwäge kurz, mich noch interessanter zu machen. Ihm zu erzählen, dass ich noch vor drei Wochen in Paris die Gattin des französischen Staatspräsidenten nach ihrem Lieblingsparfüm befragt habe. Und von meiner Begegnung mit Sophia Loren, die mir die gesundheitlich unbedenklichsten Methoden des Fettabsaugens nahegelegt hatte. Na ja … Diesem ungebügelten Hungerhaken von Dorfpolizisten mit den Modderrändern an den Schuhen könnte ich so manche selbst erlebte Geschichte aus der Welt der Reichen, Schönen und Mächtigen erzählen. Mir schwant jedoch, dass ihn dies wenig beeindrucken, sondern mich eher noch verdächtiger machen könnte. Zumal ich jetzt keine Hochglanz-Zeitschrift mehr im Rücken habe, die mir bis vor wenigen Tagen eine globale Identität und damit Schutz vor banaler Belästigung verliehen hat. Katja Klein ist jetzt nur noch eine weitere Arbeitslose der Republik. Nichts ist armseliger als der Versuch, mit verwelkten Lorbeeren zu punkten. Also halte ich mich an die Story meiner Ankunft auf der Kehr.
»Am frühen Morgen ließ ich Berlin hinter mir und reiste meinem einzigen noch lebenden Familienmitglied entgegen – das von meiner Existenz wahrscheinlich gar nichts wusste«, fahre ich mit besonderer Betonung des letzten Satzteils fort.
»Ohne noch mal anzurufen?«
»Wo denken Sie hin!«
Sollte er mir die Tür vor der Nase zuschlagen, wollte ich einfach Urlaub in einer Gegend mit gesunder Luft machen, sage ich, und darüber nachdenken, was jetzt aus mir werden sollte.
Das konnte ich am besten beim Essen. Also hielt ich an einer Autobahn-Raststätte an und ließ mir auf die Kohlroulade einen Matjeshering legen. Diese Komposition bedeckte ich mit einer Mischung aus Tütchenmayonnaise und Aprikosenkompott, um dem Fleisch die Trockenheit und dem Hering das Ranzige zu nehmen. Unter den entsetzten Blicken der Erwachsenen und den begeisterten der Kinder bestellte ich noch eine Brühwurst zum Mitnehmen.
Da erwog ich zum ersten Mal, Berlin für immer zu verlassen und irgendwo ganz neu durchzustarten. Dieser Gedanke kam mir weniger abenteuerlich vor als der, mir in einer billigen Berliner Bude ständig vor Augen halten zu müssen, was ich alles verloren hatte.
Wenn schon Suppenküche, dann lieber in der Fremde. Dort werden die Blessuren des Welteroberers geachtet, die des Einheimischen geächtet. Aber so weit war ich noch lange nicht. Was sprach dagegen, sich in meinem Alter eine neue Existenz aufzubauen? Bei näherer Betrachtung derartig viel, dass mir fast schwarz vor Augen wurde. Aber vielleicht lag das auch an der kurzen Nacht und der schweren Mahlzeit.
Die Welt erobern kann ich auch später, dachte ich, als ich kurz hinter Köln in meinem Wagen die Rückenlehne verstellte und die Augen schloss.
Mit schmerzenden Knochen wachte ich ein paar Stunden später auf, froh, dass die momentan zu erobernde Welt in der Eifel und somit nicht mehr allzu weit entfernt lag. In Blankenheim endete die Autobahn, und so fuhr ich über die B51 durch eine dünn besiedelte Landschaft mit sanften Hügeln, großartigen Aussichten, kleinen Gehöften und vielen Wäldern. Ich wurde von unzähligen Wagen mit gelben Kennzeichen überholt, parkte in einer Einbuchtung und vergewisserte mich auf der Karte, dass ich weder in Holland noch in Luxemburg gelandet war. Kronenburg hieß der nächste Ort, ganz in der Nähe meines Ziels. Fast hätte ich die Ausfahrt verpasst, die gleich hinter einer Biegung lag. Eine schmale kurvenreiche Straße erforderte besondere Aufmerksamkeit, aber aus den Augenwinkeln sah ich rechts auf dem Berg eine Burgmauer und links einen See in der Sonne glitzern. Plakate an Bäumen wiesen auf Ausstellungen, Dichterlesungen und Disko-Abende hin. Vielleicht war der Hund hier doch nicht ganz so tief begraben, wie ich es nach der Lektüre von Karl Christensens Briefen geglaubt hatte.
Auf jeden Fall sind die Leute energiemäßig auf der Höhe, dachte ich, als vor mir ein ganzer Wald an Windrädern auftauchte. Auf der Straße zur Linken wies ein Schild auf »Die Hexenküche« hin, ein winziges Ausflugslokal nahe einer Autowaschanlage. Mein Vater hatte seine letzten Briefe vor mehr als dreißig Jahren abgesandt. Irgendetwas würde sich in der Zwischenzeit bestimmt auch in der Eifel getan haben.
»Warum hat Ihnen Ihre Mutter diese Briefe überhaupt zukommen lassen?«, unterbricht mich Langer. »Sie hätte sie auch einfach vernichten können. Dann hätten Sie ihr Andenken in Ehren hochgehalten, nie erfahren, wo Sie väterlicherseits herstammen und sich wohl damit abgefunden.«
Diese Frage stelle ich mir auch immer wieder und beantworte sie genauso. Aber wenn dieser verwuschelte Polizist mit der schief hängenden Krawatte, dem ungebügelten Hemd, den dreckigen Schuhen und dem schrägen Schnurrbart so einfühlsam ist, kann er mich doch nicht ernsthaft für eine Mörderin halten!
»Meine Mutter kannte mich«, erwidere ich. »Sie wusste, dass die Lektüre auch Zorn in mir auslösen würde.«
Ende der Leseprobe