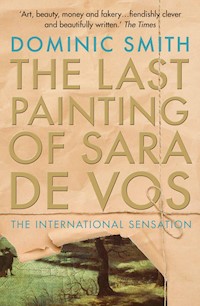9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ein eleganter Pageturner um ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert Sara de Vos ist 1631 die erste Malerin, die in die Meistergilde in Amsterdam aufgenommen wird. Dreihundert Jahre später ist nur ein einziges ihrer Gemälde erhalten geblieben. Das Bild hängt über dem Bett eines reichen, etwas ruhelosen New Yorker Anwalts. Ohne böse Absichten kopiert eine junge Australierin das Bild. Doch die Kopie wird in Umlauf gebracht, mit erschütternden Konsequenzen. Jahrzehnte später treffen die beiden Bilder, die Fälscherin und der Anwalt noch einmal aufeinander … "Wie der Autor drei Zeitläufte und Städte verbindet ist so brillant wie fesselnd." The Washington Post "Smiths Roman erinnert uns daran, dass die Wahrheiten, denen wir vertrauen, wertvoll bleiben, auch wenn sie ungenau sind." The Chicago Tribune "Ein Roman über Liebe und Sehnsucht, über Authentizität und ethische Grauzonen, vor allem aber über die Malerei als ein Weg, Trauer in Schönheit zu verwandeln." Lauren Groff, Autorin von "Licht und Zorn" "Hinreißende Erzählkunst. Mit einer fast greifbaren Kenntnis der vielen Verästellungen des menschlichen Herzens. Dieser Roman hält Sie nachts wach, anfangs, weil Sie unbedingt weiterlesen wollen, dann weil Sie bewusst langsamer lesen, um das Ende hinauszuzögern." The Boston Globe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Sara de Vos ist die erste Malerin, die 1631 in die Amsterdamer Meistergilde aufgenommen wird.
New York, 1957: Marty de Groot ist Anwalt und ein gediegener Gentleman. Sein Schlafzimmer schmückt einzig ein Gemälde von Sara de Vos, das sich seit Jahrhunderten in Familienbesitz befindet.
Ausgerechnet dieses Bild wird ihm gestohlen, was er nur durch einen Zufall bemerkt. Denn die Kopie, die ihm die Diebe hinterlassen, ist exzellent. Marty findet heraus, dass die junge Kunststudentin Ellie Shipley das Bild kopiert hat. Er umwirbt sie, und Ellie verliebt sich in ihn. Er jedoch hat nur die Fälschung und ihren Betrug im Sinn.
Jahrzehnte später treffen die beiden Bilder, die Fälscherin und der Anwalt noch einmal aufeinander.
Der Autor
Dominic Smith wuchs in Australien auf und lebt heute in Austin, Texas. Seine Kurzgeschichten waren für den Pushcart Prize nominiert und sind in mehreren Magazinen erschienen, u.a. The Atlantic. Er hat mehrere Fellowships erhalten. Weitere Informationen unter: www.dominicsmith.net
Dominic Smith
DAS LETZTE BILD DER SARA DE VOS
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Roth
Ullstein
Die Originalausgabe erschien 2016 unter demTitel »The Last Painting of Sara de Vos« beiSarah Crichton Books, ein Imprint von Farrar, Straus and Giroux, LLC, New York
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-1489-1
© 2016 by Dominic Smith© der deutschsprachigen Ausgabe2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © akg-images / Album / Prisma
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für Tamara Smith, Parlamentsabgeordnete –geliebte Schwester, treue Freundin, Wegbereiterin
Am Saum eines Waldes (1636)
Öl auf Leinwand
76 × 61 cm
Sara de Vos
Niederlande, 1607–16??
Eine Winterlandschaft im Abendlicht. Das Mädchen steht am vorderen Bildrand, die blasse Hand um einen Birkenstamm gelegt, und blickt hinaus auf die Schlittschuhläufer auf dem zugefrorenen Fluss. Ein halbes Dutzend sind es, dick vermummt gegen die Kälte, übers Eis gleitende Tupfer aus braunem und gelbem Tuch. Ein gefleckter Hund springt neben einem Jungen her, der zu einem weiten Bogen ansetzt. Den Fäustling in die Luft gereckt, winkt er das Mädchen – uns – näher heran. Ein Stück flussaufwärts duckt sich ein Dorf, eingesponnen in einen Kokon aus Rauch und Feuerschein, unter der Glocke des zinngrauen Himmels. Aus einem Riss in den Wolken sticht ein einzelner Lichtspeer auf ein Feld herab, verhält bei den bloßen Füßen des Mädchens im Schnee. Ein Rabe, fast violett schimmernd in dem Dämmer, krächzt von einem Ast neben ihr. Durch die schmalen Finger ihrer herabhängenden Hand ist ein zerfranstes schwarzes Band geflochten; unter einem langen grauen Umhang lugt der zerschlissene Saum ihres Kleides hervor. Wir sehen sie im Halbprofil, dunkles Haar fällt in losen Strähnen um ihre Schultern. Ihre Augen fixieren einen Punkt in der Ferne – aber ist es Furcht, was sie an ihren Platz bannt, oder dieser seltsame Nimbus aus wintrigem Zwielicht? Kann sie die eisige Uferböschung nicht erreichen oder will sie es nicht? Ihre Fußspuren führen durch den Schnee zurück Richtung Wald, aus dem Rahmen hinaus. Es ist, als wäre sie von außerhalb ins Bild gewandert, hätte sich aus unserer Welt auf die Leinwand verirrt, nicht ihrer eigenen.
Erster Teil
Upper East Side
November 1957
Das Gemälde wird in derselben Woche gestohlen, in der die Russen einen Hund in den Weltraum schießen. Ihm von der Wand überm Ehebett heruntergestohlen, bei einem Benefizessen für Waisenkinder auch noch. So wird Marty de Groot die Geschichte in den Jahren danach hindrehen, so wird er sie für seine Partner in der Kanzlei aufbereiten, wird auf Dinnerpartys und bei Drinks im Squashclub Lacher damit ernten. Wir tunken unsere Shrimps in Cocktailsauce, von Rachels bestem Porzellan natürlich, draußen auf der Dachterrasse, weil es mild ist für Anfang November, und währenddessen vertauschen zwei Gangster, die sich als, sagen wir, Kellner getarnt haben, das Original gegen eine meisterlich gefertigte Kopie. Besonders auf diese letzte Formulierung wird er stolz sein – meisterlich gefertigte Kopie. Er wird sie bei Freunden, Versicherungsvertretern und auch dem Privatdetektiv anbringen, weil sie die Spannung erhöht, weil sie nahelegt, dass hier ein Genie, ein kriminelles Superhirn geduldig seine Ränke gegen ihn geschmiedet hat, genau wie die Russen all diese Jahre konspiriert haben, um die Stratosphäre zu erobern. Die Wendung verschleiert außerdem die Tatsache, dass Marty die schöne Fälschung viele Monate lang gar nicht bemerkt hat.
Unerwähnt lassen wird er zumeist, dass sich Am Saum eines Waldes seit über drei Jahrhunderten im Besitz seiner Familie befindet und ihm von seinem Vater auf dessen Sterbebett vermacht wurde. Oder dass es das einzig erhaltene Gemälde von Sara de Vos ist, die 1631 als erste Frau der holländischen Lukasgilde beitreten durfte. Und wem sollte er beichten, dass er beim bedächtigen, kontemplativen Sex mit seiner melancholischen Frau in den Jahren nach ihrer zweiten Fehlgeburt regelmäßig aufgeblickt hat in das bleiche, rätselhafte Gesicht des Mädchens? Nein, all das wird er für sich behalten wie einen heimlichen Glauben an einen launenhaften Gott. Er ist Agnostiker, neigt aber zu Anwandlungen krausesten Aberglaubens, eine Schwäche, bei der er sich nicht gern ertappen lässt. Im Stillen wird er mutmaßen, dass das Verschwinden des Gemäldes nicht nur das Ende von Rachels langwieriger Depression herbeigeführt hat, sondern auch der Grund ist, warum ihn seine Kanzlei endlich doch zum Partner befördert. Und dass das vermaledeite Bild schuld an der Gicht, dem Rheumatismus, den Herzinfarkten, Schlaganfällen und der sporadisch auftretenden Unfruchtbarkeit ist, die seine Familie über dreihundert Jahre hinweg heimgesucht haben. Wo immer das Gemälde hing, ob in London, Amsterdam oder New York – keiner der vormaligen Besitzer, so macht er sich klar, ist je älter als sechzig geworden.
Die Miet-Beatniks sind Rachels Versuch einer Wiederannäherung an das Leben. Angeödet von der bloßen Vorstellung sanft beduselter Patentanwälte in Umschlagmanschetten mit ihrem Smalltalk über Immobilien und Segeltörns in Nantucket, hat sie sich an das Inserat erinnert, das sie aus einem Alumni-Magazin ausgeschnitten hat, und es aus ihrer Rezepteschachtel hervorgesucht. Verleihen Sie Ihrer Dinnerparty Schwung – mieten Sie sich Beatniks. Sämtl. Zubehör incl.: Bart, Sonnenbrille, alte Armeejacke, Jeans, löchriges Hemd, Turnschuhe oder Sandalen (wahlw.). Preisnachlass möglich bei Rasur, ordentl. Schuhwerk oder Haarschnitt. Auch weibl. Beatniks verfügb.
Wenn sie schon alljährlich Spenden für die Waisen der Stadt sammeln – was selbst Rachel etwas zu sehr nach Charles Dickens klingt –, warum der Stadt dann nicht Einlass gewähren, warum die Veranstaltung nicht ein bisschen erden mit einer Portion Schmutz und Farbe aus der Lower East Side und dem Village? Als sie die Nummer anrief, meldete sich eine Frau mit Polypenstimme, die ganz offenbar von einem Skript ablas: Für eine Pauschale von 250 Dollar, leierte sie ihr vor, würden sich pünktlich zur vereinbarten Zeit zwei Künstler, zwei Dichter und zwei Intellektuelle einfinden. Rachel stellte sich ein Souterrain in Queens vor, Neonröhren, in deren fahlem Schein Geschiedene mit Kopfhörern saßen wie Usambaraveilchen im Treibhaus. Sie stellte sich arbeitslose Schauspieler vor, die aus Hoboken angeschlappt kamen, die Adresse auf ein Streichholzheft gekritzelt. Die Frau fragte: »Wie viele Beatniks nehmen Sie dann, Ma’am?« und: »Möchten Sie die Frauen lieber mit Ponchos oder Bolerojacken?« Am Ende des Telefonats hatte Rachel ihre gesamte Garderobe ausgewählt, bis hin zu den Ballerinas, Baskenmützen, Sonnenbrillen und Silberohrringen. Das ist inzwischen Wochen her, und jetzt, am Tag des Ereignisses, fragt sie sich, ob ihre originelle Idee nicht doch eher eine Geschmacksverirrung war. Ein russischer Hund kreist um den Planeten, und sie fürchtet, ihr kleiner Scherz könnte als frivol und unpatriotisch aufgefasst werden. Den ganzen Morgen brütet sie darüber, außerstande, Marty zu gestehen, dass um Punkt neun, während der Après-Dinner-Cocktails, ein Trupp Bohemiens bei ihnen einfallen wird.
Marty hat ebenfalls eine Überraschung parat, seine eigene kleine Darbietung für seine Gäste und Kollegen. Aber davon schweigt er wohlweislich, während Rachel die Leute vom Partyservice instruiert. Um fünf duften alle drei Etagen der Wohnung nach Lilien und frischem Brot, und es weckt auch die restlichen seiner Sinne. Er steht bei der Terrassentür im obersten Stock, ab vom Schuss, blickt durch die im Abendlicht leuchtenden Räume, und diese Flut späten Lichts erfüllt ihn mit einem flüchtigen Gefühl nostalgischer Genugtuung. Alles wirkt so ungeheuer solide und real um diese Tages- und Jahreszeit, jeder Gegenstand aufgeladen mit Bedeutung. Als Heranwachsendem erschienen ihm die Räume hier oben abweisend, ein Museum, kein Zuhause. Die niederländischen Porträts mit ihren dämmrigen, holzgetäfelten Interieurs hatten etwas Bedrückendes für ihn, die fernöstlichen Lackschatullen etwas Kaltes, Asketisches, aber nun, da all die Dinge ihm gehören, befriedigt der Anblick, gerade in dieser Stunde vor dem Anschalten der ersten Lampe, ihn ungemein. Ein Leben, ausgedrückt und aufgegliedert in Objekten. Wenn er die Augen schließt, riecht er das Leinöl in den Seestücken, riecht die türkischen Gebetsteppiche mit ihrem undefinierbaren Duft warmen Heus. Er schenkt sich zwei Fingerbreit Single Malt ein und zieht sich damit in den dänischen Lehnsessel zurück – seinen Hamlet-Sessel, wie Rachel ihn nennt. Carraway, der zehnjährige Beagle, kommt mit klimperndem Halsband vom Flur her über das Parkett getrottet. Marty lässt die Hand herabbaumeln, und während der Hund ihm die Fingerspitzen abschleckt, erhascht er durch die geöffnete Küchentür einen Blick auf die Kellner in ihren gestärkten weißen Schürzen und zwischen ihnen Rachel; den Kopf gesenkt, eine Hand an ihrer Perlenkette, verhandelt sie mit einer Diskretion, dass es eine Frage der nationalen Sicherheit sein könnte, die da erörtert wird, und nicht Pilau und Räucherlachs. Im Grunde ist sie immer dann ganz und gar in ihrem Element, denkt er, wenn es etwas zu planen gibt – eine Reise, ein Essen, eine Party. Doch seit einiger Zeit hängt um Rachel diese stille Mattigkeit, an die sie beide nicht rühren. Fortwährend scheint sie kurz davor, leise nach Luft zu ringen, und sooft sie ein Zimmer betritt, wirkt es, als hätte sie sich draußen im Flur erst sammeln müssen wie ein Schauspieler vor seinem Auftritt. Wenn er spät aus der Kanzlei heimkommt, ist sie manchmal im Wohnzimmer eingeschlafen, alle Lichter gelöscht, Carraway neben ihr zusammengerollt. Oder er findet leere Weingläser im Haus verteilt, in der Bibliothek, neben dem Bett, findet russische Romane zwischen den Sofakissen oder draußen auf der Terrasse, wo das Wetter sie ausbleicht und zerfleddert.
Sie fängt seinen Blick auf und kommt auf ihn zu. Er krault Carraway hinter den Ohren und lächelt ihr entgegen. Die letzten fünf Jahre, denkt er, hätten ebenso gut zwanzig sein können. Im Frühling ist er vierzig geworden, gleichsam als Tusch auf seine dümpelnde Karriere und ihrer beider Unfähigkeit, Kinder in die Welt zu setzen. Letztlich, so muss er sich eingestehen, ist er alles spät angegangen, das Jurastudium, den Beruf, die Familiengründung. Ererbter Wohlstand hat ihn träge gemacht, ihn im Wachstum gehemmt, bis er die dreißig überschritten hatte. Nach sieben Jahren hopp oder top lautet die Faustregel für Partnerschaftsanwärter in der Kanzlei, und Martys siebtes Jahr läuft. Er sieht es in dem Blick, mit dem Rachel sich ihm nähert: Warum haben wir so lange gewartet? Sie ist acht Jahre jünger als er, aber weniger robust. Nicht direkt zerbrechlich, nur ängstlicher, leichter verwundbar. Einen gedehnten Moment lang denkt er, sie naht mit einem gemessenen, ehefraulichen Kuss – eine dieser einstudiert wirkenden Gesten, die sie ab und zu aus den Falten ihrer Depression hervorzaubert. Stattdessen ermahnt sie ihn, keine Hundehaare an seine Anzughose zu bringen. Von nahem riecht er den Burgunder in ihrem Atem, und er überlegt kurz, was die Kellner von ihr halten mögen, verachtet sich dann für diesen Gedanken. Er beobachtet sie, wie sie den Gang entlang Richtung Schlafzimmer entschwindet. Er selbst bleibt sitzen, bis der Raum bis zum Rand mit Dunkelheit vollgelaufen ist. Erst dann steht er auf und geht von Zimmer zu Zimmer, um die Lichter anzudrehen.
Kurz vor sieben ruft Hart Hanover, der Portier, an und meldet den de Groots, dass er ihre ersten Gäste heraufschickt, Clay und Celia Thomas. Marty dankt ihm und vergisst auch nicht, sich nach Harts Mutter zu erkundigen, einer Frau, die draußen in Queens still an Krebs stirbt. »Tapfer wie eh und je, Mr de Groot, danke der Nachfrage.« Hart war schon Ende der zwanziger Jahre, als Martys Vater das Penthouse gekauft hat, Portier in dem Gebäude Ecke East 80th Street und Fifth Avenue. Der schmale dreizehnstöckige Bau besteht aus nur sechs Wohnungen, und sämtliche Bewohner behandeln Hart wie einen gütigen alten Onkel, der finanziell zu kämpfen hat. Marty sagt, sie werden ihm ein Essenstablett hinunterbringen lassen, und hängt auf. Er und Rachel gehen die beiden Treppen hinab, um den Lift zu erwarten. Der geschäftsführende Teilhaber der Kanzlei und seine Frau kommen unweigerlich als Erste und gehen auch als Erste. Sie sind beide in den Sechzigern, und im Sommer enden die Abendgesellschaften bei ihnen, bevor es draußen dunkel wird.
Die Lifttüren öffnen sich, und die Thomas treten heraus auf den schwarzen Marmorboden des Foyers. Rachel nimmt den Gästen immer eigenhändig die Mäntel und Hüte ab, und etwas an diesem Ritual, dieser Vortäuschung häuslicher Demut, bringt Marty jedes Mal in Harnisch. Der Haushälterin, Hester, hat Rachel demonstrativ für den Großteil des Abends freigegeben; sie sitzt wahrscheinlich in ihrem Zimmer vor dem Fernseher. Also muss er seiner Frau zuschauen, wie sie seinem Chef den Kamelhaarmantel abnimmt (der viel zu warm ist für die Witterung) und Celia ihr Schultertuch aus Kaschmir. Auch heute fällt Marty wieder auf, wie unbehaglich Clay bei jedem seiner Besuche hier dreinschaut. Er stammt aus einem Geschlecht alteingesessener Neuengländer: Geistliche, Intellektuelle, eine Kultiviertheit und Privilegiertheit, über die ein Wort zu verlieren schlechter Stil wäre. Insgeheim scheint er Marty seinen ererbten Reichtum zu verübeln – mahlt stumm mit den Kiefern, als würde er Eisen schmecken, sobald er über die Schwelle tritt. Auch das bremst Martys Aufstieg zum Partner, argwöhnt er; sein dreistöckiges Penthouse mit ungehindertem Blick auf Metropolitan Museum und Central Park beleidigt die aristokratische Zurückhaltung seines Chefs.
Clay bohrt die Hände in die Hosentaschen und wippt auf den Fußballen, ein überbreites Lächeln im Gesicht. Marty muss an einen Mann denken, der im Smoking Holz gehackt hat, voll Tatendurst nach seinem kurzen, belebenden Kontakt mit den Elementen.
Clay sagt: »Haben Sie noch einen Stock draufgesetzt, Marty? Ich könnte schwören, Ihre Wohnung wird von Mal zu Mal ein Stück größer.«
Marty quittiert dies mit einem kleinen Lachen, spart sich aber die Antwort. Er schüttelt Clay die Hand – was er im Büro nie tun würde – und küsst Celia auf die Wange. Hinter seinen Gästen sieht er Rachel, halb verschluckt von den Tiefen des Garderobenschranks, über die feine Wolle von Celias Schal streichen. Sie könnte in diesen Schrank gehen und nie wieder herauskommen, denkt er.
»Er wollte unbedingt laufen, den halben Park hoch«, beschwert sich Celia.
»Jetzt bekommen Sie beide erst mal einen Drink.« Rachel führt sie zur Treppe.
Clay setzt seine Brille ab und poliert die Gläser mit einem Taschentuch. Im Lampenlicht des Flurs bemerkt Marty einen dicken roten Striemen auf Clays Nasenrücken und fühlt sich an einen Landpfarrer erinnert, der gleich eine flammende Predigt vom Stapel lassen wird.
Clay sagt: »Wenn wir für Waisenkinder spenden, sollten wir laufen, dachte ich. Außerdem ist es ein wunderschöner Abend. Aber keine Bange, Schatz, zurück nehmen wir ein Taxi. Ich warne Sie, Marty, ich bin völlig ausgehungert nach diesem Marsch. Ich werde schlingen wie ein Wikinger.«
»Da haben Sie Glück«, sagt Marty. »Rachel hat sämtliche Partydienste von ganz New York angeheuert.«
Sie haben das Dachgeschoss erreicht. In dem Moment, in dem sie aus dem langen Flur in den Salon kommen, hebt draußen das Streichquartett zu spielen an, und hinter der Terrassenmauer leuchten die Wohntürme jenseits des Parks wie Ozeanriesen, pointillistische Muster über dem Dunkel der Baumkronen. Marty hört Celia einen ganz schwachen Seufzer ausstoßen und weiß, das ist der Neid. Er denkt an das nüchterne Steinhaus der beiden mit seinen schmalen Fenstern, seinem kreidigen Pfarrhausgeruch. Clay räuspert sich, während sie hinausblicken auf das Büfett auf der Terrasse, die Berge von Horsd’œuvres, die Pyramide aus glitzerndem Eis und Shrimps.
Celia schluckt, sagt dann: »Es sieht traumhaft aus, wie immer, Rachel.«
»Ein paar Anrufe, mehr habe ich nicht gemacht.«
»Von wegen«, sagt Marty. »Hier wurde fünf Wochen lang geplant wie für die Invasion in der Normandie. Jedenfalls dachten wir, wir nutzen das warme Wetter aus. Sie können draußen oder drinnen sein, ganz wie Sie möchten.«
»Einen Gimlet und eine Handvoll Erdnüsse«, sagt Clay, »mehr brauche ich gar nicht.«
Marty hört in Clays Smoking loses Kleingeld klimpern und sieht den Mann vor sich, wie er vor einem schmucklosen Schreibpult oder Sekretär steht und sich die Vierteldollars und Zehn-Cent-Stücke in die Hosentaschen füllt. Irgendwo da drin ist bestimmt auch ein Schweizer Messer. Er sagt: »Tut mir leid, Clay, ich fürchte, Sie müssen mit Brie und Shrimps vorliebnehmen.« Mit ausladender Geste zeigt er hinaus auf die Terrasse. Unten klingelt es, und Rachel eilt den Gang entlang, ehe Marty sie aufhalten kann.
Mit seinen zweihundert Dollar pro Gedeck lockt das Dinner der Aid Society alljährlich die gleichen rund sechzig Gäste an: Anwälte, Chirurgen und Firmenvorstände aus Uptown Manhattan, philanthropisch gesinnte Gattinnen, einen pensionierten Diplomaten. Abendkleidung ist vorgeschrieben, und es gibt eine Sitzordnung, kalligraphisch gestaltete Platzkärtchen an zehn runden Tischen. Jedes Jahr sagt Rachel einem japanischen Künstler in Chelsea ihre Namensliste durch, und drei Tage später wird der Reispapierumschlag mit den Tischkarten darin geliefert. Marty fertigt den Sitzplan an, nach einer Methode, die er sich von einem Freund abgeschaut hat, der bei Sotheby’s Auktionator für europäische Kunst ist: Die reichsten Gäste sitzen dem Auktionstisch am nächsten, und die Kellner sind angewiesen, ihre Weingläser alle Viertelstunde nachzufüllen. Diese Strategie hat die zehn Jahre, die Marty die Essen der Aid Society schon ausrichtet, zu den einträglichsten in der Geschichte der Organisation gemacht. Die Gebote, die bei der stillen Auktion für Karibikkreuzfahrten, Opernkarten, Füllfederhalter und Abonnements des Yachting-Magazins abgegeben werden, sind samt und sonders haltlos überhöht. Marty hat einmal ausgerechnet, dass Lance Corbin, ein orthopädischer Chirurg, der nicht einmal ein Boot besitzt, für jede Ausgabe seines Maritime Monthly120 Dollar hinblättert.
Die Tische, mit Lilien und antikem Silber geschmückt, sind im Salon gedeckt, der an die Terrasse angrenzt. Da es so warm ist, sollen Cocktails, Champagner und die Desserts im Freien serviert werden, aber Marty besteht darauf, dass das Essen selbst drinnen stattfindet, wo man mehr Licht hat, um seine Schecks auszustellen, und wo holländische und flämische Genrebilder und Landschaftsgemälde wenn auch nicht unbedingt Waisenkinder, so doch eine gewisse Unterprivilegiertheit suggerieren – der Knecht, der bei Wind und Wetter irgendeine Tierhälfte in ein Kellerloch schleppt, die Zecher in der Schenke, die mit Löffeln nach einer Katze werfen, der Avercamp mit seinen rotgesichtigen schlittschuhlaufenden Bauern auf einem zugefrorenen Kanal.
Als Rachel zum Essen hineinbittet, schwenkt das Streichquartett von Rossini zu Bach’scher Tafelmusik um. Rachel und Marty sitzen wie stets an getrennten Tischen, um die Tuchfühlung mit den Gästen zu maximieren, aber Marty ertappt seine Frau wiederholt dabei, wie sie geistesabwesend in ihr Weinglas starrt. Clay Thomas gibt seine ewig gleichen Erzählungen über seine Zeit als Sanitäter im Ersten Weltkrieg zum Besten, über Fußballspiele mit den Italienern in knöcheltiefem Matsch. Die anderen Gäste an diesem Tisch wechseln, aber sich selbst teilt Marty jedes Mal pflichtschuldigst für Clay Thomas ein. Solange er noch nicht Partner ist, wird er Jahr für Jahr wieder so tun, als hörte er Clays Kriegsgeschichten zum ersten Mal.
Nach dem Essen und der Auktion verteilen sich die Gäste wieder über die Terrasse. Dort ist ein langer Tisch mit Champagnerflöten, Paletten von Profiteroles, ganzen Bataillone von belgischen Pralinen und Näpfchen mit Crème brulée aufgebaut. Wie in den vergangenen Jahren überlässt Rachel das so wichtige Rundendrehen Marty. Sie fühlt sich nie wohl mit den herumflachsenden Männern und auch mit den Frauen der Partner nicht, deren Kinder alle auf dieselben Schulen und Colleges gehen. Ihr sind die Außenseiter lieber, die Schwester des großen Gesellschaftslöwen, die Cousine eines bedeutenden Wohltäters, die von außerhalb zu Besuch ist. Das sind die Menschen, bei denen sie am entspanntesten ist, Menschen, die sie nicht fragen, ob sie denn nie daran gedacht hat, eine Familie zu gründen. Marty wirft ihr regelmäßig vor, sie würde sich in ihrem eigenen Haus verstecken, sich in verkrampfte, unbeholfene Konversation mit Wildfremden flüchten. Er sagt ihr auch, dass seine Partner sie für arrogant halten statt für zart und schüchtern. Von der Ecke der Terrasse aus, wo sie mit halbem Ohr einer Unterhaltung über den Straßenköter folgt, den die russischen Wissenschaftler irgendwo in Moskau aufgelesen haben, kann sie die prunkvolle Wanduhr im Salon sehen und macht sich klar, dass ihre Beatniks in weniger als einer halben Stunde hier sein werden. Sie blickt über die Menge, um zu ermessen, wie die Truppe wohl ankommen wird. Sie weiß selbst nicht, will sie den Abend auflockern oder hofft sie ihn zu torpedieren? Wenn sie die Situation falsch eingeschätzt hat, wird sie die Bohemiens im Foyer abfangen, ihnen ihr Geld in die Hand drücken und sie wieder hinausschicken in die Nacht.
Draußen hat es stark abgekühlt, und viele Gäste haben sich ihre Mäntel geholt. Schon vorhin, während der Cocktails, hat Marty den offenen Kamin auf der Terrasse angeheizt, umstanden von Clay und den anderen Partnern mit ihren Drinks und ihren guten Ratschlägen, bis schließlich Clay Asbesthandschuhe übergestreift und mit dem gusseisernen Schürhaken die Scheite in der Mitte umgeschichtet hat – unten müssten mehr blaue Flämmchen und mehr Luft sein, belehrte er die Jüngeren. Jetzt steht ein Häuflein von ihnen um das munter flackernde Feuer: Anwälte mit Zigarren und losem Metapherngebrauch, die über Philosophie, das Problem der Verslumung und die Gebührenordnung fachsimpeln. Durch die Glastür sieht sie die Kellner Stapel benutzter Teller zu der Geschirrstation tragen, die sie im hinteren Flur aufgebaut haben, dem alten Dienstbotenkorridor, auf den die rückwärtigen Türen der Schlafräume hinausführen. Die »Nachttopfgasse« nennt Marty ihn und behauptet, sich daran zu erinnern, dass seine senile holländische Großmutter – eine große Gintrinkerin vor dem Herrn – ihren »Potschamber« dort hinauszustellen pflegte, damit die Dienerschaft ihn entsorgte. Aber es gab keine Dienerschaft, nur eine überarbeitete Haushälterin, die den Korridor schon vor Jahren außer Betrieb gesetzt hatte und die die Nachttöpfe erst entdeckte, als der Geruch durch die Wände drang. Inzwischen muss sich ein Dutzend Kellner dort hinten zusammengefunden haben. Vage hat sie das Gefühl, dass sie vielleicht hingehen und nach dem Rechten sehen sollte, sich vergewissern, dass es keine Scherben gegeben hat, dass die Kellner nicht aus den Flaschen trinken, aber da sieht sie Marty mit Hester konferieren. Sie hat Hester den Abend mehr oder weniger freigegeben, nachdem die Blumen auf die Vasen verteilt waren (Hester wird schließlich auch nicht jünger), darum fragt sie sich nun, ob Marty die arme Frau aus ihrem Zimmer geklopft hat.
Jetzt geht Hester von der Terrasse hinüber zur Bibliothek und rollt ein mit einer Decke verhängtes Metallwägelchen heraus, das eine Schleppe von Verlängerungskabeln hinter sich her zieht. Marty unterdessen hat Carraway auf den Arm genommen und sieht aus, als wollte er das Wort an seine Gäste richten. Ein paar Gläser Wein, und er verwandelt sich in seinen Vater, dem noch der kleinste Anreiz zu großen Reden recht war. Mit etwas Pech geraten diese Ansprachen plump und rührselig. Er hat schon Tränen über weit Harmloseres als Waisenkinder vergossen, darum befürchtet Rachel das Schlimmste, als sich die Gäste um ihn zu scharen beginnen. Das Bach-Adagio, das aus einer Ecke der Terrasse herüberdringt, bricht abrupt ab.
Marty blickt mehrere Sekunden in den Feuerschein, strafft die Unterlippe. »Tja, ich dachte, vielleicht sage ich ein paar Worte … Zunächst mal danke Ihnen allen, dass Sie heute Abend hier sind und diesen guten Zweck unterstützen. Wie üblich ist eine hübsche Summe zustande gekommen.«
Er tätschelt dem Hund, der in seiner Armbeuge liegt, das Hinterteil; seine freie Hand hält die Zigarre.
»Wie wir alle wissen, wurde diese Woche das erste Lebewesen in den Weltraum geschickt, auf eine Fahrt ohne Wiederkehr …«
Rachel nimmt sich ein Glas Champagner von einem Tablett, das an ihr vorbeigetragen wird. Wie um Himmels willen, denkt sie, will er den Bogen vom Weltraum zurück zu den Waisenkindern schlagen?
»Wenn diese Hündin in ein paar Tagen ihre letzte Futterration auffrisst, so habe ich mir sagen lassen, dann wird ihre Abschiedsmahlzeit entweder vergiftet sein oder es tritt ein Gas aus, das sie einschläfert. Das ist offenbar die russische Art, vierbeinige Weltraumforscher zu behandeln …«
Ein Beben hat sich in seine Stimme eingeschlichen; er verstummt. Einige der Partner nippen an ihren Drinks, den Blick in den Kamin gerichtet – Verlegenheit, fragt sich Rachel, oder doch patriotische Ehrerbietung?
»Na, und da kann ich nicht anders, ich muss an unseren kleinen Beagle Carraway hier denken, und ich habe mir gesagt, lassen wir ihn teilhaben an diesem historischen Augenblick.«
Mittlerweile hat Hester einen Küchenstuhl gebracht, und Marty setzt den Hund sanft darauf nieder. Er deckt den Rollwagen auf und enthüllt das Amateurfunkgerät aus der Bibliothek mitsamt Kopfhörern und einem verchromten Mikrophon.
»Wie der Zufall es will, sendet Sputnik 2 das gleiche Signal wie Sputnik 1, wenn ich also die richtige Frequenz finde, sollten wir die Russentöle hören können, wie sie über uns um die Erde kreist. Meinen Funkerkollegen in Chicago zufolge müsste das Signal ungefähr jetzt in Reichweite sein …«
Marty schaut auf die Uhr und schiebt Carraway auf seinem Stuhl näher an das Mikrophon heran. »Ich will Carraway seine Rivalin hören lassen, vielleicht rüttelt ihn das ein bisschen auf. Im Dezember kriege ich ihn kaum zu seiner Runde im Park.«
Das trägt ihm ein paar höfliche Lacher ein.
Rachel sieht unter ihren Gästen umher. Die Frauen lächeln über Carraway, der an dem Metallnetz über dem Mikrophon schnuppert. Die Männer sind skeptischer und raunen sich Bemerkungen zu. Marty erweckt den Apparat zum Leben, drückt Knöpfe, dreht an der großen Skalenscheibe in der Mitte. Ein kurzes Knistern ertönt, dann ein paar versprengte Nachrichtenfetzen aus Kanada und zwei, drei Takte Polka, bevor sie endlich das Signal auffangen – ein hohles, unterseeisches Piepsen. Das Geräusch schmerzt beinahe in den Ohren, ein unirdischer Fiepton, in dem eine stumme sowjetische Bedrohung mitzuschwingen scheint.
»Hört ihr es?«, sagt Marty. »Das sind sie.«
Die Gäste sind näher herangetreten, die Männer ganz gebannt jetzt, sieht Rachel, ihre Zigarren vergessen in den lose herabhängenden Händen. Eine volle Minute lang lauschen sie dem Signal. Dann schließt Marty die Kopfhörer an und setzt sie Carraway auf, nachdem er den Ton leiser gestellt hat. Der Beagle zuckt zusammen und bellt. Marty erklärt der Versammlung, dass das Mikrophon ausgeschaltet ist, dass es ihm nicht erlaubt ist, den Hund unter seiner Kennung bellen zu lassen, dass er dafür aus der Amateurfunkergemeinschaft ausgeschlossen werden würde, aber dessen ungeachtet feuern schon bald erste Gäste Carraway an, es dem Russki-Köter zu zeigen. »Sag ihm, wir sind ihnen dicht auf den Fersen«, ruft einer der Partner. Marty tut so, als würde er das Mikrophon aufdrehen, und über dem ganzen Trubel beginnt der Hund zu bellen und zu jaulen. Schließlich belohnt Marty ihn mit einer aus der Schale gelösten Garnele von einem Tisch in der Nähe und lässt ihn wieder nach drinnen trotten, und alle klatschen dem kleinen Patrioten Beifall. Marty bringt einen Toast auf die Raumfahrt und den aufsteigenden Stern Amerikas aus. Rachel wendet sich um, und über den Rand ihres Glases sieht sie die Miet-Beatniks durch die Flügeltüren auf die Terrasse treten, dicht gefolgt von der händeringenden Hester. Sie kann sich Hart Hanovers Verwirrung unten am Empfang vorstellen, den Anruf über die Haussprechanlage, den Hester entgegengenommen hat, und jetzt wohnt sie dem Einzug der Beatniks bei, Amerikas Antwort auf die kosmischen Aspirationen der Russen. Bärtige, BH-lose, barfüßige Freiheit. Sie sind zu sechst, drei Männer und drei Frauen. Einer der Männer, marxistischer Poet oder vegetarischer Philosoph, wirkt aufrichtig entrüstet über den Anblick, der sich ihm hier auf der Dachterrasse bietet.
Die Beatniks halten sich an die Ränder der Menge – stoßen Gespräche über Kunstausstellungen in aufgelassenen Umspannwerken an, über Pfannkuchenpartys in spartanischen Lofts in der Thompson Street. Anfangs sind sie handsam genug, und selbst Marty muss zugeben, dass es eine schlaue Idee war. Die Frauen in ihren flachen Sandalen trinken Rotwein und tanzen exotisch vor dem offenen Kamin. Eine bringt der Gattin eines Partners Fandango bei, und das Quartett ist auf die Terrasse zurückgekehrt und improvisiert. Die bärtigen Männer in ihren Kordjacken und Kolanis verwickeln die Manhattaner in Diskussionen, legen ein ethnologisches Interesse an den Ritualen dieser dekadenten, geldigen Nordstaatler an den Tag. Sie schmeicheln, pflichten bei, lachen leise über das nervöse Gewitzel eines Zahnarzts. Eine Frau mit Drachenohrringen tauscht mit einem Anlagenbankier die Visitenkarten, aber auf ihrer steht nur ein Wort geprägt: Wehe. Die erste Viertelstunde hindurch sind alle ganz hin und weg von diesem raffinierten Partygag, und Marty schiebt sich von hinten an Rachel heran und flüstert ihr zu, dass ihr da eine sehr schöne Überraschung gelungen ist. Doch dann merkt er plötzlich, dass drinnen im Wohnzimmer einer der Männer – mit roter Baskenmütze und alter Armeejacke – ein Grüppchen Gäste beim Wickel hat. Von seinem Platz auf der Terrasse aus kann Marty ihn sehen, wie er auf einem antiken Stuhl vor seiner leicht erschrockenen Zuhörerschaft steht und die Obstschale der de Groots in die Höhe hält. Marty hat die Flügeltür schon fast erreicht, da vertritt ihm Wehe mit einem randvoll mit Shrimps beladenen Teller den Weg. Warum haben die Kellner die Vorspeisen nicht längst aus dem Verkehr gezogen? Sollen sich diese Künstlertypen jetzt hier auf seiner Dachterrasse auch noch eine Lebensmittelvergiftung holen? »Mein richtiger Name ist Honey«, sagt die Frau, »und ich habe vor, mein Körpergewicht in Krustentieren zu essen. Sie müssen der Gastgeber sein. Schön, Sie kennenzulernen, Gastgeber!« Sie ist angetrunken und barfuß; ihr langer Rock sieht aus wie aus alten Amish-Quilts zusammengeflickt. Marty schenkt ihr ein dünnes Lächeln und versucht zu erkennen, was in der Wohnung vor sich geht.
»Was zum Teufel macht Ihr Freund da auf dem Stuhl?«, fragt er sie.
»Benji? Ach, der hat sich mit Benzedrin zugeknallt. Wenn Sie nicht aufpassen, vögelt der Ihnen glatt die Obstschale.«
Marty fühlt seine Bewegungen steif werden vor Widerwillen. Die spanische Musik ist durchsetzt mit Lachsalven und Olés, als er sich seinen Weg nach drinnen bahnt und nach rechts abschwenkt.
»Sehen Sie diese Williamsbirne, Ladies und Gents, saftig und triefend vor Sinnlichkeit, die sich da mit einem Red Delicious gemein macht … Sie wartet nur darauf, ihrer Bestimmung zugeführt zu werden.« Der Mann nimmt die Birne aus der Schale, führt sie an den Mund und beißt hinein, dass das Fruchtfleisch nach allen Seiten spritzt.
»Entschuldigen Sie, aber ich glaube, das reicht«, sagt Marty.
Der Mann schaut herrisch auf ihn herab, sein Bart übersät mit Birnenstückchen. Marty kennt sich mit Amphetaminen nicht aus, aber er erkennt einen Geistesgestörten, wenn er einen sieht – der Kerl hat Pupillen so groß und so blank wie Pennys.
»Ist der da der Obermacker hier?«, fragt der Mann sein Publikum.
»Ich kann auch die Polizei holen«, sagt Marty. Er spürt, wie immer mehr Gäste von der Terrasse hereinkommen und sich schweigend hinter ihm sammeln, um Zeuge der Szene zu werden.
Voller Verachtung schüttelt der andere den Kopf. »Du zahlst für diesen Spaß, Sportsfreund. Du dachtest, die Clownstruppe rückt hier an, nippt ein paar Schlückchen von deinem Champagner, sagt ein paar Gedichte übers Trampen und Wild-Campen auf und zieht dann brav wieder ab. Irrige Annahme, Amigo. Zu kurz gedacht, Compadre. Das Skript gilt nicht mehr. Wir sind jetzt Gäste in deinem Beau-Monde-Museum: deine dunkle Seite, die Dämonen, die dich dein ganzes jämmerliches Leben lang verfolgt haben. Jetzt stehen sie vor dir, Bruder. Sehr erfreut.«
Neben Marty ist Honey aufgetaucht, die immer wieder »ganz ruhig« sagt, als spräche sie zu einem durchgehenden Pferd.
»Ihre Heimfahrt übernehmen natürlich wir«, tönt Rachels Stimme aus der Menge. »Wir setzen Sie jetzt alle schön ins Taxi, und ein Essenspaket bekommen Sie auch mit.«
Angesichts solcher Herablassung verfällt der Mann auf dem Stuhl in Zuckungen wie ein Straßenprediger, der die nahende Apokalypse verkündet. »Ich werd nicht mehr! Wir wollen eure verdammten Brosamen nicht, Lady Macbeth. Wir sind nicht auf eure Häppchen aus oder auf euren Wein, wir sind hier, weil Amerika drauf und dran ist, den Schwanz von Onkel Russki zu lutschen, und wir euch zeigen wollen, wie so ein dicker roter Kommunistenpimmel von nahem aussieht …«
In diesem Moment drängt sich Clay Thomas durch die Zuschauermenge. Im Rückblick wird Marty denken, dass er nicht erzürnter schien als jemand, der aus seinem Mittagsschlaf gerissen worden ist. Er wirkt verärgert, aber in keiner Weise zu Gewalt aufgelegt. Im Gehen zieht er sein Jackett aus, knöpft die Manschetten auf und krempelt die Ärmel hoch, als wollte er sich an den Abwasch machen. Aber als ehemaliger Weltergewichtsboxer für Princeton ist Clay sowohl standfest als auch flink. Marty will ihn gerade fragen, ob sie die Polizei rufen sollen, da hat er plötzlich die Smokingjacke seines Chefs in der Hand. Ohne einen Blick in das Gesicht des Störenfrieds tritt Clay hinter den Stuhl und kippt ihn mit einem Ruck nach vorn, so dass der Mann abspringen muss. Die Obstschale fällt zu Boden, Äpfel und Birnen kullern unter die Möbel.
»Spinnst du jetzt, Alter?«
Clay versetzt ihm einen kurzen Stoß vor die Brust. »Zeit zum Nachhausegehen.«
Einen Moment hält der Mann in der Baskenmütze die Stellung, Augen nach hinten verdreht, Arme schlaff herabbaumelnd. Was wird er tun – Clay eine antike Vase über den Schädel braten oder in deliriöser Panik davonstürzen? Beides scheint gleichermaßen im Bereich des Möglichen. Honey und die anderen Beatniks haben sich im Flur versammelt und rufen mit klagenden Stimmen nach ihrem Genossen.
Rachel sagt: »Die Polizei ist unterwegs.«
Das bedenkt er eine Weile, begrübelt es durch den Nebel in seinem Kopf. Dann endlich lässt er sich auf die Hacken zurückfallen und macht kehrt, schlurft hinter seinen Kumpanen den Flur entlang. Clay folgt ihnen die Stufen hinunter. Marty ruft bei Hart Hanover durch und bittet ihn, sicherzustellen, dass die Eindringlinge das Gebäude auch wirklich verlassen, wenn sie im Hauptfoyer ankommen. Nachdem Clay sich noch vergewissert hat, dass sie in dem privaten Aufzug im elften Stock verschwunden sind, wird er oben mit lautem Beifall empfangen. Marty klatscht mit, aber er fühlt sich bloßgestellt und düpiert. Er hat soeben mit ansehen müssen, wie sein sechzigjähriger Chef die Beatniks hinausgeworfen hat wie eine Horde Teenager, die bei einer Matinee stören. Und was noch mehr schmerzt: Rachel hat auch noch bezahlt für diese Blamage, hat angerufen und sie herbestellt wie den Zimmerservice.
Clay steht neben Marty und knöpft sich die Manschetten wieder zu. Er nimmt ihm die Smokingjacke ab und zieht sie an. »Wer sich Löwen zum Essen einlädt, der kassiert manchmal Bisse«, sagt er.
Marty weiß, die souveräne Reaktion wäre es, Clay für sein Durchgreifen zu danken, aber das bringt er nicht fertig. Er schaut dem Ehepaar Thomas nach, als die beiden zur Tür gehen. Noch weitere Gäste nutzen die Gelegenheit, sich zu verabschieden. Rachel ist nirgends zu sehen, die Aufbrechenden müssen mit der verdrossenen Hester vorliebnehmen, die mit abgewendetem Blick die Mäntel ausgibt. Als auch die Letzten gegangen sind, steht Marty einen Moment da, den Rücken an die Lifttür gelehnt. Hester wünscht ihm eine gute Nacht, und er steigt die Treppe hinauf, tastet sich durch den dunklen Flur ins Schlafzimmer. Erst als er sich schon ausgekleidet hat und nackt in dem Lichtstreifen steht, der vom Bad hereinfällt, empfindet er den Tag vollends als grausamen Scherz. Rachel hat sich zur Wand gedreht und stellt sich schlafend. Alles in Marty vibriert noch immer vor Demütigung, bis hinein in die Fingerknöchel, die Zähne. Er starrt empor zu dem Gemälde, hofft auf die beschwichtigende Kraft dieser frostigen Stille. Wie zerbrechlich das Mädchen ist, in seiner Schwebe zwischen Wald und vereistem Fluss. Die Gesichter und Hände der Schlittschuhläufer glühen rot vor Kälte. Beim Anblick des Hundes, der über das Eis springt, dem Jungen nachjagt, fällt ihm die russische Promenadenmischung in ihrer Raumkapsel wieder ein. Er wird erst mit großer Verspätung erfahren, dass das Tier kurz nach seinem Austritt aus der Atmosphäre verendet ist, dass der hohe Druck und die Temperaturen zu viel für es waren. Er wird zurückdenken an diesen toten Weltraumforscher und die offen an der Wand hängende Fälschung, und seine eigene Naivität wird ihm als fast schon grotesk erscheinen. Im Moment sieht er immerhin, dass das Bild leicht schief hängt, die rechte untere Ecke ein paar Zentimeter tiefer als die linke. Er rückt es gerade, dann knipst er das Badezimmerlicht aus und steigt ins Bett.
Amsterdam / Berckhey
Frühjahr 1636
Während ihr Leben immer mehr aus den Fugen gerät, werden Saras Gedanken hartnäckig zu dem Leviathan zurückwandern. Er ist nicht die Ursache von Kathrijns Tod und all dem, was folgt, aber er ist das Omen, das ihre Tage verdüstert. Ein Sonntag im Frühling, der Himmel blau und wolkenlos. Es hat sich herumgesprochen, dass im sandigen Flachwasser vor Berckhey, einem Fischerdorf nahe Scheveningen, ein Wal gestrandet ist. Die Dorfbewohner haben ihn mit Seilen an den Strand gezogen, wo er nun schon den dritten Tag liegt und durch sein ledriges Blasloch ächzt. Eimerweise haben sie seinen Rumpf mit Meerwasser übergossen, um sein Sterben hinauszuzögern, bis Wissenschaftler und Gelehrte ihre Begutachtung des Untiers abschließen konnten. Für Saras Ehemann, einen gelernten Landschaftsmaler, ist dies die seltene Gelegenheit, einmal ein echtes Spektakel in allen Einzelheiten auf die Leinwand zu bannen. Auf den Frühjahrsmärkten floriert der Handel mit Gemälden, und solch ein Bild wird gewiss einen guten Preis erzielen. Auf dem sandigen Fahrweg zum Meer muss Sara jedoch erkennen, dass halb Amsterdam zur Küste pilgert, um sich diesen Herold aus der Tiefe anzusehen. Barent wird es mit vielen anderen Zeichnern, Malern und Kupferstechern aufnehmen müssen. Obwohl Sara ebenfalls Mitglied der St.-Lukas-Gilde ist, geht sie ihrem Mann doch häufig bei seinen Landschaftsbildern zur Hand, reibt Pigmente für ihn an, bereitet die Untergründe vor. Barents Seestücke und Grachtenbilder sind bei Bürgermeistern und Kaufleuten beliebt; sie bringen das Doppelte von dem ein, was Sara für ein Stillleben bekommt.
Ihr Malwerkzeug und einen Weidenkorb mit Brot und Käse zu ihren Füßen, fahren sie hinten im Karren eines Nachbarn mit. Kathrijn ist sieben und ausstaffiert wie für eine Seefahrt – gebundene Haube, festes Schuhwerk und ein Kompass, der an einer Kette um ihren Hals hängt. Während sie der Karawane aus Pferdekarren und Reitern in den Polder hinausfolgen, zu den grasbewachsenen Dünen, beobachtet Sara verstohlen die Miene ihrer Tochter. Als Barent mit den Gerüchten über den Leviathan aus der Schenke heimkam und von seinem Plan sprach, das gestrandete Tier malen zu wollen, hat sich eine Düsternis über Kathrijns Züge gelegt, weniger Furcht als vielmehr eiserne Entschlossenheit. Seit Monaten wird sie von Alpträumen und Bettnässen geplagt, von Schreckensphantasien im Morgengrauen. »Das muss ich auch sehen, Vater«, sagte sie drängend. Barent versuchte das Thema zu wechseln, das sei kein Ausflug für ein Mädchen, sagte er. Eine halbe Stunde lang schien es, als wäre die Sache damit erledigt. Doch dann lehnte sich Kathrijn beim Abendessen zu Sara hinüber und flüsterte ihr ins Ohr: »Ich will sehen, wie das Ungeheuer stirbt.« So grimmig dieser Vorsatz aus dem zarten Mund ihrer Tochter klang, Sara konnte ihn verstehen. Ein Ungeheuer war aus den Tiefen der Nordsee an Land gespült worden, um, von Seilen und Trossen gehalten, vor aller Augen zu verenden. Sämtliche Heimsuchungen der Nacht, die Dämonen und Schreckgespenster, die Kathrijn seit Monaten den Schlaf raubten, könnten an einem einzigen Nachmittag vertrieben werden. Sara tätschelte ihrer Tochter die Hand und beugte sich wieder über ihre Suppenschale. Zur Schlafenszeit dann sprach sie mit Barent darüber, und schließlich willigte er ein.
Als freilich der letzte Hügelrücken den Blick auf die Küste freigibt, ist Sara sicher, dass die Unternehmung ein schrecklicher Fehler war. Aus der Ferne wirkt der Wal wie ein schwärzlich glänzender Balg, den man zum Ausdörren an die Sonne gelegt hat. Trauben von Menschen umwimmeln ihn, die neben seiner Masse wie Zwerge wirken. Einige Männer haben mit Messbändern und Holzeimern die gewaltige Flanke erklommen. Eine Leiter lehnt neben einer der zuckenden Flossen, die so breit ist wie das Segel eines Schiffes. Als der Karren das letzte Wegstück zum Strand hinabrollt, erzählt ihnen Clausz, ihr Nachbar, von dem in Branntwein eingelegten Walauge, das er auf See einmal gesehen hat: »So groß wie ein Mannskopf. Lag beim Kapitän unter einer Glasglocke, zusammen mit all den andern Merkwürdigkeiten, die er aus den südlichen Breitengraden mitgebracht hatte.« Sara sieht, wie Kathrijns Augen sich weiten, und streicht ihr die Haare hinter die Ohren. »Vielleicht können wir zwei ein Picknick machen, während Vater malt«, schlägt sie vor. Kathrijn beachtet sie gar nicht, sondern beugt sich zu Clausz vor, der auf dem Kutschbock sitzt. »Wie kommt es, dass sie überhaupt an Land getrieben werden?« Der Nachbar nimmt die Zügel auf und lässt sich Zeit mit der Antwort. »Manche sehen darin ein Zeichen des Allmächtigen, ein Orakel. Ich würde eher meinen, das Vieh hat sich einfach verirrt. Wenn das einem Schiff passieren kann, warum dann nicht auch dem Fisch, der Jona in einem Stück verschluckt hat?«
Sie fahren auf den flachen Sandrücken hinaus, binden die Pferde an einen Baumstumpf und wandern mit Sack und Pack zum Ort des Geschehens. Mit Decken und Körben bereiten sie sich ein Lager. Barent setzt seine Staffelei und den Spannrahmen zusammen. Er hat Sara gebeten, neben ihm zu arbeiten und Pigmente anzureiben; sie selbst wird ebenfalls einige Skizzen anfertigen, die daheim in der Werkstatt zum Einsatz kommen werden. »Ich denke, ich male vom Saum des Wassers aus, vielleicht mit dem Kopf der Bestie im Vordergrund.« Eine gute Idee, stimmt Sara zu, obwohl sie glaubt, dass eine Perspektive von oben wirkungsvoller wäre – der von ameisengleichen Städtern belagerte Koloss, die in der Mittagssonne verkürzten Schatten, all das vor die spiegelnde Weite des Meeres gesetzt. Auf diese Weise könnte Barent zudem bis zur Dämmerung zeichnen und die letzten Eindrücke im schwindenden Tageslicht festhalten. Allerdings hat sie wiederholt die Erfahrung gemacht, dass Barent es vorzieht, wenn sie ihre Einfälle in den Dienst der seinigen stellt, deshalb sagt sie nichts.
Während Barent sich einen Platz zum Malen sucht – keine vier Meter vom nächsten Künstler entfernt –, gesellen sich Sara und Kathrijn zu der umstehenden Menge. Der Geruch von Verwesung und Amber liegt in der Luft, ein süßlich-fauliger Gestank. Kathrijn hält sich die Nase zu und greift nach Saras Hand. Sie ernten ein paar missbilligende Blicke von den Männern mit Lederschürzen, die mit ihren Messstäben und Gewürzbüchsen am Werk sind. Einigen Gesprächsfetzen, die sie aufschnappt, entnimmt Sara, dass ein Vertreter der Rechenkammer Anspruch auf das Tier erhoben hat und den Kadaver versteigern will. »Bei dieser Sonne sind die Gedärme des Untiers bis morgen Mittag geplatzt, dann entladen sich hier Schwaden von Pestgestank«, hört sie. Den Tran wird man an die Seifensiedereien verkaufen, die Zähne für Schnitzereien verwenden, das aus dem Darm gewonnene Unguentum zur Herstellung schwerer Parfums nach Paris exportieren. Ein rotgesichtiger Kerl mit einem Diarium in der Hand führt mit einem Kollegen einen Disput über die Länge des Unaussprechlichen dieser höllischen Ausgeburt; ihre Schätzungen liegen um zwei Zoll auseinander, bei einer Mindestlänge von drei Fuß. Sie debattieren mit wissenschaftlicher Offenherzigkeit und werfen mit Bezeichnungen wie Penis und Begattungsrute nur so um sich. Sara ist froh, dass Kathrijn von der Unterhaltung nichts mitbekommt – unter der Krempe ihrer Haube hervor betrachtet sie den massig aufragenden Rumpf, gefangen, vermutet Sara, im Strudel ihrer eigenen nächtlichen Visionen.
Die Schwanzflosse ist so breit wie ein Fischkutter und mit Fliegen, Seepocken und grünlichen Parasiten übersät. Der Wal liegt leicht gekrümmt, wie eine schlafende Katze; ehe sie sichs versehen, sind Mutter und Tochter in die faulig riechende Nische mit dem umstrittenen Monster-Phallus spaziert. Mit ihrer hellen Stimme sagt Kathrijn: »Sieh mal, da klebt ein Riesenblutegel an seinem Bauch«, was bei den Männern in der Nähe grölendes Gelächter auslöst. Sara fasst Kathrijn bei den Schultern und lotst sie in Richtung Kopf. Ein Dörfler fragt, ob sie der Bestie für drei Stuiver pro Person ins Auge blicken wollen. Er hat eine Leiter an den Kieferknochen gelehnt und sie fest in den Sand gerammt. Kathrijn sieht ihre Mutter flehend an. »Du kannst hinaufsteigen, mir ist die Aussicht von hier unten lieber«, sagt Sara. Sie bezahlt den Mann und schaut zu, wie Kathrijn langsam die Leiter emporklettert. Sara stellt sich den Abglanz der Verwirrung am Grund des Auges vor, den Blick des ohnmächtigen Räubers aus der dunklen Höhle seines Schädels und Geistes. Sie stellt sich vor, wie Kathrijn ehrfürchtig in den Abgrund dieses Auges schaut und im Frieden mit den Spukbildern ihrer Träume die Sprossen wieder heruntersteigt. Doch Kathrijns schleppender Aufstieg, ihre verkrampfte Haltung, als sie sich über den Augapfel beugt, deuten eher auf ein Sühneopfer hin. Mit verschleiertem Blick starrt sie in das Walauge, lange, ehe sie zögernd wieder auf den Sand herabsteigt und sich weigert, auch nur ein Wort über das Gesehene zu verlieren.
Der restliche Nachmittag vergeht mit Zeichnen und Malen. Sara kniet auf einer Decke neben Barent, bereitet für ihn Pinsel und Pigmente vor, sieht zu, wie er Übergänge von durchscheinendem Grün zu Grau anlegt und ockergelbe Schlieren hineintupft, um das veränderte Licht einzufangen. Von seiner Arbeit geht etwas Geheimnisvolles, Forderndes aus, eine Intensität, wie sie der eingeschränkte Blickwinkel ihrer Stillleben Sara nie abverlangt. Mehrere Stunden arbeiten sie so, neben sich Kathrijn, die ihr eigenes Skizzenbuch vollmalt, Seite um Seite mit Blättern, Muscheln und Pferden bedeckt. Barent und Sara wollen nicht zugegen sein, wenn das Tier schließlich verendet oder seine Eingeweide zerspellen, daher verabreden sie mit Clausz, sich deutlich vor Einbruch der Dämmerung auf den Weg zu machen. Barent hält noch so viel wie möglich von der Landschaft und dem Licht fest; die Detailarbeit an dem Wal selbst wird er in der Werkstatt anhand von Saras Skizzen ergänzen. Währenddessen unternimmt Kathrijn, Stöckchen und Wildblumen in den Händen, kleine Streifzüge zum Uferrand. Nachdem sie mehrmals hin und her geeilt ist, sieht Sara, dass ihre Tochter ein winziges Holzfloß zusammengezurrt hat, das sie behutsam mit ein paar Zweiglein blühenden Heidekrauts schmückt. Nicht unbedingt ein Scheiterhaufen, aber etwas, das dem Wal ein Denkmal setzen oder Kathrijns Schreckensbilder mit sich davontragen soll. Der unbeirrte Aberglaube Siebenjähriger verblüfft Sara immer wieder. Keine zehn Meter weiter streiten die Dörfler darüber, welche Art von Unglück der angeschwemmte Wal denn nun ankündigt, Sturmflut, Hungersnot oder ein Feuer, das Berckhey bis auf die Grundmauern niederbrennen wird. »Gott beschütze unser geliebtes Vaterland vor dem Bösen«, murmelt einer der Fischer immer wieder.
Auf der Fahrt zurück in die Stadt herrscht weniger Betrieb. Eine Stunde von Amsterdam entfernt machen sie am Rand eines kleinen Dorfes halt, um Proviant einzukaufen. Eine Bauersfamilie hat an der Straße einen Stand mit Bergen von Stockfisch, Äpfeln und Käse aufgebaut. Ein magerer Junge etwa in Kathrijns Alter geht seinen Eltern zur Hand. Kathrijn, kühn gemacht durch ihr Tun am Strand, fragt ihre Eltern, ob sie das Geschäft tätigen darf. Barent gibt ihr Geld, und mit dem Selbstbewusstsein eines Ostindien-Kaufmanns steigt sie vom Karren herab. Sie verwaltet das Geld umsichtig, wählt bedachtsam einige Äpfel und Käsestücke aus. Die Bauersfamilie ist von ihrem Ernst so angetan, dass sie ihren Sohn vorschickt, um die Transaktion abzuschließen. Alle weiden sich am Anblick der beiden Siebenjährigen, die so völlig in ihrem Handel aufgehen – sogar kurz darüber schachern, welche Äpfel die reifsten sind. Der einzige Misston sind die kränklichen Augen des Jungen, die eine Spur gelb und schläfrig wirken. Seine Hände sind sauber gewaschen, seine Kleider rein. Dennoch wird Sara sich an seine Augen erinnern.
Es ist einer jener Momente, zu denen ihre Gedanken zurückkehren werden, als Kathrijn drei Tage später zu fiebern beginnt. Bis dahin wird Barent die Walszene bis ins feinste Detail ausgearbeitet haben, von den elfenbeinernen Auszackungen im Maul des Ungetüms bis zu den Lederschnüren am Wams eines Fischers. Kathrijn wird schnell dahinscheiden, in der vierten Nacht, mit schwarz angelaufenen Fingerspitzen, ihre Haut von Beulen überzogen. Hilflos muss Sara zusehen, wie das einzige Kind, das Gott ihr geschenkt hat, dahinschwindet und stirbt. Barent, von Kummer überwältigt, kann über Monate nicht ablassen von dem Gemälde, fügt Figuren und Geschehnisse hinzu, die sie nicht beobachtet haben. Das Bild wird so unheilverkündend und düster, dass sich auf den Märkten kein Käufer dafür findet. Auf der Rundung des gewaltigen Schädels, mit dem Rücken zum Maler, steht eine kapuzenverhüllte Gestalt und treibt ihre Axt in das schwärzlich klaffende Fleisch. Der Himmel ist überladen mit Blei und Kobalt. Sara hört ganz auf zu malen, bis es Winter wird und die Grachten vereisen. An einem blaugrauen Nachmittag sieht sie oberhalb eines zugefrorenen Ausläufers der Amstel ein junges Mädchen durch ein verschneites Dickicht stapfen. Irgendetwas an dem Licht, an der Art, wie das Mädchen aus dem Wald tritt, treibt sie an die Staffelei. Ein Stillleben zu malen ist ihr mit einem Mal unvorstellbar.
Brooklyn
November 1957
Eine Frau im Kittel steht frühmorgens am Herd, reibt Pigmente an und kocht Hasenleim. Für Ellie Shipley ist es 1630, und Leinwand ist nur in der Breite holländischer Webstühle erhältlich – nicht ganz ein Meter vierzig. Sie liest bei Kerzenschein und treibt obskure Zutaten auf, die das Handwerkszeug des Restaurators und des Fälschers gleichermaßen sind. Kaltgepresstes Leinöl, das sich nicht trübt, Spiköl, Lavendelöl, natürliche Siena. Bleiweiß, das einen Monat lang in einer Essigwolke vor sich hin dampft. Sie malt in ihrer Küchennische, wo das Licht zu den schmutzigen Nordfenstern hereinfällt und sie Blick auf den nicht abreißenden Verkehr der Gowanus-Schnellstraße hat. Sie sieht die mit Pendlern besetzten Busse stadteinwärts fahren, Metallbänder mit aufgetupften Gesichtern darauf. Manchmal fragt sie sich, ob diese Hinterglas-Passagiere ihr Behelfsatelier wohl als Nachbild auf der Netzhaut mitnehmen: eine über einen Herd gebeugte Frau, die nicht Tierhäute einschmilzt, sondern die ganz einfach ihr Porridge rührt.
Allein schon der Geruch schränkt ihr Sozialleben ein – diese Verbindung von Oxid und Moschus. Die Wohnung liegt über einem Waschsalon und hat ihr eigenes Wetter, einen tropischen Monsun während der Geschäftszeiten, kühlere, trockene Witterung bei Nacht. Wasserränder zieren die Decken, und in der Ecke über ihrem Bett blüht eine zarte Schimmelborte. Ellie ist im Abschlussjahr ihrer Kunstgeschichts-Promotion an der Columbia University, und in der ganzen Zeit, die sie schon in dieser Wohnung wohnt, hat sie nie jemanden mit nach Hause gebracht. Der Weg zur Universität ist weit, aber sie hat die Wohnung mitsamt der absurd niedrigen Miete von einer anderen Studentin übernommen, die hier in Brooklyn aufgewachsen ist. Trotz der Entfernung hat sie sich nie um eine Adresse in Manhattan bemüht. In ihren übersprudelnden Briefen an ihre Eltern in Sydney gibt sie vor, in Greenwich Village zu wohnen, darum muss sie darauf achten, wo sie ihre Kuverts einwirft. Sie berichtet von Clubs und Restaurants und Ausstellungen, die sie nicht besucht hat. Sie liest die Rezensionen im New Yorker und entnimmt ihnen möglichst schillernde Details. Ihr Vater ist Fährkapitän im Hafen von Sydney, ihre Mutter Sekretärin an der Schule, und sie weiß selbst nicht, ob sie diese Briefe aus Gehässigkeit schreibt, um den beiden die Enge ihres Horizonts vor Augen zu führen, oder ob sie darin einem Leben nachhängt, das ihr entglitten ist. Sie hat die halbe Welt umrundet, denkt sie manchmal, nur um hier in arbeitsreicher Verlotterung zu leben. Ihre Dissertation über die niederländischen Malerinnen des Goldenen Zeitalters liegt unvollendet bei ihr zu Hause; eine angefangene Seite ist noch in die Walze ihrer Remington eingespannt. Sie hat Monate nicht mehr daran geschrieben, und manchmal ertappt sie sich dabei, wie sie auf das stumpfe Profil der Schreibmaschine starrt, auf den verchromten Wagenrücklauf, und denkt: Remington stellt auch Schusswaffen her.
Seit einigen Jahren arbeitet sie nebenbei als Beraterin für Kunstrestaurierung. Die technische Seite der Malerei lag ihr schon immer, und es ist leicht verdientes Geld. Vor dem Kunstgeschichtsstudium hat sie am Courtauld-Institut in London eine Ausbildung zur Restauratorin gemacht. Aber obwohl sie – als jüngste – die begabteste unter den Studenten war, gingen die Museumsaufträge immer an die älteren, männlichen Absolventen mit zopfgemusterten Strickjacken und Oxbridge-Akzent. Dass Ellie Australierin war, machte es nicht leichter für sie. Die Museumskuratoren behandelten sie als ein Kuriosum, eine kleine Exotin aus den Kolonien, die mit einer Stelle als Privatdozentin oder als Restauratorin für eine regionale Sammlung irgendwo in der Provinz zufrieden sein konnte. Und so brach sie mit nicht ganz einundzwanzig in Richtung Amerika und Kunstgeschichte auf, an eine Fakultät, an der zwei Lehrstühle mit Frauen besetzt waren. Nach drei Jahren Promotionsstudium und bestandener Zulassungsprüfung bekam sie von ihrer Doktormutter Meredith Hornsby, Expertin für das niederländische Goldene Zeitalter, die ersten Restaurierungsaufträge zugeschanzt. Sie hatte bei Hornsby einen Stein im Brett, weil sie als einzige Doktorandin nicht über die italienische Renaissance schrieb. Ein britischer Kunsthändler namens Gabriel Lodge war auf der Suche nach jemandem, der die Echtheit alter Meisterwerke bestätigen und sie ein wenig ausbessern konnte.
Gabriel Lodge ging mit ihr ein paarmal Tee trinken und ließ sich Fotos ihrer Arbeiten zeigen. Er war Exil-Londoner, ein Mann mit einer einstmals vielversprechenden Karriere bei Christie’s, einem verknitterten, mottenbraunen Anzug und einem abgewetzten Aktenkoffer, der aussah, als hätte er in grauer Vorzeit einem Diplomaten gehört. Er kam ihr reichlich verworren und zerstreut vor, aber zwischendurch fing er bei einer Frage oder einer Formulierung Feuer, und sein Blick schnellte zurück zu ihrem Gesicht. Seinen Earl Grey vor sich, verhörte er sie über die Fadenzählung bei Barockleinwänden und Rezepte für Grundierungen und Malschichten. Er summte und wiegte den Kopf und studierte ihre Fotos mit der Lupe. Offenbar bestand sie diese Teestuben-Prüfungen, denn nur wenige Wochen später fand sich ein schadhaftes Gemälde aus dem siebzehnten Jahrhundert bei ihr ein.
Manchmal kamen die Gemälde zu ihr, manchmal ging sie zu ihnen. Sie unterzeichnete Geheimhaltungserklärungen und wurde zu privaten Sammlungen in Manhattan, Long Island und Connecticut chauffiert. Lange Nachmittage stand sie mit ihrer Holzkiste voll Pigmenten, Ölen und Pinseln in üppigst ausgestalteten Räumen und arbeitete auf ein paar Quadratzentimetern Leinwand im Stil und mit den Farben eines anderen Malers. Oder ein Bote lieferte ein verwahrlostes holländisches oder flämisches Porträt bei ihr ab, und sie verbrachte Wochen damit, es instand zu setzen, die brüchig gewordene Leinwand neu zu hinterlegen oder Grundier- und Farbschichten auszubessern. Teilweise zahlte man ihr Hunderte für einen einzigen Tag, aber sie konnte mit dem Geld nichts anfangen. Sie hätte die Arbeit mit Freuden umsonst gemacht, darum erschien es ihr unredlich verdient. Die Dollars fühlten sich für sie außerdem wie eine Kompensation für all die Jahre der Nichtbeachtung durch die Herren am Courtauld-Institut an. Sie auszugeben hätte ihre Macht verwässert.
Zu dem Zeitpunkt, als Gabriel mit dem Auftrag für Am Saum eines Waldes zu ihr kam, hatte sie fast zehntausend Dollar angespart, so dass sie das Geld eigentlich nicht brauchte. Der derzeitige Besitzer wolle eine exakte Kopie anfertigen lassen, so Gabriel, könne sich dafür aber nicht vom Original trennen. Sie reagierte skeptisch, erwiderte, ein Kunstwerk zu kopieren sei etwas anderes, als es zu restaurieren. Als er jedoch drei gestochen scharfe Farbfotografien des Gemäldes mitsamt Rahmen vor sie hinlegte, stockte ihr der Atem – es war anders als jedes andere Gemälde einer Barockmalerin. Vor ihr lag eine Winterlandschaft mit der bläulich grauen Atmosphäre eines Avercamp – die zarten Grau- und Blau- und Rosttöne, die schlittschuhlaufenden Bauern in der schleirigen Dämmerung über dem Eis –, aber an dem Baum vorne lehnte diese einsame, verlorene Gestalt. Sie war Zuschauerin und gleichzeitig Blickfang, der Fokus des gesamten Bilds. Das hier war kein munteres Dorftreiben vor Einbruch der Nacht, ein gängiges Motiv bei Avercamp, es war ein Moment des Nicht-hier-und-nicht-Dort: ein Mädchen, gefangen in immerwährendem Zwielicht. Sie war mit feinsten Pinselstrichen gemalt, der Saum ihres Kleides ausgefranst in wohl hundert Farbfädchen, jedes nur halb so breit wie ein Menschenhaar. Die Anmutung des Werks, selbst auf den Fotos, war leuchtend und gedämpft zugleich. Es vereinte die andachtsvolle Sammlung mancher Marienbilder mit der Umwölktheit einer italienischen Allegorie.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.