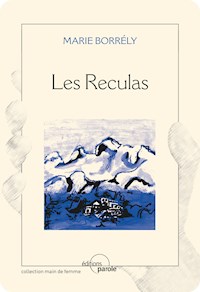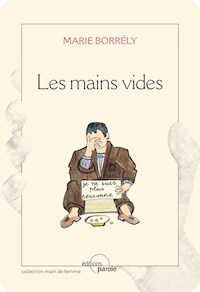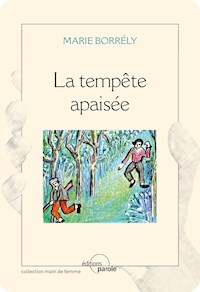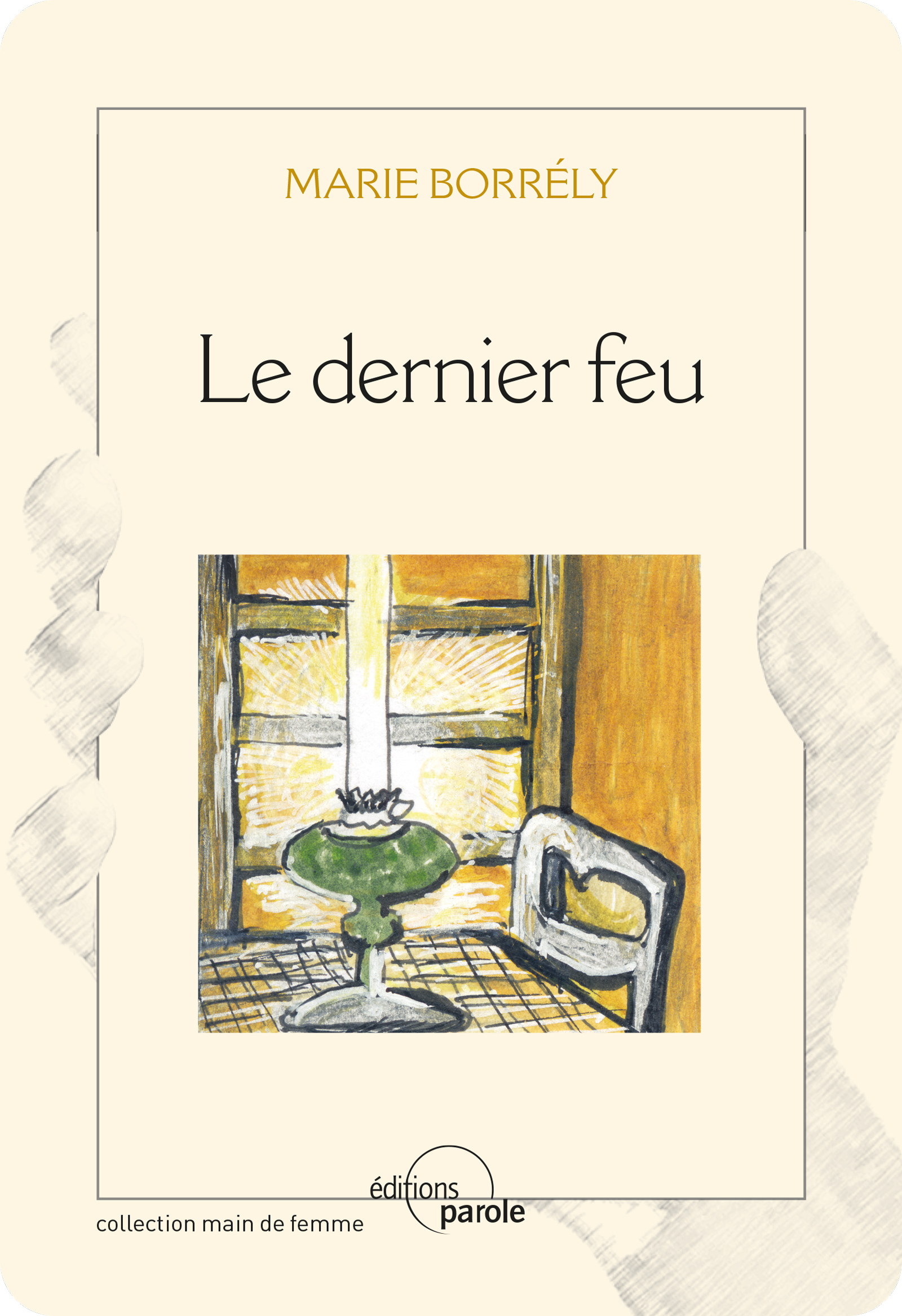Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pélagie Arnaud will ihr altes Dorf nicht verlassen. Obwohl ihre Enkelin Berthe und alle anderen längst ins fruchtbare Tal gezogen sind.Im Bergdorf Orpierre-d'Asse hat man sich längst daran gewöhnt, am Hungertuch zu nagen und den Kindern, statt Äckern und Weinbergen, Steine zu hinterlassen. Doch als der reißende Fluss eingedeicht wird, locken seine fruchtbaren Auen eine Familie nach der anderen hinunter ins Tal. Nur die halsstarrige alte Pélagie mit ihrer kleinen Enkelin Berthe, der Ziege und den Hühnern will davon nichts wissen. Kein Deich, sagt sie, kann die Asse zähmen, und ihre feuchten Nebel machen krank. Unterdessen gedeiht im Tal das neue Dorf, bis eines Tages die Asse wieder anschwillt...Ein fehlendes Puzzlestück der Weltliteratur, aus dem Französischen in grandioser Übersetzung von Amelie Thoma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIA BORRÉLY wurde 1890 in Marseille geboren und lebte ein Leben zwischen Aufbruch und Rückzug. »Das letzte Feuer«, der zweite von insgesamt vier Romanen, erschien 1931 auf Empfehlung von André Gide bei Gallimard, wie schon ihr Roman »Mistral« ein Jahr zuvor. Maria Borrélys literarisches Talent entfaltete sich in der Künstler-Gruppe um Jean Giono, die in den dreißiger Jahren in der Haute-Provence eine kurze intensive Blüte erfuhr.
AMELIE THOMA übertrug u. a. Werke von Leïla Slimani und Simone de Beauvoir sowie »Mistral« von Maria Borrély. Zuletzt übersetzte sie »Die Postkarte« von Anne Berest.
Im Bergdorf Orpierre-d’Asse hat man sich längst daran gewöhnt, am Hungertuch zu nagen und den Kindern, statt Äckern und Weinbergen, Steine zu hinterlassen. Doch als der reißende Fluss eingedeicht wird, locken seine fruchtbaren Auen eine Familie nach der anderen hinunter ins Tal. Nur die halsstarrige alte Pélagie mit ihrer kleinen Enkelin Berthe, der Ziege und den Hühnern will davon nichts wissen. Kein Deich, sagt sie, kann die Asse zähmen, und ihre feuchten Nebel machen krank. Während das alte Dorf langsam verwildert, gedeiht im Tal die neue Siedlung, einem blühenden Obstgarten gleich. Bis eines Tages Pélagie, die wie ein Hase immer nur mit einem Auge schläft, den Regen auf die Dachziegel prasseln hört und weiß: Die Asse wird über die Ufer treten.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Dieses Dorf, das da oben auf dem abgewetzten Bergrücken mit dem Geröll verschmilzt, ist Orpierre-d’Asse. Gott allein weiß, wie man dort hinkommt. Besonders die Karren.
Für die Tiere ist es eine Plackerei.
André, der Fuhrmann, der einmal alle vierzehn Tage hochfährt, um den Kramladen der Anna zu beliefern, kann ein Lied davon singen. Wer Lust hat, ihn fluchen zu hören, muss ihn nur darauf ansprechen … Das Pferd ist schon vor den ersten Häusern am Ende. Es hat mehrmals angehalten, um Atem zu schöpfen.
Kurz vor dem Dorf sind die beiden schlimmsten Stellen: die Biegung am Heiligenhäuschen, mit der vom Wind geknickten Zypresse, und die an der Eberesche überm Abgrund.
An der ersten angelangt, pfeift der André auf zwei Fingern, und der Clermond Gilly kommt mit zwei Vorspanntieren, rutschend und mit allen vier Eisen Funken schlagend auf den Felsen, die blank sind wie der Rand eines Weihwasserbeckens.
Etwas, das dem kleinen staubigen Sankt Rochus in der Nische hinter dem rostigen Gitter sicher nicht gefällt, sind der Hagel Gotteslästerungen, die Hiebe mit Peitsche und Sesel, die auf das Gespann niedergehen. Ein Donnerwetter. Es klingt wie Steinschlag in der Schlucht, und das Echo wirft es zurück … Die Zähne zusammengepresst, bohrt der André die Spitze seines Messers, das er mit blutigem Daumen hält, dem Stangenpferd in den Schenkel, trommelt mit der Faust auf seinen hübschen Kopf, tritt ihm gegen die Fessel, nähert sich dann dem Ohr, in das er hineinbeißt, und da legt sich das Tier noch einmal so energisch ins Geschirr, dass sie im Trab die Stelle passieren, während der Mann Blut und Haare spuckend hinterdrein rennt.
Das Halsgeschirr im Fleisch, die schweißtriefenden schwarzen Kruppen weiß vor Schaum, läuft den drei Pferden der Geifer von den Kandaren, sie straucheln mit weit aufgerissenen, verdrehten Augen, gehen in die Knie.
Der Clermond ist hinten mit einem großen Stein, um, wenn nötig, das Rad zu blockieren.
Ganz zu schweigen davon, dass man die Tiere unmöglich dazu bringt, geradeaus zu laufen: Sie bewegen sich im Zickzack von einem Rand des Wegs zum anderen. Bei der Eberesche, da wo die Schlucht abstürzt, zerren die beiden Männer mit gespannten Muskeln und feuerroten Wangen wie besessen an den Trensen. Die Brust der Tiere hängt ganz überm Abgrund. Es scheint, als wollten sie hundert Meter in die Tiefe springen … Dem André und dem Clermond bricht jedes Mal der kalte Schweiß aus …
In der Gasse ist die Luft weniger frisch als auf dem Weg über den Hügel.
Der André hält vor dem niedrigen, von Fliegendreck getrübten Schaufenster mit seiner immer gleichen Dekoration, dem Geranientopf, den Packungen schwarzer Schnürsenkel, dem Reklameschild für Éclipse-Schuhwichse, der Pâte-de-verre-Zuckerdose in Form eines Pinienzapfens, dem Wasserkrug in Form eines Hahns.
»Ist jemand da oder ist niemand da?«, ruft er, so laut er kann.
Er ist in Schweiß gebadet und mörderischer Laune.
Die Anna, ein altes, dürres Weib, eilt geschäftig herbei. Unter ihrer Bluse zeichnet sich die Korsage ab. Sie hat den fahlen Teint der Krämer, lächelt, so gut sie kann, mit ihren drei Zähnen.
Vom Karren runter wirft der André Seife, Zucker, getrocknete Feigen, Kabeljaupackungen in den Laden. Die Kiste mit Orangen geht entzwei. Die Früchte rollen in alle Ecken des Geschäftes.
Die Anna läuft zwischen dem Karren und der Tür hin und her, stellt die Pakete ab, wiederholt in einem fort:
»André! André!«
Er poltert:
»Was ist? Glauben Sie etwa, das geht ewig so weiter, mit dieser Schinderei? Meinen Sie, ich komm noch lange hier herauf in Ihr elendes Kaff?«
Die heilige Jungfrau bekommt ihr Fett weg, er flucht, schäumt wie ein Wildbach. Die Frauen, die vorbeigehen, scheinen es eilig zu haben.
Als sie fertig sind, besänftigt die Anna ihn mit ihrem alten Obstbrand, den sie ihm im Hinterzimmer in dem kleinen blauen Glas mit dem gesprungenen Fuß serviert, welches sie zwei Mal vollschenkt.
Jedes Mal schiebt sie ihm die Zuckerdose hin, damit er ein Bröckchen in seinen Schnaps tunkt, was er jedes Mal ablehnt.
In der Ecke neben dem kleinen Fenster, die Ellbogen auf den blank gescheuerten Backtrog gestützt, der als Truhe dient, sitzt die Pélagie Arnaud, Annas Schwester, mit ihrer Enkelin Berthe von vier Jahren. Zwischen die Beine der Pélagie geschmiegt, beäugt das Kind den André argwöhnisch.
Die Anna schließt hinter sich die Glastür zum Laden, aus Diskretion und wegen des Luftzugs: Der Mann ist in Hemdsärmeln, das Büschel roter Brusthaare im Freien. Sein Kopf glüht, er badet noch immer in Schweiß. Das Glas zittert in seiner Hand.
Im wilden Duft des Buchsbaums, unterhalb des Dorfes und von weiter oben kommend, liegt gewunden wie eine Schlange dieses Schreckenstal der Terres-Rompues mit dem Riou-Sec, der alles Land der Bewohner von Orpierre-d’Asse gefressen hat.
Riou-Sec – Trockener Bach? Er könnte ebenso gut Wolf oder Geier heißen …
Niemand wohnt hier und niemand kommt vorbei. Außer den Jägern. Wind und Asse rauschen einstimmig. Dazu manchmal das dumpfe Donnergrollen eines weiteren Stücks, das abstürzt …
Mittendrin das gewaltige Trümmerfeld mit seinen in der Hitze sengenden, rundgeschliffenen Steinen, die aufgehört haben zu rollen. Seit Jahr und Tag schon sind Schilf und Binsen vertrocknet. Keine silbrige Espe flimmert hier mehr.
Vier Pappeln, die die Zwergeichen überragen, vergilben und sterben vollends dahin. Eine dicke, noch aufrechte, aber zu drei Vierteln entwurzelte Eiche krümmt Armen gleich fünf mächtige Wurzeln, die nur mehr leere Luft umfangen.
Der Riou hat die Wiese gefressen, die hoch zwischen den großen Felsen hing, mit dem Schuppen und der Einfassung aus Pinien, er hat sich die schrägen Weiden einverleibt, die im Frühling errötenden Pflaumen- und Pfirsichbäume; verschlungen die kugeligen, in die Milde des Südhangs gekauerten Olivenbäume und die alte schwarze Brücke mit dem Rundbogen und die beiden Holzstege, den Brunnen neben den großen Platanen und die Hütte mit dem sonnenversengten Dach unter den Feigen und Weiden.
Und da liegt er nun tot in seinem steinernen Auswurf, der sich unten trichterförmig weitet bis zur tosenden Asse.
In den Nachbardörfern nennt man die Leute aus Orpierre-d’Asse für gewöhnlich die Schmalhänse.
Jeder lebt dort mit seiner Bedrängnis und seinen Schulden. Die Wege ziehen sich. Man schränkt sich ein, so gut es geht. Wer ein Schwein mästet, muss beide Schinken und Schultern hergeben. Man verkauft sämtliche Eier, alle Kaninchen, das Beste von Most, Weizen, Öl.
Sie verwöhnen sich auch nicht mit Worten. Das Wenige, was ihnen über die Lippen kommt, ist bitter wie Absinth. Jedes Jahr sagen sie wieder: Das ist ein schlechtes Jahr!
Der Gerstenacker von den Amable Arnoux’ ist gerade in die Schlucht gestürzt. Auch die Eberesche ist hinunter mitsamt ihrer Scholle. Drei Ölbäume hat es umgerissen.
»Wo die Asse sich schon nach und nach das ganze Maisfeld geholt hat«, sagt der Amable.
»Und aus den Erdäpfeln ist auch nichts geworden, bei der Dürre«, fügt seine Frau hinzu.
»Die Saat ist hin.«
»Wir werden das trächtige Schaf verkaufen müssen, zusammen mit den Zicklein, um das Ferkel und die Steuern zu zahlen.«
»Und wovon zahlen wir den Arzt?«
Nebenan nagen die Trichauds am Hungertuch. Die Séraphine würde Justins Mélie gern das Maß Mehl zurückgeben, das sie ihr schuldet. Die Mélie hat schon zwei Mal danach gefragt.
Die Alten leben fast alle vom Mausen.
Über die Pélagie Arnaud jedoch hat man sich nie etwas erzählt.
»Die brave Frau«, sagt die Mélanie Ricard, »man muss es ihr hoch anrechnen, dass sie die Kleine aufzieht, in diesen Zeiten.«
Die Flavie Roux wagt sich nicht mehr am Haus der Gillys vorbei, weil sie ihnen sechzig Francs schuldet.
»Weißt du«, sagt sie zu ihrem Mann, »es ist kein Vergnügen, zur Anna zu gehen, wir haben viel anschreiben lassen, sie zieht ein Gesicht.«
Noch dazu, obwohl es nur eine Handvoll Häuser hat in Orpierre-d’Asse, verstehen sie sich nicht, sie haben einander gefressen, die Hälfte des Dorfes sieht die andere scheel an. Es gibt nichts als Zank, Hader und Prozesse, denn wenn die Krippe leer ist, streiten die Ochsen.
Das Schlimmste ist der Wassermangel.
Das obere Tal des Riou-Sec ist tot. Die nackte Erde scheint zu klagen, nach Bäumen lechzend, verlangt sie Eichen, Tannen und Zedern, erfleht Zypressen und Lilien … In dieser Heimat rieselnden Sandes ist der Wind infernalisch. Man nennt die Gegend Brama-Fam, Hungerschrei.
In Brama-Fam haben die von Orpierre-d’Asse ihre Quelle. Früher munter wie ein Gespann Ochsen, gibt sie jetzt so gut wie nichts mehr her. Man nennt sie auch die Dreißig Tropfen. Und zu allem Überfluss hat noch der Dominique, der alte Schäfer, immer wieder auf dem Weg von Brama-Fam zum Dorf die tönerne Leitung aufgehackt, um seine Tiere zu tränken. Als sie wie die Wölfe über ihn herfielen, verteidigte er sich:
»Was sollte ich machen? Wenn man nicht mehr ein noch aus weiß, dann kommt man dahin. Ihr hättet es ebenso getan!«
Das Vieh ist rar. Wer zehn Schafe hatte, hat nur noch fünf oder drei.
Sie nutzen den Ginster der Ruinen für Streu und Misthaufen, ästen die Eichen aus, um dem Vieh die Blätter zu fressen zu geben, und diese Bäume am Rand der steinigen Wege, der trockenen Felder oder Schluchten wachsen krumm und knorrig wie Ungeheuer.
Auf der dicken, runden Platte aus schwarzem Nussbaum vergießt die kleine alte Zinnlampe ihr öliges Licht. Es erhellt gerade den Rand des Tisches und den Kamin unter dem breiten Rauchfang. Der Rest liegt im Dunkeln.
Heute essen die Pélagie Arnaud und ihre Berthe nur einen kleinen Happen zu Abend, sie setzen sich gar nicht erst an den Tisch, decken die schweren gelben Steingutteller nicht auf.
Sie sind an die Feuerstelle gerückt, wo widerstrebend ein Eichenast brennt. Man spürt die Wärme nicht, die Fliesen sind eiskalt unter den Füßen.
Nachdem sie das Brot geschnitten hat, tastet die Pélagie im Halbdunkel des Kastens nach den weichen, duftenden Vogelbeeren auf ihrem Strohbett und kommt wieder ans Feuer, um sie mit der Berthe zu teilen.
Die Kleine beginnt mit den Beeren, dann hält sie der Pélagie ihren harten Brotkanten unter die Nase und sagt:
»Das ist verschimmelt.«
»Weißt du denn nicht, dass man Groschen findet, wenn man schimmliges Brot isst?«
Die Alte hat für sich selbst nur ein kleines Stück zurückbehalten. Um den Hunger zu narren, kaut sie lange auf jedem Bissen, bis er süß schmeckt.
Sie bückt sich, um ein Bröselchen aufzuheben, das die Berthe hat fallen lassen.
»Alle Brosamen, die wir verlieren, müssen wir, wenn wir einmal tot sind, mit den Augenlidern auflesen …«
Jetzt bindet sie der Kleinen das gestrickte, wollene Häubchen, das die Ohren gut bedeckt, fest um den Kopf.
»Gehen wir zum Sosthène?«
Vor dem Hinausgehen vergisst Pélagie nicht, das glimmende Eichenscheit aus dem Feuer in den Wassereimer zu tauchen, wo es zu singen anfängt.
Draußen ist es nicht kalt, doch der Himmel ist trüb, Feuchtigkeit liegt in der Luft. Die Sterne glänzen nicht.
Man meint Wind zu hören … einen starken, gleichmäßigen Wind, doch es ist nur das beständige Rauschen der Asse.
Die Küche vom Sosthène Ricard ist groß. Es ist gemütlich dort, in der Mitte steht der Ofen mit dem langen gebogenen Rohr und strahlt Wärme aus. Es sind brave Leute. Die Pélagie tritt mit der Berthe ein, ohne zu klopfen.
Die Mélanie Ricard hat eine dicke Backe, einen Schal um den Kopf, an der Schläfe ein rundes, graues Stück Papier: ein Fliegenpflaster, das die Zahnschmerzen herauszieht.
»Das war der mächtige Wind letzte Woche«, erklärt sie der Pélagie.
Auf dem niederen Steinrand des Kamins hockt die Berthe mit der Rosine Arnaud und der Guite Roux, den Enkelinnen vom Sosthène und der Mélanie. Leise und mit unterdrücktem Kichern spielen sie Faust-Fäustchen: Faust, Fäustchen, was ist drin. Brot und Knoblauch …
Es kommen Flaminius und die Ide, seine Frau, gefolgt vom Hilarion und der Augustine Amiel.
»Guten Abend alle zusammen«, sagen die einen wie die anderen.
Die Küche ist voll schwerer, eingeweichter Weidenruten, die auf die Fliesen tropfen. Der Flaminius flicht zwei Mal so schnell wie ein anderer. Er sitzt am Boden auf einem Sack. Der Korb dreht sich zwischen seinen Beinen. Man kann zusehen, wie er wächst.
In Orpierre benutzen sie so viele Körbe, wie ein Priester weihen kann. Es sind grobe Körbe, die zum Transport der Steine dienen, mit denen man die großen Weiden-Gabionen am Ufer der Asse füllt.
Sie reden über nichts anderes als die Asse.
Die Asse kennt nur, wer passiert ihre Wasser …
»Als sie mein geeggtes und eingesätes Gerstenfeld weggespült hat«, sagt der Sosthène, »vor drei Jahren, war das, am Tag vor Sainte-Maxime, da bin ich erst nach zwei Tagen hingegangen, um es mir anzusehen.«
»Wir brachten es einfach nicht übers Herz«, sagt seine Frau. »Elf Tagwerke, ganz zu schweigen von der Saat und dem Gespann.«
»Im letzten Frühjahr«, sagt die Augustine, »waren meine Tomaten futsch. Sie waren schon recht schön, groß wie Nüsse, mir sind die Tränen gekommen.«
»Und die blühenden Saubohnen«, fügt ihr Mann hinzu.
»Es heißt, der Adrien Espariat wär gestern um ein Haar ertrunken, als er mit dem Wagen und den Schweinen zurückkam.«
»Alles ist fünfzig Meter weiter unten gelandet: Mann, Pferd, Wagen und Schweine.«
Weil ihm die Beine einschlafen, ist der Flaminius aufgestanden, er macht ein paar Schritte durch die Küche.
»Als ich bei Nacht die Furt passieren musste, vor zwei Jahren, auf dem Weg nach Riez zum Arzt wegen der armen Sophie vom Antoine, die in den Wehen lag und mehr tot als lebendig war, da sah es übel aus für mich. Es war der 9. September, zwei Stunden nach Mitternacht, der Mond schien, hell wie der Tag. Zum Glück! Meine Stelzen waren da, wo ich sie immer lasse, im Röhricht, bei der großen Silberweide. Ich stelle mich also drauf und steige ins Wasser. Ich tastete mit der Stelze dort, wo ich gewöhnlich immer gut hinüberkam. Diesmal war es nicht derselbe Grund, es gab keinen Kies mehr wie vorher, sondern weichen Sand, und Löcher, da spürte man keinen Boden. Also hab ich einen anderen Weg eingeschlagen, unterhalb der Insel, hab es hierlang und dalang versucht. Ich sah schon mein letztes Stündlein gekommen. Die Stelzen sanken in den Sand ein, wo es noch mehr Löcher gab und Strömungen und Strudel. Strudel, Grundgütiger, wie Trichter und mit einem Sog, als wollte die Asse durch ein Loch auslaufen. Ich weiß nicht, wie ich rübergelangt bin. Es überlief mich heiß und kalt … Wenn ich daran denke, bricht mir noch immer der Schweiß aus. Zum Glück schien der Mond in dieser Nacht, hell wie der Tag!«
Der Flaminius hat sich wieder auf den Boden gesetzt. Er beendet den großen Korb.
»Die Asse – verrückt, wer passiert ihre Wasser …«
Der Wind tönt und stürzt herab wie Wassermassen.
Beim Sosthène Ricard sitzen sie am Abend wieder beisammen. Über ihr Zahnweh und das Wetter klagend, drückt sich die Mélanie an den Ofen.
»Man spürt ihn gar nicht«, sagt sie.
Heute Abend bleiben die Körbe in der Ecke. Es sind vier, einer im anderen reichen sie fast bis zu den schwarzen Deckenbalken.
Der Flaminius, der Sosthène, der Hilarion und der Pfarrer spielen Quartett. Aufgeschlossen und in Medizin bewandert, ist der Curé in Orpierre-d’Asse gern gesehen. Er kennt alle guten Pflanzen des Hügels, und man zieht ihn dem Arzt vor, der zu schnell die teuren und schwächenden Arzneimittel verordnet. Frauen in den Stufenjahren, die zu Trübsinn neigen, empfiehlt er den Jungbrunnen-Sirup des Abbé Soury.
Sie sehen nicht aus wie sonst.
Etwas scheint sich verändert zu haben.