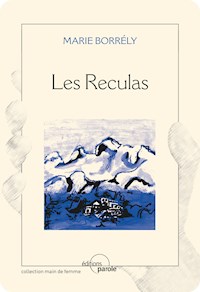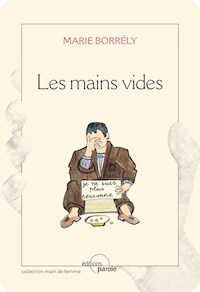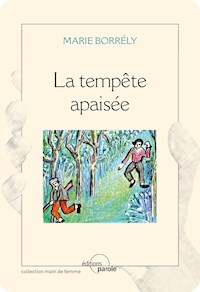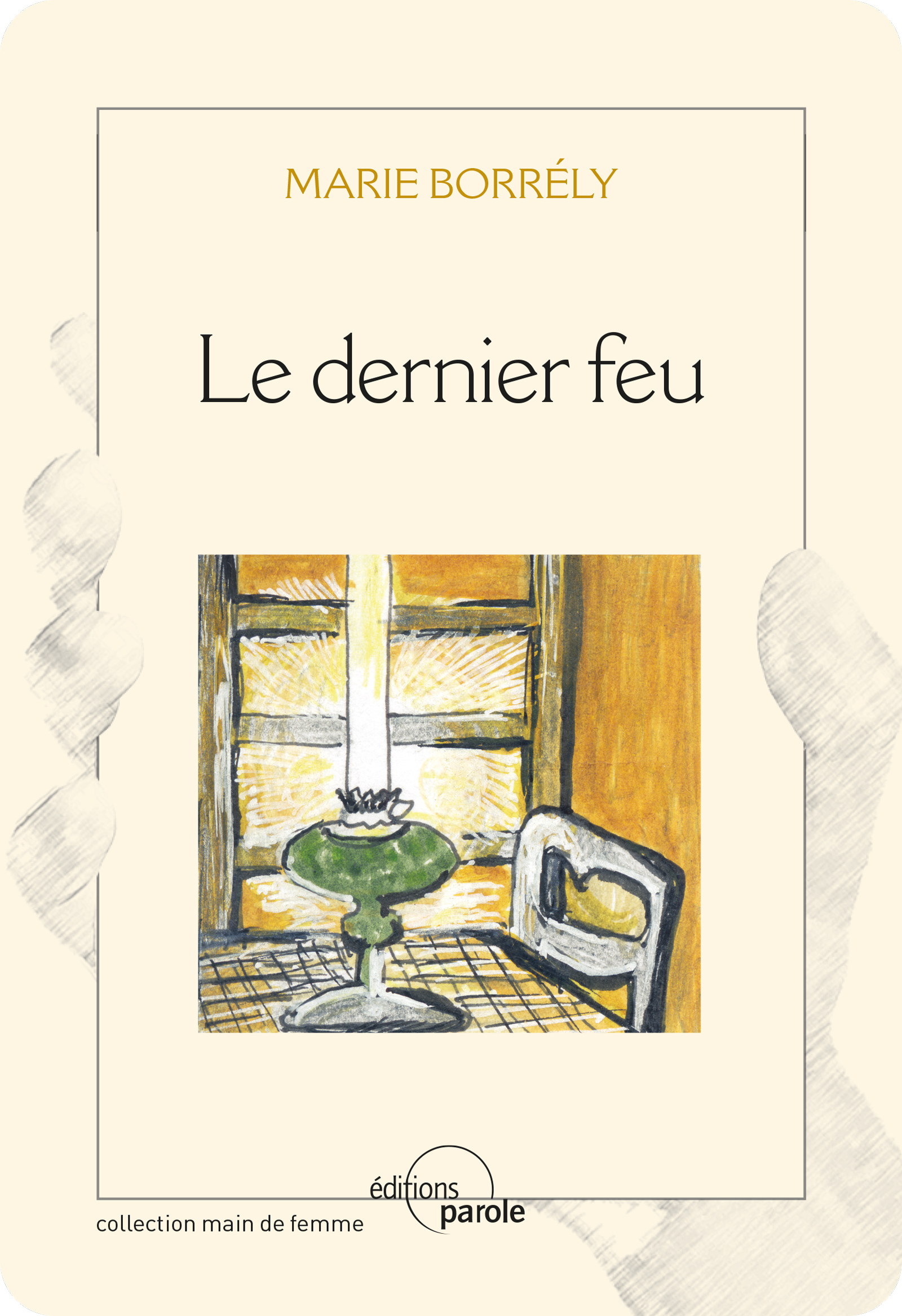Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Buch wie ein Gesang auf die Natur. Der Mistral ist ein unberechenbarer Fallwind, der auch das Leben in einem malerischen Dorf der Haute-Provence bestimmt. Als die junge Marie auf Olivier trifft, gerät ihr wohlbehütetes Leben aus den Fugen.Die junge und strahlend schöne Marie lebt in ihrem malerischen Heimatdorf in der Haute-Provence wohlbehütet mit ihrer Familie zusammen. Als sie jedoch den attraktiven Olivier küsst, wird sie aus der Bahn geworfen. Nie gekannte Gefühle erfüllen die junge Frau. Aber Olivier zieht weiter, und Maries heile Welt stürzt ein. Sie kann den junge Mann nicht mehr vergessen und zerbricht an ihrer Sehnsucht.In diesem Meisterwerk der französischen Literatur spielt der Mistral eine besondere Rolle. Der allgegenwärtige Fallwind spiegelt die Gefühle Maries wider: Ist sie verliebt, weht er sanft – ist sie bewegt, stürmt er.Dieser Roman wurde meisterhaft neu übersetzt und begeistert auch durch seine Naturbeschreibungen und seine wunderbare Sprache.Die Wiederentdeckung eines vergessenen Schatzes der französischen Literatur in grandioser Neuübersetzung. Eine Verbeugung vor der zornigen Natur, dem einfachen Leben und dem weiblichen Mut.Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Amelie Thoma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIA BORRÉLY wurde 1890 in Marseille geboren und lebte ein Leben zwischen Aufbruch und Rückzug. »Mistral«, der erste von insgesamt vier Romanen, die innerhalb weniger Jahre entstanden, wurde 1930 auf Empfehlung von André Gide bei Gallimard veröffentlicht. Maria Borrélys literarisches Talent entfaltete sich in der Künstler-Gruppe um Jean Giono, die in den 30er Jahren in der Haute-Provence eine kurze intensive Blüte erfuhr.
AMELIE THOMA übersetzt u. a. Werke von Leïla Slimani und Simone de Beauvoir. Von Kindesbeinen an verbringt sie die Sommer am Schauplatz des Romans von Maria Borrély: Puimoisson.
Auf einem Bauernhof in der Haute-Provence ist die strahlende Marie glücklich im Kreise ihrer Familie. Bis sie Olivier begegnet, der etwas Neues, Unbekanntes in ihr weckt – ehe er verschwindet. Die Geschichte einer jungen Frau, die an ihrer Sehnsucht zerbricht, und zugleich eine Liebeserklärung an die wilde Schönheit der Haute-Provence, ihre Natur, ihre Farben und Gerüche. Und über allem, unablässig, der Wind, der schmeichelt, heult, peitscht und manch einen in den Wahnsinn treibt.
»Ich machte mich auf eine ländlich-pittoreske Erzählung gefasst, doch die Sprache des kurzen Romans war beeindruckend: zugleich bäuerlich und poetisch, archaisch und modern. Ein echtes literarisches Kleinod, das hier spielte, an diesem Ort, dessen vertraute Physiognomie ich zwischen den Seiten wiederfand: die zusammengedrängten Steinhäuser mit ihren blassroten Ziegeldächern, die unendliche Weite der Landschaft rundherum, die über das Plateau peitschenden Winde, das wechselnde Spiel des Lichts in den Bergketten, die nach allen Seiten den Horizont säumen.«
Aus dem Nachwort der Übersetzerin
Maria Borrély
Mistral
Roman
Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Amelie Thoma
Er hatte sich leise erhoben, war mit sachtem Flügel über die Hausdächer gestrichen und dann verstummt, als hätte er sich tief in eine Höhle verkrochen.
Plötzlich war er mit schrecklicher Stimme gewaltig drohend angeschwollen.
»Das ist die Montagnère«, sagt die Marie. »Heute Nachmittag, beim Waschen unten am Brunnen, ließ der Wind das Wasser auffliegen. Ich war triefnass und mir war nicht warm.«
Ihre Stimme ist eine Freude, und das Spiel ihrer Lippen entblößt im Lampenlicht blitzende Zähne.
»Ich dachte eher, es wär Mistral«, sagt Luce, die alte Nachbarin.
Sie hat eine hängende Schulter. Das Soda-Pulver hebt sich zwischen den Fingern weiß von ihren Wäscherinnenhänden ab. Ihr Schädel unter den spärlichen Haaren glänzt wie ein Stück Seife.
Da sitzt eine ganze Tischgesellschaft in der Küche der Maurels am Abend zum Mandelnauspulen beisammen. In der Mitte hat man einen halben Sack voll Früchte in ihren runzeligen Schalen ausgeschüttet. Manche, die die richtige Reife haben, lösen sich ganz von allein. Bei anderen muss man mit dem Messer kratzen und kommt kaum voran. Die Hände sind vom harzigen Saft verklebt. Man schmeißt die Schalen auf den Boden, wo die Haufen unter den Füßen langsam anwachsen.
Die Kinder schlafen an der Tischkante. Man hört sie kaum atmen. Die Norine oder ihre Älteste schieben ab und zu eins zurecht, das herunterzurutschen droht.
Ein Laden schlägt.
Jemand sagt: »Er wird heftiger.«
»Das ist nicht die Montagnère, das ist ganz bestimmt Mistral.«
»Die Jaume hat sich dieser Tage wohl wieder toll aufgeführt.«
»Scheint so.«
»Sie hat den César le Rouge in seiner Scheune erwischt, wo er gerade sein Korn geworfelt hat. Sie hat ihm ihre Schenkel gezeigt.«
»…«
»Das überkommt sie jeden Monat.«
»Letzten Monat hat sie bei der Beerdigung vom Dominique ein Theater gemacht.«
»Da gefiel es ihr, nackt auf dem Platz herumzuspazieren.«
Durch den Ausguss ertönt frech ein langer, heller Flötenton.
»Kann sein, dass sie den Wind nicht verträgt«, sagt der Costant. »Als ich mich in der Nähe von Aix verdingt habe, das weiß ich noch, da hörte man bei Mistral auf dem Hof die Verrückten aus dem Irrenhaus schreien. Dabei lag es nicht mal in der Richtung, aus der der Wind kam.«
Eine Böe erstarb am Rand des Plateaus. Im nächsten Moment hatte er einen anderen Ton angeschlagen. Eine dichte Folge röchelnder Japser, wie von einer blutrünstigen Meute.
Man amüsierte sich darüber, wie er tobte.
»Wer den Fuß auf ein verwünschtes Kraut setzte«, greift die Luce ein unterbrochenes Thema wieder auf, »verirrte sich im Wald.«
»Eichen, so dick, dass man sie nur mit zwei Armen umfassen konnte, sind gefällt worden«, erwidert der Moisson. »Im Wald wurde so viel ausgeholzt, die Schafe haben derart gewütet, dass man sich dort beim finstersten Wetter nicht mehr verirren kann.«
Die Luce wirft ihm vor, er würde zu viel lesen.
»Ein jeder, wie er’s versteht, Gevatterin!«
Der Macime war kurz davor, an Hexerei zu glauben, so sehr verwirrte ihn die Marie. Er war nicht sicher, ob er nicht auf ein verzaubertes Kraut, ein gutes oder böses, getreten war.
Er versuchte ihren Blick festzuhalten, der ihm auswich.
In der Dunkelheit ums Haus trieb der Wind, gleich einer Woge, seine Vorhut zischender, tanzender Schlangen vor sich her.
Zehn Uhr durch, sagt man sich guten Abend und geht auseinander.
Der Costant hält beim Öffnen die Türe gut fest. Die Luce knotet straff ihr Kopftuch. Der Wind fegt hinein wie ein eisiger Gebirgsbach. Der Himmel ist klar.
»Die Lampe!«
Sie spinnt ein langes gelbes Flammengarn, ehe sie unter allgemeinem Lachen erlischt.
Während er die Tür schließt, hört der Costant, drei Schritte entfernt, Macimes Stimme, von den Böen zerpflückt und wie von weit her:
»Vielleicht wird er noch die Sterne ausblasen …«
Da es auf dem Plateau mehrere gibt, die so heißen wie sie, wird sie selten Marie Maurel genannt.
Üblicherweise sagt man Norines Marie oder die Marie vom Portal.
Ihre Augen haben die Farbe des schönen wilden Lavandins. Die Bewegung ihrer Taille, ihrer Schultern, ist wie das Wiegen einer jungen Birke im Wind, dem sie mit der geschmeidigen Kraft ihrer Lenden standhält.
Der Macime denkt, dass niemand so genau sagen kann, wie die Marie ist.
Es ist leicht, ihren Wuchs zu beschreiben, die Farbe ihrer Wangen. Aber ihr Lachen, mit weit geöffnetem Mund, dass man all ihre perfekten Zähne sehen kann. Ihr Gang. Und ihre Stimme. Ihr Ausdruck, wenn etwas sie erstaunt, amüsiert. Wie sie ihren klaren Blick umherschweifen oder auf etwas ruhen lässt, oder ihn senkt unter dem der jungen Männer. Die unbändigen krausen, glänzenden Haare, bei denen man an die Achsel denken muss. Wie sie sich hinhockt, um etwas tief im Schrank zu suchen, oder von Weitem guten Tag ruft, winkend mit erhobenem Arm. Ihr Aufschrei, wenn die Kleine in den Teller Saubohnen, die sie gerade enthülst, eine Handvoll Schalen wirft.
Und wenn sie gegen den Mistral läuft, die Haare aus der Stirn geweht, das Gesicht gespannt. Der Macime beneidet den Wind, der sich an den schönen Körper schmiegt, über dem dünnen Kleid, wie Hände, die Ton formen.
Die Norine hält sich nicht lang in den Läden auf, zeigt sich selten auf dem Platz.
Sie hat sechs kräftige Kinder bekommen und weiß nichts von den Mühen, ein schwächliches Pflänzchen großzuziehen. Die Kinder, der Haushalt, die Tiere, um die sie sich kümmert, die anstehende Ernte oder das Heu, und dann all die Wäsche und das Zeug, das geflickt werden muss, sie rackert sich ab, hat immer zu tun, findet nicht mal am Sonntagabend eine Minute, sich umzuziehen, einen Augenblick, müßig zu bleiben.
Zur Vesper geht sie nicht oft.
Wie gut, dass sie die Marie hat, die ihre rechte Hand ist und keine Arbeit scheut. Und die sich, egal worum es geht, nicht zu schade ist. Ebenso geschickt und flink beim Nähen wie beim Einweichen der großen Wäschestücke, beim Hühnerstallausmisten oder Versorgen der lammenden Mutterschafe.
Da sie die Älteste ist, hat sie nicht viel zur Schule gehen können, aber ihre Mutter hat sie zwei Jahre lang nachmittags zum Nähen geschickt.
Es heißt, der Costant und die Norine schätzen die Marie ein bisschen mehr als ihre übrigen Kinder, sie sei ihnen die Liebste.
Ihr Glückskind.
An diesem Abend sitzen wieder alle beisammen.
Die Marie macht noch rasch den Tisch sauber, wischt mit dem Lappen in der einen Hand die Krümel weg, während sie mit der anderen die Zuckerdose fortstellt. Eine Fayence-Zuckerdose aus Moustiers, die die Norine immer im Haus gesehen hat, glänzend weiß glasiert und mit blauen Bändern und Kornblumen verziert. Der Deckel ist an einer Ecke angestückelt.
Ab und zu streckt der rauchende Ofen eine zwei Spannen lange Flammenzunge heraus.
Der Wind rüttelt an Türen und Zargen.
Am Ende des Korridors hört man ihn stöhnen wie jemand, der Bauchschmerzen hat.
Der Gédéon Rougier sagt so gut wie nichts.
Er ist ein dürrer kleiner Alter mit krummem Rücken. Zur Abendrunde kommt er selten.
Es hieß, als Kind habe er einen Sonnenstich gehabt, gegen den seine Mutter ihm kalte Umschläge aufgelegt hatte, die sie in einer kurzen Sommernacht immerzu am Wasser des Brunnens erneuern lief. Die Quelle hatte mit ihren kühlen Lippen die schlimme Hitze aufgesogen. Aber er war ein bisschen so geblieben, nicht ganz wie alle anderen.
Man hatte mit der Zeit noch mehr getuschelt: Den Gédéon, der Knecht auf einer Farm gewesen war, sollte die Tochter des Dienstherren ganz verrückt gemacht haben. Eines Tages hatten die Nachbarn, die auf der Tenne Süßklee droschen, Schreie gehört. Es war der Gédéon, den man mit Heugabeln davonjagte.
Er war lange Zeit Hirte. Man munkelte damals hinter vorgehaltener Hand, er stille seine Lust bei den Schafen. So erhielt er den Beinamen Bäh.
Er verstand sich meisterlich aufs Füchsefangen und wusste obendrein noch, wie man abseits der Dörfer, zu der Zeit, da die Herden wiederkommen, auf mehreren Kilometern das Lockmittel verteilen muss: die Reste von Schafmägen. Wie man die Schlingen legen muss, deren Köder ein mit einem Gebräu bestrichener Brotkanten ist: eine Mischung aus in Fett gerösteter Zwiebel, Honig, Stutenmist, Bittersüß und weiteren Zutaten, die nur der Gédéon kennt. Er kocht das Gebräu, liefert es den Jägern, ohne es ihnen zu verkaufen, sondern gegen eine Prämie für jeden Fang, die ein bisschen höher ist bei einem weiblichen Fell. Das der männlichen Tiere nimmt Schaden während der Kämpfe in der Brunftzeit.
Der Gédéon sammelt Reisig, wenn Eichen geschlagen werden, oder die Zweige, die man ihm auf den abgelegenen Feldern lässt, nach dem Auslichten der Mandelbäume im Frühling, ehe die Säfte steigen.
Im Mai pflückt er Thymianblüten, erntet später den wilden Lavendel und den Großen Speik, lebt mehr schlecht als recht, ernährt sich, man weiß nicht wovon, wilden Beeren, Feldkräutern, Schnecken, sucht die Wurzel der Alraune, die einem hilft, Schätze zu finden und Träume zu deuten, die Sonnenstiche heilt und vor Vipernbissen und Unglück feit.
Und seit zwanzig Jahren nun geht er mit der Wünschelrute und träumt von durch sein Geschick bewässerten und fruchtbaren Ebenen, munter plätschernden Brunnen überall, blühenden Gärten rund um die Häuser, üppigem Gemüse und, in der trockenen und steinigen Bergheide mit ihrem tristen, buckligen Ginster: hohen Pappeln, Birken und Trauerweiden inmitten saftiger Wiesen …
Die Marie ist einen Teller gekochter Birnen holen gegangen, die langstieligen, die man im Sud, der von den vorigen übrig ist, kocht.
Sie bietet immer Birnen an, wenn der Gédéon da ist, weil sie weiß, dass er nur schlecht oder gar nicht zu Abend gegessen hat.
Dem Macime ist es aufgefallen. Er steht hinter dem Ofen und wärmt sich die Hände am Rohr, das er tätschelt.
Manche sagen, er hat nicht gerade das Schießpulver erfunden oder er ist ein Hanns Guck-in-die-Luft. Wer ihn besser kennt, weiß, dass er nicht einfältiger ist als jeder andere, sondern nur zu viel an die Marie denkt.
Der junge Mann wendet den Blick nicht von den beiden ab, dem Gédéon, der abseits beim Herd sitzt, wo er ganz zusammengekauert wenig Platz einnimmt, und dem schönen Mädchen, frisch wie ein junger, gerade aufgeschossener Baum.
Ihre Zähne sind so weiß wie geschälte Mandeln.
»Nehmen Sie noch, Gédéon«, sagt sie aufmunternd. »Nehmen Sie. Die sind süß.«
Der Mistral hat aufgefrischt und bläst stärker als am Vortag. Ohne Unterlass. Wie Stöße mit dem Hobel, meint man, hastig, wütend, ein Starrsinn, die Erde bis auf die Knochen abraspeln zu wollen.
»Gehst du morgen in die Mandeln?«, fragt der Macime die Marie.
»Morgen? Da ist Michaeli. Ich will doch nicht, dass mir ein Unglück passiert.«
»Ach ja. Daran hab ich nicht gedacht.«
Wenn man sich an Sankt Michael um die Mandeln kümmert, läuft man Gefahr, vom Baum zu fallen.
Das Dorf breitet unter dem gleichförmigen Himmel die Blöße seiner rotblonden Dächer aus, lehnt sich zwischen Oliventerrassen, schmiegt sich an die vom Plateau abfallende Sonnenflanke.
Seine Füße baden in Wiesen und blühenden Obstgärten.
Es scheint mehr, als es ist, durch die Ausdehnung der am Hang liegenden Viertel.
Die alten ausgeblichenen Ziegel, die Mauern, die im Laufe der Jahreszeiten ihren Putz verloren haben, nichts an diesem Dorf, was sich nicht in den Schoß des grünen Hügels fügte. Alles hat die Farbe der Zeit, der Felsen. Und wenn die Sonne hinter den Olivenbäumen untergeht, tritt der Block ärmlicher Häuser mit schiefen Dächern klar hervor und präsentiert das prächtigste Wirrwarr goldener, rosa oder von schwarzen Schatten verhüllter Mauern.
Die Häuser, die im Dorfkern zusammengepfercht sind, verteilen sich großzügiger rundum am geschützten Hang ebenso wie oben auf der Ebene, wo ein scharfer Wind weht.
Der weite Platz liegt auf dem Plateau, mit mageren Nuss- und Ahornbäumen, die der Wind verstümmelt, der Staub angreift, die dürre Erde und die langen, regenlosen Sommer austrocknen.
An Mistraltagen ist es nicht lustig dort.
Man frisst Staub. Diejenigen, die mit dem Wind gehen und sich leicht fühlen wie Blätter, scheinen zu gleiten. Die anderen, die Köpfe gesenkt, außer Atem, dringen nur stoßweise, stockend, mit seitlichen Schritten in die dichte Masse des Windes vor.
Dreißig Schritte abseits der Straße das Portal, ein hoher Durchgang im schwarzen Überbleibsel der Befestigungsmauer, der eine blaue Gewölberippe ausschneidet. Der Mistral fährt trompetend hinein.
Auf dem ehemaligen Wehrgang, in luftiger Höhe, hat ein Feigenbaum es fertiggebracht zu wachsen, wild und üppig.
Den Spitzbogen überragt ein Wappenschild mit zwei parallelen Flöten quer darüber:
Die Leute vom Plateau werden Pfeifer genannt.
Vom Portal und vom Platz fallen die engen, gepflasterten Straßen steil zum niederen Viertel ab. Hier, ihr Reichtum: eine Quelle, verteilt auf einen von Moos dick gepolsterten Brunnen mit unentzifferbarer Jahreszahl und die Becken des Waschhauses unter den Weiden. Sie sprudelt das ganze Jahr.
Das laute Plätschern übertönt alle gewohnten Geräusche. Der Überlauf rinnt in einem Bach die Straße hinunter. Er wässert die Gärten am Rand, vor den Wiesen.
Ganz unten, am Grund der Senke, ein Flusslauf mit einer Reihe Pappeln.
Das Klima ist ganz anders als dort oben.
Die Häuser, deren Türen angelehnt sind, liegen warm und windgeschützt, mit Terrassen, Balkonen, Außentreppen aus Holz oder Stein, Kürbisranken, Oleander, Pfaffenhütchen, Spalieren blumenbepflanzter Töpfe und Tiegel. Das Glaskraut erklimmt die abgeblätterten Mauern.
Hierher kommen die Alten, um Sonne zu tanken, während der goldenen Stunden an Winternachmittagen.
Die Kinder tummeln sich am Bach.
Die meisten alten Straßen verfallen, bieten ein Bild rissiger Mauerreste, aus zwei Wänden bestehender Häuser ohne Dach, deren Stockwerke eingestürzt sind und deren Erdgeschoss nur noch ein von Brennnesseln oder einem aus Schutthaufen wachsenden Feigenbaum überwucherter Hof ist.
Fassaden ohne ihr Inneres ragen auf mit leeren Fensterhöhlen, durch die auf weiten Schwingen der Wind aus der Ferne streicht.
Manche alten Häuser sind weniger als all das: Steinhaufen, die sich hie und da aus dem Abfall erheben.
Baufällige Hütten stehen noch, die nur Luken haben und deren Mauern schwarz sind, die Dächer schimmlig und schief.
Man sieht mit Kalk geweißte und blau gestrichene Alkoven, die das Wimmern von Neugeborenen hörten, das unterdrückte Stöhnen feuriger Leidenschaft, das Röcheln langsamen Siechtums, Alkoven, einst geschützt und abgeschirmt, jetzt unter freiem Himmel und allen Winden ausgesetzt.
Von etlichen Häusern bleibt nur, in einem von Efeu umklammerten Mauerstück, die kleine archaische Tür mit ihrem Rahmen aus zerfressenem Tuffstein.
Hell auf vergilbten Trennwänden: ein Kreuz, das Rechteck eines gerahmten Porträts.
Spuren von Regalen, die Stapel ordentlich gefalteter, mit guter Lauge sauber gebleichter und nach Lavendel duftender Wäsche trugen.
Nichts lebt mehr in diesen verlassenen Vierteln, außer der Stimme des Windes.
Im oberen Viertel, angrenzend an das Haus der Maurels, liegt das vom Moisson, dem Großonkel der Norine.
Er lebt allein, halb Handwerker, halb Bauer.
Unter seinen Händen entstehen treffliche Fässer.
Am Leib trägt er, sommers wie winters, bloß eine Baumwolljacke über dem Hemd, lebt nur von Brot, Gemüse und Salat, isst kein Fleisch, hält weder Hühner noch Kaninchen, noch Tauben, pökelt kein Schwein, hütet keine Ziegen.