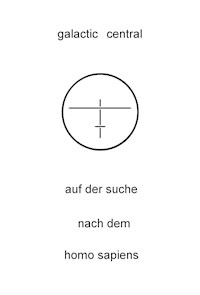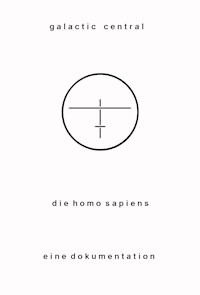Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Tod ist der beste Lehrmeister zu bürgerlichem Ungehorsam. Fritz Roth Unser ganzes Leben lang streben wir nach Selbstbestimmtheit und Autonomie. Doch als Trauernde lassen wir uns unsere Toten stehlen. Wir haben gelernt, zu delegieren, uns auf »Experten« zu verlassen. Und spätestens, wenn wir persönlich mit dem Verlust eines nahe stehenden Menschen konfrontiert sind oder wenn uns eine lebensbedrohliche Krankheit überkommt, erkennen wir schmerzlich, dass die alten Rituale nicht mehr passen. Wir sind als Individuen und auch als Gesellschaft gefordert, eine neue Sterbe- und Trauerkultur zu entwickeln. Wollen wir unser Leben (bis zum Ende) gestalten oder nur verwalten? Wie ist es um den Wert der Individualität bestellt, wenn wir sie im entscheidenden Moment verschenken? Trauer sollte wie jede Krise nicht als lästiges Hindernis, sondern als langer Weg einer Veränderung verstanden werden. Dann erst können wir die Chancen dieser Erfahrung nutzen und erkennen: Auch allem Ende wohnt ein Zauber inne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritz Roth
Das letzte Hemd ist bunt
Die neue Freiheit in der Sterbekultur
Information zum Buch
Unser ganzes Leben lang streben wir nach Selbstbestimmtheit und Autonomie. Doch als Trauernde lassen wir uns unsere Toten stehlen. Wir haben gelernt, zu delegieren, uns auf »Experten« zu verlassen. Und spätestens, wenn wir persönlich mit dem Abschied von einem nahe stehenden Menschen konfrontiert sind oder wenn uns eine lebensbedrohliche Krankheit überkommt, erkennen wir schmerzlich, dass die alten Rituale nicht mehr passen. Wir sind als Individuen und auch als Gesellschaft gefordert, eine neue Sterbe- und Trauerkultur zu entwickeln. Wollen wir unser Leben (bis zum Ende) gestalten oder nur verwalten? Wie ist es um den Wert der Individualität bestellt, wenn wir sie im entscheidenden Moment verschenken? Trauer sollte wie jede Krise nicht als lästiges Hindernis, sondern als langer Weg einer Veränderung verstanden werden. Dann erst können wir die Chancen dieser Erfahrung nutzen und erkennen: Auch allem Ende wohnt ein Zauber inne.
Informationen zum Autor
Fritz Roth arbeitete als Unternehmensberater, bevor er Trauerpädagoge wurde und ein Bestattungshaus in Bergisch-Gladbach übernahm. Der »Pionier des deutschen Bestattungswesens« gilt vielen Kollegen zugleich als Enfant terrible der Branche. Er gründete den ersten Privatfriedhof Deutschlands; Zehntausende Manager, Theologen, Mediziner, Verbände und Jugendliche besuchen jährlich sein »Haus der menschlichen Begleitung«. Der Autor mehrerer Bücher zum Thema Trauer erklärte den Tod für die »Sendung mit der Maus« und ist ein gefragter Redner.
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Copyright © 2011 Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: total italic, Amsterdam – Berlin
Umschlagmotiv: © total italic, Amsterdam – Berlin
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
ISBN der Printausgabe: 978-3-593-39476-3
E-Book ISBN: 978-3-593-41157-6www.campus.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Teil I
1 Der fremde Tod
»Outsourcing« des Sterbens
Die enteigneten Toten
Hilflose Trauer
2 Die stille Revolte
Vom Unbehagen zum Ungehorsam
Individuelle Freiheit und ihre Grenzen
Krisen in Perspektiven wandeln
3 Gemeinsam einsam
Der Tod »in Nahaufnahme«
Kult und Kultur des Sterbens
Wir konsumieren uns zu Tode
Moderne Gesellschaft – moderne Ängste
4 Memento mori: ein Blick zurück
Die Bedeutung von Totenritualen in der Geschichte
Das Individuum und das kollektive Gedenken
Der Tod als Weltverbesserer
5 Den Tod neu denken
Ungewissheiten aushalten
Trauer-Power: Die Kraft der Trauer
Teil II
6 Der Trauer eine Heimat geben
Ein Ort der Begegnung
Ein Trauerritual ist wie ein Bilderrahmen
Trauer braucht Vertrautheit
Sich Zeit nehmen zum Trauern
7 Der Tod und die Liebe
Was Sterbehemd und Brautkleid gemein haben
Abschied als Anfang einer neuen Verbundenheit
Geteilte Erinnerungen
Trauerzeit ist Lebenszeit
8 Jeder Abschied ist einzigartig
Individuelle Gestaltung statt Pomp
Kreativer Ungehorsam
Trauer ist ein Reifeprozess
9 Verwandlungen
Lebendigkeit ist unsterblich
Zeit für die großen Fragen
Teil III
10 Der Tod als Lehrmeister
Die a-mortale Gesellschaft
Vom Wert der Bindung
Leben in der Gegenwart
Unendliche Erwartungen
Verluste akzeptieren
Die Angst vor dem Alter
Grenzen der Kontrolle
11 Krise und Aufbruch
Krisenbewältigung als Lebenskompetenz
Die Unvorhersehbarkeit von Krisen
12 Verdrängte Verluste
Königsdisziplin Change Management
Der Aufstand des Individuums
Der Preis der Flexibilität
Die Kehrseite der Veränderungen
Überlebenden-Depression
13 Der Tod und sein Preis
Die Kosten-Nutzen-Brille
Friedhofszwang versus Vielfalt
Die TrauerOase
14 Der letzte Wille (Sterben und sterben lassen)
Hilfe für die Hinterbliebenen
Selbstbestimmung am Ende des Lebens
Teil IV
15 Aus dem Schatten der Trauer
Die guten Ratschläge der anderen
Credo ergo sum
Die Bedeutung von Trauergruppen
Wer macht den ersten Schritt?
Berufsvorbereitung für Trauerbegleiter
Der Tod kommt immer unerwartet. Über Selbstverständlichkeiten und Tabus
16 Individuelle Abschiede
Der Tod hat viele Farben
Fünf Tage Abschied
Das eigene Hemd
Ein Fest für Horst
Reisebegleiter
Ahnengalerie
Ein Stein als Skulptur
Fußball für immer
Digitale Ewigkeit
Der letzte Tag – und ein Koffer
Ein handbemalter Sarg
Darf man erleichtert sein, wenn jemand stirbt?
Wenn Kinder trauern
17 Traueralltag am Arbeitsplatz
Funktionieren um jeden Preis
Verantwortung der Unternehmen – auch im eigenen Interesse
18 Fazit – Der Tod gehört ins Leben
Leseempfehlungen
Weitere Quellen und Artikel
Ich habe keine Angst vor dem Tod,
ich möchte nur nicht dabei sein, wenn’s passiert.
Woody Allen
Vorwort
Eine stille Revolte ist im Gang gegen die Vorschriften und Verordnungen zur Sterbekultur. Noch regieren Technik, Konventionen und Standards dort, wo wir selbst nicht steuern und gestalten können oder wollen. Der Tod wird, wie so vieles, »hergestellt«. Dabei brauchen wir viel mehr Auseinandersetzung und Nähe, damit wir die Realität des Todes erfahren können. Denn eines ist gewiss: Entgehen werden wir dem Tod und der Erfahrung, Abschied nehmen zu müssen, nicht.
Vor nicht allzu langer Zeit lag in unseren Wäscheschränken das Totenhemd obenauf. Die Botschaft war klar: Mensch, bedenke, dass Du sterblich bist – memento mori. Die allermeisten unserer Zeitgenossen wussten mit diesem Satz jahrzehntelang nichts mehr anzufangen. Ich bin sicher: Das ist – wenn nicht Ursache – dann doch zumindest Ausdruck vieler krisenhafter Zuspitzungen, die uns heute beunruhigen.
»Wer bremst, verliert«: Viel zu lange galten die Mantren eines auf messbare Leistungsfähigkeit reduzierten Menschenbildes außerhalb religiöser oder esoterisch geprägter Kreise als alternativlos. Zu viel Nachdenklichkeit war etwas für Spaßbremsen und Warmduscher, der Tod fand in Hollywood statt und in den Nachrichten. Das eigene Ende war kein Thema, bevor es nicht in greifbare Nähe rückte – und selbst dann nicht immer.
So viel Ignoranz hat unterschiedlichste, weit unterschätzte Folgen. Den beiden wichtigsten möchte dieses Buch entgegenwirken: Der Not der Hinterbliebenen und dem Niedergang der gerade heute wichtigen Kultur der Bewältigung von Verlusten.
*
Trauer braucht eine Heimat. Trauernde brauchen in besonderem Maß die Gewissheit des Geborgen- und Akzeptiertseins, um die erforderliche Ruhe für einen konstruktiven Trauerprozess zu finden. Diese Heimat boten bis vor nicht allzu langer Zeit traditionelle Gemeinschaften: Familie, Nachbarschaft und Gemeinde. Doch sie sind auf dem Rückzug. Und unsere gesellschaftlichen Institutionen springen nicht in die Bresche, sondern vernachlässigen ihre Fürsorgepflicht.
Der Tod braucht einen Platz im Leben. Die Ausgrenzung von Sterben und Tod hindert Hinterbliebene am bewussten Umgang damit und trägt so die Hauptschuld an individuellen und gesellschaftlichen Folgeschäden. Fix it, sell it or close it, sagt die Management-Ikone Jack Welch: Jede starrsinnig auf Wachstum fixierte Gesellschaft verdrängt Verlusterfahrungen. Wer nicht (mehr) leistet, passt nicht ins System und wird an den Rand gedrängt.
Doch selbst aus kühler, rein betriebs- oder volkswirtschaftlicher Sicht ergibt eine solche Maxime keinen Sinn. Denn ein bewusst gelebter Trauerprozess verläuft erheblich schneller und konstruktiver und schafft so die schnellstmögliche Reintegration Hinterbliebener in die Wertschöpfungskette. Weil aber die Gesellschaft wegsieht, bezahlt die Volkswirtschaft. Etwa 800000 Menschen sterben in Deutschland jährlich. Nimmt man an, dass jeder von ihnen nur fünf trauernde Ehepartner, Kinder, Freunde hinterlässt, dann sind das jährlich vier Millionen Betroffene. Darunter unzählige Arbeitnehmer, die nur bedingt leistungsfähig sind, Patienten, die Therapie oder Psychopharmaka benötigen. Die sprunghaft ansteigenden Fallzahlen Depressiver und Burnout-Betroffener sind in aller Munde. Ich bin überzeugt, dass verdrängte Trauer einen weit unterschätzten Anteil an diesen Phänomenen hat. Nicht nur, weil wir unfähig geworden sind, Trauernden zur Seite zu stehen. Sondern auch, weil wir selbst die enorm wichtigen und lehrreichen Erfahrungen bewussten Trauerns nicht zur Entwicklung unserer Persönlichkeit nutzen.
Die fundamentale Verlusterfahrung beim Tod eines nahestehenden Menschen lehrt – wenn sie angenommen und bewusst verarbeitet wird – den richtigen Umgang mit Brüchen anderer Art: Scheidungen, Job- und andere wirtschaftliche Verluste werden weniger fatal empfunden und besser verarbeitet. Die gesellschaftliche Verdrängung der Trauer bereitet den Boden für irrational-fatalistische lähmende Grundstimmungen, wie sie – auch infolge der medialen Herausstellung negativer Nachrichten – immer wieder zu beobachten sind.
*
Der Tod erklärt das Leben. Allerorten wird ein Verfall der Werte als Ursache vieler gesellschaftlicher Probleme beklagt. Voraussetzung für einen angemessenen Umgang miteinander ist Wertschätzung; der höchste Wert ist dabei das Leben. Den Wert des Lebens spürt nur, wer den Tod kennt. Denn wir brauchen immer Relationen, um bewerten zu können. Wer einmal die Präsenz des Todes begriffen hat, weiß sofort, was Respekt bedeutet. Wem diese Erfahrung verwehrt wird, gebühren mildernde Umstände bei der Beurteilung gesellschaftlichen Fehlverhaltens.
Unsere gesellschaftlichen Institutionen aber tragen nicht nur durch Unterschätzung und Ignoranz zur Verschärfung solcher Problematiken bei. Die in vielen Bundesländern regressive Gesetzeslage zum Thema Tod und Trauer beschränkt darüber hinaus die im Grundgesetz verankerten Rechte auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Religionsfreiheit. Sargzwang und Friedhofsordnungen bevormunden die Menschen in wichtigen Bereichen, ohne dass ein ausreichend begründetes übergeordnetes öffentliches Interesse vorläge. Und sie nehmen uns damit vielfach die für einen konstruktiven Trauerprozess so wichtige Möglichkeit zu als angemessen empfundener Abschiednahme und Gedenken.
Am Ende werden Trauernde zu Kranken, weil die Menschen nicht mehr wissen, wie ihnen zu begegnen ist. Der Trend zu anonymen Bestattungen betrügt Hinterbliebene um den wichtigen Ort der Erinnerung.
Die Verdrängung des Todes aus dem Leben erzeugt in uns die Illusion von Unsterblichkeit – und raubt uns damit das Bewusstsein für den unschätzbaren Wert jeden Tages. Mehr noch: Wenn doch die wichtigste Ressource von allen – das Leben – unendlich scheint, wer erfasst dann noch die Bedeutung eines achtsamen Umgangs mit Ressourcen insgesamt? Ich bin überzeugt: Ohne memento mori muss jede Wertediskussion ins Leere laufen.
*
Es gibt auch eine gute Nachricht: Sie halten dieses Buch in Händen. Damit sind Sie Teil einer wachsenden Minderheit, die entscheidende Fragen neu stellt. Und unter dem Eindruck des offensichtlichen Ungenügens der alten Antworten zu neuen Schlussfolgerungen kommt.
Vielleicht sind Sie in Trauer oder bereiten sich auf einen bevorstehenden Verlust vor. Dann wird dieses Buch Sie ermutigen: Stellen Sie sich den Fragen, die der Tod aufwirft: Wie hätte ich mir die Sterbestunde gewünscht? Was hätte ich gern gesagt und getan? Welche Form der Bestattung hätte mir wirklich gut getan? Wie finde ich den Mut, mich über vorgebliche Gegebenheiten und Konventionen hinwegzusetzen? Das Buch wird Ihnen helfen, Trauern als konstruktive Kraft begreifen zu lernen. Wie können wir mit Trauer leben? Können wir überhaupt damit leben? Müssen wir uns wirklich bemühen, so schnell wie möglich mit dem Trauern fertig zu werden, damit wir dann endlich »wieder« leben können?
Oder ist es nicht eher umgekehrt: Dass wir aus der Fähigkeit zu trauern viele Kräfte gewinnen, die unsere Leben bereichern. Ich möchte verhindern helfen, dass Sie gegen Ihre eigentlichen Bedürfnisse doch zu den vorgegebenen, leeren Ritualen greifen. Indem Sie das, was Sie beunruhigen könnte, dieses Mal zu Ende zu denken. Damit Sie Trauer als wertvolle Phase der Veränderung erfahren. Ich möchte Ihnen zeigen, wie viel Sie vom Tod, von Trauer für die Bewältigung von Lebenskrisen gewinnen können.
Vielleicht sind Sie auf der Suche nach Gründen für ganz offensichtlich Widersinniges, das sich dennoch täglich wiederholt. Sie fragen nach der Ursache für mutlose Weichenstellungen zulasten künftiger Generationen, für milchmädchenhaftes Missmanagement in Konzernen, allzu leichtfertigen Umgang mit Ressourcen? Dann wird dieses Buch Ihnen Denkanstöße und konkrete Hinweise darauf geben, wie uns das ganz reale Begreifen des Todes als absolute Grenze und der bewusste Umgang mit Trauer dabei helfen können, bessere Prioritäten zu setzen und vernünftiger zu agieren.
Es geht mir darum, uns Tod und Trauer wieder zueigen zu machen, in den eigenen Lebens- und Handlungshorizont zu integrieren, anstatt sie an Experten zu delegieren. Für die Wiederentdeckung unserer Kultur des Sterbens und Trauerns müssen wir selbst die Verantwortung übernehmen – besser heute als morgen. Denn das letzte Hemd ist bunt. Nur Mut – wir haben viel zu gewinnen!
Teil I
1
Der fremde Tod
»Outsourcing« des Sterbens
Sonntagabend, kurz nach acht. Ein Arm ragt aus dem Gebüsch, getrocknetes Blut. »Können Sie schon etwas über den Todeszeitpunkt sagen?« »Gestern abend zwischen acht und zehn, Genaueres nach der Obduktion.« Die Kommissare stapfen zu ihrem Wagen – der Tatort im Ersten beginnt. Das ist der Tod, wie wir ihn kennen. Allabendlich wird in Deutschland gestorben, allabendlich begegnen wir dem Tod als Verbrechen, für das es einen Schuldigen gibt. Diesen Tod werden die wenigsten sterben. Doch der Tod, wie ihn heute immer mehr Menschen erleben, hat durchaus Gemeinsamkeiten mit dem Fernsehkrimi: Das Ende des Lebens ist zur Kampfzone geworden. Zu einem Kampf, den wir immer seltener selbst kämpfen, bei dem die Regie in fremden Händen liegt.
»Als ich ihn zum letzten Mal durch die Glasscheiben eines aseptischen Zimmers sah und mich ihm nur mit Hilfe einer Sprechanlage verständlich machen konnte, lag er auf einem Rollbett, mit zwei Inhalationsschläuchen in den Nasenlöchern, mit einem Atmungsschlauch im Mund, mit irgendeinem Apparat zur Herzmassage, den einen Arm an eine Perfusions-, den anderen an eine Transfusionsverbindung angeschlossen und am Bein den Anschluss für die künstliche Niere … Da sah ich, dass Pater de Dainville die festgeschnürten Arme befreite und sich die Atemmaske abriss. Er sagte mir – und das waren, glaube ich, seine letzten Worte, bevor er im Koma versank: ›Ich werde um meinen Tod betrogen.‹« Diese Szene, die der Historiker Philippe Ariès in seinen Studien zur Geschichte des Todes im Abendland beschreibt, ist für viele Menschen ein Schreckensszenario. Bis heute wünschen sich die meisten Menschen, zu Hause zu sterben, im Kreis der Familie, möglichst schmerzfrei und schnell. Fast genauso viele Menschen sterben anderswo, im Krankenhaus oder Pflegeheim und – viel zu selten – im Hospiz. Und sie sterben wie Pater de Dainville: einen enteigneten Tod.
Zwei innere Bilder stehen sich heute gegenüber: das Ideal vom »natürlichen Tod«, bei dem man sanft entschlummert, am liebsten zu Hause im Kreis der Lieben, und das medizinische Horrorszenario vom einsamen Sterben auf der Intensivstation. Fast jeder möchte daheim sterben, aber nur jedem Vierten ist dies vergönnt; mehr als die Hälfte der Sterbenden beenden ihr Leben in einem Krankenhaus, ein Viertel in einem Alten- oder Pflegeheim. Die meisten Menschen sterben heute in einer Institution, auch wenn sie wie 70 Prozent aller Pflegebedürftigen in Deutschland zuvor von Angehörigen mit Unterstützung ambulanter Fachkräfte gepflegt wurden. Nicht nur für Deutschland, sondern für nahezu alle industrialisierten Regionen der Welt gilt: Die Professionalisierung des Umgangs mit Krankheit, Leiden und Sterben hat dazu beigetragen, dass der Tod aus unserer Alltagserfahrung verschwunden ist.
Nach der Definition des amerikanischen Soziologen Robert K. Merton ist die Medizin eine Institution, von der Gesellschaft geschaffen, um ihre Mitglieder von der Beunruhigung durch Krankheit und Sterben zu entlasten. Sie verbirgt den Anblick des Sterbenden hinter ihren Mauern und gibt die Beschäftigung mit dem Problem an Experten ab, die ihrerseits Mittel und Wege finden, sich das Thema vom Leibe zu halten: »Das Entsetzen darüber, dass ein Mensch sich im Sterben in einen bloßen Körper verwandelt, kann ferngehalten werden, wenn man sich von Anfang an nur für den Körper interessiert«, merkt der schwedische Psychiater Per Christian Jersild an.
In manchen Rettungsleitstellen, berichtet der Intensivmediziner Michael de Ridder, kommt mittlerweile die Hälfte aller Einweisungen aus Pflegeheimen. Niemand möchte sich einer Unterlassung schuldig machen, weder Pflegekräften noch Angehörigen noch Ärzten ist die schwierige Entscheidung zuzumuten, ob es sich womöglich noch um eine behandelbare Krankheit handelt, wenn ein Hochbetagter eine Herzschwäche oder eine Lungenentzündung erleidet – beides noch vor wenigen Jahrzehnten als »natürliche Todesursachen« angesehen – oder um ein »natürliches Sterben«.
Mittlerweile hat man den Einsatz medizinischer Intensivmaßnahmen sowohl auf chronisch kranke Menschen ausgeweitet als auch auf Menschen, die an den Grenzen ihres Lebens angekommen sind. Kaum jemand stirbt ohne Infusion oder künstliche Ernährung: »Im Extremfall schockt man jemanden mit einem Tumor im Endstadium ins Leben zurück«, stellt de Ridder fest. Rund 100000 Menschen in Deutschland leben mit einer PEG-Sonde, obwohl zahlreiche Studien belegen, dass die PEG in der Endphase des Lebens weder das Leben verlängert noch die Lebensqualität verbessert. Einfach so zu sterben ist nicht mehr vorgesehen. Der Tod wird, wie so vieles, »hergestellt«.
Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre kaum jemand auf die Idee gekommen, den Rettungswagen zu rufen, wenn die Großmutter über Tage hinweg stiller wurde, weniger Appetit hatte und oft auch ahnte, dass es »zu Ende« ging. Kaum einer würde es heute wagen, solche Signale als Beginn eines Sterbens zu deuten. Nur noch in den wenigsten Familien leben mehrere Generationen zusammen und können so Erfahrungen mit Altern, Sterben und Tod machen.
Dort, wo die Traditionen schwächer werden, entstehen Freiräume, die zur Entscheidung auffordern. In der Frage, wann Leben endet und Sterben beginnt, verlassen wir uns seit langem auf medizinische Definitionen; in der Frage, wie wir mit den Toten umgehen, rücken ökonomische Aspekte in den Vordergrund. Was wir erleben, ist eine Enteignung: Technik, Konventionen und Standards regieren dort, wo wir nicht (mehr) steuern und gestalten können und wollen. Die modernen, westlichen Gesellschaften tun so, als müssten – als könnten! – sie Tod und (individuelles) Leid aus der Welt schaffen.
Der faustische Ausruf »Zwei Seelen, ach, wohnen in meiner Brust« bringt das Verhältnis der Deutschen zu Tod und Sterben auf den Punkt: Der Normalfall eines langsamen, medikalisierten Sterbens im Krankenhaus wird, wenn es um den eigenen Vater oder die Mutter geht, fast immer klaglos akzeptiert. Den eigenen Tod wollen sich die wenigsten so vorstellen, wenn man die Diskussionen um Patientenverfügungen und ein »Sterben in Würde« ernst nimmt. Für viele stellt sich die Frage, was wir verloren haben, seit es möglich ist, das Lebensende medizintechnisch immer länger hinauszuzögern.
Innerhalb nur einer Generation ist der reale Tod aus unserer Alltagserfahrung verschwunden. Die meisten Jugendlichen haben zwar schon Tausende sterben sehen – allerdings nur auf der Leinwand. Einen echten toten Körper haben die wenigsten schon einmal gesehen. Die Großmutter stirbt im Pflegeheim oder in der Klinik. Sie wird vom Bestatter abgeholt, der uns manchmal Gelegenheit gibt, sie vor der Einäscherung noch einmal zu sehen. So sehr wir im Leben auf Individualität Wert legen, so selten fordern wir als Angehörige im Umgang mit »unseren« Toten, mit unserer Trauer, dieses Recht ein. Die Ausgrenzung des Sterbens aus der Alltagserfahrung, die Auslagerung und Enteignung des Todes findet im Umgang mit den Toten einen nahtlosen Anschluss.
Die enteigneten Toten
Sobald ein Arzt den Totenschein ausgestellt hat, setzen sich die professionalisierten Abläufe unter der Regie des Bestattungsunternehmens fort. Gesetzlichen Vorschriften entsprechend dürfen höchstens zwei Tage vergehen, bis der Verstorbene »in einer dafür vorgesehenen Einrichtung« ordnungsgemäß aufbewahrt und für die Bestattung vorbereitet wird. Die Fragen, die zu beantworten sind – Art der Bestattung, Sargmodell und -ausstattung, Kleidung des Toten, Zeit und Ort der Trauerfeier – geben die in Deutschland erlaubten Bestattungsformen vor. Den meisten Hinterbliebenen bleibt nur die Zuschauerrolle. Vom Waschen und Kleiden des Toten bis zur Trauerfeier beschränken sich ihre Aktivitäten auf Wahlentscheidungen. Zwar ist dies nirgendwo vorgeschrieben, doch die wenigsten wissen, welche Handlungsspielräume sie haben – und noch weniger entschließen sich, diese tatsächlich zu nutzen. So wie wir einen All-inclusive-Urlaub buchen, können wir uns auch für eine All-inclusive-Bestattung entscheiden. Der Begegnung mit dem verstorbenen Bruder oder Vater, der Freundin oder dem eigenen Kind, gehen viele aus dem Weg. »Behalten Sie ihn so in Erinnerung, wie Sie ihn gekannt haben.« So und ähnlich lauten die Ratschläge, die in solchen Lebenssituationen aber oft mehr Schläge als Rat sind.
Wir haben gelernt, zu delegieren, uns auf Experten zu verlassen und Probleme »mental zu verarbeiten«. Doch um die Realität des Todes zu begreifen, bedarf es konkreter Erfahrung und auch der konkreten Begegnung mit dem Toten. Man sollte ihn sehen, fühlen, mit den Sinnen erfassen. Wir brauchen den Anblick der Verstorbenen, doch wir begnügen uns heute beim Abschied von einem vertrauten Menschen mit dem Anblick des blumengeschmückten Sargs oder einer Urne.
Eine normale Trauerfeier in einer deutschen Großstadt dauert kaum länger als eine halbe Stunde und findet in immer kleinerem Kreis statt, wie an den Todesanzeigen abzulesen ist: »In aller Stille wurde beigesetzt …«. Die Selbstverständlichkeit, mit der Nachbarschaften benachrichtigt werden und für den gemeinsamen Kranz sammeln, nahe Angehörige oder Freunde das Tragen des Sarges übernehmen, ist schon lange verloren gegangen. Vom häuslichen Aufbahren des Verstorbenen bis zu den Trauerzügen, die durchs Dorf führten, sind viele Rituale verblasst, die dem Tod einen Platz in der Alltagserfahrung gaben. Die Sicherheit, mit der wir wissen, was zu tun ist, wenn ein Kind geboren wird – Glückwünsche, Hilfsangebote – fehlt, wenn ein Mensch gestorben ist. Rituale wie das Tragen schwarzer Trauerkleidung, das Verschicken oder Überreichen von Beileidskarten, die Beileidsbezeugung am Grab und das Kaffeetrinken nach der Bestattung werden oft als inhaltsleere Konventionen empfunden. Sie wirken verunsichernd auf viele Trauernde, weil sie sich mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen in ein Korsett gezwängt fühlen, das ihnen nicht passt.
Der Tod und die Toten sind aus unserer Mitte verschwunden wie die Dorffriedhöfe aus den Vororten der Großstädte, die Gemüsegärten und Wochenmärkte. Längst sind Leichenwagen nicht mehr als solche zu erkennen, längst sind die Friedhöfe an die Ränder der Städte gewandert und zu Orten geworden, mit denen die meisten von uns nicht mehr viel anfangen können. Die klassische Grabstelle als letzte Ruhestätte ist zum Auslaufmodell geworden: »Wer soll das pflegen?«, »Wer hat Zeit, dorthin zu gehen?«, fragen sich viele. Und verschweigen, dass ihnen auch das »Wozu?« abhanden gekommen ist.
Kosten-Nutzen-Abwägungen und Zeitknappheit machen auch vor dem Tod nicht Halt. Eine wachsende Zahl von Menschen verfügen testamentarisch, dass ihre Asche nicht in einer identifizierbaren Grabstelle beigesetzt werden soll, sondern ohne Namensnennung oder sonstige Identitätskennzeichen auf einem zumeist als Wiese oder sonstige Naturlandschaft gestalteten Urnenfeld.
Auf welche Weise wir unsere Angehörigen bestatten lassen, ist auch eine ökonomische Frage. Immer häufiger gilt: möglichst rasch und möglichst günstig. Das Sterbegeld zählt seit 2004 nicht mehr zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Seit Jahren wächst der Anteil der Feuerbestattungen, gegenüber der klassischen Beerdigung eine kostengünstigere und pflegeleichtere Alternative. Rund 13 Milliarden Euro pro Jahr werden in Deutschland für Bestattungen ausgegeben; Heute teilen sich 4500 Betriebe den Markt, noch 1980 waren es knapp halb so viele. Für eine Standardbeerdigung liegt der Preis bei rund 4000 Euro. Inzwischen werben Betriebe mit »Niedrigpreisen«, die unter 1000 Euro liegen, und es gibt All-inclusive-Angebote, die von der Traueranzeige bis zur Gestaltung der Trauerfeier die komplette Palette der Dienstleistungen umfassen. Aber wo enden die Kosten einer Bestattung? Sind sie mit der Beerdigung beglichen oder setzen sie sich fort, wenn ein Betroffener noch Jahre lang medizinisch behandelt werden muss, weil er mit dem Tod seines Kindes nicht fertig wird?
Die Kosten der persönlichen und gemeinschaftlichen Verdrängung des Todes, des Sterbens, werden spätestens dann sichtbar, wenn der Tod uns nicht mehr als abstraktes Thema begegnet, sondern persönlich trifft. Wenn mit dem Tod eines nahestehenden Menschen oder der ärztlichen Diagnose einer unheilbaren Krankheit der Tod einbricht ins eigene Leben. Plötzlich wird klar, dass die Distanz, die wir zum Tod und Sterben kulturell geschaffen haben, umso verwundbarer macht. So wenig wir wissen, welches unser letzter Tag sein wird, so wenig können wir wissen, ob der Tod uns nicht schon morgen, übermorgen, nächste Woche einen uns nahestehenden Menschen nimmt. Wir können den Gedanken an Sterben und Tod aus dem Alltag verdrängen; entgehen werden wir Tod, Abschied und Trauer dadurch nicht.
Hilflose Trauer
Wie Sterben als Krankheit definiert wird, so gilt Trauer in unserer Gesellschaft als eine leidvolle Phase, die es möglichst rasch zu »überwinden« gilt. Trauer ist eine universelle Erfahrung, die jeder individuell und auf seine Weise erlebt. Was Trauer für uns ist, wie wir sie empfinden und ausdrücken, hat etwas mit der Zeit zu tun, in der wir leben: welche Traditionen und Freiheiten sie bietet, welche wissenschaftlichen Theorien für gültig gehalten werden. Es gibt keine verbindlichen Regeln mehr wie einst das Trauerjahr. Heute gilt »Trauerarbeit« als Bewältigung einer Krise, vergleichbar einem Krankheitsverlauf. Und wie dieser ist die Trauer ein durch und durch individueller Prozess – auch in seiner Kehrseite: Viele Betroffene machen die Erfahrung, dass sie mit ihrer Trauer allein sind, dass Kollegen, Nachbarn, selbst Freunde sich zurückziehen.
»Was soll ich denn sagen? Lieber sage ich gar nichts, bevor ich etwas falsch mache.« Es ist kein Zufall, dass uns bei der Nachricht vom Tod eines Kollegen, eines Verwandten, eines Freundes oft die Worte fehlen. Was sagt man den Hinterbliebenen? Wie geht man mit der Situation um? Auch die professionellen Kräfte, die in ihrer Arbeit im Krankenhaus oder Pflegeheim, bei der Polizei oder in der Seelsorge Trauernden begegnen, fühlen sich oft hilflos; sie würden gern etwas tun, wissen aber nicht was.
*
Wir verstecken die Toten und die Sterbenden und wissen nicht, wie wir Trauernden begegnen sollen. Diese Unsicherheit im Umgang mit ihnen verhindert, dass wir sie unterstützen können. Die Leistungsgesellschaft hat wenig Verständnis für diejenigen, die – aus welchen Gründen auch immer – den Anforderungen des Alltags plötzlich nicht mehr genügen. Trauer, Rückzug und Verlusterfahrungen werden als Defizit, als Ausnahmezustand und Abweichung von der Norm wahrgenommen – und sie werden eher mit Ausgrenzung als mit Zuwendung beantwortet.
Trauer ist etwas Intimes geworden, in das sich Fremde nicht einzumischen haben, über das man vielleicht mit dem Arzt spricht, aber nicht mit der Nachbarin oder dem Arbeitskollegen. Mit der Trauer über den Verlust eines nahestehenden Menschen zu leben ist daher oft eine einsame Sache. »Da muss ich alleine durch«, ist für viele Trauernde das Motto der Stunde.
Wir verdrängen das Sterben und wir verdrängen Trauer, Leiden, Abschiednehmen. Über Tod und Bestattung wird in den meistens Familien nicht gesprochen. Nur noch 30 Prozent der Deutschen haben eine Verfügung für den Todesfall getroffen; kaum jemand hat eine Willenserklärung zur Sicherung der eigenen Bestattungswünsche hinterlegt. Damit, dass wir auf persönliche, individuelle Gestaltung verzichten, tragen wir dazu bei, dass standardisierte Verfahren greifen. Es gilt, diesen Handlungsspielraum zurückzugewinnen. Im eigenen Interesse, im Interesse der Angehörigen, für die oft genug unklar ist, wie wir uns das Ende gewünscht hätten, wie wir uns den Abschied gewünscht hätten.
Der Umgang mit Sterben und Trauer, mit Verlust und Endlichkeit ist mehr als eine persönliche Angelegenheit. Er berührt vielmehr die für alle geltende Frage, wie eine Gesellschaft sich ihrer Toten erinnert. Woran sie glaubt, wie viel Individualität sie erlaubt und wie sie dies in Zukunft gestalten will. Mit der Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten wächst zugleich die Notwendigkeit konkreter und individueller Entscheidungen am Lebensende und im Umgang mit Tod und Trauer.
Wir sind sepulkrale Analphabeten geworden. Wir haben uns von den letzten Dingen entfremdet. Spätestens, wenn wir persönlich mit dem Tod eines nahestehenden Menschen konfrontiert sind, merken wir, dass die alten Rituale nicht mehr passen, dass viele verzichtbar geworden sind – und dass wir gefordert sind, neue zu entwickeln. In ihrem Gedicht »Memento« schreibt Mascha Kaléko: »Den eigenen Tod, den stirbt man nur; doch mit dem Tod der anderen muss man leben.« Man muss den Tod eines nahestehenden Menschen aushalten, annehmen, akzeptieren – und Trauer nicht als lästige Unterbrechung, sondern als langen Weg einer Veränderung begreifen.
Dort, wo wir unsicher sind, wo wir uns nicht auskennen, verlassen wir uns auf Experten. Wir ersetzen die eigene Sichtweise durch eine professionelle, eine funktionale Perspektive. In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ist nicht nur das Sterben, sondern auch der Umgang mit Trauer zum Thema geworden. Die wissenschaftliche Beschäftigung füllt die Lücke, die das Schwinden von Traditionen und Selbstverständlichkeiten im Umgang mit einem toten Körper und den trauernden Angehörigen hinterlassen hat. Doch weder kann der Arzt entscheiden, wie wir sterben wollen; noch kann – darf – der Bestatter vorgeben, wie wir zu trauern haben. Es geht daher um die Frage, wie wir die Handlungsspielräume füllen und die Vertrautheit mit Tod, Abschied und Trauer zurückgewinnen. Wir sind an dem Punkt, dass wir über den Umgang mit Sterben und Tod neu verhandeln müssen.
2
Die stille Revolte
Vom Unbehagen zum Ungehorsam
Das Unbehagen am Verlust der realen Erfahrung mit dem Tod, am Fehlen einer Sterbekultur, wächst seit Jahren. Die Art und Weise, wie wir mit dem Tod umgehen, ist bis in akademische Diskurse und politische Kontroversen hinein Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden. Ärzte wie Michael de Ridder stellen das Selbstverständnis der Hochleistungsmedizin in Frage, demzufolge die Aufgabe der Ärzte allein darin bestehen soll, Leben zu verlängern und zu erhalten. Als einer der wenigen, die sich öffentlich für eine andere Sterbekultur starkmachen, appelliert er an seine Fachkollegen: »Es geht darum, die eigene Sterblichkeit anzunehmen und ihr im eigenen Leben Raum zu geben.«
Vor allem in der Hospizbewegung wird das Problem seit langem wahrgenommen, und man versucht hier, neue Wege zu gehen. Ambulante und stationäre Hospizdienste bieten Begleitung für Sterbende und werden dabei in Deutschland von mehr als 80000 ehrenamtlichen Kräften unterstützt. Im medizinischen Bereich wurde – auch angesichts der großen Resonanz auf die Hospizbewegung – ebenfalls reagiert: Hier entwickelte sich in den letzten Jahren die Palliativmedizin, die mit neuen Formen der Schmerzbekämpfung und Pflege am Lebensende die erkannten Missstände beheben soll.
Das öffentliche Unbehagen kommt nicht nur in der Debatte zur Sterbekultur zum Ausdruck. Wir befinden uns in Deutschland auch inmitten einer stillen Revolte gegen die Enteignung und Entpersönlichung von Tod und Trauer. Diese Revolte richtet sich gegen eine Verregelung, deren Wurzeln zum Teil weit in die Vergangenheit zurückreichen und die den Lebensstilen und -bedürfnissen unserer Zeit nicht mehr entspricht.