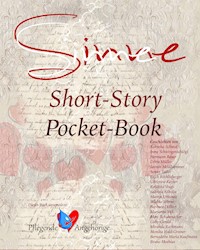5,99 €
5,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Es gibt keine Grenzen außer denen, die wir uns setzen.« Seit Monden deuten die Schamanen die Zeichen der Natur. Flüsse bluten. Leuchtende Fische schwimmen gegen den Strom. Auch die Häuptlingstochter Merana folgt ihrem Verlauf in den Norden. Denn dort, im Herz der Nebelsümpfe, wartet eine Göttin, die Merana ihr Schicksal offenbaren wird und sie zur Anführerin ihres Stammes machen könnte. Doch der Glaube ist trügerisch … High Fantasy in der Steinzeit über Selbstbestimmung, Religion und erwachende Magie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Kornelia Schmid
Die Stimme im Licht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbib-liografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
© 2025 Kornelia Schmid
Impressum:
Kornelia Schmid, Eichendorffstraße 55, 92331 Parsberg
Lektorat: Dr. Florian Schulz
Korrektorat: Dr. Lisa Seibold
Umschlaggestaltung: Saskia Ziegenbalg, Bildnachweis: unter Verwendung von Motiven unsplash.com: © digit42 © picsbyjameslee, freepik.com: © starline
Inhalt
Die Stimme im Licht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Epilog I
Epilog II
Nachwort
Über die Autorin
Leseprobe
Prolog
Die Mitte des Teichlandes, 11 Jahre vor dem Kampf in den Nebeln
Von weitem wellten sich grüne Hügel. Manchmal blitzen Felsen auf, dahinter lagen funkelnde Teiche. Es war fruchtbares Land, also schlug der Stamm hier seine Zelte auf.
Die Sonne versank gelb hinter dem Horizont und die Neumondnacht brachte Dunkelheit mit sich. Der Junge kuschelte sich an seine Eltern, ohne schlafen zu können. Wind zerrte an den Zelten und das Rascheln der Gräser klang, als würden dort körperlose Stimmen wispern. Eine Weile lauschte er ihnen und fragte sich, was sie ihm erzählten. Doch er konnte sich keinen Reim darauf machen.
Also kroch der Junge hinaus. Anstelle von Finsternis erwarteten ihn tausend grüne Feuer, die in einem merkwürdigen Tanz über die Hügel hüpften. Der Junge wusste, dass es Irrlichter waren – doch er hatte nie so viele auf einem Fleck gesehen. Noch hatten sie ihn nicht entdeckt – es konnten also nicht die Menschen gewesen sein, die sie angelockt hatten.
Der Junge nahm sich fest vor, standhaft zu bleiben und ihnen nicht zu folgen, egal, wie verlockend es scheinen mochte. Und mit dieser Überzeugung wagte er es, sich ihnen vorsichtig zu nähern.
Grün wandelte sich zu orange und die Lichter begannen zu flackern, als wären sie echte Feuer. Doch der Junge ignorierte sie und steuerte den Punkt in der Landschaft an, wo sie besonders zahlreich zuckten. Sie wichen zurück, wohl um ihn auf gefährlicheres Terrain zu führen. Aber er hockte sich nur ins Gras und untersuchte den Boden.
Seine Hände gruben sich in feuchte Erde. Sie war seltsam warm. Der Junge zog die Brauen zusammen. Der Herbst war angebrochen und heute war ein kühler Tag gewesen. Wie konnte aus dem Boden Hitze steigen und das noch dazu in der Nacht?
Als er noch ein wenig weiter grub, sah er es. Feine Risse zogen sich durch den Untergrund. Und anstelle von Schwärze zuckten dort gleißende Farben. Es war ein Strahlen, wie er es noch nie gesehen hat: Rot, gelb, violett und blau wie die Blüten einer Sommerwiese, jedoch viel gleißender. Der Junge schreckte zurück. Er betrachtete das merkwürdige Phänomen noch einige Herzschläge lang, bevor er herumfuhr und zurück zum Zelt seiner Eltern rannte.
Als der Junge dem Stamm am nächsten Tag von seiner Entdeckung berichtete, glaubten die Leute ihm nicht. Das Erdreich war dunkel, wie es sein sollte, und natürlich waren am Tag auch alle Irrlichter verschwunden. Vielleicht war es an der besagten Stelle tatsächlich ein wenig wärmer, doch sie lag auch mitten in der Sonne, nicht wahr?
Nur die Schamanin vertraute den Worten ihres Sohnes und versetzte sich in Trance, um von den Göttern einen Rat zu erbitten. Und während sie mit geschlossenen Augen im Rauch verbrennender Kräuter tanzte, wühlte der Junge verängstigt im Boden, pflückte Würmer und Käfer heraus, fand jedoch nichts Verdächtiges. Also alles nur ein Traum?
Die Götter jedenfalls schwiegen in dieser Angelegenheit und der Junge traute sich in dieser Nacht nicht hinaus. Doch ein Blick durch die Ritzen des Zeltes verriet ihm, dass die Irrlichter allesamt zurückgekehrt waren. Vielleicht waren sie sogar noch zahlreicher als zuvor.
Am nächsten Tag kam der erste Nebel. Es waren blasse Bahnen, die über dem Gras trieben. Kein Wind wehte – dennoch schienen sie sich zu bewegen, als würde eine Böe sie mitreißen. Die Schamanin ordnete an, den Göttern vorsichtshalber ein Opfer zu erbringen. Und so wurden die besten Jäger ausgeschickt, um ein Tier zu erlegen.
Als sie mit einem wilden Ziegenbock zurückkehrten, war der Stamm in Aufruhr. Der Junge hatte das Licht im Boden wiedergefunden und zeigte die flackernden Risse jedem, der sie sehen wollte. Viele Leute schrien auf den Häuptling ein, doch er mahnte sie zur Ruhe, während die Schamanin eilig das Opfer vorbereitete.
Sie schlachtete den Bock und vergoss sein Blut über dem Leuchten. Während es zäh in die Ritzen sickerte, sang sie die Götter an und bat um ein Zeichen.
Und als die Dunkelheit einbrach, kamen die Irrlichter zurück und wirbelten verzückt über die Risse im Boden. Ist das das Zeichen?, wollte der Junge wissen, doch die Schamanin konnte es ihm nicht sagen. Durch die dichten Nebel waberten die grünen Feuer wie Baumgeister aus den Geschichten.
Diesmal war der Junge nicht der Einzige, der nicht schlafen konnte. In vielen Zelten saßen die Leute unruhig beisammen und befragten ihre Ältesten nach ähnlichen Vorkommnissen in der Vergangenheit. Doch die Greise erinnerten sich an nichts dergleichen und so blieb die Furcht bestehen.
Die Morgendämmerung flammte wie rotes Feuer. Die Nebel sogen die Sonnenglut auf und verwandelten die Landschaft in ein unheimliches Meer aus Licht.
Und dann brach der Boden endgültig auf. Hitze strömte heraus, gefolgt von einem vielfarbigen Leuchten, dass sich in den Dunst ergoss. Und die Menschen, die von dem unheimlichen Schein berührt wurden, brüllten. Der Junge und seine Mutter aber rannten.
Kapitel 1
Im Schluchtenland, Saso Nebelläufer
Der Häuptling des fremden Stammes hieß Wotto, was an und für sich völlig in Ordnung war. Kräftiger Klang, einfach zu merken. Dass ihm seine Leute allerdings den Namen Haudrauf – kräftiges Wort und einfach zu interpretieren - verpasst hatten, stimmte Saso alles andere als zuversichtlich. Wotto war ein gutes Stück größer als er selbst und seine nackten, muskelbepackten Oberarme verrieten, dass er in der Tat wohl öfter auf Dinge – und vermutlich auch auf Lebendiges – draufhaute. Als wäre das nicht genug, schleppte er eine bodenlose Unverschämtheit an Waffe mit sich herum.
Saso selbst, bescheiden wie er war, hatte sich einen eleganten, gekonnt bemalten und insgesamt ziemlich raffiniert aussehenden Speer gebastelt, während Häuptling Haudrauf mit einem Hammer daherkam. Saso schluckte. Mit Oldo Brüller, seinem letzten Gegner, hatte er nur bis aufs erste Blut gekämpft. Aber wie hart musste man mit einem verdammten Hammer draufhauen, damit das Opfer – also Saso – blutete? Mit einer kleinen Schnittwunde würde dieser Kampf hier nicht erledigt sein.
Saso, du bist verrückt, sagte er sich, als wäre das etwas Neues. Denn das war es nicht.
Nun denn, die Sache hatte bestimmt auch etwas Gutes. Saso schluckte. Saso schluckte noch einmal. Nur einfallen wollte ihm einfach nichts. Immerhin war es ein schöner Morgen. Die Sonne leuchtete gelb am Horizont und ließ die Tautropfen im Gras glitzern. Zwischen ihnen hingen schimmernde Spinnennetze. Die Felsen im Schluchtenland formten ein einprägsames Muster. Die Bäume an den Hängen … Ach, verdammt. Saso wusste, dass er sich mit der Betrachtung der Landschaft nur selbst ablenken wollte. Ich schinde Zeit. Und das macht mich zu einem Feigling. Pah. Feige zu sein verstieß gegen seine Prinzipien. Denn ein paar davon durfte man sich selbst als Verrückter erlauben.
Haudrauf stapfte auf ihn zu. Hinter ihm standen die Leute aus seinem Stamm: zwei hochgewachsene Schamanen mit Masken ganz vorne, dahinter in Berglöwenpelze gehüllte Frauen und Männer, die sich auf Knüppel stützen und Saso grimmig musterten. Und das war genau der Haufen, den anzuführen er sich vorgenommen hatte. Wenn alles gutging. Was, Saso blickte auf den Hammer, nicht unbedingt wahrscheinlich war.
»Nun, also …« Er räusperte sich. »Ich, Saso Nebelläufer, fordere hiermit -«
»Du bist der Kahragon?«, unterbrach ihn Haudrauf. Sogar seine Stimme hatte etwas Hämmerndes. Er blieb vor Saso stehen und musterte ihn von oben bis unten – was schnell erledigt war, denn Saso war nicht sonderlich groß.
»Ähm ja, so nennen sie mich«, sagte Saso.
Haudrauf pfiff anerkennend. Die Leute hinter ihm raunten. Die grimmigen Gesichter waren prompt weniger grimmig, sondern vielmehr neugierig, vielleicht sogar ein wenig aufgeschlossen. Was es einfacher machen würde, diesen Haufen zu führen – wobei das ja egal war angesichts dieses dämonenverseuchten Hammers.
»Und, bist du wirklich durch die Nebel gelaufen?«, fragte Haudrauf.
Saso zuckte mit den Schultern. »Gegangen, gelaufen, um mein Leben gerannt … was auch immer.«
Haudrauf legte den Kopf schief. »Und, was hast du dort gesehen?«
Saso hob die Schultern. »Na Nebel.«
»Und sonst?«
»Man sieht nichts im Nebel.« Saso lächelte seinen Kontrahenten an, als wäre er ein Kind, das die Welt nicht versteht. Ein wenig Einschüchterung vor dem Kampf konnte schließlich nicht schaden. Zumindest glaubte er das. Denn Einschüchterung hatte noch nie zu seinen Talenten gehört. Wer einschüchtern wollte, musste groß sein, muskelbepackt und einen Hammer schwingen.
Haudrauf spuckte auf den Boden. »Hat sich also nicht gelohnt.«
Lohnt sich nicht alles im Leben? Außer vielleicht ein Kampf mit Wotto Haudrauf … aber sonst …
»Na ja, ich habe einen ausgefallenen Namen bekommen.« Saso grinste kurz.
Haudrauf nickte heftig. »Stimmt. Gut gemacht.«
Einen Moment lang blickten sie sich voll gegenseitigen Respekts in die Augen und Saso hing der Vorstellung nach, er könnte sich einfach dem Stamm anschließen und mit Haudrauf ein paar Geschichten am Lagerfeuer austauschen. Dann räusperte er sich. »Wo war ich?«
»Du wolltest mich zum Zweikampf herausfordern, um Häuptling meines Stammes zu werden«, sagte Haudrauf hilfreich und schulterte seinen Hammer.
Saso schluckte. Und schluckte noch einmal. »Ah, ja, genau. Das wollte ich.«
»Blöde Idee«, bemerkte Haudrauf.
So viel Weisheit hätte ich dir gar nicht zugetraut.
»Ja, das stimmt.« Saso sah sich gerne als ehrlichen Menschen, deswegen kam er nicht umhin, seinem Gegner in dieser Angelegenheit recht zu geben.
Haufdrauf runzelte die Stirn. »Dann lass es doch.«
Saso schloss die Finger fest um seinen Speer. »Geht nicht. Ich habe jemandem versprochen, Großes in meinem Leben zu vollbringen.«
»Deiner Mutter?«
Verdammt. Wahrlich ein weiser Mann. »Ähm«, sagte Saso.
Haudrauf pfiff noch einmal. »War bestimmt eine große Frau.«
»Nein, kleiner als ich.«
Saso wechselte den Speer in die linke Hand. Die meisten Leute fanden das komisch, aber er konnte ihn so einfach besser halten und es brachte die Gegner aus dem Konzept.
»Also dann«, sagte Haudrauf.
»Also dann«, sagte Saso.
Er brachte seine Waffe in Position, sah wie Haudrauf mit dem Hammer ausholte, warf sich zur Seite und spürte einen Schlag auf den Kopf, der ihm Schwärze vor die Augen trieb.
»He, Kahragon.«
Oh, es hatte also etwas Gutes. Genau wie er vermutet hatte. Er hörte die Stimme seiner Mutter. Ihren lieblichen Klang. Wie die Laute der Vogelgötter. An die er eigentlich nicht glaubte. Aber wenn es Vogelgötter gäbe, dann wäre seine Mutter sicherlich bei ihnen auf ihren Geisterbäumen. War sie aber nicht.
»Kahragon? Nebelläufer?« Jemand zupfte an seiner Schulter. »Wie hieß der Kerl mit Vornamen?«
»Soso?«
»Nein, Saso«, würgte er hervor. Seine Mutter sollte das wissen. Innerlich seufzte er. Tot war er schon mal nicht. Außer es gab doch ein Jenseits und seine Mutter war nicht hier. Was er für unwahrscheinlich hielt. Natürlich könnte es auch verschiedene Jenseitse geben und er war in dem gelandet, wo niemand wusste, wie er hieß. Welche Form grausamer Marter wäre es, bis in die Ewigkeit mit Soso angeredet zu werden? Zu schrecklich für alle Götter, von denen ihm die Schamanen erzählt hatten. Also war er wohl oder übel noch am Leben. Wie war denn das passiert?
Saso blinzelte vorsichtig. Über ihm hing ein Frauengesicht, das nur zur Hälfte mit einer roten Maske bedeckt wurde. Immerhin, was er sah, war hübsch. Hübsche Lippen, ein hübsches Kinn. Aber warum kümmerte ihn das überhaupt?
»Hallo«, sagte Saso. Seine Stimme klang so feierlich wie das Gebrüll der Ziegen.
»Ich glaube, dem geht’s gut«, sagte eine andere Stimme.
»Mir geht’s gut?«, wiederholte Saso. Hinter seiner Stirn summte ein Wespenschwarm, der immer wieder beharrlich gegen seine Schädeldecke schwirrte und sie löcherte. Bunte Punkte tanzten vor seinen Augen und ließen das Gesicht der Schamanin verschwimmen.
»Na ja, Wotto bemüht sich inzwischen, eher zu stupsen als zu hauen«, sagte sie.
»Weiser Mann«, krächzte Saso. Wieder einmal. Dieser Wotto hatte es drauf. Haute drauf … hatte … Oh, mein Kopf.
»Man merkt, dass Wotto seinen Schädel erwischt hat«, bemerkte die andere Stimme richtigerweise.
Saso drehte den Kopf ein wenig und machte die Silhouette einer weiteren Gestalt neben sich aus. Ein Mann mit demselben rotbraunen Haar wie die Schamanin. Geschwister vielleicht? Zumindest trug auch er eine Halbmaske, doch sie war schwarz. Ah, jetzt wusste er es wieder. Die beiden hatten bei dem Kampf in der ersten Reihe gestanden. Wottos junge Schamanen.
»Erwischt? Eingeschlagen, würde ich sagen«, erwiderte die Frau.
»Dann hätte er ja ein Loch darin«, sagte der Mann.
»Da sollte ein Loch sein. Siehst du das Blut?« Sie zog Saso an den Haaren und hob seinen Kopf damit ein Stück in die Höhe. Blitze zuckten vor seinen Augen und er brüllte auf. Dann sank er wieder zurück.
»Ist wohl nicht von ihm«, sagte der Schamane.
»Von wem dann?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Es ist seines. Es hat gespritzt, als Wotto ihn getroffen hat.«
»Aber wenn da doch kein Loch ist. Wie soll es dann spritzen?«
»Aber da sollte ein Loch sein. Oder glaubst du, ich habe mir das eingebildet?«
»Es fühlt sich an, als wäre da ein Loch«, pflichtete Saso der Schamanin bei. »Jedenfalls würde ich das sagen, wenn ich wüsste, wie es sich anfühlen müsste, wenn da ein Loch wäre.«
»Da ist aber kein Loch«, sagte der Mann.
Die Frau schlug ihrem Bruder mit der Faust in die Seite – vielleicht als eine Art stummer Protest. Sasos Blick blieb an der Geste hängen, dann riss er sich los und versuchte sich aufzusetzen. Die Schamanin packte ihn beherzt am Hemd und zerrte ihn so vorwärts. Saso stöhnte. Loch. Kein Loch? Er war noch am Leben.
Um ihn herum wuchs Gras. Der Tau war verschwunden und die Sonne stand mittagsgrell über ihm. Die Konturen der Felsen zeigten sich nun unspektakulär gleichförmig und einige Insekten schwirrten durch die Luft.
»Wo bin ich?«, fragte er.
»Genau da, wo der Häuptling dich erwischt hat«, sagte der Mann.
»Dir den Schädel eingeschlagen hat, um genau zu sein«, ergänzte seine Schwester.
»Aber da ist doch kein -«
Die Schamanin schnaubte laut. »Also, jedenfalls kannst du bleiben, bis du wieder auf den Beinen bist. Dann solltest du allerdings weiterziehen. Wotto Haudrauf duldet keine Konkurrenten in seinem Stamm. Nicht einmal so hoffnungslose wie dich.«
»Verstanden«, murmelte Saso. »Dann suche ich mir eben einen anderen Stamm.«
Die Lippen der Frau zuckten kurz. »Gute Idee, solange du nicht wieder den Häuptling herausforderst.«
Wahrscheinlich war es am besten, nicht darauf zu antworten. Wenn er zugab, dass er genau das vorhatte, würden sie ihn für verrückt halten. Andererseits wäre das nicht mehr und nicht weniger als die Wahrheit.
Das kühle Wasser prickelte beinahe schmerzhaft auf seiner Kopfhaut, aber es wusch das Blut davon. Saso kniff die Augen zusammen und tauchte den Kopf noch einmal unter. Als er blinzelte, waren die Wogen des Flusses rot. Das konnte unmöglich alles von ihm sein.
Die Abendsonne glitzerte auf den Wellen. Am anderen Ufer leuchteten die ersten Irrlichter. Saso sah hinüber. Als hätten sie seinen Blick bemerkt, zuckten sie und hüpften davon. Merkwürdig, dass sie nicht einmal versuchten, ihn anzulocken. Offenbar hatten sie Besseres zu tun. Er beobachtete sie noch eine Weile, wie sie durch das hohe Gras flussaufwärts sprangen. Schließlich waren sie verschwunden. Heute würde er ihnen nicht folgen.
»Solltest du aber.«
Ah, sie sprach wieder zu ihm. Saso war nicht in der Stimmung zu antworten. Er strich seine nassen Haare zurück und wunderte sich noch einmal über die seltsame Färbung des Wassers, die einfach nicht davonschwimmen wollte.
Dann zuckte er mit den Schultern, sammelte seine Habseligkeiten zusammen und erhob sich. Er blickte nach Westen und beschattete die Augen mit der Hand. Die Sonne hing über den Felskämmen. Wind fegte durch die Landschaft und ließ ihn frösteln.
Wenn seine Informationen stimmten, waren im Süden die Stämme von Häuptling Fullo Todpflücker, Moko dem Baum und Nurno Schimmerfuß unterwegs. Und wahrscheinlich noch andere, von denen er nur nichts gehört hatte. Gegen keinen der drei Männer hatte er schon einmal gekämpft, aber sie waren alle berüchtigt.
Saso seufzte. Sein Kopf schmerzte noch immer. Er schnippte mit den Fingern und blaue Funken erschienen auf seiner Haut. Saso drückte sie an die Stelle, wo Wotto Haufdrauf draufgehauen hatte und schloss einen Moment lang die Augen. Seine Haut pulsierte angenehm und der Schmerz zog davon. Einfach so. Es hat dermaßen viele Vorteile, verrückt zu sein, dachte Saso. Wenn die anderen das wüssten, würden sie alle liebend gerne ihren Verstand zugunsten seltsamer Stimmen und verwirrender Lichtsprengsel hergeben.
»Ich bin keine seltsame Stimme.«
»Hm«, sagte Saso.
»Und deine Magie ist auch nicht seltsam. Denk doch mal nach, Junge.«
»Nicht jetzt. Die Kopfschmerzen sind gerade erst weggegangen«, sagte Saso.
»Die Zeit ist reif. Die Spalte kann nun versiegelt werden. Ich brauche nur genug Blut dafür.«
»Klappe, Fini«, sagte Saso und folgte dem Verlauf des Flusses.
»Falsche Richtung!«
Die Zelte der Siedlung Wottos blieben hinter ihm zurück. Als Saso sich noch einmal umsah, hatten die Felsen sie bereits geschluckt und die Gegend schien verlassen. »Ich brauche einen Stamm«, sagte er.
»Du hast aber keinen. Nach all den Jahren hast du es immer noch nicht geschafft, Häuptling eines Stammes zu werden.«
Saso schnaubte. Warum musste sie es ihm auch noch unter die Nase reiben? »Im Süden gibt es noch ein paar Kandidaten. Diesmal wird es klappen. Ganz bestimmt.«
»Hör zu, es ist viel passiert seitdem.«
Saso rollte mit den Augen. »Natürlich ist viel passiert. Ich war, ähm, zwölf oder sowas?«
»Wenn es um Menschen geht, die nicht mehr als einen Funken Magie im Blut besitzen, braucht man tatsächlich einen ganzen Stamm, damit das Ritual gelingen kann. Findest du aber Menschen, die mehr Kraft in sich tragen, würden wenige von ihnen schon reichen.« Fast wirkte es, als würde die unsichtbare Stimme Luft holen. »Diese Personen sind einfach zu erkennen. Du musst nur darauf achten. Die Magie ist bei ihnen -«
Ein Windstoß wirbelte durch seine Haare. Saso hielt inne. »Ich verstehe nichts von dem, was du sagst.«
»Magie, sage ich! Verwirrende Lichtsprengsel hast du es genannt. Oder warum glaubst du, hast du Haufdraufs Schlag überlebt?«
»Also, das habe ich mich auch schon gefragt. Aber du bist nicht hilfreich, Fini.«
»Hör auf, mich so zu nennen.« Die Stimme schwieg einen Moment, er hörte lediglich ein leises Grollen in seinem Kopf. Dann meldete sie sich mit einem lautstarken Seufzen zurück. »Finde Leute, die so sind wie du.«
Saso lachte auf. Als ob es jemanden gäbe, der so war wie er.
»Ich bin hilfreich, Saso«, sagte die Stimme. »Ich werde dir die richtigen Leute schicken. Du wirst sehen.«
»So? Ich dachte immer, du sprichst nur zu mir und zu niemandem sonst?«
»Sei kein Trottel, Junge.«
Saso zuckte mit den Schultern und marschierte weiter. Die Dunkelheit würde bald hereinbrechen und mit ihr kam das Licht. Seltsame Zeiten, würde er sagen, wenn sie nicht schon immer seltsam gewesen wären. Zumindest für ihn.
Kapitel 2
Am See Morror, Merana
Sie bauten hinter dem Schilf am Ufer ihre Zelte auf. Der Stamm nannte den See Morror, was in der Alten Sprache so viel wie Der Große bedeutete. Merana fand, dass das nicht der schlaueste Name für einen – zugegeben großen - See war, aber zumindest verstand ihn jeder. Sie würden hier genug Nahrung finden.
Heute Nacht waren die Irrlichter auf dem Wasser verloschen und nur der Schein des Vollmonds tanzte auf den Wellen. Unter der Oberfläche schossen die letzten leuchtenden Fische durch die Wogen, immer weiter in Richtung Norden. Dort, wo manchmal dunkle Strudel die Flüsse aufwirbelten, während Blut in ihren Tiefen trieb. Merana lauschte dem Summen der Schamanin, das sich unter das Plätschern und das Zirpen der Grillen mischte. Dann war es auf einmal still.
»Dort«, sagte Urla. Die Schamanin war die älteste Person, die Merana je gesehen hatte. Sie trug ihr schlohweißes Haar offen und bedeckte das Gesicht mit einer federgeschmückten Maske. Nur im Dämmerlicht eines Zeltes zeigte sie ihre zerfurchte Haut. Die Kette aus Schneckenhäusern an ihrem Handgelenk klapperte, als sie wild auf einen Punkt hinter Merana zeigte.
Merana wandte den Kopf. Ein einsamer Lichttupfen hüpfte in der Ferne auf und ab. Orange wie ein Feuer. Ein Irrlicht, das ihnen vorgaukelte, ein Mensch zu sein, damit sie ihm folgten? Oder tatsächlich ein Mensch mit einer Fackel? Nun, ein Neuankömmling mitten in der Nacht wäre merkwürdig, aber nicht unmöglich. Merana war schon einigen Fremden begegnet. Manchmal tauschten die Stämme Werkzeuge miteinander. Manchmal auch Menschen. Ganz freiwillig, natürlich. Männer folgten einer Frau in einen anderen Stamm oder Frauen einem Mann. Merana strich sich die Haare hinter die Ohren und beobachtete den Lichtschein und seine Spiegelung im Wasser.
Sie hatte darüber nachgedacht, wie es wäre, mit einem Mann in einen anderen Stamm zu gehen. Natürlich nicht sofort, irgendwann vielleicht. Es würde aber bedeuten, ihren Vater hier zurückzulassen. Und ihre Lehrmeisterin Urla. Und alle, die sie kannte. Und überhaupt ihren bisherigen Lebensweg. Dann könnte sie alles sein, was sie wollte. Nun, vielleicht nicht alles. Natürlich nicht. Sie war die Tochter eines Häuptlings, aber sie würde niemals selbst Häuptling sein. Die Gefährtin eines Häuptlings, das wäre möglich. Merana atmete aus. Viele Häuptlinge waren mit ihren Schamaninnen zusammen, also sollte sie wohl dafür sorgen, dass sie tatsächlich eine wurde. Merana schloss einen Moment lang die Augen.
Der Aufruhr in der Nähe verriet, dass tatsächlich ein Fremder aufgetaucht war. Merana erhob sich und drängte sich durch die Menge, bis sie ganz vorne stand.
Der Neuankömmling trug eine Maske, an der getrocknete Blätter befestigt waren. Auf seinem Rücken war ein Speer festgebunden. Wahrscheinlich benutzte er ihn nur selten – das hatten Schamanen normalerweise nicht nötig. Außerdem hatte er drei grimmig dreinblickende Krieger als Eskorte dabei. Sie blieben ein Stück hinter ihm.
Meranas Vater ging dem Fremden entgegen. »Verstoßen sie neuerdings sogar Schamanen?«
»Aber nicht doch. Ich bin nur ein Bote«, sagte der andere. Seine Maske hatte keinen Schlitz zum Sprechen und so klang seine Stimme seltsam dumpf.
»Mitten in der Nacht?«, fragte Meranas Vater. Moko, genannt Der Baum, überragte den Fremden um gut zwei Köpfe, obwohl dieser nicht unbedingt klein war.
Merana fragte sich unwillkürlich, warum dieser große Mann die Schamanenlaufbahn eingeschlagen hatte, wo er doch auch als Jäger oder sogar Häuptling hätte erfolgreich sein können. Nun, man musste sicher nicht alle Menschen und ihre Beweggründe verstehen. Es fühlte sich nicht jeder zu Großem berufen. Und viele hielten Schamanen für groß genug. Merana dachte nur immer: Den ganzen Tag singen, tanzen und Heilpasten anrühren? Das klang nicht sonderlich spannend. Würde die Göttin tatsächlich mal vernünftig antworten, wäre das natürlich etwas anderes, aber bisher hatte Merana ihre Stimme nie gehört …
Der Schamane straffte sich sichtlich. »Mein Häuptling zieht es vor, unmittelbar zu reagieren.«
Moko verschränkte die Arme. »Aha. Und wer ist dein Häuptling?«
»Ihr befindet euch hier im Gebiet von Fullo Gundoran.«
Drachenscheiße. Der Stamm des Todpflückers war mindestens doppelt so groß, wahrscheinlich sogar größer, und in den letzten drei Jahren beängstigend aggressiv geworden. Allerdings hatte ja niemand ahnen können, dass er jetzt gerade am Morror hockte. Sie sollten besser den Rückzug antreten, vielleicht mit der Bitte, heute Nacht noch hierbleiben zu dürfen. Wenn sie dem breiten Fluss nach Osten folgten, würde es bestimmt auch noch genug Nahrung geben.
Aber Meranas Vater zuckte mit den Schultern. »Nie gehört.« Was natürlich gelogen war. Jeder hatte vom Todpflücker gehört.
Der Moment der Stille zog sich in die Länge. Dann schüttelte der Schamane den Kopf, sodass die Hölzer an seiner Maske klapperten. »Der Gundoran! Fullo Todpflücker.«
»Pflücker? Wer soll das sein?« Meranas Vater bleckte die Zähne zu einem bissigen Grinsen. »Und selbst wenn: Er ist drüben am Ufer. Wir sind hier. In einem Mond ziehen wir vielleicht wieder weiter.«
Obwohl Meranas Vater einen Schritt auf den Schamanen zukam und nun unmittelbar vor ihm stand, musste man dem Fremden zugutehalten, dass er keinen Deut zurückwich. Im Gegenteil. Er blickte gelassen zu ihm auf. Masken waren schon etwas Praktisches. Das spricht auf jeden Fall für die Schamanenlaufbahn, dachte Merana.
»Der Gundoran hat einen Pakt mit dem Wassergott geschlossen. Der See gehört ihm«, sagte der Fremde.
Ihr Vater runzelte die Stirn. »Ich dachte mit einem Erdgott?«
»Mit dem auch.« Der Schamane zuckte ein wenig. »Hast du nicht gesagt, du hättest noch nie von ihm gehört?«
»Wir glauben nur an die eine Göttin«, rief Urla laut.
Der Fremde wandte nicht einmal den Kopf. »Trotzdem müsst ihr dem Gundoran Tribut entrichten, solange ihr hier seid.«
»Tribut?«, wiederholte Merana. »Wir sollen ihm unsere Sachen schenken? Einfach so?« Das war die verrückteste Idee, von der sie je gehört hatte. »Warum?«
Ihr Vater spuckte dem Schamanen vor die Füße. »Verzieh dich, Blättergesicht.«
Der Fremde grunzte. Merana kratzte sich am Kopf. Sie grunzte niemals, also was wollte der Kerl mit diesem dämlichen Laut ausdrücken? Dass er ein Trottel war?
»Der Gundoran hat diese Antwort in seiner Weisheit vorausgesehen. Deine Beleidigung muss mit Blut vergolten werden.«
»Die Göttin verbietet solch barbarische Sitten«, sagte Urla.
Jetzt sah sie der Schamane doch an. Wie hatte er die Blätter eigentlich so gut festgepappt? Und gingen die nicht ständig kaputt? Ein ziemlich unnützes Teil, diese Maske. Was definitiv gegen die Schamanenlaufbahn spricht, dachte Merana.
»Oh, wir sind keineswegs Barbaren. Der Todpflücker tötet seine Gegner nicht … meistens. Es wird nur bis zum ersten Blut gekämpft. Unter den Augen der Götter – an welche auch immer ihr glaubt.«
»Was bekommt der Gewinner?«, fragte Meranas Vater.
O nein. Er spielt doch nicht mit dem Gedanken, sich darauf einzulassen, oder?
»Den Stamm des Verlierers. So ist es Sitte.«
»Und wenn ich mich weigere?«
Gut so. Weigere dich. Und dann verschwinden wir von hier.
»Ich fürchte, dann wird unser Stamm deine Beleidigung anderweitig sühnen. Blut wird fließen, so oder so.«
Barbaren. Durch und durch. Merana beschloss, sich niemals einen Gefährten aus dem Stamm des Gundorans auszuwählen. Andererseits … so groß war die Auswahl in ihrem Fall vermutlich nicht. Garo, dieser Idiot, hatte ihr vor einigen Wochen klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass jemand von ihrem Liebreiz bei der Auswahl eines Gefährten wohl einige Kompromisse machen musste. Kompromisse wie ihn.
Die Kiefermuskeln ihres Vaters bewegten sich einen Moment. »Ganz schön mutig, mit solchen Worten hierher zu kommen, Blättergesicht«, sagte er langsam.
Der Fremde grunzte erneut. »Jeder Schamane steht unter dem Schutz der Götter … Sacknase.«
»Wie?«, schnappte ihr Vater.
Merana zog die Brauen zusammen und betastete ihr Gesicht. Garo – was für ein Volltrottel - hatte ihr außerdem einmal gesagt, sie sähe aus wie ihr Vater, nur in dünn, bleich und bartlos. Ach ja und klein. Klein natürlich auch. Letzteres war in diesem Fall keine Beleidigung, sondern nur eine logische Konsequenz. Ihr Vater war der größte Mann, den sie je gesehen hatte und seine muskelbepackten Arme waren so dick wie Baumstämme. Seine Nase wiederum … war genauso dick. Und na ja, vielleicht sah sie auch ein wenig aus wie ein Sack. Ihre Finger fanden den Knoten, der ihr eigenes Antlitz zierte und kniffen ihn ärgerlich zusammen. Verdammt, ganz so rund wie bei ihrem Vater war die doch nicht, oder?
Merana verengte die Augen und schob Spucke in ihrem Mund hin und her, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hatte. Dann spitzte sie die Lippen und zielte auf das Blättergesicht. Ihr Speichel klatschte unbemerkt auf den Boden. Merana mahlte mit den Zähnen. Unkrautvisage. Kackdickicht. Fliegenfriedhof. Dummschwätzer, nein, Dungschwätzer.
Ihr Vater spuckte mit mehr Erfolg als sie einen gewaltigen Schwall direkt vor die Füße des Schamanen. »Also schön, dann sag dem Pflückscheißer – oder wie auch immer er sich nennt -, dass ich seine Herausforderung annehme. Wir kommen morgen zu ihm. Im Licht der Göttin.«
Der Schamane machte einen Schritt rückwärts und verneigte sich elegant. »Es wird den Gundoran freuen, das zu hören.«
»Blutdurstiger Drecksack«, brummte Urla, allerdings so leise, dass es kaum jemand hören konnte. Merana pflichtete ihr im Stillen bei.
Sie beobachtete die Fackel des Schamanen, bis die Nacht das hüpfende Feuer gänzlich verschluckt hatte.
Die Luft über dem Morror war schwer von Feuchtigkeit. Weiße Schwaden hingen reglos über der Wasseroberfläche. Nur ein matter Schimmer Morgenlicht fiel durch den Dunst auf den Stamm herab, der lärmend am Ufer entlang marschierte. Urla sang. Ihre Stimme brach mehrere Male beinahe, aber für eine alte Frau legte sich die Schamanin wirklich mächtig ins Zeug. Merana hoffte nur, dass ihr Gebet wirkte und die Göttin ihnen gewogen machte.
Merana strich sich die feuchten Haare zurück und holte zu ihrem Vater auf. Moko schritt voran. Und wenn er schritt, dann schritt er schnell. Alle anderen mussten irgendwie sein Tempo halten, auch wenn sie mit kürzeren Beinen gestraft waren. So ziemlich jeder hatte kürzere Beine als er.
»Mir gefällt das nicht.« Merana sprach leise, denn sie wollte mit ihren Worten weder den Stamm verunsichern, noch die Göttin verärgern. Denn Meranas Zweifel konnte man durchaus so auslegen, dass sie nicht auf die Führung der Göttin vertraute, oder?
Ihr Vater zuckte mit den Schultern. »Ich habe schon ein Dutzend Häuptlinge besiegt.«
Merana schnitt eine Grimasse. »Drei, um genau zu sein.«
Er nickte. »Und die waren wirklich harte Kerle, das kann ich dir sagen.«
Konnte sie nicht beurteilen. Bei seinem letzten Kampf war sie ein kleines Mädchen von etwa fünf Jahren gewesen und hatte sich nicht dafür interessiert, auf wen ihr Vater gerade eindrosch. Das musste kurz nach dem Tod ihrer Mutter gewesen sein.
Blinzelnd blickte sie auf den nebelverhangenen See. Seine Oberfläche verharrte in dunkler Stille. Nichts regte sich in der Tiefe.
»Das mit seinem Wassergott ist doch ein Vorwand«, sagte Merana. Denn wenn der Wassergott irgendetwas gegen sie hatte, würde er doch selbst etwas unternehmen, nicht wahr? Er könnte einfach eine Flutwelle schicken und sie damit wegspülen. Deswegen zur Finsternis mit ihm. Sie umklammerte ihren Speer fester. Sie hatte seine Spitze die ganze Nacht über an einem Stein gewetzt und sie sehr sorgsam an dem Stab befestigt. Anschließend hatte sie noch etwas rote Farbe aufgetragen, um die Waffe furchterregender aussehen zu lassen. Nicht, dass es ihr geglückt wäre.
Ihr Vater musterte Merana einen Moment lang und quittierte ihren selbstgemachten Speer mit einem Stirnrunzeln. Ja, er war nicht sonderlich gut. Aber er war ihre erste Waffe, die nicht wie ein Spielzeug wirkte. Trotzdem konnte sie ihn heben und wer sie nicht kannte, würde vielleicht glauben, dass sie damit zustach.
Einen Moment lang hing sie der Vorstellung nach, es wirklich zu tun. Ihre ganze Kraft zusammenzunehmen – so wenig es auch sein mochte – und dann zu schauen, wie weit sich diese Spitze in Fleisch treiben ließ. Das herausfließende Blut betrachten und den Schrei eines Gegners hören. Oh, sie verstand den Reiz des Kämpfens. Doch letztlich war es nicht mehr als ein Reiz, der nur allzu schnell von der Realität eingeholt wurde. Merana verscheuchte die Bilder aus ihrem Kopf.
»Wahrscheinlich ist dieser Pflücker ein Furz, der nur Häuptling wurde, weil sein Gegner zufällig gestolpert ist. Und jetzt meint er, jeden schikanieren zu können. Männer wie er kommen und gehen. Aber ich«, ihr Vater breitete die Arme aus, »ich bin seit dutzenden …«
»Zweiundzwanzig«, sagte Merana.
»… Jahren Häuptling«, sagte ihr Vater.
Er beschleunigte seine Schritte. Verdammt. Merana fiel hinter ihm zurück. Es hatte keinen Sinn, ihn weiter umstimmen zu wollen, das wusste sie. Also ging sie neben Urla und stimmte zögernd in ihren Gesang mit ein.
Am See stiegen Vögel auf – ein Zeichen, definitiv! Nur was mochte es bedeuten? Merana beobachtete nachdenklich ihren Flug.
Es war kein Zufall, dass der Stamm des Gundorans im Moment am Morret hockte, denn ganz offensichtlich wollte er länger bleiben. Die Leute hatten Kreise aus rot und weiß bemalten Baumstämmen gebaut und ihre Zelte fest am Boden fixiert. Es hingen derart viele Fische zum Trocknen in einigen Gestellen, dass die Luft stank. Ein Junge arbeitete an einem Mahlstein, der größer als jeder war, den Merana je gesehen hatte. Doch der Junge hatte auch einen beachtlichen Haufen Körner, den er zu verarbeiten gedachte, also lohnte sich das Gerät offensichtlich. Weidenkörbe, prall gefüllt mit frischem Fleisch wurden zu großen, mit Steinen umrahmten Feuerstellen getragen. Merana beobachtete das Treiben irritiert. So viel konnte der Stamm doch gar nicht verbrauchen? Was würden sie mit dem Zeug tun, das sie nicht aufaßen? Oder … waren hier wirklich so viele Menschen?
Einige Leute arbeiteten außerdem an einer riesigen Konstruktion aus Stäben, die eine Art Spitze bildete. Mindestens drei Mannslängen hoch und absolut sinnlos, soweit Merana das beurteilen konnte. Trotzdem sah das Ding irgendwie eindrucksvoll aus. Welchem Gott auch immer es geweiht wurde, er oder sie würde sicherlich angetan davon sein. Verdammt, sie sollten der Göttin wahrscheinlich auch etwas Nettes bauen.
Kaum jemand hielt in seinem Tun inne, obwohl gerade ein fremder Stamm durch die Siedlung marschierte. Lediglich ein paar Kinder zeigten lachend auf sie. Sie schienen nicht bei der Arbeit mithelfen zu müssen, sondern spielten im Schilf. Dabei sahen sie alle wohlgenährt aus, wie Merana auffiel. Was auch immer man vom Todpflücker halten mochte – man konnte ihm zumindest nicht vorwerfen, er würde nicht für seine Leute sorgen.
Ihr Vater hielt inne und blieb mit verschränkten Armen zwischen den Zelten stehen. Merana ließ den Blick schweifen und bemerkte den blattgesichtigen Schamanen, der ihnen entgegen rauschte. Hinter ihm lief ein junger bartloser Mann mit wirren braunen Haaren.
»Moko der Baum, nicht wahr?«, rief er.
»Du hast also von mir gehört«, sagte ihr Vater.
Der Junge blieb vor ihm stehen und legte den Kopf in den Nacken, um zu ihm aufzublicken. »Oh, eine ganze Menge. Aber du nicht von mir. Zumindest nicht genug, wie ich annehme. Sonst wärst du nicht gekommen.«
Ihr Vater spuckte auf den Boden.
Moment mal. Das ist der Todpflücker? Merana musterte ihn erneut. Er konnte – wenn überhaupt - höchstens ein paar Jahre älter als sie selbst sein, hatte graue Augen und schmale Schultern. Insgesamt wirkte er ein wenig unterernährt, wie sie fand. Nicht wie ein Häuptling. Fette Kinder, ein dürrer Anführer. Verkehrte Welt.
»Zieh deine Waffe«, sagte ihr Vater.
»Du willst sofort loslegen?« Der Gundoran lächelte schmal. »Meinetwegen. Lass uns in den Kreis gehen.«
Merana schüttelte den Kopf. Was für ein Irrsinn. Der Kerl musste doch wissen, dass er ziemlich mickrig neben ihrem Vater aussah.
Die Leute um sie herum schienen das Gespräch mitbekommen zu haben, jedenfalls kam die Geschäftigkeit nun zum Erliegen. Die Gesichter blickten interessiert, aber keineswegs besorgt auf die beiden Häuptlinge. Manche tuschelten miteinander.
Gundoran führte sie in einen der Holzkreise. Natürlich hatte nicht der ganze Stamm darin Platz, aber doch eine ganze Menge Leute. Ihre Stimmen schwollen hier drinnen seltsam an und Merana fühlte sich auf einmal bedrückt. Urla wippte nervös neben ihr. Auf ihrer anderen Seite befand sich ein fremdes Gesicht. Der Unbekannte neigte sich ein wenig zur Seite, sodass er ihren Arm streifte. Merana zuckte heftig zusammen und schluckte. Der Mann bedachte sie mit einem irritierten Blick. Merana lächelte entschuldigend und spürte, wie sie rot wurde. Wahrscheinlich einer aus Gundorans Stamm. Konnten diese Idioten keinen Abstand einhalten? Das wäre höflich. Noch gehörten sie schließlich nicht zusammen.
»Wir werden heute Abend ein wenig feiern, schätze ich«, sagte er. »Du kannst auch zu uns kommen.«
Merana öffnete schon den Mund, als Urla neben ihr mit einem Schnauben kundtat, dass sie den Fremden nicht für würdig hielt, Merana gegenüber eine solche Einladung auszusprechen. Also zuckte sie nur mit den Schultern und er wandte sich wieder ab. War bestimmt auch besser so, dachte sie. Man musste es ja nicht gleich übertreiben mit dem Zusammenschluss.
»Ein Kampf bis zum ersten Blut!«, schrie Blättergesicht der Menge entgegen. Viele jubelten und stampften mit den Füßen. Merana hielt sich still.
»Wessen Blut auch immer als erstes vergossen wird, ist der Verlierer und muss dem Gewinner seinen Stamm abtreten.«
Jajaja. Komm zum Punkt.
»Willigen die beiden Kämpfer in diese Regeln ein?«
Gundoran nickte. »Ja.«
Ihr Vater grunzte und stieß auf den fragenden Blick des Schamanen hin schließlich ein ärgerliches »Joh« aus.
»So möge der Kampf beginnen!«
»Gundoran!«, brüllte jemand und »Zeig’s ihm, Baum!« ein anderer. Urla stimmte einen Segensgesang für ihren Häuptling an und rasselte mit ihren Ketten, doch die Laute schafften es nicht, das Geschrei der Menge zu übertönen.
Meranas Vater legte seinen Wolfspelzmantel ab und nahm sein Kriegsbeil in die Hand. Es war ein riesiges Ding, dessen Anblick schon ausreichte, damit Merana sich noch mickriger fühlte. Die graue Steinfläche des Blatts war solange poliert, bis sie glatt und glänzend war und die Kante war so dünn und scharf, dass ihr Vater seinem Gegner schon mit geringem Druck tiefe Schnitte zufügen konnte. Der Stiel war dick, der Griff mit Lederstreifen umwickelt. Urla hatte mit Blut einen vielzackigen Stern, das Zeichen der Göttin, auf die Waffe gemalt. Moko trug dasselbe Zeichen auch auf der Stirn. Merana fand, dass ihr Vater ziemlich furchteinflößend aussah. Ganz im Gegensatz zu Fullo Todpflücker.
Blättergesicht hielt dem Gundoran eine Schale hin und neigte respektvoll den Kopf. Moment, wo kommt das jetzt her? Merana war zu sehr mit der Betrachtung ihres Vaters beschäftigt gewesen, dass sie es nicht mitbekommen hatte. Der Häuptling ergriff das Gefäß, musterte den Inhalt einen Moment lang und lächelte dann zuversichtlich.
»He!«, rief Merana laut und sie war nicht die Einzige.
Die blonden Brauen ihres Vaters rutschten zusammen, bis sie fast eine Linie bildeten. »Was trinkst du da?«
Der Todpflücker schwenkte die Flüssigkeit in der Schale. »Ein Mittel, um mich für den Kampf zu kräftigen.«
»Das ist Betrug«, rief ihr Vater.
Der Gundoran zuckte mit den Schultern. »Wer sagt das? Ich darf dich nicht vergiften, aber selber kann ich trinken, was ich will.«
Ihr Vater blickte kurz zu Merana herüber. Nein, zu Urla neben ihr. Die Schamanin hob ratlos die Schultern.
»Jeder Kämpfer darf nur eine einzige Waffe führen«, sagte sie.
Der Gundoran lachte. »Du willst mir nicht weismachen, mein Getränk wäre eine Waffe?«
Meranas Vater schnaubte laut. »Das verzerrt den Sinn des Kampfes. Ich verlange, ebenfalls davon zu trinken.«
Der Gundoran grinste. »Bist du dir sicher? Es ist ein sehr spezielles Getränk. Die Wirkung könnte … zu viel für dich sein.«
Drachenscheiße. Zu viel für dich. Jetzt hat er ihn. Merana knirschte mit den Zähnen.
»Ich bestehe darauf!«, rief ihr Vater.
»Ihr habt es gehört! Er möchte von meinem Getränk trinken!«, schrie der Gundoran in die Runde. Sein Stamm jubelte. Ein verdammt schlechtes Zeichen.
Als der Todpflücker ihrem Vater die Schale reichte, kribbelte Meranas Nacken. Sie beobachtete, wie sich sein Kehlkopf ein paarmal beim Schlucken bewegte. Dann reichte er seinem Gegner die Schale zurück. Der Gundoran blickte hinein und trank dann den Rest. Sein Blattschamane nahm das Gefäß entgegen und ging dann direkt auf Urla zu, um sich neben sie zu stellen. Merana hätte gerne ihr Gesicht gesehen, doch sie hatte den Kopf abgewandt.
»Deine Waffe«, brummte Meranas Vater. Seine Pupillen schienen seltsam klein. Oder bildete sie sich das nur ein?
Der Todpflücker verschränkte die Arme. Jetzt fiel auch Merana auf, dass ihm niemand ein Beil oder einen Speer gereicht hatte und er auch sonst nichts bei sich trug. Ihr Vater taumelte plötzlich und spuckte auf den Boden. Urlas Finger krallten sich in Meranas Arm. Vielleicht fürchtete die Schamanin, Merana würde sonst vorstürzen. Wahrscheinlich fürchtete sie das zurecht. Frost biss sich in ihren Nacken und verursachte ihr Gänsehaut am ganzen Körper. Ihr Herzschlag beschleunigte sich.
»Fühlst du dich nicht wohl?«, fragte der Todpflücker laut.
»Was … war in dem Becher?«, presste Meranas Vater hervor. Sein Blick wirkte trüb und seine Beine so wackelig, dass er nicht mehr lange dauern konnte, bis er in die Knie ging.
»Ein Gift aus einer roten Blume«, sagte der Gundoran mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. »Ein garstiger Trick, wie ich gestehe. Es hat Jahre gedauert, um meinen Körper so weit daran zu gewöhnen, dass es mir nichts mehr ausmacht.«
Merana schnappte nach Luft. Ihr Vater stemmte sein Beil in den Boden, um sich gebückt daran festzuhalten.
»Ich nehme an, du hast diese Zeit nicht dafür aufgebracht?« Der Todpflücker lachte humorlos. »Wie bedauerlich. Ohne das Gegengift wirst du wohl sterben.«
Die Kälte wich flammender Hitze. Merana wollte den Kerl aufspießen. »Lass mich los«, zischte sie und versuchte Urlas Hand abzuschütteln.
»Nein«, knurrte die Schamanin. »Der Kampf ist im Gange und wir dürfen nicht eingreifen. Recht ist Recht.«
»Das ist Unrecht!«, brüllte Merana. »Wo ist denn hier ein Kampf?«
»Gemeiner Betrüger«, würgte ihr Vater heraus. Zumindest glaubte sie, dass das seine Worte waren, denn sie gingen im allgemeinen Stimmengewirr unter.
Der Gundoran erhob die Stimme. »Oh, ich greife dich nicht an. Nicht in diesem Zustand. Das hätte keine Ehre.«
»Gib meinem Vater das Gegengift!«, schrie Merana, stieß Urla endlich weg und stürmte vor.
Die Augen des Todpflückers zuckten kurz in ihre Richtung. Dann band er einen Beutel von seinem Gürtel und schüttete den Inhalt auf seine Handfläche. Merana konnte nicht erkennen, was es war. Sie nahm ihren Speer und hielt ihn dem Gundoran unter den Hals. Er hob lediglich eine Braue.
»Meinst du das hier?« Der Gundoran öffnete die Hand, sodass sie die roten Kugeln darauf erkennen konnte. »Der Saft dieser Beeren kann wahre Wunder wirken.«
Merana wollte nach den Beeren greifen, doch der Todpflücker zog seine Hand blitzschnell zurück. Seine Lippen verzogen sich zu einem dünnen Lächeln, dann drückte er die Beeren auf das Blatt ihres Speeres, sodass der Saft über den Stein rann und ihn rot färbte. Merana konnte nur ungläubig gucken. Fullo Gundoran sah ihr einen Moment lang in die Augen, bevor er den Kopf zu ihrem Vater wandte.
»Du solltest dafür sorgen, dass das Gegengift schnell in dein Blut gelangt.«
»Was?«, murmelte Merana.
»Mädchen, nicht!«, rief Urla.
Ihr Vater taumelte vorwärts und riss Merana die Waffe aus der Hand. Der Schaft rutschte durch seine Finger und er hielt zitternd die Spitze in der Hand. Er schrie auf, als er sie in seinen Arm stieß.
»Bis auf das erste Blut! Ich habe gewonnen.« Der Todpflücker musste nicht brüllen, damit ihn alle hörten. Die Luft war still wie nach einem Gewitter. Dann brach sein Stamm in Jubel aus.
Der Speer knackste und Meranas Vater verlor das Gleichgewicht. Sie erreichte ihn noch rechtzeitig, um ihn notdürftig zu stützen. Als sie sich hilfesuchend zu Urla umsah, reagierte die Schamanin nicht. Natürlich nicht. Ihre Maske war reglos bis auf die Federn, die im leichten Windzug zitterten. Ihre Gestalt wie erstarrt.
»Es brauchte nur ein paar Beeren, um Moko den Baum zu besiegen«, sagte der Gundoran leise, sodass nur Merana und ihr Vater es hörten. »Und das mit dem Gegengift war gelogen. Es waren einfach nur Kirschen.«
»Du -«, schrie Merana.
»Vorsicht«, sagte der Todpflücker. »Wenn du mich jetzt angreifst, fällt er wahrscheinlich auf die Schnauze. Das mit dem Tod war ebenfalls gelogen. Was ich ihm gegeben habe, war einfach nur Mohnsaft.«
Merana schüttelte ungläubig den Kopf. »Bitte was?«
Der Gundoran lächelte dünn. »Das ist eine Blume, die im Süden wächst. Wir bauen sie an, weil der Saft schmerzlindernd wirkt. Dein Vater braucht nur ein wenig Ruhe, dann wird er sich schon erholen.«
Merana heulte auf. Noch immer hielt sie ihren Vater fest. Sein Gewicht zerrte an ihren schwachen Muskeln. Der Todpflücker wandte sich ab und verließ den Kreis. Statt seiner kam Blättergesicht auf sie zu.
»Lass mich diese Wunde behandeln«, sagte er leise.
Doch Merana schlug seine Hand beiseite. »Bleib verdammt nochmal weg von ihm!«
Blättergesicht seufzte. »Wenn wir die Wunde nicht säubern, könnte sie faulen. An deiner Stelle würde ich das Risiko nicht eingehen.«
Urlas dürre Gestalt trat neben den Schamanen.
»Du.« Eine erneute Hitzewoge schoss in Meranas Kopf. »Du hast nichts getan.«
»Recht ist Recht.« Urla ging vor ihr in die Hocke. »Wir gehören nun zu Gundorans Stamm. Der Häuptling wird für uns sorgen – auch für deinen Vater.«
Moko stöhnte hörbar. Niemals – niemals! – würde er sich hilflos in die Hände des Feindes geben, der ihn betrogen und unterworfen hatte. »Darauf geschissen«, sagte Merana. Ihre Augen brannten, während sie ihren Vater in die Höhe zog. »Das ist nicht unser Stamm.« Und so torkelten sie aus dem Holzkreis heraus, wo sich die Menge bereits zerstreut hatte. Allein. Merana begriff plötzlich, dass sie das noch nie in ihrem Leben gewesen war. Ihr Leben … jetzt würde alles anders werden.
Merana zerrte ihren Vater durch die Siedlung. Er schleifte sein verdammtes Riesenbeil hinter sich her. »Kannst du das nicht loslassen?«, fragte sie. Er blickte sie kurz an, doch falls er überhaupt reagierte, so packte er die Waffe nur noch fester. »Drachenscheiße!«, fluchte Merana.
Ein paar Leute blickten ihnen noch hinterher, aber sonst nahm niemand Notiz von ihnen. Nicht einmal der eigene Stamm. Nur war er jetzt nicht mehr ihr Stamm. Er gehörte dem Todpflücker. Urla konnte natürlich behaupten, dass er sich auch um sie beide kümmern würde. Kümmern. Merana schnaubte. Je länger sie darüber nachdachte, desto klarer wurde ihr, wie dieses Kümmern aussehen würde. Bei Nacht würde Gundoran ihren Vater meucheln. Welcher Häuptling duldete schon Konkurrenten in der Nähe? Denn würde ihr Vater wieder gesund werden, könnte er Gundoran erneut herausfordern. Und diesmal würde er nicht mehr auf seine Tricks hereinfallen.
Ja. Das war die Lösung. Sie musste dafür sorgen, dass er wieder auf die Beine kam und dann würde er den Todpflücker besiegen, sein Stamm würde ihm gehören und größer sein als je zuvor. Er würde der mächtigste Häuptling in diesen Breiten sein und sie könnte … Na ja, sie könnte wohl Schamanin werden. Und wenn nicht, wäre es auch in Ordnung, denn als Tochter von Moko dem Baum, größter Häuptling aller Zeiten, würde sie sicherlich einen akzeptablen Gefährten finden, der vielleicht sogar bereit wäre, einen eigenen Stamm mit ihr zu gründen. Das wäre doch eigentlich eine gute Sache. Jedenfalls wäre alles gut. So gut, wie eben möglich.
Die Nebelschwaden auf dem See waren davongezogen. Die Mittagssonne glitzerte auf seiner Oberfläche, so grell, dass es in den Augen schmerzte. Ihr Vater konnte sich kaum auf den Beinen halten und Meranas Muskeln brannten, als würden sie zerreißen. »Du schaffst das.« Eigentlich hatte sie es mehr zu sich gesagt als zu ihrem Vater, doch er stieß ein zustimmendes Grunzen aus und seine Schritte wurden etwas sicherer.
»Gib mir etwas zu trinken«, sagte er.
Merana griff nach ihrem Wasserschlauch und hielt ihn ihm hin. Er nahm einen Schluck und spuckte aus.
»Gib mir etwas Richtiges«, fuhr er sie an.
Merana runzelte die Stirn. »Ich denke nicht, dass du …«
Ihr Vater bäumte sich auf. »Mir wurde mein Stamm geraubt und du verbietest mir das Trinken, Tochter?«
Merana öffnete kleinlaut das Tonfläschchen mit dem Getreidebrand und hielt es ihrem Vater hin. Er schüttete den Schnaps in sich hinein, als wäre es Medizin und warf die Flasche dann davon. Sie war leer.
»Scheiße!«, schrie Merana.
Ihr Vater rülpste.
Merana kämpfte ihren Zorn nieder und schleifte ihren Vater weiter.
Die letzten Zelte blieben hinter ihnen zurück und vor ihnen lag nur noch wilde Landschaft. Früher hatte Merana den Wald immer gemieden. Sie war keine Jägerin und traute sich nicht, auf Nahrungssuche zu gehen, weil sie nicht schnell genug weglaufen konnte, sollte irgendein Biest ihren Weg kreuzen. Stattdessen war sie im Stamm geblieben und hatte nach einer Beschäftigung gesucht, die man mit zwei linken Händen ausführen konnte. Denn was immer sie anfasste, ruinierte sie. Sie konnte keine Seile drehen, Körbe flechten, Keramiken töpfern. Also war sie Urlas Schülerin geworden, mit dem Plan, irgendwann in ihre Fußstapfen zu treten. Sie hätte die Gebete der Menschen an die Göttin gerichtet und auf ihre Antworten gelauscht. Sie hätte den Häuptling beraten. Sie hätte die Toten gesegnet und Kontakt mit ihren Geistern aufgenommen. Sie hätte so viel tun können … auch wenn es keinen Spaß machte … aber sie hätte es können … Verdammt, jetzt keine Panik schieben. Das kann alles wieder werden, Merana. Alles gut.
»Weiter«, sagte Merana. Was machte sie, wenn sie auf Wölfe stießen? Sie hatte nicht einmal mehr ihren kaputten Speer. Nur das schwere Beil ihres Vaters, das er in seiner Faust hielt, sie aber nicht schwingen konnte. Wölfe wären also ungünstig. Diese aggressiven Pflanzen, die auf manchen Lichtungen wuchsen und Ranken nach Lebenden ausstreckten, konnten sie immerhin nicht verfolgen, damit wäre also umzugehen. Und was die Geister in den toten Bäumen betraf … gegen die hätte ihr Speer ohnehin nichts genützt. Einfach keinen Wölfen begegnen. Guter Plan.
Am Nachmittag brach ihr Vater endgültig zusammen und riss sie mit zu Boden. Merana prallte schmerzhaft auf. Auf ihren Lippen lag der modrige Geschmack des Herbstwaldes. Sie spuckte Erde aus. Ihr Vater rollte sich stöhnend herum und blieb mit geschlossenen Augen liegen, das Beil quer über der Brust.
Merana warf einen Blick auf die Wunde, doch sie schien nicht so tief, wie sie zuerst angenommen hatte, und blutete kaum mehr. Das musste genügen. Sie hatte nichts zum Verbinden. Urla hatte ihr einmal etwas von Heilkräutern erzählt. Oder waren es berauschende Kräuter gewesen? Oder beides? Merana rieb sich die Stirn. Arzneikunde hatte nicht gerade zu ihren besonderen Interessen gezählt. Doch sie wusste, dass sie die Wunde so schnell wie möglich säubern sollte. Sie brauchte sauberes Wasser und sie sollte es abkochen. Das ging nur, wenn sie ein Feuer machte.
Ja. Feuer machen. Auch ein guter Plan.
Aber worin sollte sie das Wasser kochen? Sie besaß einen Wasserschlauch, aber keinen Topf. Die Tochter des Häuptlings schleppte doch keinen Topf mit sich herum. Und der Häuptling natürlich auch nicht. O Mist.
»Ich … leg dich schlafen. Morgen ist bestimmt alles wieder in Ordnung. Ich halte Wache«, sagte sie zu ihrem Vater.
Viele der Zweige, die sie fand, waren feucht, doch immerhin gab es trockene Blätter, die sie benutzen konnte. Merana legte ein paar Steine kreisförmig aus und schichtete darin das Brennmaterial. Licht war riskant, konnte allerlei Kreaturen anlocken. Oder Ausgestoßene, die Wanderer überfielen.
Moment mal, wir sind selbst Ausgestoßene. Merana schluckte. Nun ja, dann war diese Gefahr schon mal gebannt. Haha. Ha. Sie schluckte noch einmal.
Wie auch immer, sie brauchte das Wasser und außerdem würde die Nacht kalt werden. Ohne ein Dach über dem Kopf wären sie morgen beide Eisklötze – oder würden sich zumindest so fühlen.
Merana platzierte einen getrockneten Buchporling aus ihrer Tasche als Zunder, holte ihre Feuersteine hervor und schlug sie solange aneinander, bis Funken sprangen. Immerhin etwas, das ihr glückte. Ist auch wirklich nicht kompliziert. Wenn das nur für alles andere ebenfalls gelten würde …
Als Merana nach dem Steinbeil ihres Vaters griff, hatte sie zuerst Schwierigkeiten, es von seiner Brust zu heben, ohne ihm dabei einen Haufen blaue Flecken zuzufügen, indem sie es wieder und wieder fallen ließ. Merana biss die Zähne zusammen und ächzte. Ihre Wangen glühten, als sie sich schließlich ins Laub setzte und die Waffe auf ihre Knie hievte.
Nun denn. Sie hatte noch nie so lange Wache gehalten. Nachdem ihr Urla einmal bestätigt hatte, dass ihr Augenlicht recht gut war und ihr Gehör ganz exzellent, hatte Merana in heiklen Gegenden oftmals zusammen mit den Kriegern nach Auffälligkeiten Ausschau gehalten. Meistens aber nur in bestimmten Abständen, zwischen denen sie sich wieder schlafen legte. Und ihr Schlaf war wirklich tief – wenn sie schlief, dann schlief sie richtig. Was bedeutete, dass sie heute auf keinen Fall wegdämmern durfte. Denn heute konnte ihr guter Schlaf ihr und ihrem Vater das Leben kosten.
Würde der Todpflücker sie verfolgen? Hoffentlich waren sie inzwischen weit genug von seiner Siedlung entfernt. Merana wusste nicht, wie weit genau. Verdammt, sie wusste nicht einmal, wo sie sich in etwa befanden. Vielleicht war sie schon einmal mit ihrem Stamm in diesem Wald gewesen, vielleicht auch nicht. Die verfluchte Landschaft sah überall gleich aus.
Ihr Vater schlief. Der Rauch des Feuers kringelte sich zu den Sternen empor. Merana summte leise ein Lied, das sie von Urla gelernt hatte, und hoffte, es würde die Aufmerksamkeit der Göttin erregen. Sie mochte zwar keine vollausgebildete Schamanin sein, dennoch wusste sie Einiges.
Irgendwann klapperten ihre Zähne so sehr, dass sie das Summen einstellte. Derartige Laute würden die Göttin eher beleidigen als gewogen stimmen.
»Hat das einen Sinn?«, fragte Merana leise, während sie die schattenhaften Blätter der Bäume betrachtete. »Wolltest du, dass ich den Stamm verlasse und hast es deshalb so eingerichtet, dass es passiert?« Aber dann hätte ihr die Göttin doch nur ein erkennbares Zeichen geben müssen und sie hätte es freiwillig getan.
»Oder wolltest du mich auf diese Reise schicken?« Merana rieb sich die Augen. Ihre Lider fühlten sich viel zu schwer an, doch die Kälte hielt sie wach. Sie dachte an ihren Vater. Wie sie ihn gesehen hatte, als sie noch ein Kind gewesen war. So groß und unbesiegbar. Dann dachte sie auch an ihre Mutter, an die sie nur blasse Erinnerungen hatte. Wenn sie in ihrer Obhut aufgewachsen wäre und nicht in der von Urla, was wäre dann aus ihr geworden? Und dann dachte sie an Urla und wollte sie hassen, aber inzwischen war sie viel zu erschöpft dafür.
Merana kuschelte sich an ihren Vater, lauschte seinem angestrengten Schnaufen und blickte wieder zu den Sternen hinauf. Es lag jetzt in der Hand der Göttin. Alles lag in ihrer Hand.
Die Nacht wich einem grauen Morgen über dem Blätterdach. Merana wusste nicht, wann sie eingenickt war. Oder wann ihr Vater zu atmen aufgehört hatte. Doch als sie die Hände auf sein Gesicht legte, war seine Haut kalt.
Kapitel 3
Am See Morror, Fullo Todpflücker
»Was hältst du davon?«, fragte Fullo und zeigte auf das Gerüst aus Holzstäben, das seine Leute errichtet hatten. Die Stangen waren oben miteinander verknotet und steckten unten in breiten Abständen am Boden. Wenn alles fertig war, würden ein Feuer und seine Schamanen darunter Platz finden, um ihre Gesänge anzustimmen. »Wir bestreichen das Holz mit dem Schleim der leuchtenden Fische. Dann werden die Götter bestimmt mit euch sprechen.«
Schon jetzt umgab die Stangen ein matter Schimmer, der mal gelb, mal grün oder sogar rosa leuchtete. Doch im strahlenden Licht der Herbstsonne war es schwierig zu erkennen.
Die Arbeitenden scheuchten schon wieder eine Gruppe Kinder weg. Die Farben, obwohl sie nur blass waren, lockten sie an.
---ENDE DER LESEPROBE---