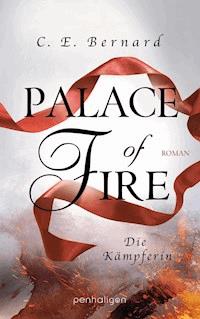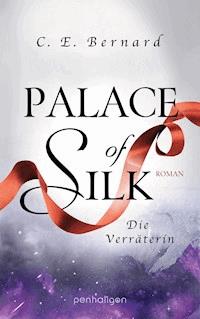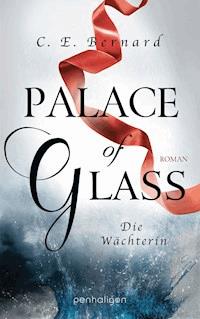9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Wayfarer-Saga
- Sprache: Deutsch
Nur ein vergessenes Lied vermag es, die Dunkelheit der Nacht zu durchbrechen. Wäre es doch nur erlaubt zu singen – oder sich zu erinnern ... Das Fantasy-Must-Read des Frühjahrs 2021!
»Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt in einem finsteren Tal mit hohen, schneebedeckten Bäumen. Sie beginnt mit einem einsamen Wanderer in den fahlen Stunden des Zwielichts, in der bläulich glänzenden Dämmerung. Sie beginnt mit einer Frage. Fürchtet ihr euch?«
Die deutsche Fantasy-Autorin C.E. Bernard hat ein episches, bewegendes und beeindruckendes Meisterwerk geschaffen, das High-Fantasy-Leser feiern werden. »Das Lied der Nacht« ist die Geschichte des in sich gekehrten Wanderers Weyd und der mutigen Bardin Caer, die gemeinsam vor einer fast nicht zu bewältigenden Aufgabe stehen: Feuer in einer Welt entzünden, in der Schatten, Albträume und Furcht regieren. Und die einzige Hoffnung, die sie in diesem Kampf haben, ist ein Lied ...
Die Printfassung enthält exklusives digitales Bonusmaterial (Augmented Reality, AR) zum Entdecken.
Alle Bände der »Wayfarer«-Saga:
Das Lied der Nacht
Das Flüstern des Zwielichts
Der Klang des Feuers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
»Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt in einem finsteren Tal mit hohen, schneebedeckten Bäumen. Sie beginnt mit einem einsamen Wanderer in den fahlen Stunden des Zwielichts, in der bläulich glänzenden Dämmerung. Sie beginnt mit einer Frage. Fürchtet ihr euch?«
Die deutsche Fantasy-Autorin C. E. Bernard hat ein episches, bewegendes und beeindruckendes Meisterwerk geschaffen, das High-Fantasy-Leser feiern werden. »Das Lied der Nacht« ist die Geschichte des in sich gekehrten Wanderers Weyd und der mutigen Bardin Caer, die gemeinsam vor einer fast nicht zu bewältigenden Aufgabe stehen: Feuer in einer Welt entzünden, in der Schatten, Albträume und Furcht regieren. Und die einzige Hoffnung, die sie in diesem Kampf haben, ist ein Lied …
Autorin
C. E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Sie studierte die Fächer English Literatures and Cultures und Politikwissenschaft, seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben erforscht sie Strukturen der Gewalt im Heldenepos, erwandert das Siebengebirge oder backt britischen Gewürzkuchen. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet, ihre Romane waren für den RPC Fantasy Award und den LovelyBooks Leserpreis nominiert. Christine Lehnen schreibt auf Englisch – ihre auf Deutsch erschienenen Werke, darunter die Palace-Saga und zuletzt die Wayfarer-Saga, werden ins Deutsche zurückübersetzt.
Weitere Informationen unter: http://de.cebernard.eu/
Von C. E. Bernard bereits erschienen:
Palace of Glass
Palace of Silk
Palace of Fire
Palace of Blood
Das Lied der Nacht
Das Flüstern des Zwielichts
Der Klang des Feuers
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
C. E. Bernard
DASLIEDDERNACHT
Roman
Deutsch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Entdecke die Wayfarer-Saga!
In unserem Printbuch haben wir für unsere Leser digitales Bonusmaterial, sogenannte Augmented Reality (AR)-Inhalte, versteckt. Damit Sie als E-Book-Leser möglichst viele davon ebenfalls entdecken können (zum Beispiel das Pinterest-Inspirationboard und die Spotify-Playlist der Autorin sowie das Wayfarer-Special mit Gewinnspiel), besuchen Sie bitte unsere Website www.penhaligon.de/wayfarersaga-ar oder scannen Sie den QR-Code.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Copyright der Originalausgabe © 2021 by Christine LehnenCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Jennifer JägerKarte: Annika WalterUmschlaggestaltung und -motiv: Isabelle Hirtz, InkcraftBL · Herstellung: MRSatz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, MünchenISBN 978-3-6412-6894-7V002www.penhaligon.de
Für den Barden, der befand, dass die Fantasie ein Menschenrecht ist
Des Nachts erwachen die Geschichten.
Schnell fliegen sie dahin in den fahlen Stunden des Zwielichts, dem bläulichen Dunkel der Dämmerung.
Denn Geschichten, müsst ihr wissen, Geschichten reisen unaufhaltsam wie das Licht, über breite Straßen und verschlungene Pfade, durch Wälder und über Berge, selbst über das weite Meer. Ein geflüstertes Wort, mehr braucht es dazu nicht. Eine leise Melodie. Ein Stückchen Garn, einen Tropfen Tinte, eine tapfere Seele.
Erinnert euch.
Erinnert euch an die Geschichte, die keine Stimme mehr hat, an das Lied, das nicht mehr gesungen wird. Erinnert euch an die mächtigen Türme, an die Melodie der Nacht, an die hohen Brücken weit über dem Meer.
Erinnert euch, wohin euer Herz euch führen wollte, bevor Furcht auf allen Wegen wandelte.
Ich werde euch dabei helfen. Schürt das Feuer und rückt dichter zusammen, lasst euch nicht schrecken von meinen Narben und dem Blut auf meinem Mantel. Wenn ihr euch zu mir setzt, singe ich ein Lied für euch, und ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt in einem finsteren Tal mit hohen, schneebedeckten Bäumen. Auf einer uralten Straße, einst breit und stolz, nun stumm und grau. Sie beginnt mit einem einsamen Wanderer in den fahlen Stunden des Zwielichts, im bläulichen Dunkel der Dämmerung.
Sie beginnt mit einer Frage.
Fürchtet ihr euch?
1 – Das Massaker am Pass
Das Massaker am Pass
Sie waren überall heutzutage, die Fremden.
Da war man sich einig im Tal von Schur, tief versteckt zwischen den hohen, zerklüfteten Bergen. Natürlich konnten die Leute damit nicht ihr eigenes Tal meinen. Hier gab es nur sehr wenige Fremde, kaum jemanden von außerhalb, seien es Kaufleute, Reisende oder Entwurzelte. Vor allem jetzt im Winter, wo der Pass im Norden durch den Schnee abgeriegelt war und die Höhlen im Süden von den Soldaten des Barons. Niemand reiste mehr über die Straße zwischen dem Nördlichen Pass und dem Südlichen Tunnel.
Niemand außer ihm.
Die Dämmerung senkte sich bereits herab, als der Wanderer den Grauen Pfad hinaufkam, jene einst so stolze, mit blütenweißem Stein gepflasterte Straße, die heute kaum mehr war als ein Schotterweg. Ein Mann, dem man wohl keinen zweiten Blick geschenkt hätte, wäre er nicht so groß gewesen und hätte er nicht eine so außergewöhnliche Stute am Zügel geführt – schwarz wie die Nacht war ihr Fell mit einem rötlichen Glanz. Doch selbst seine Größe, selbst sein prachtvolles Reittier, selbst das leicht beunruhigende Grau seiner Augen, schimmernd wie das Meer an einem trüben Morgen, wäre wohl nicht weiter aufgefallen, wenn er nicht leise vor sich hin gesungen hätte, während er ging: eine altbekannte, sonst so fröhliche Melodie. Traurig klang sie aus seinem Mund, traurig und wundervoll zugleich. Er war der einzige Fremde, dem man hier im Tal begegnen konnte, er und seine Gefährten. Den Vagabunden nannte man ihn im Tal, denn er war auf unbekannten Wegen gereist, hatte Berge erklommen und Meere durchkreuzt, von denen man im Tal kaum zu träumen wagte. Er war der Einzige, der selbst im Winter den Pass überwand, der Einzige, der beide Meere gesehen hatte, das im Norden und das im Süden, auch wenn niemand im Tal von Schur sich wirklich sicher war, ob es so etwas wie ein Meer überhaupt gab. Seine Abenteuer waren Legenden, um ihn rankte sich so manche Geschichte. Und Geschichten begegnete man in diesem Tal mit äußerster Vorsicht.
Seinen wahren Namen kannten sie nicht. Für die Leute war er einfach nur ein Reisender mit einem Schwert, das eines Königs würdig gewesen wäre. Einem Schwert, das er nur zog, wenn es absolut unumgänglich war. Seine Schritte waren schwer, die Schultern gebeugt. Die Erschöpfung hatte von ihm Besitz ergriffen, war bis tief in seine Knochen gedrungen, hatte sich wie ein dicker, stumpfer Dolch in seine Muskeln gebohrt.
So erreichte er schließlich die Alte Wegscheide, an der einst der höchste Lampenturm des Tals gestanden hatte. Stark und unverwüstlich war er gewesen, aus weißem Stein aus dem Süden erbaut. Nun passierte der Vagabund nur noch eine Ruine, brüchige, unter dem Schnee verstreute Steine. Hier wandte er sich ab und betrat den Wald, wo er einem Pfad folgte, der sich nur jenen zeigte, die genau wussten, wo er sich befand.
In diesem Moment geschah es.
In diesem Moment erhoben sich die Schatten.
Noch bemerkte es niemand. Nicht die einfachen Dorfbewohner, die gerade die Lampen löschten und Türen und Fenster verriegelten. Nicht der Herr über dieses Tal, der Baron, in der höchsten Kammer seiner Festung, wo das Zwielicht durch zwölf schmale Schießscharten fiel, zwölf fahle Streifen auf seinen Körper zeichnete, während er zusah, wie sich die Nacht über das Land legte. Nicht der Wanderer und seine Stute unten im Wald, angetrieben vom schwindenden Licht ringsum, auch wenn die Erschöpfung an seinen Knochen nagte und an seinen Muskeln schabte.
Angetrieben von dem Wunsch, nach Hause zu kommen.
Immer schneller raubte die Nacht dem Himmel seine Farben, immer schneller eilte der Wanderer den Pfad entlang. Er konnte spüren, wie die Dunkelheit auf seine Brust drückte, wie die Berge immer näher heranrückten. Und als die Dämmerung endgültig schwand, tauchte kein einziger Stern am Himmel auf, kein silbriger Mond stieg über den Horizont. Nur undurchdringliche Dunkelheit legte sich über den halb vergessenen Pfad zwischen den Bäumen. Denn zu jener Zeit waren die Nächte finster, so finster, dass kein Stern und kein Mondstrahl sie durchdringen konnte. Wie ein erstickendes Tuch nahm sie einem die Sicht, diese Finsternis, Vögeln und Getier ebenso wie Männern, Frauen und Kindern. Schon bald sah der Wanderer nicht einmal mehr die Zügel in seiner Hand, den weißen Schnee, durch den er stapfte, den Pfad vor seinen Füßen. Das einzige Licht, das verblieb, kam von der silbernen Brosche an seiner Brust. Wie ein Stern war sie geformt, jener Stern, dessen heller Glanz am Himmel den nördlichsten Punkt markierte – wollte man der Legende Glauben schenken.
Bis plötzlich vor ihm in der Dunkelheit ein kleiner Schimmer erschien. Warmes, goldenes Licht flackerte irgendwo zwischen den schwarzen Bäumen auf.
Licht, das ihn wieder frei atmen ließ, Licht, das die Schwere aus Knochen und Muskeln zog. Auch sein Pferd warf den Kopf hoch, stampfte auf. Lächelnd drehte sich der Wanderer zu der Stute um und klopfte ihr den Hals. »Wir sind zurück, Raud«, sagte er leise, woraufhin sie glücklich wieherte und den Kopf gegen seine Stirn drückte.
Und so folgten die beiden dem Willkommenslicht, das seine Gefährten entfacht hatten, obwohl es im Tal von Schur unter Strafe verboten war, in der Nacht auch nur die kleinste Lampe zu entzünden oder mehr als ein Flüstern von sich zu geben, denn die Menschen und ihr Baron fürchteten, dass Licht und Lärm Fremde in ihr Tal führen könnten. Oder die Furcht heranlocken würden.
Durch das Licht fand der Wanderer schließlich nach Hause.
Tief im Wald lebte er, in einer vergessenen Poststation, die er instand gesetzt hatte. Sie lag am Ende einer Lichtung zwischen hohen Tannen und Fichten, deren Nadeln grün-blau schimmerten wie das tiefe Meer und die Luft mit ihrem würzigen Duft anreicherten. Schon während er sich dem Haus näherte, hörte er leise Klänge, die feine Melodie eines Liedes, das dort drinnen gesungen wurde, auch wenn es gegen das Gesetz dieses Tales und seines Barons verstieß, auch wenn man dafür in den tiefsten und dunkelsten Kerker unter der Festung von Schur geworfen werden konnte.
Mit einem Lächeln auf den Lippen lauschte der Wanderer den leisen Klängen.
Und auch da.
Auch da krochen die Schatten unbemerkt durch das Tal. Lautlos und unüberwindlich glitten sie dahin, gehüllt in die undurchdringliche Finsternis der Nacht.
Der Wanderer brachte seine Stute in den Stall, den letzten von vielen, der dieser Poststation noch geblieben war, da seine Gefährten und er nur diesen einen wiederaufgebaut hatten. Nachdem er ihr den Sattel abgenommen und das schwarze Fell trocken gerieben hatte, schmerzten seine Arme. Nur für einen Atemzug lehnte er sich gegen die Stallwand, ließ sie einen Teil seines Gewichts tragen, und musterte seine Hände. Blau vor Kälte waren sie, aufgerissen und schwielig.
Er lehnte den Kopf gegen das Holz und schloss die Augen.
Nur für einen kurzen Moment.
Da hörte der Wanderer, wie eine Oud angeschlagen wurde.
Ohne den Kopf zu drehen, lachte er auf. Und er konnte das Lächeln in ihrer Stimme hören, als sie leise zupfend in der Gemeinen Sprache sagte: »Eine Sekunde lang dachte ich, ich müsste nur mit meiner alten Oud einen Pferdedieb verjagen.«
»Hast du etwa keine Wurfspieße bei dir?«, fragte der Wanderer. Seine Stimme war fast so rau wie seine Hände. Er räusperte sich.
Sie schlug die ersten Töne eines Liedes an und erwiderte mit ihrer weichen, tiefen Stimme: »Du kennst mich doch. Ich bin durch und durch Pazifistin.«
Noch einmal lachte er laut auf. Er drehte sich um.
Sah sie an.
Mit der Oud vor dem Körper stand sie vor ihm und zupfte mit langen, starken Fingern an den Saiten ihres Instruments, dieser entfernten Verwandten der Laute. Hochgewachsen und drahtig war die Bardin, das Haar so dunkel wie die Augen, die Fäuste so treffsicher wie ihre Worte. Sie trug eine enge schwarze Hose, darüber eine Tunika und ihre liebste Tassel aus feinster dunkelroter Wolle.
Er war ungefähr so groß wie sie, und in seinen Augen war sie wunderschön – ihr Körper, ihre Stimme, ihre achtlos geflochtenen Haare. Aber am meisten faszinierten ihn ihr Gesicht, ihr Lächeln und diese langen Finger mit den schwieligen Spitzen. Ihr raues Lachen – denn sie zog das Lachen stets dem Lächeln vor und das freche Grinsen noch dem Lachen.
»Estela vos sal, Caer«, begrüßte er sie in einer ihrer Lieblingssprachen, Pausian, gesprochen in einem Land an der Küste, südlich dieser Berge, das sie beide seit so vielen Jahren nicht mehr besucht hatten.
»Amics, ben sias benvengutz ara tornats sai«, antwortete Caer in derselben Sprache. Und dann grinste sie und fügte voller Überschwang hinzu: »Willkommen zu Hause, Weyd!«
Lächelnd ging der Wanderer auf die Bardin zu. Als er sie an sich drückte, begriff er endlich, dass er tatsächlich zu Hause war.
Und während die beiden einander umarmten, drangen die Schatten am anderen Ende des Tals weiter vor. Dichter und immer dichter schoben sie sich an das Dorf Festra heran, das Dorf direkt am Pass, dreißig Meilen von der Poststation entfernt.
Caer drückte dem Wanderer die Oud in die Hand und nahm ihm die Satteltaschen mit den Nahrungsmitteln ab. Dabei schnupperte sie an den Lederklappen, um herauszufinden, was er mitgebracht hatte, womit sie ihm ein weiteres Lachen entlockte. Befreit klang es. Erleichtert. Weit hatte er das Tal von Schur hinter sich gelassen, um die Nahrung zu erstehen, in freundlicheren Gefilden am Fuß der Berge.
Und während Caer und Weyd die Tür des Posthauses hinter sich zuzogen, setzten sich die Bewohner von Festra in ihren Betten auf, von der Ahnung geweckt, draußen etwas gehört zu haben.
Die Kräuterfrau, die Stria, schreckte als Erste hoch. Ihr Wissen um die Kraft der Pflanzen und die Tatsache, dass sie ein paar Worte in der Sprache des Wassers beherrschte, hatten ihr diesen Ehrentitel eingebracht. Nur ein Sohn und eine Tochter hatten es bis ins Erwachsenenalter geschafft, und beide wohnten nun bei ihr, nachdem auch deren Kinder alle tot und begraben hinter dem Haus ruhten.
Die Alte schob die nackten Füße aus dem Bett und schlich zur Tür ihres Häuschens. Mit angehaltenem Atem lauschte sie, spürte, wie die kalte Winterluft den Schweiß auf ihrer Haut trocknete.
Und jenseits der Tür glitt ein Schatten heran, lautlos und sanft.
Vierzehn Schatten fielen in Festra ein, glitten zu den Häusern rund um den Markplatz, lautlos und zart wie ein Nebelstreif.
Viele Meilen weiter südlich verriegelte Weyd die Haustür hinter sich. Caer schleppte die Satteltaschen in die Küche, die selbst ihren starken Muskeln einiges abverlangten, während Weyd im Lesezimmer das Willkommenslicht löschte.
Die Poststation bestand aus zwei großen Räumen, dem Lesezimmer vorn und der lang gezogenen Küche hinten, an die sich noch ein Waschraum anschloss. Im Lesezimmer lehrten sie die Talbewohner an manchen Tagen fremde Sprachen. Denn benötigte man etwas von Feuer, Wasser, Tieren, Luft oder Klang, eigentlich von allem, was diese Welt durchstreifte, in ihr wuchs oder auch nur existierte, so musste man seine Sprache lernen und höflich bitten. Manchmal half das. Manchmal nicht. In dieser Hinsicht hatte die Welt Ähnlichkeit mit den Menschen. Es kamen nicht viele zu ihnen in das Lesezimmer, denn in Schur begegneten viele fremden Sprachen mit Misstrauen, und wer sie beherrschte, galt schon beinahe als Entwurzelter. So blieb dieser Raum selbst am Tag oft leer, und nachts war er düster und kalt, weshalb Weyd Caer eilig in die Küche folgte.
Sobald er über die Schwelle trat, schlugen ihm Licht und Wärme entgegen, strichen sanft über seine schmerzenden Füße und die müden Schultern. Hier nun war es endlich warm und trocken, und mehr als das: Über dem gefliesten Kamin war eine Seekarte an die weiß verputzte Wand gemalt, in der Ecke stand ein hölzernes Bett, und die Mitte des Raums wurde von einem wuchtigen Tisch beherrscht. In den Regalen lagerten Gewürze aus all den Ländern, die der Wanderer bereist hatte; Thymian, Salbei und getrocknete Lorbeerzweige hingen von der Decke herab. Und vor allem waren hier seine Gefährten.
Zuerst ging er zu Bahr der Seefahrerin, eine kräftige Frau mit den grauen Locken und den blassen Brandnarben an Hals und Handgelenken, die gerade am Feuer beschäftigt war. »Wie geht es dir, Bahr?«, fragte er sie und legte ihr eine Hand auf die Stirn. Bei seiner Abreise hatte sie an einem Fieber gelitten. Sie schlug seine Hand weg und zog ihn in ihre Arme, bestimmt mit der Absicht, ihm sämtliche Knochen im Leib zu brechen.
»Kannst von Glück sagen, dass ich’s geschafft hab, dir noch ein paar von den gerösteten Kastanien aufzuheben, so spät bist du dran!«, brummte sie. »Nichts als Ärger hat man mit euch Wanderern.«
Lachend löste er sich von ihr. »Immerzu wollen wir fort«, bestätigte er. »Ganz wie ihr Seefahrer!«
»Unverschämtheit«, murmelte Bahr, hielt ihn aber noch immer fest im Arm. Der Schein des Feuers zeigte ihm, dass sie wieder kräftiger aussah; ihre umbrabraune Haut schimmerte im Licht, war aber nicht mehr von kaltem Schweiß bedeckt. Und sie war wieder so bärbeißig, wie sie sich am wohlsten fühlte. Zufrieden ließ Weyd sie los.
Sofort wandte Bahr sich wieder dem Feuer zu und sprach leise auf die Flammen ein, um sie dazu zu bewegen, nicht allzu viel Qualm zu produzieren. Nun konzentrierte sich Weyd ganz auf den alten Jori, der bereits auf ihn zukam. Als Erstes untersuchte er den Verband an Joris Hand, der in sauberem Weiß leuchtete. Jori ließ sich diese Fürsorge gefallen, er genoss sie sogar, denn er legte seine faltigen Hände an Weyds Wangen und drückte einen herzlichen Kuss darauf.
»Siehst du, mein Junge, solange ich dein Gesicht noch packen kann, ist es nur halb so schlimm«, verkündete er fröhlich. »Meine Finger sind so gut wie neu, und dieser kleine Zwischenfall mit Bahrs besten Küchenmessern ist schon halb vergessen. Ich hätte sogar schon wieder unterrichten und die lästigen, fremdartigen Worte aus der Sprache der Murmeltiere und Mäuse an die Tafel im Lesezimmer schreiben können, wenn irgendeiner dieser Talbewohner mal hier aufgetaucht wäre.«
Seine Stimme klang unbeschwert und volltönend. Niemand wusste, wie alt er genau war – nicht einmal er selbst – , doch er sagte oft scherzhaft, er sei älter als so mancher Stern. In seinen Augen lag stets ein schalkhaftes Funkeln, sein weißes Haar war stets zerzaust, seine Ohren riesig und das Gesicht mit dunklen Altersflecken übersät. Auf dem Kopf trug er einen Hut mit einer Feder, die ein prachtvoller blauer Vogel in den Bergen ihm freiwillig überlassen hatte, denn Jori beherrschte die Sprachen fast aller Tiere zu Land und zu Wasser und wäre eher gestorben, als einem von ihnen ein Haar zu krümmen, weshalb in der Poststation auch kein Fleisch auf den Tisch kam.
Weyd wandte sich dem letzten Mitglied ihrer kleinen Schar zu und beugte sich zu Bellitas hinunter, der neben dem Tisch saß und interessiert die Rüben, Kartoffeln, Kohlrabi und Kohlköpfe musterte, die Caer gerade auspackte. Jori hatte eines Tages mit dem weißen Fuchs Freundschaft geschlossen, der nun tagsüber meist schlafend bei ihnen am Feuer lag, um nachts im Tal auf Jagd zu gehen, wobei er so weite Kreise zog, dass er sogar bis zum Pass und bis nach Festra streifte. Bellitas ließ sich von Weyd den Rücken streicheln und unter dem Kinn kraulen, doch selbst als ein wohliges, leises Schnurren Weyds Finger vibrieren ließ, verharrte der scharfe Blick des Tieres auf den Satteltaschen. Offenbar hatte sein Geruchssinn dem Fuchs bereits verraten, dass ganz unten in den Taschen noch einige Winterbeeren warteten. In Bezug auf die angenehmen Dinge des Lebens war Bellitas wahrhaft unersättlich, seien es nun Essen, Trinken, Streicheleinheiten oder Musik.
»Gehst du heute gar nicht auf die Jagd, mein Freund?«, erkundigte sich Weyd in der Gemeinen Sprache, denn so viele menschliche Sprachen des Kontinents er auch beherrschte, die Sprachen der Tiere gehörte nicht dazu. Bellitas hingegen verstand die Gemeine Sprache der Menschen zumindest gut genug, um nun seine Hand zu lecken, wohl auch, weil sie schön salzig schmeckte. Nein, der Fuchs war in dieser Nacht nicht auf die Jagd gegangen, denn die liebevolle Aufmerksamkeit hier in der Poststation war der Wildnis draußen doch eindeutig vorzuziehen. Wäre er gegangen, so hätten sie ihn niemals wiedergesehen, denn er wäre auf vierzehn lautlose, unüberwindbare Schatten gestoßen. Und die Bewohner der Poststation ertrugen Verluste nur schwer. Die meisten von ihnen hatten bereits zu viel verloren, bevor sie Teil dieser bunten Schar wurden, in der man gemeinsam allen Gefahren trotzte, manchmal sogar dem eigenen Wahn.
In Festra stieß die Stria den Atem aus und wandte sich von der Tür ab. Selbst dieses zarte Geräusch hallte dröhnend laut in der Nacht wider. So leise wie möglich schlich sie zu ihrem Bett zurück und zog ein altes Schwert darunter hervor. Gehegt und gepflegt hatte sie es, wie ihre Kinder, die der Tod geholt hatte. Schnell warf sie sich einen Umhang über, bevor sie sich in der Dunkelheit ihrer Tochter und ihrem Sohn zuwandte.
In der Poststation ging Caer zu Weyd hinüber, zog ihm die Reisetassel von den Schultern und scheuchte ihn zu einem Stuhl. »Macht Platz für unseren strahlenden Leitstern, ihr Bauern! Macht Platz für den Wanderer! Macht Platz für Weyd den Weltenbummler!«, rief sie in der Gemeinen Sprache, der einzigen, die sie alle verstanden.
»Schrei nicht so, midons«, mahnte Weyd gutmütig. »Obwohl deinesgleichen wahrscheinlich gar nicht dazu in der Lage ist, leise Töne anzuschlagen.«
»Leck mich, mos segurs«, erwiderte sie freundlich, und benutzte den Kosenamen, mit dem sie ihn so gern aufzog. »Überlass es den Menschen in Schur, mich Krähe zu schimpfen und nachts nur zu flüstern, und setz dich endlich.«
»Ich würde mich geehrt fühlen, wenn man mich als Krähe bezeichnen würde«, stellte Jori wie schon so oft fest. Caer schnaubte nur und warf dem Alten die Tassel des Wanderers zu, der sie grinsend am Feuer aufhängte. Dann schlug Caer Weyd noch einmal kräftig auf die Schulter, bevor sie ebenfalls zum Kamin ging, sich kurz die Hände wärmte und die brummige Bahr in eine feste Umarmung zog, ob es der Seefahrerin nun passte oder nicht. Hin und wieder bezeichnete Caer Weyd als ihren Leitstern, als strahlendes Licht, oder sie sang die Balladen, die bereits von dem Wanderer berichteten, was Weyd aus nur ihm bekannten Gründen von Herzen verabscheute. Er rächte sich dann, indem er sie midons nannte und laut die Vorzüge von Ruhe und Frieden betonte. Selbstverständlich ließ sie sich dadurch nicht abschrecken, dazu machte es ihr und den anderen viel zu viel Spaß, ihn zu triezen, wo er doch oft so still war, sein Lächeln und seine Lieder so traurig.
Doch nicht heute. Heute ließ sich Weyd mit einem zufriedenen Ächzen auf den Stuhl fallen. Endlich, endlich konnte er die Stiefel ausziehen und die langen Beine den wärmenden Flammen entgegenstrecken.
Caer ließ sich im Schneidersitz an dem behaglich prasselnden Feuer nieder, legte ihre Oud auf ihren Schoß und bat den Klang, nicht weiter vorzudringen als bis zur Tür. Sie beherrschte die Sprache der Klänge, und keiner von ihnen hatte Lust, sich plötzlich einer Horde von Holzfällern mit gezückten Äxten gegenüberzusehen. Mit den Holzfällern von Schur sollte man sich nicht anlegen, denn es gab enorm viele von ihnen, und sie brachten allen Entwurzelten ein tiefes Misstrauen entgegen. Denn der Baron selbst hatte mit Gesten großen Bedauerns sichergestellt, Jahr für Jahr, dass sie wussten, wie leicht sie zu ersetzen waren, durch wandernde Arbeiter, die im Frühling zuhauf den Pass hinaufkommen würden.
Deshalb sorgte die Bardin dafür, dass von ihrem Lied nichts nach außen drang. Sobald der Klang sein Einverständnis gegeben hatte, stimmte sie eine fröhliche Melodie an. Sie sang eine Ballade von der schönen weiten Welt dort draußen. Und Jori legte Weyd den Arm um die Schultern, während Bahr die Seefahrerin den Fuchs Bellitas mit saftigen roten Beeren fütterte, die so herrlich auf der Zunge zerplatzten, und sie gemeinsam dem Gesang der Bardin lauschten, untermalt von dem Knacken der Kastanien über dem Feuer.
Die Stria von Festra hatte kein Feuer. Sie konnte nur mit steifen Fingern ihr Schwert packen und ihre Kinder wecken. Fest drückte sie die Hand auf ihre Münder, damit sie bloß keinen Laut von sich gaben.
Vor der Tür glitten die Schatten heran.
Nur ein Schritt zur Tür. Ein langsamer Schritt. Und dann noch einer.
Lautlos näherten sich die Stria und ihre Kinder der Hintertür, den Blick unverwandt auf die Haustür gerichtet. Kaum ein Atemzug schaffte es über ihre Lippen.
Draußen.
Schatten an der Schwelle.
Sie waren bereit.
Die Stria und ihre Kinder stahlen sich durch die Hintertür, als in Festra das erste Zischen ertönte, das erste dumpfe Dröhnen, das erste Flüstern. Das Zischen einer Flamme, die unter einem Wasserstrahl erstickt. Das dumpfe Dröhnen der Trommeln in den tiefsten Tiefen der Berge. Das Flüstern, rau und unverständlich. Nur spüren konnte man es, denn es legte sich um das Herz und ließ es erstarren. Die Stria legte eine Hand an die Brust, wo doch eigentlich ihr Herz schlagen sollte. Stattdessen spürte sie nur entsetzliche Stille.
Für einen Moment stand sie nur da, wie betäubt.
Die Stille.
Und in der Stille das Flüstern. Das Dröhnen. Das Zischen.
Die Schatten waren gekommen.
Während die Stria dastand mit der Hand auf der Brust und das Entsetzen ihr den Atem nahm, setzten sich die Freunde in der Küche der Poststation zum Essen zusammen.
Die Flammen im Kamin tanzten fröhlich knisternd mit den Schatten an der Wand. Warmes Brot gab es und dazu die Kastanien, die sie im Herbst von dem mächtigen Baum hinter dem Haus gepflückt hatten. Dann sang Caer noch eine Ballade für sie. Diesmal ließ sie die dichten Wälder von Klawppeda vor ihnen entstehen, Bäume mit salzverkrusteter Borke, die direkt aus dem Meer emporwuchsen. Sie sang von Roggenstockbrot, gebacken über einem Lagerfeuer am Strand, gewürzt mit Kümmel und Koriander.
Sie hörten die Trommeln nicht. Festra war zu weit entfernt, einen halben Tagesritt nach Norden, durch die Sorteid-Klamm musste man, bis an den äußersten Rand des Tales.
Doch die Stria hörte sie. Ihre Kinder hörten sie. Die Kühe, die Pferde und die Vögel hörten sie.
Caer sang von einem Hähnchen, das sorgsam mariniert werden sollte in Wein, Zitronensaft, Knoblauch und Rosmarin und nur mit letzter Not entkommen konnte, bevor es gerupft wurde. Entkommen wie die Vögel von Festra, die in Scharen über dem Dorf aufstiegen und flüchteten, während die Kühe, die Schafe und die Pferde ihr Entsetzen hinausbrüllten.
Das hörten auch die Menschen von Festra. Das ließ sie aus dem Schlaf schrecken.
Aus dem Schlaf schrecken, als die Schatten ihre Türen aufbrachen.
Caer sang die Geschichten von all den Wegen, die der Wanderer beschritten hatte, und von jenen, die man nur in Balladen erkunden konnte. Ein Lied folgte aufs nächste, bis ihre Gefährten sich nach und nach dem Schlaf ergaben. Ein Haus folgte aufs nächste, als die Schatten über Festra herfielen. Während Bellitas sich warm und sicher unter dem Tisch zusammenrollte, traten sie über die Schwellen der Häuser am Pass. Während Jori sich ins Bett legte, seinen alten Körper mit einem zufriedenen Lächeln auf der Strohmatratze ausstreckte, hoben sie ihre Klingen, scharf und tödlich, kümmerten sich weder um das flehende Flüstern der Erwachten noch um die letzten Träume der Schlafenden.
Während Bellitas leise schnurrend die Augen schloss, fielen die Schatten über den Milchmann her, über den Schuster und über den Schmied und schlachteten sie in ihren Betten ab.
Geduldig verfolgten sie jene, die vor ihnen flohen. Sie verfolgten die Stria und ihre Kinder auf ihrer Flucht zum Stall, in dem die Pferde tobten vor Angst.
Als die letzten Worte des letzten Schlafliedes in der Poststation verklangen, waren alle eingeschlafen bis auf die Bardin und den Wanderer. Während Caer ihre Oud zur Seite legte, hetzten die Stria und ihre Kinder in Festra zur Stalltür. Hinter ihnen glitt ein Schatten heran.
Langsam.
Geduldig.
Tödlich.
Nach und nach schwand die Glut aus den Kohlen im Kamin, während der Wanderer auf seinem Stuhl saß und sich alle Mühe gab, nicht zur Bardin hinüberzusehen. Nicht ihre Haut zu mustern, braun wie die Bronzespitzen ihrer Pfeile, nicht zu beobachten, wie sich die sterbende Glut in ihren Augen spiegelte.
Ihre Schultern berührten sich. Ihre Arme waren stark, da sie oft mit Wurfspeeren und Bogen hantierte. Sicher war sie es, die sich zu ihm gebeugt hatte. Fast hätte sich ein wehmütiger Laut über seine Lippen gestohlen. »Bist du nicht müde, Caer?«, fragte er.
»Doch«, antwortete Caer.
»Tja.« Er schwieg kurz. »Ich auch.«
Trotzdem machte keiner von ihnen Anstalten aufzustehen. Nachdem er so lange unterwegs gewesen war, nachdem er bis nach Briva gewandert war, in die Blaue Stadt oben im Norden, wollte er in ihrer Nähe sein.
Überallhin war sie mit ihm in den vergangenen acht Jahren gereist, hatte ihn blutverschmiert gesehen, schlammverklebt, oftmals auch beides gleichzeitig. Hatte gesehen, wie sich seine Hand voller Verzweiflung um den Schwertgriff legte, wie seine Muskeln sich bis zur Schmerzgrenze spannten, wie er dem Tod ins Gesicht sah. Das alles hatte sie gesehen und war trotzdem noch hier. Auch in stillen Momenten wie diesem, zusammen an einem sterbenden Feuer, mit dem Duft von Thymian, Salbei und Kiefernnadeln in der Nase, wenn er sich die Frage stellte, ob sie vielleicht dasselbe empfand wie er.
Ob auch sie ihn liebte.
Und wenn er nichts sagte? Würde er dann mit neunzig – falls er so viel Glück hatte – auf dem Sterbebett liegen und voller Stolz verkünden: Aber wenigstens habe ich es ihr nie gesagt?
»Hat der Baron während meiner Abwesenheit etwas von sich hören lassen?«, fragte der Wanderer schließlich.
»Er war sogar hier.« Sie versuchte, es ungerührt klingen zu lassen, wenn überhaupt leicht belustigt, doch die leise Anspannung in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
Er hob den Kopf. »Was wollte er?«
»Das Übliche«, erklärte sie achselzuckend. »Mich auf ein Bärenfell betten. Er hat wieder diesen schrecklichen Pelz getragen, weißt du, in dem er sich offenbar für unwiderstehlich hält.«
Weyd schwieg.
»Hör auf.« Sie warf ihm einen mahnenden Blick zu.
»Ich sage doch gar nichts.«
»Trotzdem höre ich, wie du dich sorgst. Eiserner Baron hin oder her, Lurin könnte mich niemals zu etwas zwingen. Klugerweise hat er es nicht versucht. Wahrscheinlich hatte er keine Lust, mit einem Pfeil in der Luftröhre zu enden.«
Plötzlich schien sich kaum noch Luft in Weyds Lunge zu befinden. Oder zu viel davon. »Danke, dass du auf die Poststation aufgepasst hast, während ich fort war.«
Deshalb war sie dieses Mal nicht mit ihm gekommen. Sie hatten entschieden, ihre Kräfte aufzuteilen. Dieser Winter war länger und kälter als alle, an die sie sich erinnern konnten.
Caer drehte sich zu ihm um, wobei ihre Schulter sich wieder gegen seine drückte. Ihr Blick war stechend. »Du musst dir nicht immer die ganze Verantwortung für alles aufbürden, Weyd.«
Er wich ihrem Blick aus. »Lass gut sein.«
»Du bist nicht allein«, betonte sie. »Und es sollte nicht dein Zweck sein, auf uns aufzupassen. Denn dazu sind wir sehr gut selbst imstande.«
»Und was sollte dann mein Zweck sein?«, fragte er betont scherzhaft. »Natürlich auf keinen Fall, für deine Sicherheit zu sorgen, auch wenn mir für einen erfahrenen Wanderer nicht viel anderes einfallen will.«
Caer lehnte sich noch näher zu ihm. »Mein lieber Wanderer, in einem kannst du dir sicher sein: Ich brauche niemanden, der mich vor dem Eisernen Baron beschützt. Lurin ist ein Schwein, nichts weiter.«
Es dauerte lange, sehr lange, bis er erwiderte: »Vielleicht bin ich das ja auch.«
Sie stieß frustriert den Atem aus. Nichts wünschte sich Caer mehr, als dass er sich einmal so sah, wie sie es tat: das Strahlen seiner Augen, sein warmherziges Lächeln, seine Verbundenheit mit all den Sprachen, mit den Wegen, den Karten, den Sternen und den längst vergessenen Liedern. Seine langen Finger, die Art, wie sich die Adern an den Unterarmen unter seiner Haut abhoben, sodass sie nichts lieber tun würde, als darüberzustreichen. Manchmal konnte sie an nichts anderes denken, wenn sie ihn ansah. Er hatte sie alle hier aufgenommen, sogar sie, obwohl sie nicht wie Bahr mit dem Feuer sprechen konnte, nicht wie Bellitas sogar in der finsteren Nacht sehen konnte, nicht die Raben dazu überreden konnte, ihre Reste mit der Gruppe zu teilen wie der alte Jori. Caer beherrschte keine andere Sprache als die der Klänge und keine andere Fähigkeit als das Singen von Liedern. Sie hatte nichts mitgebracht außer einer Oud und ihrer Stimme, die rau und kratzig gewesen war, schartig wie ein altes Schwert vom vielen Schreien. Und die Angst hatte sie dabeigehabt, dass sie nie wieder weich klingen, nie wieder heilen würde.
Weyds Herz begann zu rasen, als er plötzlich Caers Hand auf seiner spürte. »Ich wünschte, du würdest nicht so über meinen Freund sprechen«, sagte sie leise.
Er nahm ihre Hand in seine. Musterte sie im letzten Licht der glühenden Kohlen. Vorsichtig strich er über ihre spitzen Knöchel. Über ihre schwieligen Fingerspitzen. Während er nichts lieber getan hätte, als hochzusehen und sie zu küssen. »Dein Wunsch ist mir natürlich Befehl.«
Seine Stimme verriet ihn, verriet die Zärtlichkeit.
Die Nacht, die Dunkelheit, das sanfte Glühen der Kohlen machten ihn mutig. Vertrieben die Anspannung. Ließen den Gedanken in ihm erwachen, dass
vielleicht
vielleicht
alles gut werden würde.
Wenn er jetzt den Kopf hob, wenn er die Hand hob, wenn er sanft über ihre Wange strich, über ihre raue, wundervolle Haut …
Vielleicht würde sie gar nicht flüchten. Sie, die erfüllt war von Witz, Geist und aufrührerischen Liedern. Sie, der es auf ihren gemeinsamen Reisen nie an Gesellschaft mangelte, während er stets die Freudenhäuser aufsuchen musste, wenn seine eigene Hand nicht mehr ausreichte, um ihm Erleichterung zu verschaffen.
Und einen Moment lang dachte Caer, dass
vielleicht
vielleicht
alles gut werden würde, wenn sie jetzt seine Hand an ihr Gesicht hob, sie küsste, ihr Schandmaul dazu benutzte, ihm zu sagen, wie sehr sie ihn liebte.
Ja, die Nacht machte sie mutig. Denn dazu waren die Nächte bestimmt gewesen, bevor sie so finster geworden waren. In manchen Liedern erzählt man sich noch davon: Wie des Nachts ausgesprochen werden konnte, was man im hellen Licht des Tages nie wagen würde.
Sag es ihm, befahl sie sich.
Sieh sie an, befahl er sich.
»Weyd.« Ganz leise sagte sie es.
Und er hob den Kopf.
Während sich in der Poststation zwei Blicke trafen, stürzten in Festra die Stria und ihre Kinder in den Stall. Sie öffneten drei Stände. Griffen nach dem Zaumzeug. Die Pferde wieherten wild.
Im selben Moment glitt der Schatten in den Stall hinein. Ein Schatten nur.
Ein einziger.
Wandte sich ihnen zu in der Finsternis.
Nun wieherten die Pferde nicht mehr. Und die Stria spürte, wie ihr Herz verstummte.
Die Kräuterfrau drehte sich um. Packte ihr Schwert und starrte den gesichtslosen Schatten an. »Verschwinde«, flüsterte sie. »Wir lassen uns nicht von der Furcht beherrschen! Wie werden nicht das Knie beugen vor deinem Meister!«
Der Schatten antwortete nicht. Lautlos wandte er sich dem nächsten Stand zu.
Langsam
ganz langsam
teilte sich sein Mantel aus finsterster Nacht, und er zog ein Schwert hervor. Weiß. Weiß wie ein Feuer kalt und scharf war die Klinge.
Langsam
ganz langsam
schlug der Schatten zu.
Als die Klinge das Pferd berührte, starb es nicht einfach nur.
Es brannte. Wie durch Wasser glitt die bleiche Klinge, versengte Haut, Fleisch und Knochen, durchtrennte Muskeln, Mark und Sehnen, ließ alles zerfallen, zerfallen und verbrennen, als wäre das Schwert aus kaltem Feuer geschmiedet, aus weißen, gnadenlosen Flammen.
Der Sohn der Stria schrie auf. Die verbliebenen Pferde schlugen panisch aus. Blut spritzte aus dem brennenden Pferdeleib, ließ den Schatten anwachsen. Sein Körper blähte sich auf, das Schwert wurde breiter, schwerer, schneller, als er sich zu der Stria und ihren Kindern umdrehte. Schwarze Ranken schienen aus seinem Körper zu sprießen, lang, dick, gierig wie tastende Krallen der Furcht.
Wieder packte die Stria ihr Schwert, und mit einem Schrei stürmte sie los, stieß dem Schatten ihre Klinge in den Leib.
Das Schwert glitt einfach durch ihn hindurch.
Die Stria stürzte zu Boden, doch der Schatten fing sie auf mit seinen Ranken, ließ beinahe zärtlich seine Klinge über ihre Wange gleiten.
Sie fing an zu schreien, als ihre Haut schmolz, schlug wild um sich, konnte sich nicht befreien. Ganz sanft hob der Schatten die alte Frau hoch, als wollte er sie liebkosen. Eine Liebkosung voll unerträglichem Schmerz, denn jedes Stückchen Haut, das die bleiche Klinge berührte, verbrannte in ihrem tödlichen Feuer.
Ihre Tochter griff an.
Dass sich so etwas zutragen konnte, während Weyd und Caer in der Poststation am Feuer saßen, ahnungslos, sorglos, tief im Wald verborgen, und nur Augen füreinander hatten.
Kaum merklich glitten seine Fingerspitzen über ihre Haut. Und je länger er sie ansah, desto mehr Hitze strömte durch seinen Körper. Sie roch nach warmer Haut, nach dem Harzöl, mit dem sie ihre Oud polierte, nach Rauch, weil sie immer viel zu dicht am Feuer saß.
Und dann beugte sich die Bardin vor. Und der Wanderer wich nicht zurück. Keinen Zoll weit wich er zurück. Während die Schatten in sämtlichen Häusern Festras einfielen, jedes Tier, jeden Baum, jedes Kind, jede Frau und jeden Mann niederstreckten mit ihren kalten Klingen, während ihre Körper anschwollen von dem vielen Blut, ihre gierigen Rankenarme dicker und länger wurden, hungriger und hungriger, beugte Caer sich vor. Während der Bruder die Schwester mit aller Kraft zurückhielt, während die Stria halb erstickt nach ihren Kindern rief – fliehen sollten sie, fliehen – , schob sich Caer näher an Weyd heran als jemals zuvor. Er spürte ihren Atem an seiner Wange. Blickte in ihre Augen, sanft geschwungen wie der Körper ihrer Oud, schwarz wie die Kohlen im Feuer, so dicht vor ihm. Die Worte hatten schon fast seine Zunge erreicht.
Ich liebe dich.
Im selben Moment zogen Bruder und Schwester sich auf ihre Pferde. Im selben Moment streckte der Schatten sich ihnen entgegen, griff mit seinen dicken, lauernden Ranken nach den beiden.
Sie krümmten sich vor Schmerz, als die Ranke sie streifte. Schlugen schreiend um sich, während ihre Mutter hilflos zusah. Während der Schatten sie liebkoste. Verbrannte. Ihre Rippen zerquetschte. Lange, dicke, schwarze Ranken um sie schlang.
Im selben Moment jagten die von Furcht getriebenen Vögel aus Festra über die Poststation hinweg.
Caer nahm all ihren Mut zusammen und hob die Hand. Ließ die Fingerspitzen über Weyds Haut gleiten. Über seine Wange.
Und seine Lippen öffneten sich.
In Festra kämpften Schwester und Bruder, schrien. Und noch immer rief die Stria nach ihnen. Rief ihnen zu, dass sie fliehen mussten. Brüllte den Schatten an, damit er sie gehen ließ. In diesem Moment erhob sie erst zum vierten Mal im Leben ihre Stimme. Das erste Mal hatte sie bei der Geburt ihres ältesten Kindes geschrien. Das zweite Mal bei dem Aufstand der Singenden, der so viele das Leben gekostet und bei dem sie manches Enkelkind verloren hatte. Das dritte Mal im Stall, als der Schatten sie angriff.
Nun zum vierten Mal.
Zum letzten Mal.
Die Pferde ergaben sich der Panik. Sie gingen durch, brachen aus ihren Ständen aus und rannten los, fort, nur fort von dem Schatten. Bruder und Schwester klammerten sich fest, ohne Zügel, ohne Sattel, einfach nur festhalten. Sie bluteten, waren halb verbrannt, halb verkrüppelt, doch sie lebten. Und die Stria rief hinter ihnen her, rief und rief, während die Pferde kopflos auf die Stalltür zupreschten.
Der Schatten ließ sie entkommen.
Denn wie sollte sich der Schrecken verbreiten, wenn es keine Überlebenden gab, um davon zu berichten?
Der Wanderer hielt abrupt inne, als Bahr sich auf ihrem Platz am Feuer regte. Ebenso schnell huschte Caers Blick zu ihr hinüber. Dann grinsten sie sich plötzlich an, hätten beinahe laut gelacht.
Bis Caer es nicht mehr aushielt.
Und während Caer lachte
während Bellitas träumte, leise winselnd
während Jori im Schlaf Worte in der Sprache der Krähen murmelte …
und während Bahr kurz erwachte, schlaftrunken die Glut bat, noch ein wenig länger durchzuhalten, woraufhin die Reste des Feuers jammerten, sie wären zu müde, wollten nicht mehr, was sie mit einem brummigen »Na schön« quittierte, sich fester in ihre Decke wickelte und wieder einschlief
während die Glut Mitleid bekam mit Bahr und ihr stillschweigend ihren Wunsch erfüllte
während der Wanderer ansetzte, um Caer zu sagen, wie sehr er sich nach ihr sehnte
ihr endlich zu sagen, dass er sie liebte
war die Furcht ins Tal gekommen.
Eis und Schnee hielten sie nicht auf, auch kein unüberwindbarer Gebirgspass, keine gesperrte Höhle. Nein, Eis, Schnee, ein vernachlässigter Pass, verschlossene Tunnel und das Fehlen von Licht in der Nacht sorgten nur dafür, dass die Furcht sich heimisch fühlte.
Später hieß es, sie sei aus den Höhlen gekrochen oder aus den Tiefen der Berge emporgestiegen. Doch die meisten waren der Ansicht, es sei wegen der Entwurzelten geschehen. Weil heutzutage überall Fremde seien, weil die Fremden die Furcht mit sich gebracht hätten.
Wo die Furcht doch in Wahrheit in den Häusern mit den verriegelten Fensterläden gelauert hatte, auf den der Musik beraubten Marktplätzen, im Herzen des Barons, dessen Augen so sehr an Schießscharten erinnerten. Gelauert hatte sie, und gewachsen war sie, weiter und weiter, lautlos, verstohlen, über hundert, dreihundert, fünfhundert Jahre hinweg, bis sie schließlich bereit war, Gestalt anzunehmen.
In jener Nacht war sie so weit. Die Schatten waren gekommen.
Nachdem sie ihr Werk vollendet hatten, versammelten sie sich auf dem Dorfplatz von Festra. Langsam. Lautlos. Erbarmungslos.
Und als der Wanderer sich wieder zu Caer umdrehte, die Finger und die spitzen Knöchel streichelte, die er so bewunderte, in dem Wissen, dass er es ihr nun sagen würde …
waren sämtliche Bewohner des Dorfes Festra, der letzten Siedlung vor dem Pass im Norden, bereits tot.
Später würde man es das Massaker am Pass nennen, dem nur zwei Seelen lebend entronnen waren: Schwester und Bruder.
Sie ritt zur Festung.
Er ritt zur Poststation.
Weyd wusste nicht, wie lange er einfach nur Caers Hand gestreichelt hatte, nur die müden Finger seiner Bardin massiert hatte, während seine eigenen Glieder in der Wärme immer schwerer wurden.
Wie lang es auch gewesen sein mochte, schließlich blickte er auf
blickte Caer direkt in die Augen
und sagte: »Es gibt etwas, das ich dir sagen möchte, midons.«
Doch es war zu spät. Denn in diesem Moment brach der Bruder bewusstlos auf der Schwelle der Poststation zusammen.
2 – Die letzten Worte der Stria
Die letzten Worte der Stria
So fing es an.
Mit einem Bruder, der auf der Schwelle einer aufgegebenen Poststation zusammenbrach. Mit seiner Schwester, die in gestrecktem Galopp auf die Stadt Colmstat und die Burg Reuldum zupreschte.
Mit einem Bruder und einer Schwester, die allein die letzten Worte ihrer Mutter gehört hatten.
Während der Wanderer und seine Gefährten den Bruder von ihrer Türschwelle auflasen, erreichte die Schwester Colmstat, die Burgstadt am Fuß des Schlosses Reuldum, in dem Lurin residierte, der Eiserne Baron des Tales. Man gewährte ihr Einlass hinter die dicken Steinmauern, erlaubte ihr, die gepflasterte Straße hinaufzureiten, hinein in das alte, kalte Schloss mit dem hohen Festungsturm, der seit Menschengedenken noch nie erstürmt worden war. Drei Mägde führten sie die Wendeltreppe hinauf, in die höchste Kammer des Turms, vorbei an vielen, vielen Schießscharten, schmal und hell wie bleiche Augen. Und während sie Runde um Runde emporstieg, eine Stufe nach der anderen erklomm, musste sie an ihre Mutter denken, daran, was sie ihnen mit letzter Kraft hinterhergerufen hatte.
Ja, ihre Gedanken waren bei dem, was die Stria ihnen gesagt hatte. Im letzten Moment, als die Pferde sie aus dem Stall hinaustrugen.
Diese letzten Worte ihrer Mutter musste sie dem Baron überbringen. Er war es, der über Schur herrschte. Er war es, der sie beschützen würde.
Lurin, der Eiserne Baron, stand in der höchsten Kammer seines Festungsturms und war gerade dabei, sich anzuziehen, als es an der Tür klopfte. Da er nicht mehr trug als eine Hose und den Lederhandschuh, den er nur auszog, wenn er sich wusch, legte er sich ein Bärenfell um die Schultern, bevor er rief: »Herein!«
Ihm war auf den ersten Blick klar, dass die Frau, die seine Kammer betrat, einen langen, harten Ritt hinter sich hatte. Ihm fiel auf, dass ihr Haar auf eine Art geflochten war, wie man sie in den Dörfern im Norden des Tales fand, kurz vor dem Pass, in jener Gegend, die in Schur als die Grenze bekannt war, und dass sie kaum mehr trug als der Baron selbst. Dass ihr Nachthemd weit aufklaffte, ihre Hose zerrissen war, dass nur das getrocknete Blut diese Fetzen noch an ihrem Körper hielt.
Ein Auge war zugeschwollen, der Großteil ihres Gesichts verbrannt, ihre bloßen Füße waren schwarz vom Frost.
Und er wusste auch, dass dieses Mädchen unter der verbrannten Haut und dem vielen Blut sicher sehr schön war.
Drei Mägde hatten sie heraufgebracht, alle drei selbst sehr hübsch. Mit hinter dem Rücken verschränkten Händen stellten sie sich rings um sie auf, hielten aber Abstand. Die drei waren noch dürftiger bekleidet als der Baron, trugen nichts außer einem hauchzarten Stoffstreifen um die Hüften und um die Brust, unter den Armen mit goldenen Schleifen festgebunden, damit sie weder eine Klinge noch ein Fläschchen mit Gift am Körper verstecken konnten. Ihre Körper wurden jeden Morgen rasiert, komplett vom Scheitel bis hinunter zu den Füßen.
Auf einen Wink ihres Barons hin entzündeten sie die Fackeln in der Kammer, wie es nach Tagesanbruch rechtens war, damit der Baron sich die junge Frau gründlich ansehen konnte. Die Schwester wartete nicht ab, bis sie fertig waren, sondern setzte zum Sprechen an. Ihre zerschnittenen, gerade verkrusteten Lippen rissen wieder auf, und Blut tropfte aus ihrem Mund, als sie ihm berichtete, dass sie aus dem Dorf Festra zu ihm geritten sei. Dass wohl niemand dort die Nacht überlebt hatte.
»Es war eine finstere Nacht«, erwiderte der Baron, während er zwei Mägden signalisierte, zu ihm zu kommen und ihn weiter anzukleiden.
Sie schüttelte den Kopf, auch wenn es ihr ein schmerzerfülltes Stöhnen entlockte. »Nicht die finstere Nacht war schuld. Die kennen wir gut. Meine Mutter ist die Stria von Festra, wir kennen die finstere Nacht und wissen, dass man nicht auf die Einflüsterungen der Furcht hören darf. Und wir verschließen die Tore des Dorfes gegen Banditen und Gefahren, immer, aber welch ein Bandit könnte schon kommen, wenn der Pass blockiert ist? Nein, diesmal war es anders. Das war nicht die Nacht. Es waren die Schatten.«
»Was für Schatten?« Lurin zog fragend eine Augenbraue hoch, während die Mägde ihm eine schwere Eisenkette um den Hals legten. Nun musterte er die junge Frau mit mehr Aufmerksamkeit.
Ihr Anblick rief Erinnerungen wach.
»Aye«, bekräftigte sie. Aus einer Wunde an ihrem Bauch quoll Blut hervor. »Es waren Schatten, gehüllt in Mäntel schwärzer als die Nacht, mit Schwertern heiß wie Feuer.«
Eine der Mägde schnappte hörbar nach Luft.
Der Baron wandte sich ihr zu. Schnalzte leise mit der Zunge. Eine andere Magd streifte ihm die Freiherrenringe über die Finger der linken Hand, über den dicken Lederhandschuh. Jedes dieser Schmuckstücke war aus dem schweren Eisen gefertigt, das nur in den tiefsten Tiefen der Berge zu finden war, die das Tal umschlossen. An jedem Finger seiner Linken saß ein Ring, alle geformt wie kleine Ambosse. Dainte wurden sie genannt. »Also waren es schwarz gekleidete Fremde?«, fragte der Baron und drehte sich zu der Schwester um. »Reisende, Fremde, Marodeure, Entwurzelte?«
Sie schüttelte so heftig den Kopf, dass das Blut spritzte, weshalb die Mägde hastig zurückwichen. »Nein, nein, Herr, nichts dergleichen. So war es nicht. Meine Mutter hat einen von ihnen mit dem Schwert durchbohrt, bis zum Heft, doch es war nur ein Schatten. Weder Klinge noch Pfeil noch Bratpfanne konnten ihm etwas anhaben. Und dann hat der Schatten sie niedergestreckt, hat sie mit seinem Schwert verbrannt, die Klinge war wie weißes Feuer. Mich und meinen Bruder hat er mit Ranken aus Finsternis umschlungen, aber mein Bruder und ich sind geflohen, so schnell wir konnten. Wir haben es nur da rausgeschafft, weil unsere Mutter so lange gebrannt hat, so lange, ihre Haut hat gebrannt, und sie hat geschrien, gebrannt, gebrannt, geschrien, und als wir wegritten, da hat sie gerufen …«
»Dein Bruder?«, unterbrach sie der Baron. Gerade griff die Magd nach seiner rechten Hand und schob den letzten Daint auf seinen Finger, lang und dünn war dieser, das Metall funkelte wie eine Klinge. Tur war der Name dieses Ringes. »Er hat überlebt?«
»Aye.« Das Mädchen zitterte.
Ganz langsam nickte der Baron. »Wie ist dein Name, sora?« Er sprach sie mit dem schurischen Wort für Schwester an. Gleichzeitig winkte er ab, als die Magd ihm weitere Kleidungsstücke bringen wollte. Noch immer trug er nur Hose, Lederhandschuh und Bärenfell, dazu seine Ringe und seine Kette.
Sie schluckte schwer. Blut quoll aus ihrem Mundwinkel. »Blanka aus Festra.«
Der Baron lächelte. »Knie nieder, sora«, befahl er.
Sie schwankte leicht. »Ich … Ich glaube, das kann ich nicht, Herr.«
»So ist das nun einmal mit Herrschern und Obrigkeiten«, erwiderte er sanft. »Man muss vor ihnen niederknien.«
Blanka sah sich nach einer Stütze um. Dabei streifte ihr Hilfe suchender Blick auch die Mägde, die still den Kopf gesenkt hielten.
Ächzend humpelte sie durch die Kammer zur östlichen Wand hinüber, wo der Glanz der aufgehenden Sonne durch die Schießscharten fiel. Eine Hand an den kalten Stein gepresst, sank sie langsam auf die Knie; schrie auf, als ihre Knie den Boden berührten, ihre Knöchel einknickten, die Verbrennungen ihr eine neue Schmerzenswelle schickten.
Der Baron sah zu, wie sie stöhnte, wimmerte, kämpfte. Dann ging er mit einem milden Lächeln zu ihr hinüber. Hob zärtlich mit der von Leder verhüllten Hand ihr Kinn an. »Gut gemacht, Blanka«, lobte er sanft. »Und nun sei ein braves Mädchen und sage mir: Wo ist dein Bruder?«
Jedes Wort bereitete ihr Schmerzen, trotzdem presste sie hervor: »Er hat sich auf die Suche gemacht nach dem Entwurzelten, der in den Wäldern lebt, und nach diesem alten Mann. Sie bringen den Leuten im Winter fremde Sprachen bei. Nach dem Vagabunden! Wir dachten, vielleicht kann er auch mit diesen Schatten sprechen …«
Der Baron nickte. »Gut gemacht, sora.«
»Herr«, flehte sie, »ich muss auch dort hin. Ich habe meinem Bruder versprochen, zu ihm zu kommen. Es geht ihm nicht gut.«
»Ich werde ihn für dich herbringen lassen. Willst du denn nicht bleiben, sora?«
Sein Finger glitt über ihr Kinn.
Sie wich zurück.
Das Lächeln des Barons verblasste.
Oh ja, wie sehr sie ihn doch erinnerte an eine andere Frau. Eine Frau, die nicht vor seinen Berührungen zurückgeschreckt war.
Doch das war vor langer Zeit gewesen, und Lurin, der Eiserne Baron, konnte sich kaum noch daran erinnern, wann er das letzte Mal bei jemandem gelegen hatte, ohne es befehlen oder in klingender Münze entgelten zu müssen.
Doch er wusste, dass er sich danach verzehrte.
»Blanka«, sagte er leise. »Möchtest du nicht ein wenig bleiben?«
»Nein, Herr. Ich muss zu meinem Bruder. Wir müssen unsere Mutter beerdigen. Wir müssen … die Kräuter. Ich muss ihre Arbeit weiterführen, denn wenn ich es nicht tue, wer soll dann die Salben anrühren, die Tinkturen mischen und Erkältungen, Wunden und Herzschmerz behandeln?«
Er nickte langsam.
Dann packte er sie. Fest. Drückte den Daumen auf eine besonders schlimme Verbrennung.
»Blanka«, rief er über ihren Schmerzensschrei hinweg. »Hast du dich etwa gerade deinem Herrn verweigert?«
Blanka konnte nicht sprechen. Konnte nur wimmern.
Lurin beugte sich zu ihr hinunter und flüsterte ihr ins Ohr: »Bleib.«
Sie versuchte, den Kopf zu schütteln. Die Mauer war dick und kalt, ihre Hand rutschte daran ab, als sie nach einem Halt tastete. Blankas Blick huschte umher, suchte nach der nächsten Schießscharte, an der sie sich festklammern, die ihr ein wenig Licht spenden würde.
Seine Hand packte noch fester zu, und er beugte sich über sie. Atmete ihren Duft ein: Blut, verbrannte Haut, kalter Angstschweiß und noch etwas, das er nicht benennen konnte. Etwas Dunkles, Widerwärtiges. Und unter all dem war sie. Der süße Duft einer Frau, die vor ihm zurückgeschreckt war.
Ganz tief atmete er ein.
Wie sehr er sie wollte.
Das Bauernmädchen mit der Hexenmutter.
Und doch
hatte Lurin noch etwas Weiteres bemerkt, schon in dem Moment, in dem Blanka eingetreten war: dass ihr Leben nicht mehr zu retten war.
Gerade als Blanka den Rand des nächsten Simses ertastet hatte, drückte der Baron Tur an ihre Kehle. Ihre Augen weiteten sich. Er wartete nicht, bis Blanka anfing zu kämpfen. Wartete nicht, ob ihr Mund sich öffnete und ein paar letzte, verzweifelte Worte hervorpresste.
Stattdessen schlitzte er ihr die Kehle auf.
Blut spritzte aus der Halsvene. Er ließ den Körper zu Boden fallen, ihren Duft noch immer in der Nase.
Nun wandte sich der Baron seinen Mägden zu. »In unserem Tal treiben sich Entwurzelte in schwarzen Mänteln herum«, erklärte er, während er die zitternden Finger hinter dem Rücken verbarg. »Sie sind wohl über den Pass gekommen. Wir müssen sie finden und auslöschen. Heute noch.«
Die Frauen senkten demütig die kahl rasierten Köpfe. Dunkle Tropfen spritzten auf ihre weißen Stoffbänder, als Blanka hilflos nach Luft rang, wieder und wieder. Ihr wurde schwarz vor Augen, und ihre Gedanken wanderten zu ihrer Mutter; zu den Worten, die sie nun nicht hatte weitergeben können. Und dann dachte sie an ihren Bruder, nur noch an ihren Bruder, sie vergaß die letzten Worte, wünschte bloß, sie könnte ihn noch einmal an sich drücken, ihm sagen, dass er nun allein auf sich achtgeben musste, aufpassen musste, wenn sein Geist so dumpf wurde und er es morgens nicht aus dem Bett schaffte, auf sich aufpassen musste er, er musste, er musste …
Lurin atmete tief ein, als die Frau das Bewusstsein verlor. Während er den Mägden bedeutete, ihm seine Kleidung zu bringen und den Leichnam fortzuschaffen, gab sich der Baron alle Mühe, nicht auf seine zitternden Finger zu blicken. »Wie bedauerlich, dass ihr das mit ansehen musstet«, beteuerte er. »Es war ein Gnadenakt. Sie litt, und wir hätten sie nicht mehr retten können. Auch ich habe keine Freude an einer Hinrichtung. Aber wir müssen nun einmal alle unsere Pflicht tun. Selbst ich. Oh ja, vor allem ich.«