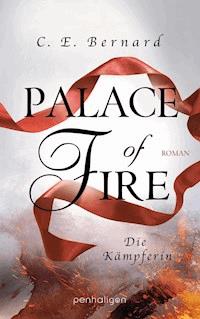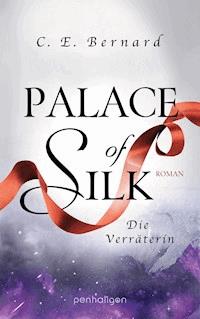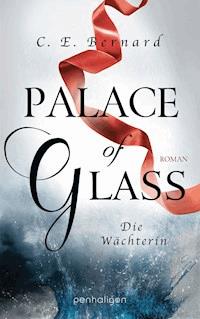9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Wayfarer-Saga
- Sprache: Deutsch
Das große Finale der Wayfarer-Saga: Wird der Wanderer Weyd die Welt in die Dunkelheit stürzen?
Der Wanderer Weyd und seine Freunde haben eine dunkle Wildnis durchreist, um die sagenumwobenen Türme des Lichts zu erreichen. Doch die drei Bauwerke sind so tödlich wie ein Waffenarsenal und verlangen den Gefährten Schreckliches ab. Das Schlimmste steht Weyd allerdings noch bevor: Wenn er das Feuer an der Turmspitze entzünden will, muss er ein unmenschliches Opfer bringen – oder sich stattdessen für ewige Finsternis entscheiden ... Das Finale der dreibändigen »Wayfarer«-Saga aus der Feder einer umwerfenden deutschen Autorin!
Die Printfassung enthält exklusives digitales Bonusmaterial (Augmented Reality, AR) zum Entdecken.
Alle Bände der »Wayfarer«-Saga:
Das Lied der Nacht
Das Flüstern des Zwielichts
Der Klang des Feuers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Der Wanderer Weyd und seine Freunde haben eine dunkle Wildnis durchreist, um die sagenumwobenen Türme des Lichts zu erreichen. Doch die drei Bauwerke sind so tödlich wie ein Waffenarsenal und verlangen den Gefährten Schreckliches ab. Das Schlimmste steht Weyd allerdings noch bevor: Wenn er das Feuer an der Turmspitze entzünden will, muss er ein unmenschliches Opfer bringen – oder sich stattdessen für ewige Finsternis entscheiden … Das Finale der dreibändigen »Wayfarer«-Saga aus der Feder einer umwerfenden deutschen Autorin!
Autorin
C. E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Sie studierte die Fächer English Literatures and Cultures und Politikwissenschaft, seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben erforscht sie Strukturen der Gewalt im Heldenepos, erwandert das Siebengebirge oder backt britischen Gewürzkuchen. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet, ihre Romane waren für den RPC Fantasy Award und den Lovelybooks-Leseraward nominiert. Christine Lehnen schreibt auf Englisch – ihre auf Deutsch erschienenen Werke, darunter die Palace-Saga und zuletzt die Wayfarer-Saga, werden ins Deutsche zurückübersetzt.
Weitere Informationen unter: http://de.cebernard.eu/
Von C. E. Bernard bereits erschienen:
Palace of Glass
Palace of Silk
Palace of Fire
Palace of Blood
Das Lied der Nacht
Das Flüstern des Zwielichts
Der Klang des Feuers
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
C. E. Bernard
DERKLANGDESFEUERS
Roman
Deutsch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Copyright der Originalausgabe © 2021 by Christine LehnenCopyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Jennifer JägerKarte: Annika WalterUmschlaggestaltung und -motiv: Isabelle Hirtz, InkcraftBL · Herstellung: MRSatz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, MünchenISBN 978-3-641-26896-1V001www.penhaligon.de
Für alle, die wandern
Wieder seid ihr gekommen, um euch meine Geschichte anzuhören.
Denn wie ihr richtig vermutet habt, ist es wahrhaftig meine Geschichte.
Kommt und setzt euch ans Feuer. Ich habe es am Leben gehalten. Warm und hell brennt es, und wenn ihr in die Flammen blickt, hört ihr vielleicht sein Flüstern. Hört vielleicht seine Worte. Hört vielleicht sein Lied. Wir warten noch auf die anderen. Auch sie kommen durch den Wald, um mit uns zusammenzusitzen. Auch sie wollen die Geschichte hören. Seht, wie die Sonne untergeht, während wir warten. Die ersten Sterne leuchten bereits am Himmel. Die Nacht bricht an, die strahlende, dunkle Nacht.
Seht die warmen, roten Flammen.
Rot ist die letzte Farbe, die bleibt, bevor die Nacht anbricht.
Rot war das Blut, das auf meinem Mantel getrocknet ist.
Rot ist das Feuer, um das ihr euch schart, um diese Geschichte zu hören.
Nun kommt also. Die Sonne ist untergegangen, die Sterne leuchten am Himmel, der Mond geht auf.
Rückt dichter zusammen.
Rückt näher ans Feuer. Hört euch das Ende meiner Geschichte an. Es beginnt auf einer alten Straße, hoch oben im Norden, wo die Nächte lang sind; lang, kalt und finster. Es beginnt auf einer alten Straße weit unten im Süden, nahe dem gefährlichen und tödlichen Meer. Es beginnt auf einer alten Straße im Osten, die sich in die hohen, grausamen Berge hinaufwindet.
Es beginnt auf drei Straßen. Beginnt mit Erde, Meer und Himmel. Und es beginnt mit einer Frage:
Wisst ihr es?
Wisst ihr, wer ich bin?
Wisst ihr, was ihr tun werdet
wenn Finsternis die Nacht verschlingt
wenn Furcht auf allen Wegen schreitet?
Seid ihr bereit
für das Ende meiner Geschichte?
1 – Auf dem Weg
Auf dem Weg
Silbern schimmerte der Graue Pfad im Schein des Mondes, im Licht der Sterne. Er wand sich durch den Norden, wo der Schnee selbst im Frühling nicht schmolz, wo schon die kleinste Laterne hell die Nacht erleuchtete, wo man die langen, finsteren Winter auch mit Feuer und Liedern kaum überlebte.
Etwas Fremdes spürte diese Straße.
Es reiste auf ihr.
Kroch auf ihr dahin.
Breitete sich aus.
Noch hatte es niemand gesehen, weder Mensch noch Tier. Zumindest niemand, der davon hätte berichten können.
Nur der Graue Pfad hatte es gesehen.
Jene Straße hatte es gesehen, die sich durch den Norden, in den Süden und gen Westen erstreckte. Jene einst so breite, stolze Straße. Jene Straße, die so weit im Norden stets einsam war, weil kaum jemand sie je bereiste. Niemand kannte sie in ihrer Gänze von Norden bis Süden.
Niemand außer ihm.
Auch jetzt war er der einzige Reisende auf dem Grauen Pfad. Ein großes, graues Pferd führte er am Zügel, und über ihm glitt eine Krähe dahin, die hin und wieder einen heiseren Schrei ausstieß. Schier undurchdringlich war der Wald um sie her, schier unerträglich die Kälte der Luft. So kalt war es, dass ihr Atem zu dichtem Nebel gefror, so kalt, dass Pferd und Mensch und Vogel zitterten. Wie eine weiße Decke hatte sich der Schnee über die kahlen Bäume gelegt, über die dunklen Nadeln der Tannen. Auch die Straße hatte er vereinnahmt, hatte aus dem Grauen Pfad wieder einen weißen gemacht. Solange der Wanderer das Lied der Nacht sang, warf der Schnee das Licht von Sternen und Mond zurück und ließ die Nacht auf seltsame Weise erstrahlen.
Weyd wickelte sich fester in seinen Mantel. Längst war dieser nicht mehr blau oder grau: Er hatte die Farben von Schlamm, Erde und Staub angenommen, von jedem Wald, durch den er gewandert, jedem Graben, in dem er in unruhigen Schlaf gesunken, jedem Bach, durch den er gewatet war.
Das Pferd an seiner Seite schnaubte.
»Ich weiß«, antwortete er. »Es dauert noch ein wenig, Blíkna. Erst kurz vor Sonnenaufgang werden wir in Hewsos sein.«
Wieder schnaubte Blíkna. Er blieb stehen. »Stimmt etwas nicht?«, fragte er leise. Wieder einmal schalt er sich dafür, nie die Sprache der Pferde gelernt zu haben. Der Wanderer sah sich auf der Straße um, konnte aber nichts Ungewöhnliches entdecken. Also trat er dichter an Blíkna heran, drückte seine Stirn an die des Hengstes und strich langsam über seinen Hals.
»Ist schon gut«, flüsterte er. »Sicher fehlt er dir sehr.«
Ein nervöses Tänzeln war die Antwort.
»Mir fehlt er auch«, fuhr er ruhig fort. »Ja, mir fehlt er auch. Es fühlt sich an, als wären wir vollkommen allein, wir beide, nachdem es doch so aussah, als sollten wir es nicht mehr sein. Wir hatten einen Gefährten. Wir hatten Freunde. Wir waren eine Gemeinschaft.«
Noch einmal streichelte er den Hals des Pferdes. »Nun müssen wir ohne sie auskommen, auch wenn wir geglaubt haben, es würde nie wieder so sein. Aber sie sind fort, und wir müssen weiter. So weit schon hast du mich über den Grauen Pfad getragen, und bald kannst du dich ausruhen, wenn wir Hewsos erreichen. Weit kann es nicht mehr sein, Urth hält bereits für uns Ausschau.«
Sein Blick ging zum Himmel, suchte nach der Krähe. Noch immer glitt sie hoch über ihnen dahin. Dann wandte er sich wieder der Straße zu. Hier im Norden war sie noch immer breit und stolz, denn sie wurde instand gehalten. Wie ein mächtiger, silberner Fluss wand sie sich durch die Landschaft.
Der Wanderer griff nach seiner Reiselaterne und machte sich wieder auf den Weg. In Gedanken war er bereits in Hewsos, der Stadt der Lichter, auf die er nun schon seit vielen Tagen zustrebte, um dort die Vorräte aufzufüllen auf seiner Suche nach dem Grauen Turm. Er sehnte sich nach ihr. Nach ihren vielen Lichtern, ihren vollen Gesängen, den alten Holzbauten und Gasthöfen, in denen jeder Stuhl und jede Stiege ächzten, sodass ihr Lied einen begleitete, wenn man sich in seinem Zimmer in ein warmes Federbett sinken ließ.
Angetrieben von seinen Gedanken ging er weiter, sang leise das Lied der Nacht. An die Bardin Caer dachte er, und an das Willkommenslicht von Briva. Er drückte eine Hand an den Stern auf seiner Brust, der selbst in tiefster Finsternis noch Licht spendete. Licht, das nun in seinen Augen strahlte, in seinem Lied und seinen Worten, auch wenn sie bei ihm stets traurig klangen. Trost spendeten sie ihm dennoch.
So zog der Wanderer dahin.
Ohne zu ahnen, dass vor ihm etwas Fremdes reiste.
Sich ausbreitete. Dahinkroch.
Über den Grauen Pfad bis nach Hewsos.
Hewsos, Stadt der Lampen, die auch in jener Nacht so hell erstrahlten. Es war die Nacht vor dem Tag der Ruhe, und in den Straßen tummelten sich die Fremden, denn in Städten trifft man ja viel öfter auf fremde Gesichter als auf vertraute Menschen. Manche von ihnen waren hier geboren worden, andere nicht. Manche waren erst vor Kurzem hier eingetroffen, nachdem die Schatten sich erhoben und mit ihren Schwertern aus kaltem Feuer alles niedergemetzelt hatten, was sie fanden. Manche waren auch schon früher gekommen.
Nun also waren sie alle in den Straßen der Stadt unterwegs, sangen leise das Lied der Nacht, ob sie nun auf dem Weg zum Theater waren, nach einem zu langen Tag in der Werkstatt heimwärts gingen oder Freunde, Schwester, Bruder, Mutter oder Vater besuchten. Sie trugen warme, mit Schafwolle gefütterte Mäntel. Pflastersteine befestigten die Pfade unter ihren Füßen, hölzerne Gebäude umgaben sie, aus Stöcken errichtete alte Tempel ragten über ihnen auf, deren spitze Giebel mit geschnitzten Pferden, Trollen, Lichtbögen und hohen, magischen Bäumen verziert waren.
Und überall hingen Lampen. In jeder Straße und auf jedem Platz reihten sich an langen Bändern die Laternen aneinander, in denen dicke, solide Kerzen brannten. Warm erhellten sie den Abend.
Überall war Licht.
Überall war Musik.
Überall wurde gelacht und zum Himmel aufgeblickt, an dem die Sterne strahlten, und der Klang unzähliger Schritte hallte von den Pflastersteinen wider.
Und oben auf den Mauern der Stadt behielt die Wache den Grauen Pfad fest im Blick, denn sie erwartete jemanden.
Sie wartete auf einen Fremden.
Die Frau, die an diesem Abend zur Wache eingeteilt war, hatte ihn noch nie gesehen. Nur gehört hatte sie vom Wanderer, in so vielen Geschichten. So vielen Liedern. Balladen, Gedichte und Legenden berichteten von ihm, wie man sie sich nur flüsternd im Dunkel der Nacht erzählte, denn sie sollten einem kalte Schauer über den Rücken jagen und das Herz wild und freudig klopfen lassen, während man sich sicher in sein Federbett kuschelte, sich mit seinen Brüdern und Schwestern um das flackernde Licht einer Kerze drängte.
Sie wusste, dass er als junger Mann über das Midlamari gesegelt und von seiner Reise mit einem Schwert zurückgekehrt war, das eines Königs würdig gewesen wäre. Mit einem Schwert und einem Herzen, in dem jede Freude erloschen war. Sie wusste, dass er dem Weg des Winters gefolgt war, ihn gut kannte. Dass er einen Versorgungstross von Turis über Briva bis nach Hewsos geführt hatte im großen Hungerwinter, als die Bhelsee zugefroren war und die Schiffe nicht mehr durchkamen mit Getreide, Früchten und Mehl. Auch von seinem großen Kampf auf dem Grauen Pfad hatte sie gehört. Hatte sich erzählen lassen, wie die Bardin und der Wanderer die Straße gegen die Eiserne Patrouille verteidigt hatten, wie sie der gesamten Armee von Schur getrotzt hatten.
Der Gedanke daran ließ ihr Herz höher schlagen.
Auch wenn sie es natürlich nicht glaubte.
Zumindest nicht alles. Geschichten mussten schließlich immer etwas ausgeschmückt werden, sonst taugten sie nichts. Sonst ließen sie das Herz nicht freudig klopfen, jagten einem keine kalten Schauer über den Rücken.
Aber sie glaubte sehr wohl, dass sie gemeinsam der Gefahr getrotzt hatten – die Bardin und der Wanderer. Und während die Bardin ihre Pfeile verschossen hatte, die Klänge gebeten hatte, sich für ihn zu verstärken, hatte er in tiefster Dunkelheit gekämpft mit seinem Schwert und dem glänzenden Silberstern an der Brust.
Sie wollte die beiden sehen. Wollte sehen, wie der Wanderer und die Bardin gemeinsam über den Grauen Pfad herankamen. Wollte wissen, ob es wahr war.
Dass sie Seite an Seite gekämpft hatten. Dass er sich ihr zugewandt und ihr seine Liebe gestanden hatte. Dass sie sich ihm zugewandt und geantwortet hatte: Was bist du doch für ein Trottel.
Nachdenklich blickte sie zu den Sternen hinauf. Hier in Hewsos trug die Wache keine Waffen, nur eine Laterne und zwei Hörner hatte sie bei sich, eines in Silber und eines in Gold, in den Farben der Sterne und der Sonne. Genauso sähen die Sterne auch in Briva aus, hatte sie gehört, sie funkelten in demselben Silberton, verharrten alle am selben Ort. Ihre Schwester lebte in Briva, arbeitete dort als Botin für Reys, die Bürgermeisterin von Briva der Blauen. Bürgermeisterin und Schwester des Wanderers.
Briva.
Belagertes Briva.
Einen kurzen Augenblick lang stellte sie sich vor, dass ihre Schwester nun in Briva ebenfalls auf der Mauer stand, dass auch sie zu diesen Sternen aufblickte.
So viel weiter im Süden blickte sie doch zu denselben Sternen hinauf.
Und auch schon vor Tausenden von Jahren hatte jemand hier gestanden und ebendiesen Himmel betrachtet.
Sie wandte sich wieder dem Grauen Pfad zu, der sich dort unten entlangzog. Behielt wieder die Straße im Blick, auf der sie im Dunkeln nach einem Fremden Ausschau hielt. Nach dem Wanderer und seinen Gefährten. Einem Reisenden, gehüllt in einen nebelgrauen Mantel, mit sicherem Schritt. Einem Entwurzelten mit einem funkelnden Silberstern an der Brust. Silbern wie die Straße, die sich im Licht der Sterne unter ihr entlangzog. Wie ein schimmerndes Band wand sie sich durch die Wälder, an Flüssen entlang, bis tief in den Süden, wo es wärmer war, heller und lauter. Wo sich viele Straßen kreuzten, viele Wegscheiden aufeinander folgten, viele Lichtsäulen an den Wegen aufragten.
Verwirrt runzelte die Wächterin die Stirn.
Die Straße.
Sie war nicht länger silbern. Nein, sie schien sich zu verfinstern.
Als würde sich etwas nähern, herankriechen.
Wieder blickte sie in die Höhe, getrieben von dem Gedanken, dass vielleicht die Sterne erloschen waren. Dass die finstere Nacht wieder das Firmament verdeckte, wieder Mond und Sterne erstickte. Mond und Sterne und das golden-grün schimmernde Farbspiel, das nur hier im Norden über den Himmel zog.
Nein, sie waren alle noch da. Strahlten noch immer. Funkelten noch immer.
Also blickte sie wieder auf die Straße hinunter.
Vielleicht hatte sie sich ja getäuscht.
Und auch der Wanderer musterte die Straße vor sich, ebenso der Hengst Blíkna. Das Pferd sah nachts klarer als er, brauchte keine Laterne dafür.
Nervös war das Tier.
Der Wanderer erkannte das, wusste aber nicht, wie er nach dem Grund fragen sollte; und Blíkna wusste nicht, wie er sich mitteilen sollte.
Sagen sollte, dass dort etwas war.
Dort vor ihnen.
Etwas, das in ihm den Wunsch weckte, herumzufahren und davonzugaloppieren.
Er hatte den Tod auf seinem Rücken getragen, und trotzdem ließ das dort vor ihnen alles in ihm nach Flucht schreien.
Blíkna wurde langsamer. Dann blieb er stehen.
Weyd drehte sich zu ihm um. »Komm«, sagte er nur und zog sanft an den Zügeln.
Blíkna stemmte die Hufe in den Boden und wieherte.
Und der Wanderer kam zu ihm, wollte ihn beruhigen. Doch wie tröstlich er auch flüsterte, wie eindringlich er auch bat, wie ruhig seine Stimme auch klingen mochte, wie oft er ihm auch über den Hals strich … der Hengst rührte sich nicht vom Fleck. Schließlich trat der Wanderer einen Schritt zurück und musterte ihn prüfend. »Ich nehme es dir nicht übel, wenn du umkehren möchtest. Du hast mich weit getragen, viel weiter als du es hättest tun müssen. Aber ich muss weiter, muss nach Hewsos und noch weiter in den Norden hinauf, muss den Grauen finden, muss das Feuer entzünden und die Glocke schlagen im Turm des Lichts. Wenn es also sein muss, werde ich ohne dich gehen.«
Und mit diesen Worten drehte der Wanderer sich um und stapfte weiter die Straße entlang.
Blíkna sah ihm hinterher.
Wieherte noch einmal.
Weyd drehte sich nicht um.
Der Hengst schnaubte.
Dann trabte er dem Wanderer hinterher.
Lächelnd spürte Weyd, wie das Tier an seine Seite zurückkehrte. »Ich danke dir«, flüsterte er. »Sobald wir in Hewsos sind, werden wir uns richtig ausruhen, du und ich. Dort bekommst du einen anständigen Stall, ich werde dich mit Stroh abreiben, und du wirst dich mit Eicheln und Äpfeln und Nüssen vollstopfen können.« Der Wanderer streckte sich. Sein Rücken schmerzte. Ja, er war eindeutig kein junger Mann mehr. »Und ich werde mir eines dieser herrlichen, mit Federn gefüllten Betten suchen, und dann schlafen wir eine Nacht und einen Tag durch.«
Ein Blick nach oben zeigte ihm eine kleine dunkle Silhouette, die sich vor dem funkelnden Sternenhimmel abzeichnete. »Und auch für Urth werden wir den perfekten Ruheplatz suchen, und dazu Rosinen und Weinbeeren. Ausgeruht gehen wir dann zur Universität, denn ich hoffe, dort einen Führer zu finden, der uns mehr über die fremden und gefährlichen Gebiete nördlich der Stadt verraten kann. Wir werden den Turm finden, Blíkna.«
Der ganze Himmel war mit Sternen übersät; wunderschön und hell schimmerten sie dort oben.
Wunderschön und hell schimmerten sie auch für die Wache auf der Mauer von Hewsos. Unzählige Sterne und der strahlende Mond leuchteten über der Stadt. Es sollte also keine Finsternis geben. Breit und stolz und silbern sollte sich die Straße dort unten erstrecken.
Wieder sah sie hinunter. Und während sie auf die Straße hinabblickte, war ihr, als wäre sie blind geworden. Nein, die Straße war nicht in Finsternis gehüllt.
Sie schien einfach nicht mehr da zu sein.
Die Wachhabende wich einen Schritt zurück. Starrte angestrengt hinunter.
Und da spürte sie es. Etwas näherte sich. Kroch, schlich, schob sich heran.
Über die Straße zu ihr heran.
Sie löste das Horn von ihrem Gürtel und blies hinein.
Einmal.
Zweimal.
Dreimal.
Hilfe! Gefahr! Hilfe! Feuer! Wacht auf! Hilfe!
So hallte der Warnruf durch die Stadt, wurde schnell aufgegriffen. Überall auf der Mauer drückten die Wachen ihre Hörner an die Lippen und bliesen hinein.
Hilfe! Gefahr! Hilfe! Feuer! Wacht auf! Hilfe!
Und mit ihren Hörnern kamen sie angelaufen. Alle versammelten sie sich auf der südlichen Mauer, blickten hinunter auf die Straße.
Auf das, was von ihr geblieben war.
Denn sie schien zu verschwinden, direkt vor ihren Augen.
Ebenso die Bäume zu beiden Seiten, die Tiere und die Vögel. Meter für Meter, kriechend, schleichend, glitt das wahrhaftige Nichts auf die Stadt zu. Brachte drückende Stille mit sich.
»Hvat er betta?«, fragte einer der Wachleute, der befürchtete, es könnten die Schatten sein, die sich dort näherten. »Er bat Skuggarnir?«
»Eigi skaltu hrðask«, antwortete die Wache, deren Schwester Botin in Briva war: Fürchtet euch nicht. Sie dachte an ihre Schwester, die sicher auch großen Mut bewiesen hatte, hoffte, sie noch einmal wiederzusehen und dann mit ihr zusammen zu den Sternen aufzublicken. Und so bat sie alle, das Lied der Nacht zu singen: »Syngðu Nætrljóð!«
Gemeinsam stimmten sie das Lied an.
Sangen das Lied, während das Nichts näher heranrückte. Wie eine Mauer schob es sich voran.
Näher
und näher
und näher
heran.
Und die Wachen sangen. Tapfer standen sie oben auf der Mauer und sangen das Lied, das ihnen Schutz versprach. Sangen das Lied der Nacht in der alten Sprache.
Trotzdem rückte es weiter vor.
Immer mehr Bewohner von Hewsos stürmten auf die Mauer: Nachbarn, Fremde, Kinder, Männer, Frauen. Hunde, Vögel und Ratten. Die Eulen stiegen in den Himmel auf, glitten auf ihren mächtigen Schwingen dahin. Setzten sich auf die prächtigen Giebel der alten Tempel und sangen. Die Wölfe heulten in den Wäldern. Sie alle sangen, so gut sie es vermochten.
Hewsos sang.
Hewsos war geschützt.
Auf dem Grauen Pfad hörte der Wanderer das Wolfsgeheul in der Ferne. Auch Blíkna hörte es. Über ihnen stieß Urth einen heiseren Schrei aus, dann kam sie zu ihnen hinuntergeflogen.
Weyd legte eine Hand auf den Griff von Mundian, das sicher an seinem Gürtel hing. »Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Wölfe uns hier auf der Straße angreifen«, erklärte er, denn zumindest Urth verstand ja seine Worte.
Die Krähe nickte; während der vielen Tage ihrer Wanderung gen Norden hatte sie diese Geste nun perfekt erlernt. Doch ihre Flügel, ihr Körper, ihre Krallen zitterten.
Und auch der Wanderer spürte, dass seine Finger bebten, als sie sich um den Schwertgriff schlossen.
Nicht das Wolfsgeheul bewirkt das, dachte er.
Da war noch etwas anderes.
Vielleicht nur die Nacht, die seinen Sinnen einen Streich spielte. Schon oft hatte das Dunkel der Nacht unerträglich erscheinen lassen, was in Wahrheit nur eine leise Furcht war, eine flüchtige Sorge.
»Nicht nachlassen!«, rief die Wache auf der Mauer von Hewsos in der Gemeinen Sprache. »Singt weiter!«
Doch das Nichts kroch weiter voran.
Näher
näher
immer näher
heran.
Und dann, ganz plötzlich, verstummte das Wolfsgeheul. Frauen, Männer, Vögel und Tiere auf der Mauer und auf den Giebeln … sie sahen nicht mehr. Blind glaubten sie zu sein.
Vor ihnen
direkt vor ihnen
glitt das Nichts heran.
Näher und näher heran.
Es verschluckte das Geheul der Wölfe.
Es verschluckte die Schreie der Eulen.
Es verschluckte die Worte ihres Liedes.
Weiter, immer weiter kroch es. Drohend ragte es auf, wie eine Mauer, die niemand erklimmen konnte, die niemand niederreißen konnte. Niemand, sei es Vogel, Tier oder Wanderer. Bis zum Himmel ragte es auf. Verschluckte jeden Klang, verschluckte jeden Funken Licht. Brachte das Leben selbst zum Schweigen.
Die Wachhabende spürte, wie die Furcht sie ergriff, ihr den Verstand zu rauben drohte. Einer der Kameraden an ihrer Seite verstummte. So deutlich, so grausam spiegelte sich die Furcht in seinen Zügen, dass sie ihn am liebsten in die Arme geschlossen hätte. Ihm am liebsten zugeflüstert hätte:
Alles wird gut.
Wie gerne hätte sie ihn von der Wand fortgeführt, die dort auf sie zustrebte. Doch stattdessen sang sie. Blickte hinauf zum Himmel und sang, immer und immer weiter.
Und der Kamerad an ihrer Seite hob wieder sein silbernes Horn an die Lippen, blies mit aller Kraft hinein. Viele andere hörten ebenfalls auf zu singen und ließen ihre Hörner erschallen. Ihr gellender Klang glitt von der Stadtmauer herab, flog dieser grausigen Wand entgegen.
Und draußen auf dem Grauen Pfad dachte der Wanderer erneut, er habe etwas gehört.
Er blieb stehen. Lauschte.
Waren das nicht die Hörner von Hewsos?
Langsam drehte er sich zu Blíkna um. Der Hengst hatte ebenfalls die Ohren gespitzt. Er schnaubte leise. »Hörst du das?«, fragte Weyd.
Beide lauschten.
Da. Es klang, als würden viele, viele Hörner geblasen, alle zugleich.
Der Wanderer wusste, was der Klang dieser Hörner bedeutete. In Hewsos trugen die Wachleute keine Waffen bei sich, dafür aber zwei Hörner, eines silbern, das andere golden. Das Goldene Horn hatte einen warmen, vollen Ton, es diente als Willkommensgruß. Jedes Mal, wenn er die Stadt besucht hatte, hatte ihn dieser Ton begrüßt – jedoch nie so laut, so klar und so freudig wie an jenem Tag, als er an der Spitze eines Versorgungszuges herangeritten war, der Essen und andere Vorräte in die Stadt brachte, damals im großen Hungerwinter.
Der Ton des Silbernen Horns klang vollkommen anders. Er war hell, gellend und hallte weit über das Land.
Er bedeutete
Hilfe! Gefahr! Hilfe! Feuer! Wacht auf! Hilfe!
Und was er nun hörte, klang wie viele, viele Silberhörner, die alle gleichzeitig geblasen wurden.
»Das sind die Silbernen Hörner von Hewsos«, erklärte er. »Die Stadt ist in Gefahr!«
Hastig sprang er auf Blíknas Rücken. »Komm, Urth«, rief er, woraufhin die Krähe auf dem Sattel landete, noch während Weyd Blíkna antrieb. »Wir müssen ihnen helfen!«
Und so hetzte Blíkna durch die Nacht, trug eine Krähe und einen Reisenden über den Grauen Pfad, eingehüllt in das Licht der Laterne, in den silbernen Schimmer des Sterns, der an der Brust des Reiters prangte. Immer weiter galoppierte der Hengst, immer fester klammerte Weyd sich an den Sattel. Der Himmel über ihnen verfinsterte sich. Tief, so tief beugte er sich über Blíknas Hals. Schnell und unaufhaltsam wie ein grauer Blitz flogen sie auf die Stadt Hewsos zu. Denn Blíkna ergab sich nicht der Furcht, wenn er wusste, dass seine Hilfe gebraucht wurde.
Weiter und weiter hetzten sie über den Grauen Pfad, bis sie schließlich die Stadt der Lichter erreichten.
Doch da waren keine Lichter.
Weyd kannte diese Stadt, kannte sie gut. Er wusste, dass dort Abend für Abend die Lichter entzündet wurden, in jeder Straße und auf jedem Platz, dass viele, viele Lampen oben auf den Mauern brannten, dass jede Wache eine Laterne bei sich trug. Selbst während des großen Hungerwinters hatten die Lichter in dieser Stadt gebrannt. Schon von Weitem hatte er sie damals gesehen, ihren warmen, funkelnden Schein. Und auch schon lange davor, auf seiner ersten Reise nach Hewsos. Kaum mehr als ein namenloser Vagabund war er gewesen, doch auch da hatten all die Lichter gebrannt, und die Goldenen Hörner hatten ihn mit ihrem warmen Klang willkommen geheißen.
Jetzt gab es keine Lichter.
Weyd ließ Blíkna anhalten, sprang aus dem Sattel. Im ersten Moment dachte er, es wäre nur die Finsternis.
Dann erkannte er, dass es nicht einfach nur dunkel war.
Wo die Stadt Hewsos hätte sein sollen, war
Nichts.
Als wäre er blind geworden, so fühlte es sich an.
Mitten auf der Straße stand Weyd und starrte auf das Nichts, das den Ort verschlungen hatte, wo Hewsos hätte sein sollen. Ein blinder Fleck, eine Mauer, eine schwarze, wabernde Nebelwand, hoch wie der Himmel, weit wie die Welt. Undurchdringlich. Und lebendig. Denn sie bewegte sich, kroch, glitt, tastete sich voran.
Blíkna riss den Kopf hoch, wich zurück.
Die Krähe Urth schoss in den Himmel hinauf. Sie flog Richtung Stadt.
»Urth!«, rief er. »Tu das nicht! Es könnte gefährlich sein!«
Sie krächzte. Weyd lief ihr hinterher. »Urth! Komm wieder runter!«
Blíkna wieherte, wich noch weiter zurück.
Nun änderte sich Urths Flügelschlag. Was auch immer ihr Freund der Hengst gesagt hatte, es schien sie überzeugt zu haben. Sie kehrte zu ihrem Platz auf dem Sattel zurück.
»Das war einmal deine Stadt, nicht wahr?«, fragte Weyd, als er zu ihr trat. »Deine Heimat.«
Sie nickte.
Dann schob sie den Kopf unter ihren Flügel.
Sanft strich Weyd über die schwarzen Federn, sagte nichts mehr. Stattdessen starrte er auf das wabernde Nichts.
Lauschte auf die drückende Stille.
Und in seinem Inneren breitete sich ein Zittern aus, ein Beben, als wäre eine Saite angeschlagen worden. Eine lange, feste Saite, die tief in seinem Herzen verankert war.
Ein Beben, das sein Herz erfasste, es schmerzhaft verkrampfen ließ.
Es für einen Moment innehalten ließ.
War Hewsos für immer verloren? War es einfach verschluckt worden, ausgelöscht, als hätte es nie existiert? All seine Lichter, seine Lieder, seine Feuer und Geschichten? Das fröhliche Gelächter von Mensch und Tier?
Er wusste es nicht.
Der Wanderer wusste nicht
dass viele, viele Meilen weiter südlich,
an einem so ganz anderen Punkt des Grauen Pfades,
noch jenseits des Elbongebirges
Bahr die Seefahrerin dasselbe vor sich sah.
In einem Hafen stand sie. Hier strahlte der Mond so kraftvoll vom Himmel, ließ das Wasser so silbern leuchten, dass es beinahe taghell war. Obwohl der Frühling dem Sommer noch nicht weichen wollte, waren die Nächte hier bereits warm. Der leichte Wind strich sanft über ihre nackten Arme, ihr Gesicht, ihren Hals. Vor ihr lagen viele Schiffe vertäut, mit vielen mächtigen weißen Segeln, und die Möwen sangen ihr wehmütiges Lied über die tosenden Wellen und die große Freiheit der See.
So lange hatte sie sich danach gesehnt.
So lange hatte sie sich davor gefürchtet.
Nun stand sie also wieder am Ufer des Meeres. Im Hafen der Stadt Pau stand sie, einem der größten seiner Art in allen Meeren, in dem es eigentlich hätte wimmeln müssen von Hafenarbeitern, Handelsgütern, Dieben und Prostituierten. Wo die Hafenwache ihrer unermüdlichen Jagd nach Sklavenhändlern hätte nachgehen müssen.
Doch stattdessen lag Stille über dem Hafen. Reglos lauschten alle dem leisen Platschen, mit dem die Wellen gegen den Kai schlugen. Reglos starrten sie über das Wasser.
So auch Bahr. So auch der alte Jori an ihrer Seite, dessen wahres Alter niemand mehr kannte, nicht einmal er selbst. Reglos hielt er seinen Hut umklammert, an dem eine lange blaue Feder hing. Neben ihm stand die weiße Stute Demar.
»Alles in Ordnung, altes Mädchen?«, wandte er sich schließlich an Bahr.
»Das gefällt mir nicht.« Sie zeigte auf die Brücken. Auf das Nichts, hoch wie der Himmel und weit wie die Welt, eine düstere Nebelwand, die sie alle verschlingen wollte.
»Es fühlt sich an, als wäre mein Herz stehen geblieben.«
»Ja, meines auch«, sagte er leise.
Sie warf ihm einen Seitenblick zu, dann griff sie nach seiner Hand und drückte sie. Gemeinsam blickten sie über das Hafenbecken hinaus. Denn Pau hatte eine Partnerstadt, genau auf der anderen Seite des Estreit Fu, des Feuersundes. An dieser Stelle war die Meerenge so schmal, dass man auf beiden Seiten Städte gebaut und sie durch zwei Brücken verbunden hatte, zwei mächtige weiße Brücken, hoch genug, um Schiffe darunter passieren zu lassen. Denn in Pau und Dubros hatte es noch Menschen gegeben, welche die Sprache der Steine beherrschten. Und so hatten Mensch und Stein gemeinsam zwei Brücken erschaffen, wie die Welt sie nie zuvor gesehen hatte.
Diese Brücken gab es nun nicht mehr.
Sie waren nicht eingestürzt. Sie waren nicht zerstört worden.
Doch wenn man sie nun betrachtete, sah man
Nichts.
Und auch der Sund konnte nicht mehr überquert werden. Drei Schiffe hatten den Versuch gewagt, das große Nichts zu durchfahren.
Keines von ihnen war zurückgekehrt.
Sie waren einfach verschwunden.
Noch immer starrte Bahr auf das Wasser hinaus. Sie kaute auf ihrer Unterlippe. War das überhaupt möglich? Konnte etwas überhaupt einfach so
verschwinden?
Dies war der einzige Weg zur Weißen Insel draußen vor der Küste von Balarm gewesen. Zu dem Eiland, auf dem der südlichste Turm des Lichts stand.
Über Sapaudia konnten sie ihn nicht erreichen, denn der König hatte sämtliche Straßen gesperrt und den freien Städten von Tregeste und Dubros den Krieg erklärt. Bald würde er seine Klauen auch nach Pau ausstrecken. Erst nach Pau, dann nach Billavaho und Tiltél, und nach al-Qartuba im Westen. Von dort aus könnte er nach Tígisis übersetzen, um seinen Eroberungsfeldzug auf die Länder südlich des Midlamari auszuweiten. Und wer wusste schon, wohin er sich als Nächstes wenden würde.
»Bis hierhin hätten wir es also geschafft«, murmelte Bahr. »Und nun sitzen wir fest.«
Sie drehte sich um. »Und von dem Jungen keine Spur. Warum braucht er bloß so lange?«
Jori schüttelte den Kopf und strich langsam über Demars Hals. »Ich mache mir Sorgen. Belle ist auch schon viel zu lange weg.«
»Der wird sich irgendwo den Bauch mit frischem Fisch vollschlagen.«
Empört sah Jori sie an. »Das würde er niemals tun.«
Bahr musterte ihn liebevoll. »Ach, mein Bester, für jemanden, der älter ist als die Sterne, hast du dir aber eine gehörige Portion Naivität bewahrt. Also, wo stecken die beiden?«
»Willst du etwa behaupten, er habe hinter meinem Rücken heimlich Fisch und Fleisch gefressen?« Jori ließ nicht locker.
»Jawoll.«
»Verräter«, brummte Jori. »Da dachte ich, er wäre das sanftmütigste und ehrlichste Wesen, das je auf dieser Erde wandelte, das sich nur von Nüssen und Beeren ernährt …«
»Ah!« Bahr riss die Arme hoch und winkte. »Der Junge!«
Ja, es war der junge Andrin aus Schur mit den strahlend blauen Augen und dem leuchtend blonden Haar, der da auf sie zugerannt kam. Seine Wangen waren gerötet, und er wirkte gehetzt. Als Demar grüßend schnaubte, antwortete er ihr in der Sprache der Pferde.
»Also?« Bahr kam direkt auf den Punkt.
»Nun ja …« Andrin schnappte nach Luft.
»Ja?«, bohrte sie weiter.
»Lass den armen Mann doch erst einmal zu Atem kommen«, mahnte Jori und setzte sich mit einer schwungvollen Geste den Hut auf den Kopf. Sein Arm war auf der langen Reise nach Pau gut verheilt. Einen Monat hatten sie gebraucht, zu Fuß und auf dem Wasser. »Was hast du in Erfahrung gebracht, mein lieber Junge?«
»Das Wasser konnte mir nichts sagen«, berichtete Andrin schließlich. »Es weiß ebenso wenig wie wir, was das dort draußen ist. Allerdings hat es gesagt … also, falls ich das richtig verstanden habe …«
»Gehen wir doch einfach davon aus«, unterbrach ihn Bahr. »Was hat es gesagt?«
»Na ja …« Nervös trat Andrin von einem Fuß auf den anderen. »Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das falsch verstanden habe, denn es scheint mir quasi unmöglich zu sein. Das Wasser meinte, dieses Nichts wäre in Bewegung.«
»In Bewegung? Wohin bewegt es sich denn?«
Andrin schüttelte den Kopf. »Mehr wollte es mir nicht sagen. Oder mehr habe ich nicht verstanden. Und ich schätze mal, für Wasser ist ja eigentlich alles in Bewegung, oder?«
Nachdenklich spitzte Bahr die Lippen. »Und das ist wirklich alles?«
»Ja?« Andrins Antwort klang mehr wie eine Frage.
»Und warum ist dein Gesicht dann so rot wie eine Tomate, wie es sie jenseits des Endeleasmeeres gibt?«
Sofort nahmen Andrins Wangen einen noch dunkleren Rotton an. »Äh … man hat mich … belästigt.«
Fragend zog Bahr die Brauen hoch. »Hat eine der Huren dich am Kai entdeckt?«
Der Junge nickte stumm.
»Hat es dir gefallen?«, fragte sie weiter.
»Lass ihn zufrieden, altes Mädchen«, schaltete sich Jori wieder ein. »Und lass uns hoffen, dass Belle bessere Nachrichten bringt. Da kommt er nämlich.«
Tatsächlich kam der Fuchs in ihre Richtung gelaufen. Er schob sich zwischen Fässern und Seilrollen hindurch, vorbei an hohen Kistentürmen, und wich den Beinen der vielen Hafenarbeiter aus. Schließlich sprang er auf einen Kistenstapel. Auf seinem Rücken saß eine Ratte. Bellitas deutete auf seine Freunde, die Ratte sah zu ihnen hinüber.
Vor allem Bahr musterte sie eingehend.
Dann wandte sich der Nager an den Fuchs, und sie wechselten ein paar Worte, bevor die Ratte von seinem Rücken sprang und davonhuschte. Nun erst kam Bellitas zu ihnen.
Jori begrüßte ihn in der Sprache der Füchse, konnte aber kaum ein Wort loswerden, da Bellitas sofort auf seinen Arm sprang und zu sprechen begann.
Konzentriert hörte Jori ihm zu. Sein Gesicht verfinsterte sich. Sein Blick huschte kurz zu Bahr.
»Was ist?«, fragte die sofort.
Aber Jori wandte sich wieder Bellitas zu und fragte ihn etwas.
Der Fuchs schüttelte den Kopf.
»Bei allen zugeschissenen Schiffsdecks von Pau«, fluchte Bahr, »raus damit, Jori! Was ist los?«
»Er sagt, er sei in einer höchst anrüchigen Spelunke auf eine Ratte gestoßen«, erklärte Jori. »Und diese Ratte habe ihm etwas von einem Schiff erzählt, das uns zur Weißen Insel bringen könne.«
Andrin bekam große Augen. »Aber das sind doch fantastische Neuigkeiten!« Er drehte sich irritiert zu Bahr um. »Oder etwa nicht?«
Die Seefahrerin kniff misstrauisch die Augen zusammen. »Und wie?«
»Es liegt am Alten Pértus vertäut. Von dort aus könnten wir rübersegeln.«
»Absolut unmöglich. Haben wir nicht gerade festgestellt, dass niemand diese dicke, wabernde Wand aus Nichts durchdringen kann?«
Schulterzuckend schränkte Jori ein: »Vielleicht hat es etwas mit dem zu tun, was das Wasser gesagt hat. Vielleicht ist dieses Nichts tatsächlich beweglich. Wie auch immer, es gibt ein Boot, und wir könnten es versuchen.«
»Und warum sollte uns jemand sein Schiff überlassen?«, hakte Bahr nach. »Zu welchem Preis überhaupt?«
»Das hat die Ratte nicht gesagt.« Jori streichelte Bellitas’ weichen Pelz.
Andrin blickte zu der Stelle hinüber, wo der Nager verschwunden war. »Diese Ratte hat erst zugesagt, nachdem sie uns gesehen hatte.«
»Lasst euch nicht täuschen«, brummte Bahr warnend. »Wir werden dafür zahlen müssen.«
Auch sie warf einen Blick auf den Kistenstapel, von dem aus die Ratte sie gemustert hatte.
Irgendwie wurde sie das Gefühl nicht los, dass diese Inspektion vor allem ihr gegolten hatte. Ganz gezielt ihrer Person.
Schließlich drehte sie sich zu Bellitas um: »Das sind doch wohl keine … Sklavenhändler, oder?«
Der Fuchs antwortete an Jori gewandt.
»Er weiß es nicht«, übersetzte der Alte und drückte den Fuchs noch fester an seine Brust. »Es könnte eine Falle sein, altes Mädchen.«
»Vielleicht halten sie nach den besonders Verzweifelten Ausschau«, überlegte Bahr. »Sagen ihnen, was sie hören wollen, nur um dann mit ihnen nach Westen zu segeln, über das Endeleasmeer, wo man ihnen ein hübsches Sümmchen für frische Sklaven zahlt.«
»Sklavenhändler?«, fragte Andrin. Von einem Moment auf den anderen wurden seine geröteten Wangen aschfahl.
»In den Freien Städten ist das längst verboten, aber im Alten Pértus hält man sich an kein Gesetz«, erklärte Bahr voller Verbitterung. »Enge Gassen, Schwarzmarkthandel, Tunnel unter den Straßen. Dort gibt es Schmuggler, Freibeuter und all den Abschaum, der das Wasser der Meere mit Blut, Schweiß und Tränen füllt, bis es irgendwann vollkommen rot sein wird.«
»Ich nehme an, du warst schon dort?«, vermutete Andrin.
»Ja. Dort haben mich die Händler geschnappt, die mich dann an Lurin verkauft haben. Habe eigentlich keine Lust, da noch mal hinzugehen.«
»Das verstehe ich«, nickte Andrin. »Dann sollten wir es auch nicht tun.«
Bahr drehte sich zu ihm um. »Natürlich gehen wir.«
Er wirkte verwirrt. »Aber hast du nicht gerade gesagt …?«
»Bloß weil ich etwas nicht tun will, heißt das nicht, dass ich es nicht tun werde. Hier fahren ja keine Schiffe mehr, oder?«
Noch immer starrte er sie an. »Und wenn es nun eine Falle ist?«
»Dann werden wir eben fliehen.«
»Und wie? Keiner von uns ist ein großer Kämpfer.«
Sie schlug ihm so kräftig auf die Schulter, dass er um sein Gleichgewicht ringen musste. »Ich kann mit Feuer sprechen und du mit Wasser, schon vergessen? Falls es eine Falle sein sollte, wirst du einfach die Wellen bitten, ihr Schiff zu zerschmettern. Gemeinsam werden wir sie in Stücke reißen.«
»Ich kann niemanden in Stücke …«, protestierte Andrin zaghaft, wurde aber von Jori unterbrochen, der offenbar Mitleid bekam. »Sie meint das nicht ernst, mein lieber Junge«, versicherte er. »Was denkst du, Bellitas? Sollen wir deinem Rattenfreund folgen und den Versuch wagen? Und was sagst du dazu, Demar?«
Der Fuchs nickte, und auch die weiße Stute war einverstanden.
»Falls es eine Falle der Sklavenhändler ist«, warnte Bahr und zeigte dabei auf den Fuchs, »werde ich dir die Schuld geben. Dann helfe ich dir nie wieder dabei, dein Fleisch und deinen Fisch an Jori vorbeizuschmuggeln.«
Bellitas winselte kläglich.
»Was das angeht …«, begann Jori, doch der Fuchs entwand sich seinem Griff, sprang zu Boden und kletterte von dort geschickt auf Andrins Schulter. Schützend drückte er sein Gesicht an den Hals des jungen Mannes.
Auch Andrin wirkte plötzlich äußerst schuldbewusst.
»Ihr habt ihm beide geholfen«, begriff Jori. Einen Moment lang schien er vollkommen empört.
Dann wandte er sich mit einer dramatischen Geste ab, stieß einen geplagten Seufzer aus und ging. »Glaubt ja nicht, dass ich euch jemals wieder bei irgendetwas behilflich sein werde. Das habt ihr nicht verdient – keiner von euch! Komm, Demar, wir gehen!«
Besorgt sah Andrin zu, wie Jori und Demar davongingen. Bahr legte ihm einen Arm um die Schultern. »Keine Sorge«, meinte sie, »er wird uns verzeihen. So in ein, zwei Jahren, schätze ich.«
Dann verpasste sie ihm noch einen herzlichen Schlag auf die Schulter und folgte dem Alten und der Stute.
Andrin blieb noch einen Moment stehen und blickte über das Hafenbecken. Hinaus auf das reglose Wasser. Hinaus zu der Stelle, wo die Brücken hätten aufragen müssen.
Er hätte sie sich so gerne angesehen.
Doch stattdessen sah er Nichts.
Hörte nichts außer drückender Stille.
Ein kalter Schauer überlief ihn.
Als wäre in seinem Inneren eine Saite angeschlagen worden, eine Saite, die tief in seinem Herzen verankert war.
Eine Saite, deren Klang sein Herz schmerzlich verkrampfen ließ.
Die es innehalten ließ.
Und einen Moment lang glaubte er wirklich, dass es in Bewegung war.
Dass es sich auf ihn zubewegte.
Dass es ihn verschlingen würde.
Bei lebendigem Leib.
Dass er in diesem Nichts verschwinden würde.
Als hätte er
niemals
existiert.
Hastig wandte er sich ab und folgte seinen Freunden. Während er die Kaimauer verließ, dachte er an seine Schwester.
Hoffentlich war Jelscha in Sicherheit.
Nein, das war sie ganz sicher nicht.
Viele Meilen nordöstlich von ihm hockte seine Schwester Jelscha im matschigen Schnee. Neben ihr saß die Bardin Caer. Sie kauerten hinter einem Felsen, der nur knapp über ihre Köpfe hinausragte. Spitze Steine und der kalte Schnee stachen in ihre Handflächen. Sie presste die Lippen zusammen und versuchte, möglichst leise zu atmen.
Denn auf der anderen Seite des Felsens stand ein Trupp der Eisernen Grenzwache.
Ein Dutzend Soldaten war es, bewaffnet mit Pallaschen, Armbrüsten und Peitschen mit eisernem Griff. Ketten und Fesseln hatten sie bei sich, und schwere Helme schützten ihre Köpfe. Reglos standen sie da und starrten, so still, dass es beängstigend war.
Jelscha sah prüfend zu der Frau hinüber, die an ihrer anderen Seite kauerte: Menga, Hauptmann der Eisernen, die Hände gefesselt, der Mund geknebelt. Sie trug einfache Stiefel, eine dünne Hose und ein Hemd aus Wolle, dazu einen Reisemantel und einen Schal, der fest um ihr Haar geschlungen war. Nur eine einzige rote Strähne lugte darunter hervor. Ihre grünen Augen waren gen Himmel gerichtet.
Sie schien zu lauschen.
Dann sprach einer der Soldaten: »Bericht. Was haben wir hier vor uns?«
Es schien ihr Leutnant zu sein.
Keine Antwort.
Jelscha bemerkte im Augenwinkel eine Bewegung und drehte den Kopf. Lurin, der Eiserne Baron, ebenfalls gefesselt und geknebelt. Seine Rüstung aus schwarzem Eisen, angetan mit goldenem Zierwerk, war verschwunden. Stattdessen trug er schlichte Reisekleidung, die Kapuze seines Mantels verbarg sein Gesicht. Die langen Tage auf der Straße hatten ihn schmaler werden lassen, sein Gesicht war mit Staub und Schmutz bedeckt. So hätten ihn nicht einmal seine Dienerinnen erkannt. Jelscha sah es mit grimmiger Befriedigung. Er war es, der sich bewegt hatte.
Die Bardin Caer blickte ebenfalls zu ihm hinüber. Streng war ihre Miene, ihr Blick so unerbittlich wie ihre Fäuste, streng wie ihr geflochtener Zopf, unvermittelt wie ihr Lachen.
Kein Laut.
»Was haben wir hier vor uns?«, fragte der Leutnant noch einmal. »Wenn wir es nicht wissen, müssen wir es herausfinden. Vielleicht kommt dieses Pferd ja aus dem … Nebel. Geht durch den Nebel, findet heraus, was dahinter ist. Dann kommt ihr zurück und erstattet Bericht.«
Sechs Paar Stiefel entfernten sich knirschend über den Pass.
Caer lauschte angestrengt. Immer weiter stampften die Stiefel davon, fort vom Rest der Patrouille. Leiser wurden die Schritte, immer leiser.
Leiser.
Und dann
ganz plötzlich
waren sie weg.
Verwirrt runzelte Caer die Stirn.
Schnell beschloss sie, ihr Glück nicht weiter auf die Probe zu stellen. Es waren nur noch sechs.
Sie sah zu Jelscha hinüber.
Die packte ihren Pallasch fester und nickte.
Caer hob die Hand, streckte drei Finger in die Höhe.
Drei, hauchte sie tonlos.
Jelscha spannte die Muskeln an.
Zwei.
Mit der freien Hand tastete Caer nach ihrem Bogen.
Eins.
Sobald der letzte Finger in der Faust verschwand, sprangen die beiden Frauen auf. Schneller als der Wind hatte Caer drei Pfeile aus dem Köcher gezogen und legte einen davon an die Sehne. »Keine Bewegung!«, flüsterte sie in der Sprache von Schur, denn der Eiserne Baron hatte ihr durch eine Verletzung die Stimme geraubt, und sie konnte nicht mehr laut sprechen. »Entscheidet euch für den Frieden. Legt die Waffen nieder, dann wird euch kein Leid getan.«
Die Soldaten wirbelten herum. Raud, die als Ablenkung gedient hatte und nun von dem Leutnant am Zügel gehalten wurde, wieherte laut. Der Mann ließ sie los und zog seinen Pallasch. »Für Schur!«
Auch die fünf anderen zogen ihre Waffen.
Caer schoss. Der Pfeil bohrte sich in die Hand des Leutnants, durchschlug den Lederhandschuh und grub sich tief in seine Handfläche. Schreiend ließ er den Pallasch fallen. Der zweite Pfeil lag bereits an der Sehne. »Der nächste trifft dein Auge«, warnte sie. »Keine Bewegung. Entscheidet euch für den Frieden.« In der Gemeinen Sprache wandte sie sich an die anderen Soldaten: »Das gilt für alle.« Einer von ihnen befeuchtete nervös seine Lippen. Er schien der Jüngste in der Truppe zu sein.
»Feiglinge!« Abfällig spuckte der Leutnant ihnen vor die Füße. »Wollt ihr sie tatsächlich durchlassen? Wollt ihr tatsächlich, dass sie in unsere Baronie eindringen? Unser Schur?«
»Wollt ihr tatsächlich lieber sterben als uns durchzulassen, obwohl wir euch rein gar nichts getan haben und auch niemandem etwas tun werden?«, hielt Caer dagegen. Ihr Blick richtete sich auf den jüngsten der Soldaten. »Na, kommt schon. Kommt, legt die Waffen nieder.«
Der junge Soldat sah sie an.
Dann ließ er sein Schwert fallen.
Der Leutnant stieß ein dumpfes Knurren aus, zog einen Dolch aus seinem Stiefel und stürzte sich auf den jungen Mann.
Caer schoss, doch der Pfeil verfehlte sein Ziel. Fluchend stürmte Jelscha los, doch sie würde zu spät kommen, zu spät, verfluchte Scheiße …
Dann ertönte das unverwechselbare Geräusch von Hufen auf Knochen. Der Leutnant brach zusammen, noch bevor er seinen Soldaten erreichte.
Raud hatte mit beiden Hinterbeinen zugetreten. Nun schüttelte sie wiehernd die schwarze Mähne, deren leichter Rotstich aufleuchtete wie ein feuriger Stern in tiefer Nacht.
Hastig legten die anderen Soldaten ihre Waffen hin.
»Er hätte dich nicht loslassen dürfen, was, Raud?«, fragte Caer, während sie den Bogen sinken ließ. Ihre Mundwinkel zuckten. »Tut mir leid, dass du draußen auf der Straße bleiben musstest, Süße. Aber für ein ganzes Pferd hätte der Platz hinter dem Felsen nun wirklich nicht gereicht.« Raud schnaubte, bevor sie in aller Ruhe zu ihnen hinüberkam. Sie wirkte nicht sonderlich betrübt.
»Was machen wir jetzt mit ihnen?«, fragte Jelscha grimmig. Sie hielt den Rest der Patrouillengruppe mit ihrem Pallasch in Schach.
Schulterzuckend schlug Caer vor: »Fesseln und hierlassen, würde ich sagen. Ihre Freunde können sie dann einsammeln, wenn sie zurückkommen.«
»Werden sie denn zurückkommen?«, fragte der junge Soldat und blickte zweifelnd die Straße hinunter. Musterte das, was sein Leutnant als Nebel bezeichnet hatte.
Nun drehten sich auch die anderen um.
Das sah nicht aus wie Nebel.
Es sah auch nicht aus wie Finsternis.
Es sah aus wie
Nichts.
Wie eine Mauer, weit wie die Erde, hoch wie der Himmel. Wie eine Wand aus dichtem Nebel. Wie kriechende, schleichende, sich herantastende Blindheit.
Jelscha behielt die Wand im Auge, während sie die Soldaten fesselten. »Da kriegt man ja Gänsehaut«, sagte die Bardin leise zu Jelscha. »Es fühlt sich an, als wäre in mir eine Saite angeschlagen worden.« Sie drückte eine Hand auf die Brust. »Eine Saite, deren Schwingung mein Herz zum Stillstand zwingt.«
»Sieh nicht hin«, riet Jelscha und sicherte den letzten Knoten. »Wir müssen weiter. Es hat einen Monat gedauert, hierherzukommen. Jetzt haben wir es fast geschafft.«
Caer blickte in den Himmel hinauf, der sich rasch verfinsterte.
»Bald wird es Nacht«, stellte sie fest. »Wenn wir weitergehen, müssen wir uns vielleicht ohne jeden Schutz den Schatten stellen. Und wenn wir die Truppe hierlassen und ihre Kameraden tatsächlich nicht zurückkehren, liefern wir sie damit den Schatten aus.«
Gleichgültig zuckte Jelscha mit den Schultern.
Caer aber verdrehte die Augen und wandte sich an den jungen Soldaten: »Gibt es hier irgendwo einen Außenposten, wo wir für die Nacht unterkriechen können?«
Er nickte. Müde sah er aus.
Müde und erleichtert.
»Ein Stück die Straße runter, in Richtung Turm.«
»Das ist doch wohl keine Falle, oder?« Jelscha hob drohend den Pallasch. »Wartet da vielleicht eine Horde Soldaten auf uns?«
»Was für Soldaten?«, erwiderte der Junge. »Die sind alle in den Krieg gezogen. Meint ihr ernsthaft, ihr hättet es sonst über die Grenze geschafft?«
Caer nickte. »Da hat er nicht unrecht, oder?«
Also wanderten sie zusammen zu dem Außenposten. Langsam und stetig stiegen sie hinauf, höher und höher ging es in die Berge, wo die Luft dünner und der Schnee härter und dichter war. Als sie ihr Nachtquartier erreichten, waren sie auf allen Seiten von blendendem Weiß umgeben. Ein simpler Schutzraum war es, direkt aus dem Fels geschlagen. Aber die Tür war aus schwerem Eisen und würde sie des Nachts vor den Schatten schützen, außerdem war er groß genug, um auch Raud Unterschlupf zu bieten. Sie gingen hinein, und entgegen dem ehernen Gesetz von Schur entzündete die Bardin zwei kleine Laternen. Staunend betrachteten die Soldaten die Lampen, denn sie stammten aus Briva und waren von großer Schönheit.
»Dann ist es also wahr?«, fragte der junge Soldat. »Du entzündest in der Finsteren Nacht ein Licht, Krähe?«
»Ja«, flüsterte Caer.
»Und du singst?« Es schien ihm eine Menge Mut abzuverlangen, ihr diese Frage zu stellen.
Im ersten Moment zuckte sie betroffen zusammen, dann aber griff sie nach ihrer Oud. »Ich spiele dieses Instrument, es ersetzt mir die Stimme. Möchtest du es hören?«
Ängstlich wich der Soldat zurück. »Werden uns die Schatten dann nicht hören? Wird die Furcht uns nicht finden?«
Caer dachte zurück an den Fahlen Reiter.
Und sie dachte an den Mann in dem goldenen Mantel, der sich dem Reiter entgegengestellt, der gegen die Furcht gekämpft hatte. Gekämpft und am Ende verloren hatte.
»Nein«, versicherte sie ihm. »Die Furcht ist besiegt, und bald kommt die Zeit der Hoffnung.«
Damit schlug sie den ersten Akkord an, und dann spielte sie ihnen ein Lied von der großen, wilden Welt, von ihren vielen Gefahren und ihrer unermesslichen Schönheit. Sie spielte ihnen das Lied der Wandersfrau, auf eine Art, wie sie es nie zuvor gespielt hatte. Wie strahlende Sterne sollte es klingen, wie ein helles Leuchtfeuer und die Weite der Straße unter den Füßen.