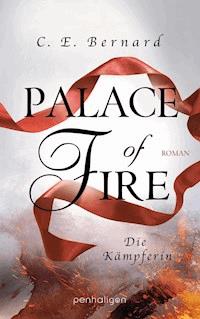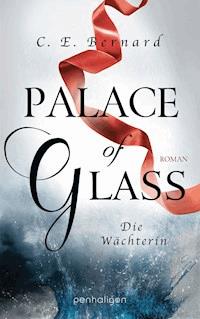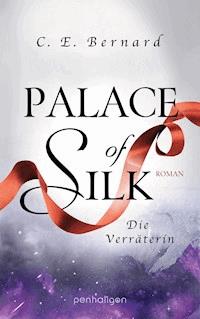
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Palace-Saga
- Sprache: Deutsch
Sie war der größte Feind des englischen Königshauses - bis sie sich in den Prinzen verliebte ...
Die mutige Rea, zuerst Leibwächterin am englischen Königshof, dann heimliche Geliebte des Kronprinzen Robin, ist nach Paris geflüchtet. Dort erhofft sie sich ein neues Leben – insbesondere die Freiheit, andere Menschen ohne Strafe berühren zu dürfen. Denn in Frankreich leben gefürchtete Magdalenen wie Rea ihre Fähigkeiten offen aus. Doch als Ninon, Reas engste Vertraute und Schwester des Roi, ihre Freundin an den Königshof ruft, holt Rea der Fluch ihrer Vergangenheit ein: Niemand Geringeres als Prinz Robin erwartet sie – doch nicht, weil er Rea zurückgewinnen will, sondern weil er um Ninons Hand anhält. Welches Spiel spielt Robin? Und welches Geheimnis verbirgt die unnahbare Madame Hiver, die den französischen König in ihrer Hand hält?
Alle Bücher der »Palace-Saga«:
Palace of Glass. Die Wächterin
Palace of Silk. Die Verräterin
Palace of Fire. Die Kämpferin
Palace of Blood. Die Königin
- Eine Kämpferin, die eine verbotene Gabe besitzt. Ein Prinz, dessen Leben auf dem Spiel steht. Ein gläserner Palast, in dem eine tödliche Intrige gesponnen wird.
- Diese hinreißende Tetralogie werden die Fans von Sarah J. Maas, Kiera Cass und Erin Watt lieben.
- Das Debüt einer hochbegabten deutschen Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Die mutige Rea, zuerst Leibwächterin am englischen Königshof, dann heimliche Geliebte des Kronprinzen Robin, ist nach Paris geflüchtet. Dort erhofft sie sich ein neues Leben – insbesondere die Freiheit, andere Menschen ohne Strafe berühren zu dürfen. Denn in Frankreich leben gefürchtete Magdalenen wie Rea ihre Fähigkeiten offen aus. Doch als Ninon, Reas engste Vertraute und Schwester des französischen Königs, ihre Freundin an den Königshof ruft, holt Rea der Fluch ihrer Vergangenheit ein: Niemand Geringeres als Prinz Robin erwartet sie – doch nicht, weil er Rea zurückgewinnen will, sondern weil er um Ninons Hand anhält. Welches Spiel spielt Robin? Und welches Geheimnis verbirgt die unnahbare Madame Hiver, die den französischen König in ihrer Hand hält?
Autorin
C. E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet; seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben studiert Christine Lehnen Englische Literaturen und Politikwissenschaft, forscht zum Thema Kreatives Schreiben und inszeniert Theaterstücke mit der Bonn University Shakespeare Company.
Weitere Informationen unter: http://de.cebernard.eu/
Von C. E. Bernard bereits erschienen
Palace of Glass – Die Wächterin
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/penhaligonverlag.
C. E. Bernard
PALACEofSILK
Die Verräterin
Deutsch von Charlotte Lungstrass-Kapfer
Für alle, die für ihre Träume kämpfen
Teil 1 Geheimnisse
Die dunkle Nacht umfängt mich bang,
die Winde stürmen, eisig wehen,
doch mich hält herrisch’ Bann gefangen,
und ich kann nicht, kann nicht gehen.
Emily Brontë
Kapitel 1
Die Straßen des Quartier Latin sind heute noch so eng wie in alter Zeit und ebenso düster. Ich gerate auf den nassen Pflastersteinen ins Rutschen, während ich im prasselnden Regen um mein Leben laufe. Drei Verfolger. Ich zähle ihre Schritte. Sie sind schnell. Die Jagd drängt mich fort von den belebten Boulevards am Fluss in immer dunklere Gassen hinein, wo die Laternen kaputt oder erst gar nicht vorhanden sind. Ich biege um eine Ecke. Häuser mit verrammelten Fensterläden, nur drei Stockwerke hoch. Ich sollte springen, auf ein Fensterbrett hechten, ein Regenrohr hinaufklettern. Vielleicht aufs Dach. Aber mein Rücken tut immer noch weh, und meine von Blutergüssen übersäten Beine zittern. Ich kann nichts anderes tun, als weiterzulaufen. Was ich in Paris zu finden gehofft habe, weiß ich nicht. Falls es Frieden war, hätte ich wohl nicht weiter danebenliegen können. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich es nicht anders verdient habe. Immerhin habe ich gegen die Regeln verstoßen. Damit kommt man nicht so einfach davon.
Dann erkenne ich, dass ich in einer Sackgasse gelandet bin. Nichts ist so schwarz wie eine Mauer, auf der ein imaginäres Aus und Vorbei prangt.
Ich warte nicht ab, bis ich gegen die Ziegel pralle, versuche nicht, über die Mauer zu klettern. Stattdessen drehe ich mich um und hebe die mit Verbänden umwickelten Fäuste. Meine Knöchel sind noch nicht verheilt. Mit den Zähnen reiße ich die Verbände ab. Sofort setzen brennende Schmerzen ein, schießen durch meine Finger. Aber nur so habe ich eine Chance – mit bloßen Händen.
Die drei Verfolger sind am Eingang der Gasse stehen geblieben. Vielleicht wollen sie den Moment auskosten. Jetzt haben sie mich. Nichts und niemand steht ihnen im Weg. Hier gibt es nur das fahle Licht des Mondes und die dicken Regentropfen auf unserer Haut. Der Mann auf der rechten Seite hat ein vernarbtes Gesicht, der Linke ballt bereits die Fäuste. Doch es ist die Gestalt in der Mitte, die mir einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Diese Frau war der Grund dafür, dass ich losgerannt bin, sobald ich die drei entdeckt habe. Sie trägt eine Maske – silbern wie das Mondlicht, aus leichtem Metall, das einem Gesicht nachempfunden ist. Wie die von Marias Megären, jenen Magdalenen, die auf andere angesetzt werden, um ihnen unerträgliche Schmerzen zuzufügen oder sie Befragungen zu unterziehen, die im Wahnsinn enden.
Die Megäre ruft mir etwas zu. Durch das laute Prasseln des Regens verstehe ich kein Wort. Ich will es auch gar nicht. Schon als die drei auf mich zukamen, verborgen unter dunklen Capes, haben sie so getan, als wollten sie nur mit mir reden. Aber ich weiß, wann man sich besser aus dem Staub macht. Narbengesicht und Faust treten einen Schritt vor. Sie kommen. Ich atme durch den Schmerz. Dann greife ich an. Meine Sohlen trommeln auf das Kopfsteinpflaster, der Regen schlägt mir ins Gesicht. Ich halte auf die Megäre zu. Ziele auf ihre Kehle. Schon jetzt brennen meine Beine, und überall an meinem Körper pochen schlecht verheilte Wunden. Viel Zeit bleibt mir nicht für einen Sieg. Narbengesicht und Faust brüllen etwas, während sie sich vor die Megäre schieben. Ich katapultiere mich voran. Narbengesicht bückt sich, greift an seinen Stiefel. Zieht ein Messer. Ich lache laut auf. Adrenalin schießt durch meine Adern. Dann werfe ich mich in eine Drehung und sehe gerade noch, wie Narbengesicht die Augen aufreißt. Die Klinge gleitet über meinen Brustkorb, als ich sie mit dem Schwung meines Körpers aus dem Weg schiebe. Ein heißes Rinnsal läuft über meine Haut. Wenn er meint, Schmerzen würden mich aufhalten, sollte er sich mal meinen Rücken ansehen. Meine Arme. Meinen Geist.
Ich pralle mit meinem ganzen Gewicht gegen Narbengesicht. Das reicht aus, um ihn von den Füßen zu reißen. Ineinander verkeilt landen wir auf dem Boden. Sofort versuche ich, nackte Haut zu berühren, egal wo, aber ich werde von hinten gepackt. Faust hebt mich hoch. Als er die Finger in meinen Rücken bohrt, schreie ich gequält auf. Er kann die Spuren der Auspeitschung nicht sehen, aber ich spüre sie. Ruckartig reiße ich den Ellbogen nach hinten, nehme ihm die Luft zum Atmen. Er lässt mich los. Schnell wirbele ich herum und schlage blind in Richtung seines Solarplexus. Der Treffer entlockt ihm ebenfalls einen Schrei, allerdings weniger laut als meiner. Es fühlt sich an, als wären meine Knochen zersplittert. Die Schmerzen nehmen mir die Sicht. Trotzdem ist er derjenige, der aus dem Gleichgewicht gerät. Das ist meine Chance. Mein Körper mag zu schwach sein, um die beiden zu schlagen, aber mein Geist ist es nicht. Ich packe Fausts Cape und nutze mein eigenes Körpergewicht, um uns herumzuwirbeln. Als er Narbengesicht direkt gegenübersteht, werfe ich mich gegen ihn. Er fällt hin, ich mit ihm. Gemeinsam reißen wir Narbengesicht mit.
Hastig rappele ich mich auf. Meine Knochen knirschen gequält, meine Muskeln brennen. Ich strecke beide Hände nach ihren Gesichtern aus. Nach ihrer nackten Haut. Sobald ich sie berühre, werde ich in ihr Bewusstsein geschleudert. Ihre Gedanken strömen wie eine Droge durch meine Adern. Die von Faust sind exakt aufgereiht – klar, karg, genau abgewogen. Wie ein endloses silbernes Band gleiten sie unter meiner linken Hand entlang. Unter der rechten drängen sich die von Narbengesicht zusammen wie die Ladung eines vollgepackten Güterzuges, Gedanke über Gedanke. Sein Bewusstsein klingt auch so, ein lautes, chaotisches Rauschen drängt sich in meinen Geist, der instinktiv zurückweicht. Ich zwinge mich, nicht nachzugeben. Die mentalen Wunden, die ich mir beim letzten Kampf zugezogen habe, reißen wieder auf. Ich denke an meinen Bruder, an meine Freunde, die bestimmt schon auf mich warten, und für den Bruchteil einer Sekunde auch an jenen, der es sicherlich nicht tut.
Mit brutaler Gewalt zwänge ich einen Gedanken nach dem anderen in Narbengesichts Geist, bis ich spüre, dass er fast platzt. Gleich darauf wende ich mich Fausts ordentlicher Gedankenkette zu. Bei ihm muss ich nur die Ränder etwas ausfransen. Ich schiebe ihm etwas unter, was nicht von ihm stammt. Nur einen einzigen meiner Gedanken. Schwarz statt Silber. Ein falscher Flicken in dem perfekten Band. Dann spüre ich, wie ihre Körper unter meinen Händen anfangen zu zucken. Bewusstseinsschock. Das wird sie lange genug außer Gefecht setzen, damit ich verschwinden kann. Und all das hat nicht länger als einen Atemzug gedauert.
Ich stemme mich auf meine malträtierten Knie hoch. Ein Krampf erfasst meinen Körper. Blut verklebt meine Kleidung. Doch mir bleibt keine Zeit. Komm schon, flehe ich stumm. Komm schon! Diesmal brülle ich es, während ich schwankend aufstehe. Aber ich schaffe es. Ja, ich schaffe es.
Zu spät.
Verhüllte Finger schließen sich um meinen Nacken.
Die Megäre steht hinter mir.
Ihre Hand drückt auf meinen Mantelkragen, zwingt mich nach unten, wieder auf die Knie. Durch den Stoff erahne ich ihren Geist, wie ein leises Wispern aus der Ferne. Er flüstert mir etwas zu, genau wie ihre Stimme. »Du hast Schmerzen.«
Diese Stimme. So weich.
»Ihr Auftraggeber wird das sicher gerne hören«, presse ich hervor, dann beiße ich wieder die Zähne zusammen, um den Schmerz unter Kontrolle zu halten.
Die Megäre scheint zu zögern. Ich höre nur ihren Atem. Und das Prasseln des Regens auf dem Pflaster. Das leise Klatschen, wenn er auf meine Haut trifft.
»Tatsächlich?«
Es ist kalt und nass. Ich zittere. Die Hand in meinem Nacken ebenfalls, für einen kurzen Moment, bevor die Megäre fortfährt: »Bist du eine visionnaire?«
»Eine was?« Das verwirrt mich. Eine Frage? Von einer Megäre? Was ist aus ihrem Motto geworden: Erst schießen, dann fragen?
Ein leises Geräusch dringt an mein Ohr, fast wie ein Seufzen, nur trauriger. Es klingt vertraut. Oder liegt das am Regen, den harten Steinen unter meinen Knien, der Erniedrigung, auf allen vieren zu hocken? »Du würdest Magdalena sagen.«
Ich schließe die Augen. Wie sehr ich dieses Wort gefürchtet habe. Magdalena. »Das ist kein Verbrechen.« Hier nicht. Anders als in England, meinem Heimatland, aus dem ich gerade erst geflohen bin. Nicht hier in Paris, wo ich dem Hass entkommen wollte.
»Ja oder nein?«
Ich könnte es sagen. Sollte es sagen. Schlagartig wird mir bewusst, dass es das erste Mal in meinem Leben wäre. Zum allerersten Mal würde ich zu dem stehen, was ich bin. Rea Emris, Mensatorin, Gedankenformerin. Wenn ich Hautkontakt mit einem anderen Menschen habe, kann ich seine Gedanken lesen und sie verändern. Hier ist das nicht illegal. Hier könnte ich frei sein.
Aber mein Geist steht in Flammen, mein Rücken brennt höllisch, und meine Knie können kaum noch mein Gewicht tragen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Also schweige ich. Am Rand meines Gesichtsfeldes blitzt etwas auf. Der Dolch liegt an meiner Kehle, bevor ich mich auch nur rühren kann. Beim Schlucken spüre ich die Klinge. Es fließt kein Blut. Noch nicht. Nur ein kalter Druck auf der Haut.
»Antworte.«
Ich verlagere mein Gewicht. Diese Waffe macht mir auch nicht mehr Angst als die von Narbengesicht. Es wird wehtun, aber ich kann es schaffen. Glaube ich.
Die Megäre keucht überrascht, als ich mich gegen ihren Dolch lehne. Ihre Finger lockern sich, rutschen über den Griff. Ich trete nach hinten aus, treffe mit der gesamten Stiefelsohle. Regen und Dunkelheit verschlucken den leisen Schmerzensschrei, doch ich bin bereits aufgesprungen und renne los. Am Ausgang der Gasse entscheide ich mich blind für eine Richtung, die mich hoffentlich zum Fluss führt. Eine Straße fliegt an mir vorbei, dann noch eine. Ich höre Stimmen. Sie folgen mir nicht, kommen eher von vorne. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Ein Geruch steigt mir in die Nase. Blumen? Ich bin mir nicht sicher. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Plötzlich muss ich wieder an den anderen Kampf denken. Erst vor drei Tagen habe ich den König von England und seinen treuesten Ritter besiegt – geistig wie körperlich. Oh Mann, ich habe echt nachgelassen. Ich gerate ins Stolpern. Ein Licht kommt auf mich zu. Hoffentlich ist es das am Ende des Tunnels und nicht der heranrasende Zug, denke ich noch, dann verliere ich das Bewusstsein.
Als ich wieder zu mir komme, ist es wesentlich wärmer und trockener. Ich kuschele mich unter meine Decke. Sie ist nicht besonders weich, aber gemütlich. Ein Feuer knistert, und ich höre Stimmen. Vertraute Stimmen.
»Was hat sie da draußen getrieben?«
»Keine Ahnung. Kleiner Mondscheinspaziergang?«
»Findest du das etwa lustig?«
»Oh ja, und wie.«
»Sicher, es waren ja auch nicht deine Nähte, die ruiniert wurden.«
»Welch ein Jammer. Die Welt der Kunst hat ein Meisterwerk verloren.«
»Ich werde dich an dieses Gespräch erinnern, wenn du das nächste Mal irgendwo blutend auf der Straße liegst.«
»Das würdest du niemals tun.«
»Dein Gesicht wäre heute jedenfalls wesentlich hübscher, wenn ich schon immer für dich da gewesen wäre.«
»Narben sind sexy, wusstest du das nicht?«
»Messieurs«, schaltet sich eine dritte Stimme ein. »Sie wacht gerade auf.«
Als ich die Augen aufschlage, blicke ich in das Gesicht des Comte. Er lehnt neben der Tür an der Wand, in der schwarz-blauen Uniform der Mousquetaires, der französischen Palastwache und Polizei.
»Miss Emris.« Er klingt ruhig wie immer, hält sich aufrecht wie immer, sieht mich finster an wie immer. Mein Erinnerungsvermögen ist demnach nicht beeinträchtigt. Das ist gut.
»Comte.« Ich versuche mich aufzusetzen, ändere meine Pläne aber, sogar noch bevor René an meine Seite eilt, um mich daran zu hindern.
»Schön langsam, Mademoiselle.« Renés attraktives Gesicht verzieht sich mitfühlend, als er mich langsam zurück auf die Matratze sinken lässt. Im Gegensatz zum Comte trägt er keine Uniform, sondern nur ein Hemd. Er hat dunkle Ringe unter den Augen, die er mit einem charmanten Lächeln zu kaschieren versucht, und sein sonst immer sorgfältig gestutzter Bart wirkt ein wenig zerzaust. Während der vergangenen drei Tage hat er jede freie Minute damit verbracht, Ninons und meine Wunden zu heilen, die körperlichen wie die geistigen, die wir im Kampf gegen den König und seinen tapfersten Ritter davongetragen haben. Es tut immer noch weh, an die beiden zu denken. An den König von England und Mister Galahad.
An den Prinzen.
Also tue ich es nicht. Und ich sehe René nicht in die Augen, dessen ganze Pflege gerade in einer dunklen Gasse von zwei Schlägertypen und einer Megäre zunichtegemacht worden ist.
Wir befinden uns in seiner Wohnung. Ich erkenne es an den Möbeln aus Ahornholz, auf denen überall Kerzen stehen, ebenso wie an der Wäscheleine, die quer durch das Zimmer gespannt ist und an der immer etwas zum Trocknen hängt. Ein Grammofon spielt leise Jazzmusik, dazu singt jemand einen deutschen Text. Aus der Küche dringt der verlockende Geruch eines deftigen Wintergerichts herüber: Fenchel, Oliven, Kapern und Knoblauch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.
Renés Arzttasche steht geöffnet auf dem Tisch, Nadel und Faden stecken in seinem Gürtel. Neben meiner liegen noch zwei weitere Matratzen im Raum. Eine von ihnen ist leer. Dort sollte eigentlich Ninon liegen. Auf der anderen hat sich Blanc ausgestreckt wie ein müder Bär. Ein mit ziemlich vielen Verbänden umwickelter Bär, aber trotzdem ein Koloss. Ich beobachte, wie seine Brust sich hebt und senkt. Seine nackte Haut, die den warmen Braunton von Tee mit Milch hat, spannt sich über seinen Muskeln, durchzogen von hellen Narben und dunklen Wunden, sowohl frischen als auch älteren. Als ich in sein Gesicht sehe, wird mir klar, dass er meine Blicke bemerkt hat. Vielleicht irre ich mich ja, aber ich könnte schwören, dass er rot wird.
Blanc hebt eine träge Pranke von seiner Uniformjacke, die ihm als zusätzliche Decke dient, und sagt: »Du machst es ganz richtig, mein Hase. Einen anständigen Kampf sollte man sich nie entgehen lassen.«
»Du weißt wirklich, wie man mit Damen umzugehen hat, Blanc«, seufzt René und zwinkert mir zu. Dann drückt er einen Kuss auf meine nun wieder aufgeplatzten Knöchel. Er ist wirklich ein Charmeur. Vorsichtig streicht er mit den Fingerspitzen über meine Verletzungen. Bei jeder Berührung schnappe ich kurze Gedankenfetzen auf: … ist nur geschehen – wir werden alles neu machen müssen – was ist nur los in dieser Sta … Als er schließlich eine Hand an meine Wange legt, flattern seine Lider kurz. Er überprüft, ob ich auch geistige Wunden davongetragen habe.
»Was ist passiert?« Der Comte hat die Arme vor der Brust verschränkt. Mir ist nicht entgangen, dass er eine Waffe bei sich hat. Die hat er nicht mehr abgelegt, seit wir hier angekommen sind – Blanc, Ninon und ich, blutverschmiert und verletzt, am Rande des Zusammenbruchs.
Ich befeuchte meine trockenen Lippen, während ich meine Gedanken ordne. Dann erzähle ich ihnen von dem Besuch bei meinem Bruder Liam, den ich viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Dem Rückweg von seiner kleinen Wohnung unten bei der Moschee, ganz in der Nähe des Jardin des Plantes im 5. Arrondissement. Wie ich mich verlaufen habe. Wie ich, beim Blick in das Schaufenster eines Schneiders, dessen gewagte Entwürfe man nur bewundern kann, bemerkt habe, dass ich verfolgt werde.
»Sie waren zu dritt. Und ich glaube, die Frau war eine Megäre.«
»Eine was?«, fragt René.
»Eine Magdalena, die man zur Befragung und Folterung seiner Feinde anheuern kann. In London gab es viele von ihnen, in Babylon«, erkläre ich ihm.
»Barbarisch«, murmelt René, während Blanc ihm einen kurzen Blick zuwirft und dann an den Comte gewandt fragt: »Megären? In Paris?«
»Das wäre die Erste seit Jahren«, erwidert der Comte. Noch immer vollkommen gelassen sieht er mich an. Egal was kommt, er hat sich stets unter Kontrolle. »Eine Patrouille hat dich bewusstlos in der Rue Santeuil gefunden. Sie haben dich erkannt und hierhergebracht. Ich werde diesen Vorfall gleich morgen Früh dem Capitaine melden.«
»Das war doch nichts weiter«, protestiere ich. René zuckt zusammen, denn er spürt meine Verlegenheit ebenso wie meine Schmerzen. Er ist ein Maltor, ein Magdalene, der nicht die Gedanken, sondern die Emotionen anderer lesen und verändern kann. Langsam, ganz subtil lässt er ein Gefühl der Geborgenheit in meinen Geist fließen. Sein Bewusstsein hüllt mich ein wie eine weiche Decke. Ein himmlisches Gefühl. Als wäre ich nach einem Spaziergang in einer bitterkalten Winternacht nach Hause gekommen und hätte mich mit einem Becher Tee an den prasselnden Kamin gesetzt.
»Haben sie dir verraten, was sie von dir wollten?«, fragt er, während er mich auf die Seite rollt, um meinen Rücken untersuchen zu können.
»Nein.« Krampfhaft presse ich die Kiefer zusammen, um den Schmerz zu unterdrücken, der mich aus der Geborgenheit reißt. »Ich habe dafür gesorgt, dass sie keine Gelegenheit dazu hatten.«
»Und wie?«
Ich schaue zu Blanc hinüber, denn ich will sein breites Grinsen sehen. »Indem ich ihnen eine Tracht Prügel verpasst habe, die sie so schnell nicht vergessen werden.« Blanc legt den Kopf in den Nacken und lacht. Ich liebe dieses Geräusch. Sofort muss ich daran denken, wie er einmal laut gelacht hat, während wir kämpften. Damals hat er mich in die Luft gehoben, als wäre das gar nichts. Einmal habe ich dabei seinen nackten Handrücken berührt – in England, wo dergleichen streng verboten ist. Noch heute spüre ich die Wärme seiner Haut und diese unendliche Weite seines Geistes.
»Gut gemacht, mein Hase.«
Ich schließe die Augen. René nimmt mir nach und nach den Schmerz, und Blancs Lachen erledigt den Rest. Von der Frage erzähle ich ihnen nichts. Bist du eine visionnaire? Auch nicht von meiner Antwort, die keine war. Blanc hat immer noch Albträume wegen der beiden Wachen, die er in England verloren hat. Sie wurden getötet, damit wir fliehen konnten. Der Comte berührt mich nach wie vor nur mit Handschuhen. Und René ist an meiner Seite und setzt seine überragenden Fähigkeiten ein, um meine Schmerzen zu lindern. Er soll nicht erfahren, dass ich eben das verleugnet habe, was uns verbindet, ihn und mich. Zwei Magdalenen. Mir wäre es am liebsten, wenn wir alle diesen Vorfall so schnell wie möglich vergessen könnten. Am besten jetzt sofort. Beim nächsten Mal muss ich einfach wachsamer sein.
Ich versinke voll und ganz in Renés Behandlung. Als wir vor drei Tagen hier ankamen, hat Blanc uns zu ihm gebracht, noch bevor er einen Arzt verständigte. Ninon und ich hatten gemeinsam die Erinnerungen des englischen Königs manipuliert, damit er vergaß, dass ich eine Magdalena und sein Sohn, der Kronprinz, überhaupt nicht sein Sohn war. Dabei hatten wir unseren Geist restlos ausgebrannt. René warf einen kurzen Blick auf uns, legte seine Uniformjacke ab, krempelte die Ärmel hoch und legte jedem von uns eine Hand auf die Stirn, während der Comte einen Arzt rief. Meine Schmerzen waren so stark, dass ich überhaupt nicht mitbekam, was um mich herum geschah. Auch jetzt erinnere ich mich nur noch daran, dass ich Blancs Hand umklammert hielt, und an das Gefühl, dass sich jeder Gedanke wie ein Eiszapfen in meinen Verstand bohrte. René nahm das alles von mir. Davor war ich noch nie von einem Maltoren behandelt worden, diesem Meister über Emotionen und Schmerz. Ich wusste nicht, wie sich so etwas anfühlte. Mir erschließen sich nur die Gedanken der Menschen. Ihre Gefühlswelt ist für mich das reinste Minenfeld, sie ist immer in Bewegung, unmöglich zu fixieren. Ihre Schmerzen sind grausame Strömungen, die mich in die Tiefe reißen und dort festhalten, bis ich keine Luft mehr bekomme. Doch für René ist es anders. Er schmolz die Eiszapfen und ließ das Wasser abfließen. Anschließend flickte er uns wieder zusammen, erst den Geist, dann den Körper – jeden Kratzer, jede Brandwunde, jeden noch so kleinen Riss. Genau wie jetzt. Er hüllt meinen Geist in federleichte Verbände, in warme Decken. Jetzt schlafen.
»Mon cher«, höre ich die leise Stimme des Comte, und es klingt wie eine Warnung. Aber ich verstehe nicht, was er damit sagen will. Dazu bin ich viel zu entspannt, viel zu sehr mit meiner Heilung beschäftigt. Bilder aus der Vergangenheit steigen auf, flackernd und verschwommen. Meine Mutter. Die Gutenachtgeschichten, die sie uns zum Einschlafen vorgelesen hat und an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Selbst ihr Gesicht ist im Laufe der Jahre immer undeutlicher geworden. Ich war noch klein, als sie uns verließ. Aber das Gefühl ist geblieben, unverfälscht und gestochen scharf. Das Gefühl, beschützt zu werden. Behütet. Das Einzige zu sein, was wirklich wichtig ist.
Es klopft an der Tür. Langsam öffne ich die Augen. Noch ein Klopfen, diesmal lauter. Orientierungslos sehe ich mich um. René schläft tief und fest, er hat sich neben Blanc zusammengerollt. Der Comte geht gerade mit erhobenem Rapier zur Wohnungstür.
Schlagartig bin ich wach. Versuche mich aufzusetzen. Dehne meine Finger. Aua. Es geht. Also ist doch nichts gebrochen, auch wenn ich sie wohl noch nicht wieder benutzen sollte. Aber der Comte sieht so aus, als ob …
Schaudernd stelle ich die Füße auf den Boden. Ich trage lediglich ein Nachthemd, und die sind hier wesentlich kürzer als in England. Es wird reichen müssen. Während ich angestrengt auf jedes Geräusch achte, stemme ich mich vorsichtig von der Matratze hoch. Wieder klopft es, diesmal noch drängender.
»C’est qui?«, ruft der Comte. Wer ist da?
Keine Antwort. Zumindest höre ich nichts. Einen Moment lang befürchte ich, meine Beine könnten unter mir nachgeben. Ich atme tief durch – einmal, zweimal – und stütze mich an der Wand ab. Dann lasse ich los. Balle die Fäuste, atme gegen den Schmerz an. Schaffe es um die Ecke.
Die Tür erscheint genau in dem Moment in meinem Blickfeld, als der Comte sie mit erhobener Waffe aufstößt. Es ist immer noch Nacht, ich kann also nicht allzu lange geschlafen haben. Das Mondlicht zeichnet tiefe Schatten auf den Hof. In der Tür steht eine vermummte Gestalt, die in schnellem Französisch auf den Comte einredet. Der hört reglos zu. Dann stößt er einen Fluch aus – eines der wenigen Wörter, die Ninon mir bereits beigebracht hat. Er steckt das Rapier weg und greift nach seinem Cape. Dabei entdeckt er mich in der offenen Schlafzimmertür.
Überrascht zuckt er zusammen. Wer hätte gedacht, dass dieser Mann dazu überhaupt fähig ist?
»Was ist los?«, frage ich.
Er wendet sich bereits ab. »Ich muss gehen. Schließen Sie die Tür hinter mir ab.«
»Und was soll ich den anderen sagen? Wo gehen Sie denn hin?«
Er zögert, legt kurz die sorgsam bekleidete Hand an den Türstock. Es dauert beunruhigend lange, bis er leise antwortet: »Sagen Sie ihnen gar nichts.«
Kerzengerade steht er da, als wäre es ein Kraftakt, sich aufrecht zu halten, und gleichzeitig seine einzige Möglichkeit. Er sieht mich an. Dieser Mann gehört zu den Menschen, deren volle Aufmerksamkeit nur schwer zu ertragen ist. Die so standhaft sind, die viel zu genau hinsehen. Für den Bruchteil einer Sekunde umklammern seine Finger den Türrahmen. Es hat den Anschein, als wolle er noch mehr sagen. Stattdessen geht er ohne ein weiteres Wort hinaus.
Kurz überlege ich, ob ich ihm folgen soll. Aber der Adrenalinschub klingt bereits ab, und mir wird bewusst, dass ich mich kaum auf den Beinen halten kann. Ich muss mich ausruhen. Noch immer habe ich das Gefühl, als hätte jemand einen schweren Vorhang vor meine Gedanken gezogen. Also kehre ich ins Schlafzimmer zurück und lasse mich wieder auf die Matratze sinken. Ich spüre das rote Seidenband an meinem Hals. René muss es mir umgebunden haben, nachdem ich eingeschlafen bin. Als er es das erste Mal sah, hat er es vollkommen überwältigt angestarrt. Ich habe nur heftig mit dem Kopf geschüttelt, als er mich Feuerschwester nannte. Das ist nichts weiter als eine Legende.
Draußen poltern Schritte über das Kopfsteinpflaster. Schwere Stiefel. Es sind nicht nur zwei Paar, sondern sechs. Nein, acht. Ich schließe die Augen und hoffe, dass ich bald wieder einschlafe. Denn bis es so weit ist, wird hinter meinen geschlossenen Lidern immer wieder ein und dasselbe Gesicht erscheinen.
Der Kronprinz von England. Robin. Wie er meine Hand nahm und vor einer Schar von Reportern einen Kuss darauf hauchte, wodurch er alles aufs Spiel setzte. Wie wir gemeinsam über alberne Vorhänge gelacht und so getan haben, als wären wir jemand, der wir nie sein könnten.
Wie er herausfand, was ich wirklich bin. Seine Hand an meinem Hals. Der Hass in seiner Stimme. »Aber das war nicht echt. Du hast mich das denken lassen. Es war alles gelogen.« Und doch war er plötzlich da, als ich fast an dem Versuch gescheitert wäre, die Erinnerungen seines Vaters zu verändern. Sein Geist verband sich mit meinem zu wahrer Feuerseide, wie in den alten Legenden, und verlieh mir die Kraft, den Weißen König zu besiegen.
Und wie er mich geküsst hat … als ich ihm anbot, ihn vergessen zu lassen, genau wie seinen Vater und Mister Galahad. Kurz vor unserer Flucht. Wie er mir seine Antwort ins Ohr flüsterte: Wage es ja nicht!
Eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, noch einmal wirklich tief einzuschlafen, aber als ich am nächsten Morgen aufwache, fühle ich mich durch und durch erholt. Sogar die Schmerzen in meiner Hand sind so gut wie fort. Blanc und René haben mir eine Nachricht auf dem Küchentisch hinterlassen, zusammen mit einem Croissant und einem Becher Tee. Sie mussten zur Arbeit. Einer von ihnen hat neben die Erklärung ein Strichmännchen gemalt, das sich gerade ein Croissant in den Mund steckt – oder vielleicht auch aus einem extrem missgebildeten Becher trinkt, das lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Grinsend setze ich mich zum Essen an den chaotischen Tisch, auf dem sich Stoffservietten, Zigaretten und zerlesene Kochbücher stapeln, bevor ich in dem kleinen Badezimmer verschwinde. Heute Morgen will ich mich mit Liam am Fluss treffen. Die Sonne scheint, Renés Wäsche schaukelt in dem leichten Luftzug, der durch das offene Fenster hereinweht, und es riecht nach Kaffee und frisch gebackenem Brot. Einen kurzen Moment lang scheinen die Geschehnisse der letzten Nacht nicht mehr zu sein als ein böser Traum.
Nachdem ich mich gewaschen habe, ziehe ich den Rattankorb unter dem Bett hervor, in dem ich meine Kleidung aufbewahre – beziehungsweise das, was Liam für mich zusammensammeln konnte. Mein Bruder bewahrt in seiner Wohnung zwar einige meiner Sachen aus England auf, die er bereits bei seiner Abreise mit nach Paris genommen hat, aber die wären hier vollkommen unpassend, weshalb er seine Kommilitonen um ein paar milde Gaben bat. Ich löse das Band Feuerseide von meinem Hals und wickele es wieder um meinen Oberschenkel, bevor ich die Sachen auf dem Bett ausbreite. Noch immer kann ich bei ihrem Anblick nur staunen. Sie sind so … zwanglos. Nicht dazu gemacht, etwas zu verstecken, sondern etwas zum Ausdruck zu bringen. Hier finden sich keine bodenlangen Kleider, keine Kummerbünde, keine Gladiéhandschuhe oder Marienkragen, die einem die Hände fesseln, Arme bedecken oder Wangen verhüllen. Stattdessen streiche ich ehrfürchtig über eine karierte Strickjacke aus Wolle. Über einen kurzen schwarzen Rock, eng geschnitten. Hier nennt man das Bleistiftrock. Über Caprihosen aus Seide. Der Stoff schmiegt sich wispernd an meine Fingerspitzen. Sofort werde ich innerlich ruhiger. Niemand weiß warum, aber Seide hilft gegen die Hautgier, die alle Magdalenen überfällt, wenn sie zu lange keinen Körperkontakt mit anderen hatten. Ich ziehe die Caprihose an, dazu die Strickjacke und hohe Schuhe mit hübschen Ziernähten, die René als Budapester bezeichnet. Sich so anzuziehen ist für mich immer noch ein kleines Wunder – all die leichten Stoffe, die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Als ich fertig bin, nehme ich einen kleinen Samtbeutel aus dem Korb und stelle mich damit vor den Ganzkörperspiegel. Er hat einen edlen Goldrahmen. Einmal habe ich René gefragt, wie er denn an ein so wertvolles Stück gelangt sei, woraufhin Blanc und der Comte nur die Augen verdrehten, während René antwortete, er wolle lieber keine alten Bettgeschichten auspacken. Diesmal nehme ich das Gold allerdings gar nicht wahr. Ich habe nur Augen für die Person im Spiegel.
Das kann nicht ich sein. Nicht diese junge Frau ganz in Schwarz, deren Beine deutlich zu sehen sind, die Knöchel entblößt. Die Jacke ist so elegant, die Hose derart gewagt. In England würde keine alleinstehende Frau es wagen, Schwarz zu tragen, nicht einmal in den verborgensten Winkeln von Babylon. Selbst mein Gesicht sieht irgendwie fremd aus. Der Stoff lässt das Blau meiner Augen dunkler wirken, meinen Hals länger, meine Wangenknochen markanter. In Paris ist alles irgendwie extremer. Hier muss ich auch meine Haare nicht hochstecken. Trotzdem flechte ich mir einen Zopf. Ich fühle mich schon frivol genug, wenn er über meinen Rücken gleitet.
Anschließend öffne ich den Beutel, in dem sich schmale Stoffbänder befinden, alle in grellbunten Farben: Pink, Grün, Gelb. Als ich sie das erste Mal sah, hielt ich sie für eine grelle Art von Kummerbund, was mir einen ordentlichen Schrecken einjagte. Aber dann erklärte mir Liam, dass man diese Bänder manchettes nennt, was früher einmal so viel hieß wie Überschrift oder Schlagwort. Und er zeigte mir, wie man sie trägt, nämlich indem man sie um Arme, Beine oder Hals wickelt, sogar um Brust, Füße oder Finger. Auf meine Frage hin, welchen Zweck das habe, antwortete er: zum Spaß. Einfach zum Spaß.
Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich nie irgendetwas zum Spaß getragen. Ich habe mir angesehen, wie er seine anlegte, unzählige grüne und rote Bänder über seinen schwarzen Ärmeln, aber ich bin nicht so wagemutig wie er. Ich entscheide mich für zwei dunkelblaue Bänder und wickele sie wie kurze Gamaschen um meine Knöchel und Waden. So halten sie auch die Kälte ab. In dem Beutel gibt es zudem Schmuck – manchettes aus Leder, die mit bunten Steinen besetzt sind – und glitzerndes Make-up. Aber diese Sachen wage ich momentan noch nicht einmal anzusehen.
Ich reiße mich erst vom Anblick meines Spiegelbildes los, als mein Handy vibriert. Eine Nachricht von Liam: Komme fünf Minuten später. Ein Blick auf meine Taschenuhr – ein wunderschönes Geschenk von Ninon – verrät mir, dass ich noch sehr viel später dran sein werde als er, wenn ich mich nicht beeile. Schnell gehe ich in die Küche zurück, streife ein Paar fingerlose Handschuhe über und lege mir das Cape um, das René mir geliehen hat. Mäntel oder Jacken scheinen momentan nicht in Mode zu sein. Dann trete ich in den Sonnenschein hinaus.
Montmartre ist wunderschön. Allerdings nennen die Pariser dieses Viertel jetzt anders. Améthyste ist sein neuer Name, wie der strahlend violette Farbton. Améthyste mit seinen langen Treppen und steilen Kopfsteinpflastersträßchen, in denen das Leben pulsiert, verschiedene Sprachen erklingen, Menschen sich begegnen und himmlisches Essen serviert wird. Überall sieht man kleine Läden wie Schneidereien oder Floristen, in Brasserien werden Couscous und Tabouleh angeboten, Fromagerien, Bäckereien und verlockende Patisserien reihen sich aneinander. Noch nie zuvor habe ich so viel Schokolade auf einmal gesehen. Die Macarons sind so bunt wie die manchettes in meinem Beutel. Und erst die manchettes in den großen Geschäften, die von den Touristen bestaunt werden! Aufstrebende Künstler tragen die Bänder im Haar, Arbeiter wickeln sie zum Schutz um ihre Hände. Hier findet man Studenten, Angestellte und Mousquetaires, rauchende Kellner in Straßencafés, deren Tische voll besetzt sind. Die Gäste genießen die Wärme von Heizpilzen oder haben sich in Decken gewickelt. Die meisten von ihnen sind schwarz gekleidet, aber durch die farbenfrohen manchettes und das glitzernde Make-up, das von Männern und Frauen getragen wird, entsteht das bunteste Chaos, das ich je gesehen habe. Die Erinnerung an den König von England, an seine weiße Uniform und seine grauen Augen, erscheint hier fast unwirklich. Der Weiße Hof, der Glaspalast und die stets verschleierte Königin … nein, so etwas kann doch gar nicht existieren.
Der Prinz. Immer in Schwarz. Seine befehlsgewohnte Stimme, die mir so oft einen Schauer über den Rücken gejagt hat.
Entschlossen schüttele ich den Kopf und gehe zur Metro. Hier gibt es nirgendwo aufgemalte Linien, die den Bürgersteig in verschiedene Spuren unterteilen, auch auf der Straße nicht. Jeder geht einfach dort, wo es ihm gerade passt. Bis ich den U-Bahnhof erreiche, habe ich mehr Hände gestreift, als ich zählen kann. Niemand trägt Handschuhe. Ich komme mir nackt vor, und die Gedanken der Menschen hängen in meinem Bewusstsein wie ein Hauch von Parfum auf der Haut. Ça, c’est un beau gosse. Ich spreche noch kein Französisch, aber oft fange ich Bilder auf. Der Mann, den die Frau offenbar bewundernd mustert, ist ein Oberkellner mit schmaler Nase und blauem Glitzer auf den Wangen. Er steht vor einer Brasserie. Peut-être qu’il vaut mieux de lui apporter des fleurs – eine alte Dame an einem Blumenstand. Oublié mon livre – ein gestresst wirkender Herr mit rötlichem Augen-Make-up. So schön – ein kleines Mädchen an der Hand des Vaters, das zu der beeindruckenden Kirche auf dem Hügel hinaufblickt. Sie ist aus weißem Stein erbaut, aber ihre Fassade verschwindet fast hinter verschiedenen bunten Bannern. Ganz ähnlich sehen die hohen Häuser ringsum aus, in denen jeder Vorhang eine andere Farbe hat, alles außer Weiß oder durchsichtig. Fast meine ich die Farben riechen zu können … die Farben und die unterschiedlichen Gedanken. Wenn da nicht noch so viele andere Düfte wären, wie die frische Winterluft, heißes Mandelgebäck und die blumigen Aromen von schwarzem Tee.
Nur ein Duft fehlt.
Bergamotte und rauchiges Holz.
Ich schiebe den Prinzen gedanklich so weit von mir weg wie irgend möglich und gehe hinunter in die Metrostation Améthyste. Das große Schild leuchtet in genau dem Farbton, nach dem das Viertel heute benannt ist. Dies ist der Beginn eines neuen Lebens. Eines Lebens, an dem er keinen Anteil haben kann. Selbst wenn er es wollte.
Die Metro bringt mich ins Herz der Stadt, zu einer kleinen Insel in der Seine, diesem glitzernden Band, das sich quer durch Paris windet. Die Gegend wird Île-de-Corail genannt, und das Metroschild ist in einem sanften Rotton gestaltet, eben der Farbe von Korallen nachempfunden. Liam wartet auf der Bank vor einem alten Laden für englischsprachige Bücher auf mich, der zwischen einem kleinen Park, dem Fluss und mehreren windschiefen Häusern eingezwängt ist. Mit einem Becher Tee in der Hand mustert er die Kathedrale am gegenüberliegenden Flussufer. Die helle Morgensonne lässt seine roten Haare leuchten, umschmeichelt seine schmale Gestalt und wärmt das Holz der Violine in seinem Schoß.
»Guten Morgen, Brahms«, begrüße ich ihn, während ich mich neben ihm auf die Bank fallen lasse und nach seinem Tee greife.
»Brahms war Pianist«, erklärt er und hält den Becher geschickt außerhalb meiner Reichweite. Dabei achtet er sorgfältig darauf, dass seine Violine nichts abbekommt. Er erzählt zwar nicht viel, aber anscheinend läuft sein Studium am Königlichen Musikkonservatorium richtig gut. Schon jetzt wurde er mehrfach gelobt und sogar als Solist für ein Konzert im königlichen Palast auserkoren, bei dem aufstrebende Musiker vor dem Hof der Farben auftreten sollen. In zwei Wochen wird es so weit sein. Ich könnte kaum stolzer auf ihn sein. Als er sich nach endloser Bohrerei gestern Abend endlich dazu herabließ, es mir zu erzählen, wusste ich plötzlich wieder, wie sich reine, ungetrübte Freude anfühlt. Er hingegen musterte nur meine blauen Flecken und Verbände und presste die Lippen zu einem dünnen, traurigen Strich zusammen.
»Kein Grund, so ein finsteres Gesicht zu ziehen«, wiederhole ich nun, was ich ihm schon am Vorabend gesagt habe. »Wir sind endlich in Sicherheit.« Ganz bestimmt werde ich ihm nichts von dem Angriff erzählen. Albträume sind etwas für die Nacht. Ich möchte von jetzt an nur noch über angenehme Dinge sprechen. »Hast du gut geschlafen?«
»Gequält von der unfassbaren Geschichte meiner kleinen Schwester und ihrer Flucht aus England. Und du?«
»Getröstet von dem Wissen, dass ich sicher in Frankreich angekommen bin. Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich sich die Dinge bewerten lassen.«
»Werd jetzt bloß nicht frech«, sagt er. »Ich habe ja wohl das Recht, ein wenig besorgt zu sein, wenn ich erfahre, dass meine Schwester innerhalb von nur drei Monaten vom Kronprinzen von England verführt, ausgepeitscht und zum Tode verurteilt wurde. Und dass sie es im Anschluss daran versäumt hat, seine Erinnerungen zu löschen, bevor sie aus dem Land floh, weil sie nun einmal der Meinung ist, man könne ihm trauen.«
Das schon wieder. »Haben wir das nicht schon gestern alles durchgekaut?«
»Du hast es durchgekaut. Mir wurde dieser Brocken einfach vor die Füße geworfen.«
»Wie ich bereits sagte«, erkläre ich ihm zum gefühlt hundertsten Mal, »muss er selbst ein Geheimnis hüten. Eines, das sogar folgenschwerer sein dürfte als meines. Er wird mich nicht verraten.«
Und er hat gesagt, dass er mich liebt.
»Bis es ihm dann plötzlich doch in den Kram passt«, murmelt Liam.
»Du kennst ihn doch gar nicht«, erwidere ich schärfer als beabsichtigt. Warum verteidige ich den Prinzen eigentlich? Vielleicht, weil ich ihn jetzt schon so sehr vermisse, dass es wehtut.
»Bitte verzeih, dass ich keinen Fanclub für den Mann gründe, der dich hinrichten lassen wollte«, pflaumt Liam mich an. »Mir liegt eben einiges an deiner fortwährenden Existenz.«
Einen Moment lang starren wir uns nur wütend an. Schon immer konnten wir uns gegenseitig von einer Sekunde auf die andere auf die Palme bringen. Dann berührt er meine Finger, und die wundervolle Sinfonie seines Geistes strömt in mein Bewusstsein. Sie ist nicht ganz so voll wie in meiner Erinnerung, klingt jetzt eher fokussiert. Aber dadurch ist sie nicht weniger einladend, nicht weniger liebevoll. Wenn überhaupt, hat sie an Wildheit gewonnen. Ein bisschen wie Ninons Geist.
»Verzeih mir«, sagt er leise. »Ich kann einfach noch nicht glauben, dass all das real ist. Dass du in Sicherheit bist.« Wenn dir etwas zugestoßen wäre, hätte ich ihren Palast dem Erdboden gleichgemacht, ihn bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das hätte ich sowieso tun sollen.
Ich drücke seine Hand. Als ob es da etwas zu verzeihen gäbe. Liam erwidert den Druck, bevor er meine Hand loslässt. »Und eine leibhaftige Feuerschwester«, scherzt er. »Muss ich dir jetzt huldigen? Wären zwei Opfergaben pro Tag ausreichend?«
Sofort bringe ich ihn zum Schweigen. »So etwas wie Feuerschwestern gibt es nicht. Das ist bloß eine Legende.«
»Nein, nein, ist schon gut. Ich wusste immer, dass du etwas Besonderes bist.«
»An mir ist überhaupt nichts Besonderes«, betone ich. »Wenn überhaupt, bist du hier die große Nummer, immerhin darfst du schon nach ein paar Monaten Studium bei Hofe auftreten.«
»Eine große Nummer vielleicht, aber trotzdem total pleite«, erwidert er leichthin und überlässt mir endlich den Teebecher. »Weißt du, was ich für diesen einen Tee bezahlt habe? Das ist eine echte Unverschämtheit. Und ich habe auch keine Zeit mehr für Straßenmusik. Mal ganz abgesehen davon, dass hier die Konkurrenz viel größer ist.« Er deutet zur anderen Straßenseite hinüber, wo eine hochgewachsene Frau Saxofon spielt. Blues. Ein toller Rhythmus, da will man gleich mitwippen.
»Mach dir darüber mal keinen Kopf«, lache ich. »Du spielst bald für den Roi.«
So nennen sie hier ihren König: Roi. Noch kann ich das Wort nicht richtig aussprechen, aber ich arbeite daran. Liam spreizt die Finger. »Bedauerlicherweise zahlt der nicht sonderlich gut.« Erst jetzt bemerke ich, dass sein Hals leicht gerötet ist, ein klares Zeichen von Nervosität. Wie entzückend – mein großer Bruder ist nervös.
»Trotzdem ist das eine ziemlich große Sache«, trieze ich ihn. »Die Presse wird da sein. Fernsehen, Radio, Talentsucher.«
»Oh Mann, halt bloß die Klappe.« Jetzt ist sein Hals glühend rot. Ich muss lachen. Er ebenfalls, schlägt dann aber die Hände vors Gesicht. »Die Besten der Besten haben vor ihm gespielt. Da kann ich mich nur blamieren. Sie werden mich bemitleiden.«
»Ich gebe zu, es ist wirklich schwierig, eine solche Riesenenttäuschung zum Bruder zu haben, aber ich werde schon irgendwie damit klarkommen«, versichere ich ihm großmütig. Das bringt mir einen Boxhieb gegen den Arm ein.
Ich zucke zusammen – etwas zu heftig. Liam mustert mich prüfend. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Klar doch. Alte Verletzung«, lüge ich. Das kann ich verdammt gut, auch wenn ich mir wünschte, es wäre anders.
»Ach so. Tut mir leid.«
»Ist schon gut.« Schnell wechsele ich das Thema: »Verrate mir lieber, was du spielen wirst und wie ich auf die Gästeliste komme.«
Verlegen spielt er an einer seiner manchettes herum. Sie ist leuchtend grün. Inzwischen hat er sich offenbar ziemlich an die Bänder gewöhnt. Er trägt sie um seine enge schwarze Jeans gewickelt, über den langen Ärmeln und am Hals, immer Rot und Grün. Ich habe sogar schon einen Hauch grünen Glitzer auf seinen Lidern gesehen. Das passt gut zu seinen Augen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Saxofonistin auf der anderen Straßenseite ihm zwischen den Songs immer wieder Blicke zuwirft.
»Als sie mich gefragt haben, ob sie jemanden für mich auf die Gästeliste setzen sollen, wusste ich noch nicht, dass du zum Konzert hier sein würdest, also habe ich Nein gesagt.«
»Du bist vermutlich der schlechteste Bruder aller Zeiten.«
»Oh bitte«, spottet er. »Du brauchst mich doch gar nicht, um Zugang zum Hof der Farben zu bekommen. Frag einfach deine berühmte neue Freundin.«
So nennt er Ninon immer. Meine berühmte neue Freundin. Womit er natürlich nicht unrecht hat. Sie ist die Duchesse d’Orléans, Schwester des Königs von Frankreich und CEO von M3RL1N, einem der größten Konzerne des ganzen Kontinents. Und sieht noch dazu absolut umwerfend aus. Natürlich.
»Seit sie in den Palast gezogen ist, habe ich sie nicht mehr gesehen«, erkläre ich ihm bemüht sorglos, schaffe es aber doch nicht ganz, meine Anspannung zu verbergen. Gerade mal zwölf Stunden nach unserer Ankunft in Paris – ich war noch kaum bei Bewusstsein – klopfte es plötzlich an Renés Tür: ein Gesandter des Roi. Der wollte, dass seine Schwester bei Hofe gepflegt wird. Ninon versuchte zu protestieren, aber da ihr Zustand genauso miserabel war wie meiner, schien das niemand zu bemerken. René war da schon wesentlich nachdrücklicher, wurde aber vom Comte mit einem Blick zum Schweigen gebracht. Selbstverständlich wurde den Wünschen Seiner Majestät Folge geleistet. Blanc verkniff sich während des ganzen Prozesses jeden Kommentar, auch wenn er meine Hand so fest umklammert hielt, dass ich mehrere Knochenbrüche befürchtete.
Hinterher hörte ich sie streiten, René und den Comte, als sie dachten, Blanc und ich wären eingeschlafen. Was sie sich gegenseitig an den Kopf warfen, verstand ich nicht, aber René wurde immer wieder laut, während der Comte fast schon unnatürlich ruhig blieb.
»Sie wird bestimmt gut versorgt«, sagt Liam nun. Ich nicke. Natürlich, schließlich ist sie die Schwester des Roi. Sie wird sich vor Maltoren und Ärzten kaum retten können. Aber sie fehlt mir. »Allerdings hat sie nicht einmal eine Telefonnummer hinterlassen. Wie soll ich es da noch auf die Gästeliste schaffen?«, scherze ich.
»Die Mousquetaires werden eine Wache abstellen. Vielleicht können die dich reinschmuggeln.«
»Nein, ich habe ihre Großzügigkeit schon mehr als genug strapaziert«, sage ich mit Nachdruck. Dass sie sich um Blanc und Ninon kümmern, ist verständlich, immerhin sind sie alte Freunde und Waffenbrüder. Dass sie mir dieselbe Freundlichkeit erweisen, ist geradezu unglaublich. Während ich noch halb im Delirium war, haben sie sich sogar eine Erklärung für Blancs und meine überstürzte Abreise aus London ausgedacht: Ihr Capitaine schrieb dem Weißen König eine Nachricht, in der er ihm erklärte, der Roi habe Blanc bei der Rückkehr der Duchesse wieder nach Paris abkommandiert, um für ihren Schutz zu sorgen, während die Duchesse darum gebeten habe, dass ich sie begleite, als ihre besondere Freundin.
»Ich bin jedenfalls froh, dass du bei mir einziehst«, stellt Liam fest. »So kann ich immer ein Auge auf dich haben.«
Jetzt würde ich ihn gerne boxen, halte mich aber zurück, da meine Finger das vielleicht nicht so gut verkraften würden. »Wird dir bestimmt guttun, eine Weile auf dem Boden zu schlafen«, schieße ich stattdessen zurück. So oder so bin ich froh, momentan nicht in London zu sein. Es war dumm, Winter für den Anschlag auf den König verantwortlich zu machen. Dadurch sind die Repressalien nur noch weiter verschärft worden. Aber die Königin ließ uns keine andere Wahl.
Liam lacht laut auf. »Manja meinte, sie hätte eine alte Matratze für dich gefunden, bis wir uns etwas Richtiges leisten können.«
Ich muss ebenfalls lachen. In Wahrheit können wir uns momentan nicht mal etwas Un-Richtiges leisten. Wenn wir über die Runden kommen wollen, werde ich mir bald eine Arbeit suchen müssen. Aber wir hatten nie viel Geld, und in diesem Moment ist mir das auch völlig egal: Ich sitze in der Sonne, habe meinen Bruder neben mir und einen heißen Tee in der Hand. »Mag sein, aber ich glaube, Beethoven hätte lieber mich als Bettgenossin.«
Beethoven ist die Katze, die nie wieder gegangen ist, seit Liam sie einmal gefüttert hat. Sie schlüpft regelmäßig am frühen Morgen durch die Dachluke und rollt sich am Fußende des Bettes zusammen – unabhängig davon, wie nass oder schmutzig sie ist.
»Dumme Katze«, brummt Liam und streckt sich. »Immerhin bringe ich das Futter nach Hause.« Da sein Stipendiumsgeld fast komplett für die Miete der winzigen Dachkammer draufgeht, arbeitet er abends zusätzlich in der Cafeteria des Konservatoriums. Vielleicht könnte ich mir etwas Ähnliches suchen. Wenn ich doch nur schon Französisch könnte – was nicht der Fall ist. Und Qualifikationen habe ich auch keine. Es sei denn, jemand braucht einen Undercover-Bodyguard. Darin habe ich Erfahrung. Vor allem aber habe ich Erfahrung darin, mich in meinen Schutzbefohlenen zu verlieben. Gott, wie ich es hasse, dass meine Gedanken ständig um Robin kreisen. Um seine tiefe Stimme, seine Schlagfertigkeit, seine blauen Augen, in denen oft kalter Zorn lodert. Wie er aus Hamlet zitiert und mich zu einer illegalen Theateraufführung mitgenommen hat, wo wir dann zusammen in einer der Garderoben gelandet sind. Mühsam versuche ich, den Blick auf Paris zu richten. Liam sitzt schweigend neben mir. Wir beobachten die Touristen, die voller Begeisterung die Kathedrale bestaunen, sich über den Sonnenschein freuen, das blanke Holz unserer Bank und die frisch gedruckten Bücher im Schaufenster bewundern. Ich höre Englisch, Französisch, Polnisch, Deutsch. Die Katze aus dem Buchladen kommt angeschlichen und beschnüffelt neugierig unsere Finger. Nachdem sie eine Weile überlegt hat, gestattet sie uns, sie zu streicheln. Ich vergrabe die Finger in ihrem Fell, bis ich ihre Haut berühre. Ihr Bewusstsein gleicht einem Feuerwerk. Es ist so ganz anders als das eines Menschen. Ein umwerfendes Erlebnis. Angeblich fürchten sich viele Magdalenen davor, weil es sie so desorientiert zurücklässt, dass ihnen übel wird, sie das Bewusstsein verlieren oder sogar Fieber bekommen. Auf mich trifft nichts davon zu. Ich betrachte die Welt gerne durch den Filter eines fremden Geistes. Die Katze beginnt zu schnurren, und Liam gibt Laute von sich, die dem sehr ähnlich sind. »Was haben wir doch für ein Glück«, sagt er.
Wo er recht hat, hat er recht. Einige Mousquetaires schlendern an uns vorbei, ohne uns die geringste Beachtung zu schenken. Schließlich sind wir einfach nur zwei junge Menschen, die vor einem Buchladen sitzen und Tee trinken.
Sobald Liam ausgetrunken hat, machen wir uns auf den Weg – weg vom Fluss und der Île-de-Corail mit ihren teuren Restaurants, Regierungsbehörden und dem Hauptquartier der Mousquetaires, direkt gegenüber der Kathedrale. Stattdessen gehen wir ins Quartier Latin, heutzutage Corail genannt. Liam erklärt mir die Stadt und wie man hier lebt. Er zeigt mir seine Lieblingsbäckerei in der Rue Monge, den Markt, auf dem er seine Lebensmittel einkauft, den Supermarkt, aus dem Beethovens Futter stammt. Dabei kommen wir an zwei Theatern, fünf Buchhandlungen, einem Dutzend Cafés und Bars, drei Diskotheken und zwei Seidenhändlern vorbei. Und an unzähligen Menschen, deren Kleidung auf der anderen Seite des Kanals nicht einmal als solche angesehen würde. Als Verbrechen gelten würde. Unverhüllte Hälse, Arme, Beine, Gesichter. Es ist wie im Traum. Ja, das muss ein Traum sein. Wie hätte ein solcher Ort denn all die Jahre existieren können, während ich in London und Amerika Kragen trug, die bis zu den Augenwinkeln reichten, um mein Gesicht vor unbeabsichtigter Berührung zu schützen. Handschuhe trug, die an den Ärmeln festgenäht waren. Wäre ich an einem Ort wie diesem geboren worden, hätte ich dann sorglos und in Sicherheit aufwachsen können? Der Gedanke ist vollkommen verrückt.
Hier bieten Magdalenen ihre Dienste ganz offen an. Liam zeigt mir einen Laden, den ich geschlagene zehn Minuten lang fassungslos anstarre, weil ich es einfach nicht glauben kann. Er heißt Gesunder Geist und scheint eine Kooperation eines Mensators mit einem Maltoren und einem Memextraktor zu sein, die in die Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen ihrer Kunden eintauchen, um ihnen bei Stressbewältigung, Migräne oder geistigen Beschwerden zu helfen. Sie haben einen offiziellen Abschluss. Einen Titel. Und sie präsentieren am Türpfosten stolz ihre Seidenbänder: blau für den Mensator, grün für den Maltoren, Gelb für den Memex. Einfach nicht zu fassen. Ich lege eine Hand an das Schaufenster. Was könnte ich hier nicht alles werden.
Während wir weitergehen, fällt mir auf, wie problemlos ich in der Menge aufgehe. Niemand beachtet mich. Wir spazieren an der Straße vorbei, die zur Moschee und zu Liams Wohnung führt, und halten auf die Place Contrescarpe zu, wo wir uns mit ein paar von Liams Kommilitonen treffen. Sie kommen aus den verschiedensten Ländern. Liam stellt mir einen nach dem anderen vor. Seine Freundin Manja ist die Erste. Lächelnd beugt sie sich zu mir. Ich kann nicht glauben, dass sie das wirklich tut. Sie begrüßt mich auf die gleiche Art, die ich auch schon bei anderen beobachtet habe, indem sie ihr Gesicht an meines drückt und mir einen Kuss auf jede Wange haucht.
Sie tut es tatsächlich. Sie alle tun es, sie alle lassen mich in ihren Geist. Ohne Angst. Ohne zu zögern. Für sie ist das so normal wie ein Devotionsknicks. Und zur Begrüßung sagen sie alle, wie es hier üblich ist: »Mögest du stets offenen Geistes sein.«
Ich bin im Himmel.
Zumindest bis einer von Liams Kommilitonen, der Junge mit der Flöte, bei meinem Anblick die Augen aufreißt. »Moment mal«, sagt er. »Bist du nicht das Mädchen, das mit dem Kronprinzen von England zusammen ist?«
Alle sehen mich an. Mir fällt wieder ein, welche Lügen der Weiße Hof der Presse untergeschoben hat … wir der Presse untergeschoben haben. Demnach war ich nicht der Bodyguard des Prinzen, sondern hatte »sein Interesse geweckt«. Entsprechend hofierte er mich. Was wir ihnen auch vorgespielt haben, erst auf einer Pressekonferenz, dann bei einem Abendessen im Savoy. Irgendwann war es keine Schauspielerei mehr, sondern wurde real.
Ich sollte die Bemerkung mit einem Achselzucken abtun können. Ich bin schließlich eine gute Schauspielerin, ich liebe es, in fremde Rollen zu schlüpfen. Es hat nicht funktioniert. Ein ganz einfacher Satz. Nur ein paar Worte, vollkommen unverkrampft vorgebracht, vielleicht mit einem kleinen Lachen garniert. Aber ich schaffe es nicht.
»Ehrlich, Cos«, rettet mich Manja, »du bist eine solche Tratschtante.«
Cos hat zumindest den Anstand, rot zu werden. »Er ist eben heiß, okay? Da lohnt es sich, auf dem Laufenden zu bleiben.«
»Du könntest ja versuchen, Monsieur le Roi bei unserem Konzert im Palast mit deiner meisterhaften Darbietung zu becircen«, schlug Manja trocken vor. Irgendwie erinnert sie mich an Zadie, mit der ich in der Schneiderwerkstatt in London zusammengearbeitet habe. Hoffentlich geht es ihr gut. Cos rümpft empört die Nase. »Das überlasse ich wohl eher Mister Erstes-Solo-nach-drei-Monaten.« Er zeigt auf Liam.
»In dieser Suite gibt es sowieso kein Flötensolo, das deinem Talent gerecht würde«, stichelt Liam, während ein anderes Mädchen sich empört: »Hast du dir den Roi überhaupt mal angesehen?«
»Er sieht doch nicht schlecht aus.«
»Nicht schlecht? Mit diesem Schnurrbart?«
Ich atme erleichtert auf, als sie begeistert weiterzanken. Schließlich mache ich sogar mit. Es ist ganz leicht. Verstohlen beobachte ich Liam, der gerade fröhlich lacht. Selten habe ich etwas Schöneres gesehen. Wir könnten hier glücklich werden.
Irgendwann setzen wir uns in ein Café weiter unten in der Rue Monge, um uns aufzuwärmen. Hinten im Raum spielt ein Pianist, und die Musik untermalt unsere Gespräche. Liams Freunde trinken fast alle Kaffee aus winzigen Tassen. Espresso, vermute ich. Ich probiere einen. Er schmeckt bitter, sehr intensiv. Irgendjemand empfiehlt mir lachend, als Nächstes einen Café au lait zu probieren, allerdings nur, wenn ich ein volles Bankkonto hätte. Cos erklärt mir, wo ich am besten auf Jobsuche gehen soll. Er winkt sogar den Kellner herbei, um zu fragen, ob hier vielleicht jemand gebraucht würde – auf Französisch natürlich. Während ich ihm zuhöre, frage ich mich bedauernd, warum er nicht singt. Seine Stimme ist so weich und voll. »Er wäre bestimmt ein großartiger Sänger«, raune ich Manja zu, während Cos mit dem Kellner plaudert.
Die verdreht nur die Augen. »Sag ihm das bloß nicht. Sein Ego ist auch so schon groß genug.«
»Bist du jetzt nicht etwas zu hart zu ihm?«, frage ich scherzhaft.
Bevor Manja antworten kann, schreit Cos begeistert auf. Zusammen mit dem Kellner deutet er auf die Straße hinaus, wo sich gerade ein schwarzer Wagen nähert. »Das ist eine Limousine aus dem königlichen Fuhrpark«, erklärt Cos aufgeregt und steht auf, um besser sehen zu können. Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und schließe die Augen, sauge die Wärme des Heizpilzes in mich auf. Was für ein Leben. Ich kann ganz entspannt hier sitzen und zusehen, wie eine schwarze Limousine vorbeifährt, ohne gleich um mein Leben fürchten zu müssen. Denn was auch immer die Königliche Garde hierherführt, es hat sicher nichts mit mir zu tun. Ich kann einfach weiter meinen heißen Kaffee trinken, den Kopf auf Liams Schulter legen und der gedämpften Sinfonie seines Geistes lauschen, die sich trotz der Kleidung, die uns trennt, erahnen lässt.
Plötzlich höre ich ein Räuspern. »Mademoiselle?«
Es ist der Oberkellner. Er mustert mich erwartungsvoll. Ich richte mich auf. »Ja?«
»Sind Sie so weit?«
Verwirrt starre ich ihn an. Darf ich hier arbeiten? Sehe ich überhaupt angemessen aus? »Jetzt gleich?«
»Aber ja. Davon gehe ich aus.«
»Gibt es keine … Formalitäten zu erledigen?«
»Nein.«
»Aber sollte ich dafür denn nicht besser Französisch können?« Ich werde immer verwirrter.
Das scheint den Kellner irgendwie zu kränken. »Mademoiselle«, setzt er an und reckt steif das Kinn. »Der Roi Citoyen spricht ausgezeichnet Englisch.«
»Rea«, sagt Liam drängend, und da begreife ich endlich.
Die Limousine hat direkt vor dem Café angehalten. Vor unserem Tisch steht ein Mousquetaire in schwarz-blauer Uniform. Und er sieht mich unverwandt an. »Entschuldigung, Mademoiselle, ich wusste nicht, dass Sie kein Französisch sprechen. Man hat mich gebeten, Sie abzuholen.«
»Wer hat Sie darum gebeten?«, frage ich, obwohl die Antwort schmerzlich klar auf der Hand liegt.
»Seine Majestät, der König von Frankreich.«
Kapitel 2
Das kann doch nur ein schlechter Scherz sein.
Ich weiß, dass ich eigentlich nicht nervös sein sollte, als ich in der schwarzen Stretchlimousine Platz nehme, aber bei Maria noch mal, das kommt mir alles so verdammt vertraut vor. Nur, dass ich diesmal nichts zu befürchten habe. Ich habe nichts getan.
Außer Seine Majestät den König von England anzugreifen und seinen Geist zu manipulieren, natürlich.
Der Mousquetaire starrt mich unverblümt an. Er ist sehr aufwendig gekleidet. Diese Jacke, der Hut und dieses Cape sind wohl eher für zeremonielle Anlässe gedacht, nicht für den Kampf. Er muss so um die fünfzig sein, zumindest sind Bart und Haare schon stark ergraut. Ich wüsste nicht, wann ich in England je so offen gemustert worden wäre. Zumindest nicht vor meinem Eintreffen am Weißen Hof. Im gläsernen Turm des Weißen Königs, dem nichts verborgen bleibt.
»Sie sind Miss Rea Emris«, stellt mein Gegenüber schließlich fest. Er spricht fließend Englisch, was mich leicht beschämt.
»Offenbar sind Sie mir gegenüber im Vorteil«, erwidere ich leicht trotzig.
»Nicht nur in dieser Hinsicht.« Seine Antwort könnte als Scherz gemeint sein. Oder eine Drohung beinhalten. »Ich bin der Capitaine der Mousquetaires.«
»Und da dienen Sie dem König als Laufbursche?« Sobald ich die Worte ausgesprochen habe, wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Aber er lächelt nur süßlich. »Immer noch besser, als die Kurtisane des Kronprinzen von England zu sein.«
Dieser Begriff stößt mir bitter auf. Kurtisane? »Worum geht es hier überhaupt?«
»Das weiß ich nicht. Doch es schien recht dringlich zu sein.«
Okay, jetzt werde ich doch nervös. »Es überrascht mich, dass der Roi überhaupt weiß, dass ich existiere.«
»Inzwischen weiß er das sehr wohl. Er hat ein Schreiben Seiner Majestät des Königs von England erhalten, das sich unter anderem mit Ihrer Person befasste.«
Sofort verkrampfe ich mich. Hätte ich doch nur ein Messer bei mir. Ich bohre die Fingernägel in die Ledersitze. Wie ein glühendes Band liegt die Feuerseide auf meiner Haut. Diese Megäre von gestern. Wurde sie am Ende aus England hergeschickt? Zum ersten Mal seit meiner Ankunft hier taucht die Kreatur an meiner Seite auf – jenes große graue Ungetüm, das nur in meinem Kopf existiert. Wenn ihr das nur ebenfalls bewusst wäre. Wenn sie sich nur nicht neben mir auf dem Sitz zusammenrollen, mir die Finger ablecken und flüstern würde: Es gibt kein Entrinnen, Magdalena.
Mit größter Mühe kann ich mich davon abhalten, aus dem fahrenden Wagen zu springen. Doch ich bleibe sitzen und würge möglichst unbeteiligt hervor: »Und was hatte Seine Majestät über mich zu sagen?«
»Ich glaube, es ging um Sie und die Duchesse d’Orléans.«
Was, wenn Ninon und ich versagt haben? Wenn der König sich doch erinnert? Oder Mister Galahad. Was, wenn sie die Megäre geschickt haben, um mich zur Strecke zu bringen? Wo ist eigentlich Ninon? Ist sie in Sicherheit? »Wo ist die Duchesse?«, frage ich mit wild klopfendem Herzen. Der Capitaine mustert mich mit undurchdringlicher Miene.
»Das weiß ich nicht.«
Der Palast des Roi befindet sich am anderen Ufer der Seine, direkt am Fluss. Ein prachtvolles Bauwerk, an dem seit zweihundert Jahren nichts verändert wurde: ein von schlanken Säulen getragenes silbernes Dach; hohe Fenster, durch die man hin und wieder einen Blick ins Innere erhaschen kann. Zwei lange Seitenflügel strecken sich weit in die Königlichen Gärten hinein, den Jardin des Tuileries, heutzutage ein öffentlicher Park. In den Beeten rund um den Palast findet man selbst jetzt im Winter strahlend bunte Blumen, sogar unter den Fenstern, in den Innenhöfen und den hellen Wandelgängen. Erst als wir aus dem Auto steigen, wird mir klar, dass es sich dabei um Kunstblumen handelt: ein wahres Blütenmeer, aus Seide gemacht.
Ich hole tief Luft. Auf dem Fußweg zum Palast hat man Blütenblätter verstreut. Es fühlt sich an, als würde man auf Wolken gehen, oder auf Wasser, das zu einer weichen Masse erstarrt ist. Der Capitaine reicht mir nicht den Arm, als wir uns dem Portal nähern. Ein paar Fußgänger im Park beobachten, wie wir den Palast betreten, aber ich sehe keine Kameras, kann nirgendwo Vertreter der Presse entdecken. Das macht mich misstrauisch. Warum bleibt das alles unbeachtet? Fast wirkt es so, als wolle man mich nicht verschrecken.
Mir fällt wieder ein, wie der Comte letzte Nacht verschwunden ist. Der Blick, den er mir zugeworfen hat. Als habe er mir damit etwas sagen wollen.
Er wollte dir sagen, dass du abhauen sollst, schnurrt die Kreatur. Aufgeregt beißt sie mich in die Wade. Bevor es zu spät ist. Abrupt bleibe ich stehen. Ich darf dem Comte nicht vertrauen. Ich darf diesem Capitaine nicht vertrauen. Und ich werde ganz sicher keinem König mehr vertrauen. »Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor ich nicht weiß, warum ich hier bin.«