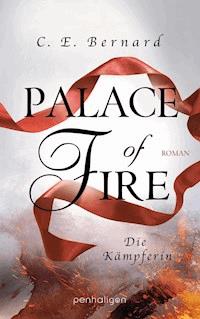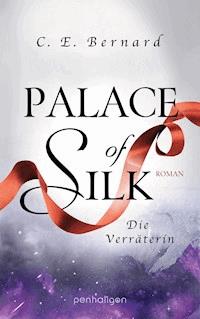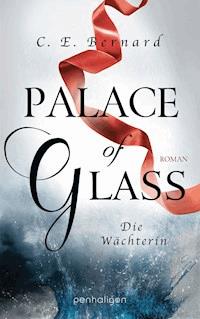4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Du liebst gruselige Neuerzählungen wie »Die Dunklen Chroniken«, die »Disney – Villains« und »Twisted Tales«? Dann mach dich gefasst auf die Schneekönigin!
Jeder kennt ihre Geschichte: Weit im hohen Norden lebt die Schneekönigin in ihrem kalten Palast. Sie ist ein Monster, das Kinder entführt und Eiskristalle in ihre Herzen treibt. Doch ich glaube nicht daran. Im Gegenteil: Ich will, dass die Schneekönigin mein Kind rettet! Denn die Gunst des Winters und seiner eisigen Stürme gehört meinem Reich seit Generationen. Erst als am Tag der Winterwende ein geheimnisvoller Luchs auftauchte, sandte die Schneekönigin mir ihren Zorn. Doch ich werde ihre drei Prüfungen bestehen und meinen Sohn retten. Sogar, wenn ich dabei selbst zu Eis erstarren werde ...
Weitere Fantasy-Highlights von C.E. Bernard:
Die »Wayfarer«-Saga:
1. Das Lied der Nacht
2. Das Flüstern des Zwielichts
3. Der Klang des Feuers
Die »Palace«-Saga:
1. Palace of Glass. Die Wächterin
2. Palace of Silk. Die Verräterin
3. Palace of Fire. Die Kämpferin
4. Palace of Blood. Die Königin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Jeder kennt ihre Geschichte: Weit im hohen Norden lebt die Schneekönigin in ihrem kalten Palast. Sie ist ein Monster, das Kinder entführt und Eiskristalle in ihre Herzen treibt. Doch ich glaube nicht daran. Im Gegenteil: Ich will, dass die Schneekönigin mein Kind rettet! Denn die Gunst des Winters und seiner eisigen Stürme gehört meinem Reich seit Generationen. Erst als am Tag der Winterwende ein geheimnisvoller Luchs auftauchte, sandte die Schneekönigin mir ihren Zorn. Doch ich werde ihre drei Prüfungen bestehen und meinen Sohn retten. Sogar wenn ich dabei selbst zu Eis erstarren werde …
Autorin
C.E. Bernard ist das Pseudonym von Christine Lehnen, die 1990 im Ruhrgebiet geboren wurde und seitdem in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien und Paris gelebt hat. Sie studierte die Fächer English Literatures and Cultures und Politikwissenschaft, seit 2014 lehrt sie Literarisches Schreiben an der Universität Bonn. Daneben promoviert sie an der University of Manchester über Neuerzählungen des Trojanischen Krieges, erwandert das Siebengebirge und mentoriert zukünftige Talente für PAN e. V. Ihre Kurzgeschichten wurden mit den Literaturpreisen der Jungen Akademien Europas und der Ruhrfestspiele Recklinghausen ausgezeichnet, ihre Romane waren für den RPC Fantasy Award und den Lovelybooks-Leseraward nominiert. Ihre Palace-Saga und die Wayfarer-Saga schrieb Christine Lehnen auf Englisch – diese beiden auf Deutsch erschienenen Reihen wurden ins Deutsche zurückübersetzt.
Weitere Informationen unter: http://de.cebernard.eu/
Von C. E. Bernard bereits erschienen:
Die »Wayfarer«-Saga:
1. Das Lied der Nacht
2. Das Flüstern des Zwielichts
3. Der Klang des Feuers
Die »Palace«-Saga:
1. Palace of Glass. Die Wächterin
2. Palace of Silk. Die Verräterin
3. Palace of Fire. Die Kämpferin
4. Palace of Blood. Die Königin
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
C. E. BERNARD
DIE SCHNEE KÖNIGIN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by C. E. Bernard und Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Covergestaltung: Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (Warm_Tail; Olive Kitt)
BL · Herstellung: MR
Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-29206-5V001
www.penhaligon.de
Meiner Nichte
Erster Teil
Seht, nun fangen wir an! Und wenn die Geschichte vorüber ist, wirst du eine ganze Menge mehr wissen als jetzt.
Hans Christian Andersen
Die Schneekönigin
Prolog
Es lebte einst hoch im Norden ein Mädchen, das Greta hieß. Ihr Haar war rot wie das Feuer im Kamin, und ihre Augen waren grün wie Sommerlaub. Ihre Nase war spitz, genau wie die Ellbogen und das Kinn. Ihre jüngere Schwester Ida, fanden viele, war schöner als sie. Ihre Mutter und ihren Vater kümmerte das nicht, auch nicht die Großeltern, schon gar nicht die Amme und Stallmeisterin und den Koch.
Sie wuchs auf in einer Burg, deren Zinnen vom Herbst bis in den Frühling mit Schnee bedeckt waren und auf der gut dreißig Seelen lebten. Im Winter wucherten Eiskristalle an den Fenstern, die das Glas zum Klirren brachten, ganz so, als wollten sie die Fenster zerschmettern, um nach ihr zu greifen, sie zu packen mit ihren kalten Fingern und hinauszuzerren in die Dunkelheit.
Die Burg stand am Fuße eines hohen Berges und am Ufer eines breiten Fjordes. Umgeben war sie von dunklen Wäldern, in denen hohe Tannen wuchsen, und drei kleinen Dörfern, in denen des Nachts Laternen entzündet wurden, um den Holzfällern den Weg zu weisen, Frauen und Männern, die mit Schlitten voller Stämme Tag für Tag aus den Wäldern zurückkehrten.
Unablässig heulte der Nordwind über den Fjord. So stark war der Nordwind, so tückisch, dass kein Schiff und kein Boot ihn befahren konnte, ohne von den Böen erfasst und zu den scharfen Felsen der Küste getrieben zu werden, an denen der Bug vieler stolzer Segler zerschellt war.
So waren Greta und die Menschen im Hohen Norden abgeschnitten vom Festland auf der anderen Seite des Fjordes, wo die Stadt Esnedo lag, die ihr Holz brauchte und die sie mit Medizin und Öl und Journalen versorgte.
Außer im Winter. Im Winter blies der Nordwind so eisig von den Bergen, und es wurde so kalt, dass die Meerenge zufror. Dann wurde das Wasser zur Straße. Wenn die Tage und Nächte am kältesten waren, zogen die Schlitten von der Burg, auf der Greta lebte, mit dem Holz über das Meer Richtung Stadt. Und jeden Winter kamen die Schlitten von der Stadt zur Burg, mit Delikatessen wie getrockneten Tomaten und scharfen Oliven, Wein aus dem Süden und Bier aus der Stadt und schwerem Brokat und allem, wovon die Menschen in den langen Sommermonaten geträumt hatten.
Und jeden Mittwinter, am dunkelsten Tag des Jahres, versammelten sich die Menschen aus der Burg und aus den Dörfern auf dem zugefrorenen Meer, um der Schneekönigin zu huldigen.
Der Diakon, nicht ganz ein Pfarrer, aber doch ein Mann Gottes, hatte das verboten, strengstens, und er betete manchmal in der verfallenen Stabkirche mit zehn oder fünfzehn Schäfchen aus den Dörfern: Bewahre uns vor dem Bösen, bewahre uns vor dem Eis und dem Schnee, bewahre uns vor der Schneekönigin.
Auf der Spitze des Hohen Berges wohnte sie, so wollten es die alten Geschichten. In einem Palast aus Eis mit ihrem Prinzgemahl, der in der Gestalt eines Luchses um sie geworben hatte, ehe ihr Kuss ihn in den schönen Mann zurückverwandelt hatte, der er einst gewesen war.
Den Nordwind schickte sie ihnen, den Schnee und auch das Eis, welches die Meerenge gefrieren ließ und ihnen so erlaubte, zu essen und zu trinken, sich mit Lavendelseife zu waschen und ihre Kranken mit frischen Verbänden, Wundsalben und Fiebermedizin zu versorgen.
Deshalb hörten die Menschen im Norden nicht auf den Diakon und sangen des Nachts vor dem Einschlafen das Lied der Schneekönigin, ob auf der Burg oder in den Dörfern. Sie sangen vom Palast aus Eis auf der Spitze des Hohen Berges, von der großen Güte ihrer Königin und vom schönen Prinzgemahl an ihrer Seite.
Auch in jener Mittwinternacht sangen sie es.
In jener Mittwinternacht, die schon lange vergessen ist.
Viel zu lange.
Kapitel Eins
Der Luchs
In den westlichen Fjordlanden Norwegens, 1842
Die Sterne schienen hell am Himmel, und der Mond war aufgegangen, als ich zum ersten Mal glaubte, das Eis würde unter meinen Füßen erzittern.
Damals war es meine Aufgabe, die Mittwinterprozession über das zugefrorene Meer anzuführen, gemeinsam mit meiner lieben Schwester Ida, die mir der wichtigste Mensch war im Leben neben meinem Mann und meinem Sohn.
Es war Ida, die den ersten Ton anstimmte. Sie summte ihn mit ihrem schönen Sopran, das hohe C, das hell wie eine silberne Glocke über das Eis hallte. Dann stimmte ich mit ein. Auch ich summte ein C, mit meiner tiefen Altstimme, und dann begannen wir alle gemeinsam zu singen, wir Schwestern und die Männer und Frauen und Kinder aus den drei umliegenden Dörfern, hier im Hohen Norden, am schroffesten Hang des Fjordes.
Damals war ich die Burgherrin, und es war seit jeher die Aufgabe der Herrin oder des Herrn der Burg, die Schlitten und die Winterstraße instand zu halten, um von der Burg hinüber zur Stadt Esnedo auf der anderen Seite der Meerenge zu gelangen. Außerdem war es meine Aufgabe, Botschaften in die Stadt zu schicken, geschrieben auf dickem Pergament, mit festen Kordeln eng an die Beine weißer Raben gebunden, die meine Familie schon seit vielen Generationen auf der Burg züchtete und denen die verräterischen Winde nichts anhaben konnten.
Wir liebten den Norden, trotz seiner Einsamkeit. Wenn die Meerenge zugefroren war, empfingen wir hin und wieder Händler aus Tromsø, und sogar sie fanden, dass wir hier einsam seien. Auf der anderen Seite des Fjordes in Esnedo hielten manche uns für sonderbar, wie uns zu Ohren gekommen war.
Wir aber kannten das Eis und den Schnee. Wir wussten, wie man mit ihnen zu leben hatte, wir liebten die dunklen Tannenwälder, den hohen Berg und die Geschichten, die man sich abends erzählte, wenn man ums Feuer in der Stube saß: von Waldgeistern und Eschenfrauen, von Hexen mit langen Brüsten, die sie sich über die Schultern warfen, von der Schneekönigin, ja, vor allen Dingen von der Schneekönigin. Ihretwegen hatten wir uns versammelt und das Lied angestimmt. Eingehüllt in dicke Wollmäntel und warme Stiefel, gefüttert mit dem Fell von Rentieren, zogen wir alle gemeinsam über das zu Eis erstarrte Meer. Auch die Fischer und Holzfäller und ihre Kinder waren Teil der Mittwinterprozession. Sie hatten Tücher um die Brust geschlungen, rot wie heißer Würzwein und grün wie die Nadeln der Bäume.
Nur Ida und ich trugen Blau. Ida das tiefdunkle Blau des nächtlichen Himmels, bestickt mit goldenen Sternen. Und ich, einzig ich trug damals den Mantel in den Farben der Schneekönigin, das helle Eisblau, durchwoben mit silbernem Garn in Form von Schneeflocken. Über die ganze Meerenge hinweg glitzerte der Mantel im Licht der Laternen aus blauem Glas, welche die Kinder der Holzfäller in den Händen hielten. Manche saßen auf großen Schlitten, welche die Erwachsenen zogen, neben Fässern voll mit warmem Wein.
Ich wusste, dass der Mantel glitzerte, weil ich ihn so oft bestaunt hatte, wenn meine Mutter ihn getragen hatte. Und nun, da er mich wärmte, während wir singend über die zugefrorene Meerenge zogen, sah mein Sohn mich an, mit ebenso glänzenden Augen.
Dass sie Unik niemals kennengelernt hatte, machte mich noch immer traurig. Unik, meinen einzigen Sohn, den ich so sehr liebte, dass es mich manchmal in panische Angst versetzte.
An jenem Abend hatte Unik nicht in dem Tuch bleiben wollen, in dem ich ihn so oft trug, fest um meine Brust gebunden, so wie auch meine Eltern und Großeltern, sogar Agnes und Frieda, mich und Ida getragen hatten.
Normalerweise liebte Unik das Tuch, obwohl er schon eine Weile laufen konnte und seinen Eltern der Rücken schmerzte. Aber an jenem Abend hatte er seine eigenen Schritte tun wollen, und nun watschelte er vor mir über das Eis, die Laterne in den kleinen Händen mit den weichen Nägeln. Unik, der mein Herz manches Mal zum Stillstand brachte vor Freude und Staunen ob des Wissens, dass Kay und ich ein so schönes, verletzliches Menschenwesen hatten hervorbringen können. Ich musste ihn angelächelt haben wie ein liebestrunkener Narr, als er über das Eis schlitterte. Aber ich bildete mir ein, dass alle, die ihn sahen, ihn so anlächelten, sogar die Nacht und das Eis und die Sterne und der Mond.
Schon immer hatte ich es geliebt, den Zug anzuführen und das Lied der Schneekönigin in der Mittwinternacht zu singen. Noch mehr liebte ich es, seit ich meinen Sohn mitnehmen konnte, der nach mir Herr auf der Burg werden und die Winterstraße instand halten würde.
So dachte ich damals.
Wenn es nur in jener Nacht nicht geschehen wäre.
Wenn ich nur in jener Nacht nicht das Zittern im Eis gespürt hätte.
Mein Leben lang hatte ich im Winter auf dem zugefrorenen Fjord gespielt, ihn mit meiner Mutter und Schwester, mit Agnes und Frieda erkundet, ihn auf Schlitten überfahren. Und mit den Stiefeln aus dem weichen Leder junger Lämmer hatte ich das Eis getestet, um herauszufinden, ob es schon stark genug war, das Gewicht der Schlitten zu tragen.
Deshalb war es auch für mich selbstverständlich gewesen, meinen eigenen Sohn mit hinaus aufs Eis zu nehmen, sobald er alt genug gewesen war, um zu laufen. Gut eingepackt in warme Wolle und kleine gefütterte Schuhe, die die Schusterin aus Tromsø geschickt hatte im ersten Winter seines Lebens. Er war am Mittwintertag geboren, mein Sohn.
Es war die Nacht seines zweiten Geburtstags. In dieser Nacht geschah es, dass das Eis unter meinen Füßen erzitterte. Ganz so, als sei es noch zaghaft und dünn, kaum mehr als eine trügerische eisige Haut im Herbst, wenn jede Sturmböe des Nordwinds es noch zerschlug.
Der Schock war so groß, dass ich es nicht glauben konnte, nicht einmal innehielt, mir bloß sagte, ich müsse mich täuschen. Mechanisch sang ich weiter, denn das Lied der Schneekönigin durfte nicht unterbrochen werden. Es ist tiefster Winter, sagte ich mir, wie eine Närrin, die sich nicht vertraute, immer noch nicht, obwohl ich schon eine erwachsene Frau war und es hätte besser wissen müssen: Der inneren Stimme zu misstrauen, ist stets ein riskantes Geschäft.
Aber es war undenkbar, und deshalb sagte ich es mir: Es ist tiefster Winter, und das Eis ist dick wie nie im Jahr. Ich muss mich täuschen.
Trotz meiner beruhigenden Gedanken lief ich schneller, um meinen Sohn bei der Hand zu nehmen. Ich fühlte mich, als lauerten spitze Felsen unter der Wasseroberfläche, die nur darauf warteten, hindurchzustoßen. Vor meinem inneren Auge konnte ich sie sehen.
Einen Moment bevor ich ihn erreicht hatte, stieß Unik einen aufgeregten Ruf aus. Mit seinem dicken Fäustchen, noch immer unbeholfen, deutete er auf das Eis, das vor uns lag.
Im Licht seiner Laterne, im Licht der Sterne und des Mondes sah ich den Luchs.
Auf einmal stand er da auf dem Eis. Aus dem Nichts schien er aufgetaucht zu sein. Bleich wie ein Geist war er, sein Fell hell in der Nacht und die Augen dunkel wie ein Himmel ohne Sterne.
Unik stieß noch einen Ruf aus und lief auf das Tier zu.
Wieder erzitterte das Eis.
Dieses Mal machte ich mir nichts vor, sondern einen Satz nach vorn. Ich versuchte, Unik zu fassen, aber sein hellblaues Tuch glitt mir durch die Finger.
Die Prozession geriet in Aufregung. Unik lief auf den Luchs zu.
Das Tier machte ein paar Schritte zurück.
Unik lief schneller. Er streckte beide Arme aus.
Da hörte ich auf zu singen.
Ich musste es tun, um seinen Namen zu rufen.
»Unik!«
Aber Unik, mein lieber, kleiner Sohn, hatte ein Tier gesehen, das er mochte, und lief einfach weiter.
Ich rief noch einmal, so laut, dass ich sogar das Lied der Schneekönigin übertönte. »Unik! Bleib stehen!«
Ich liebte die Schneekönigin, aber nicht so sehr wie meinen Sohn.
Unik hielt inne. Er drehte sich zu mir um.
Noch immer erinnere ich mich an sein Gesichtchen, das auf einmal besorgt war, ängstlich, furchtsam. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie er die Arme nach mir ausstreckte, die kleinen, speckigen Arme.
Wie weich sie gewesen waren.
Erleichtert eilte ich auf ihn zu.
Da stieß der Luchs einen Ruf aus. Ein lang gezogenes, geisterhaftes Heulen, wie ein Wolf in der Nacht.
Und dann hörten wir es.
Wir hörten es alle.
Ein tiefes Grollen. Ein unheilvolles Knacken.
Einen Moment lang, der mir wie eine Ewigkeit erschien, glaubte ich, der Luchs sehe mir direkt in die Augen.
Dann brach das Eis.
Unik schrie. Ida, die noch immer neben mir lief, stieß einen Warnruf aus. Sie war stets die Schnellere von uns beiden gewesen und ich die Gründlichere.
Die Prozession stob auseinander. Laternen klirrten, Stiefel hämmerten über das Eis, Kinder begannen zu weinen. Das Lied der Schneekönigin verstummte.
Damals kümmerte es mich nicht, nicht in jenem Moment. Ich rief nur Uniks Namen, wollte auf ihn zustürmen, aber der Spalt im Eis hatte sich genau zwischen uns aufgetan, maß schon zwei Meter.
Trotzdem kam Unik auf mich zugewatschelt, direkt auf den Spalt zu. Er kannte das Eis nur fest unter seinen Füßen, hatte den Riss im Eis nicht bemerkt, und er wollte zu seiner Mutter. Ich sah, dass er kurz davor war zu weinen, sein kleiner, zitternder Mund schon geformt zu einem breiten O, die Augen schmal, das Gesicht zerknittert wie Papier, das jemand zusammengeknüllt hatte.
Hinter ihm stand nach wie vor der Luchs und starrte mich an. Auch daran erinnere ich mich noch, als wäre es erst gestern gewesen. An diesen Luchs und alles, was er tun würde.
Ich raffte meinen Umhang. Meine Schwester packte mich an der Schulter, aber ich schüttelte ihre Hand ab und rannte mit Anlauf auf den Spalt zu.
Meine Stiefel donnerten über das Eis. Unter jedem meiner Schritte schien es zu erbeben. Ich konnte es spüren, von der Sohle bis in die Haarspitzen, wie es bebte unter dem Gewicht all der Menschen, ihrer Laternen und ihrer Schreie.
Auch unter dem Gewicht meines Sohnes, der mir ansonsten so federleicht vorkam, so leicht, dass doch kein Eis unter ihm brechen konnte, sicherlich nicht einmal das zarteste Eis im Herbst!
»Greta! Es ist zu weit!«, rief Ida hinter mir mit ihrer glockenhellen Stimme, um die ich sie als Kind so beneidet hatte.
Dieses Mal achtete ich nicht einmal auf sie. Ich maß nur den Spalt mit den Augen. Ich wusste nicht, ob ich es schaffen konnte, aber ich musste es versuchen.
Also rannte ich, bis ich die Kante der Eisdecke unter den Fußballen spürte. Dann stieß ich mich vom Boden ab. Ich schraubte mich hoch in die Luft, die Beine angezogen, das Ziel vor Augen. Unik starrte mich mit großen Augen an.
Mit einem Krachen setzte ich auf der anderen Seite auf. Der Schock des Aufpralls schoss durch meinen ganzen Körper, die Wirbelsäule hinauf, und presste die Luft aus meiner Lunge. Ich schmeckte Blut, wusste aber nicht, woher es kam. Sobald ich wieder atmen konnte, hievte ich mich stöhnend auf alle viere, sah auf, vergaß das Blut, schaute nur nach meinem Sohn.
Unik stand vor mir. Noch immer hatte er den Mund weit geöffnet vor Schrecken, noch immer das Gesicht verzerrt, aber er gab keinen Laut von sich, streckte nur die Arme nach mir aus.
Ich zog ihn an mich, drückte ihn fest an meine Brust, so fest, dass es ihm wehtun musste. »Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte ich, während mein eigenes Herz hämmerte. »Alles wird gut.«
Unik nickte. Ich stand auf und hob ihn hoch. Meine Beine und Arme zitterten, das weiß ich noch genau. Ich schaute mich um, suchte nach meiner Schwester, der Prozession, dem Spalt im Eis.
Stattdessen erspähte ich den Luchs mit seinem hellen Fell, blass wie ein Geist.
Er war uns so nah gekommen, mir und Unik, dass ich ihn mit ausgestreckter Hand hätte berühren können. Ich drückte meinen Sohn nur noch enger an die Brust. »Fort mit dir!«, zischte ich das Tier an und versuchte, meine Stimme fest klingen zu lassen.
Der Luchs blieb still. Er starrte mich nur aus seinen nachtdunklen Augen an.
Ich blinzelte. Da, hinter ihm.
Stand da nicht eine Gestalt in der Dunkelheit?
War das nicht der Umriss einer Frau, die näher kam?
Das war es, was ich sah, in jener Nacht. Oder zu sehen glaubte. Den Umriss einer Frau, die auf mich zukam.
»Greta!«
Ich wirbelte herum. Auf der anderen Seite des Spalts hatten sich Ida und einige der Holzfällerinnen und Holzfäller versammelt. Ida gab Anweisungen, immer die Schnelle, die Impulsive, die Festentschlossene, dann rief sie mir zu: »Wir bauen euch eine Brücke!«
Noch bevor sie ausgesprochen hatte, ließ Agnes behutsam den ersten Schlitten ins Wasser. Ich sehe sie noch immer vor mir, die Holzfällerin mit dem weißen Haar, der faltigen Haut und dem scharfen Blick, die geholfen hatte, uns aufzuziehen, sie und ihre Frau Frieda, die erst im vorletzten Winter von uns gegangen war und die wir mit ihrer liebsten Fischerrute und ihrem besten Kleid begraben hatten.
»Vertäu den Schlitten gut, Agnes!«, rief ich ihr zu, als wüsste sie, die alte Holzfällerin, es nicht viel besser als ich.
Agnes schnaubte.
»Wenn du’s nicht gesagt hättest, Schwesterchen«, rief Ida, »dann hätten wir nicht dran gedacht!«
Ich glaube, dass ich mühsam lächelte und Uniks Stirn küsste. Sicher weiß ich es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich noch immer spürte, wie das Eis unter meinen Füßen zitterte.
Fünf Schlitten brauchte es, dann war der stetig wachsende Spalt überbrückt. Ich band mir Unik mit dem Tuch auf den Rücken und kroch auf allen vieren hinüber.
Kaum stand ich auf der anderen Seite, zog Ida mich in ihre Arme. Niemand konnte einen Menschen so fest drücken wie meine Schwester.
»Du Wahnsinnige!«, rief sie. »Ich hab dich schon im Eiswasser schwimmen sehen.«
Einen Moment lang presste ich mein Gesicht an die warme Wange meiner Schwester. »Ich mich auch«, flüsterte ich.
Dann löste ich mich aus der Umarmung und fragte: »Geht es allen anderen gut?«
Ida nickte. »Es ist ein Wunder, dass niemand ertrunken ist. Wir mussten Gerd rausziehen, aber er hat’s geschafft.«
Die Erleichterung war überwältigend, wirklich und wahrhaftig. Am liebsten hätte ich mich einfach auf das Eis gesetzt, genau dorthin, wo ich stand.
Aber ich war die Burgherrin. Ich war die Gründliche, diejenige, die einen Plan hatte und die Verantwortung trug.
Ganz besonders für dieses Eis. Für die Winterstraße nach Esnedo.
»Gut. Lasst uns die Brücke abbauen und schnellstmöglich zur Burg zurückkehren. Was ist mit dem Luchs und der Frau?«
Ida zog die Brauen zusammen. »Welchem Luchs?«
Ich sah erst sie, dann Agnes an. »Habt ihr sie denn nicht gesehen?«
Langsam schüttelte die alte Holzfällerin den Kopf. »Keine Frau«, sagte sie. »Keinen Luchs. Nur einen schwarzen Abgrund im Eis.«
Ich erinnere mich noch ganz genau an ihre Worte, weil sie mir einen kalten Schauer über den Rücken jagten.
Vorsichtig drehte ich mich um, meinen Sohn auf dem Rücken, und spähte über den Spalt hinaus.
Da war niemand.
Kein Luchs.
Keine Frau.
»Es ist das erste Mal«, sagte Agnes unvermittelt.
»Das erste Mal für was?«, fragte ich, die ich noch immer in die Nacht starrte, noch immer an den blassen Luchs dachte und den Umriss, den ich geglaubt hatte zu sehen.
»Das erste Mal, seit ich denken kann, dass das Lied der Schneekönigin verstummt ist, bevor die Prozession den Fuß des Berges erreicht hat.«
Mit einem Mal spürte ich ihre Hand in meiner. Es war eine steife Hand, die Haut alt, die Gelenke geschwollen. Agnes’ Finger bebten.
Wie das Eis unter unseren Füßen.
»Kommt«, sagte ich. »Zurück zur Burg.«
Und noch während wir über das Eis stapften, ebenso hastig wie vorsichtig, Unik auf meinem Rücken, glaubte ich ihn zu hören.
Den lang gezogenen Ruf eines Luchses.
Kapitel Zwei
Die Burg der Weißen Raben
»Du hättest ihn nicht mitnehmen dürfen.«
So sanft seine Hände waren, so fest klang seine Stimme, nachdem wir an diesem Abend auf die Burg zurückgekehrt waren. Mein Mann war Arzt, wenn auch eigentlich Geburtshelfer, und ich saß auf dem Rand unseres Ehebettes, während er mich abtastete, um nach verborgenen Verletzungen zu forschen.
»Das Eis ist noch nie zum Mittwinter gebrochen, Kay«, sagte ich. »Noch nie.«
Kay schüttelte den Kopf. Er kniete vor mir, betastete vorsichtig meine Knie und Schienbeine, meine Fußgelenke und die Sohlen. Sein Haar leuchtete bronzen im Licht der Flammen, die in der Feuerstelle vor dem Bett brannten. Um den Hals trug er eine Kette mit einem Anhänger in der Form eines Kreuzes. Es glitzerte silbern im Licht des Feuers, silbern wie die grauen Strähnen an seinen Schläfen.
»Es ist ein alberner Ritus, diese Mittwinterprozession«, stieß er hervor.
Ich streckte eine Hand aus und streichelte seine Schläfen, die grauen Strähnen, die Sorgenfalten auf seiner Stirn. Er mochte die silbernen Haare nicht, hatte sie mit einer Pinzette herausgepickt, als er sie zum ersten Mal entdeckt hatte.
Ich fand sie anziehend wie wenig sonst. »Agnes sagt, das Lied der Schneekönigin sei noch niemals nicht zu Ende gesungen worden«, erwiderte ich.
Kay schüttelte unwillig den Kopf. »Sie ist eine abergläubische alte Frau.«
»Sie lebt länger als wir beide zusammen«, mahnte ich und zog die Hand zurück. »Sie war schon Vertreterin der Holzfäller, als ich geboren wurde.«
Er fing meine Hand ab, nahm sie in seine beiden. Dann küsste er zärtlich meine Handinnenfläche. »Du hättest sterben können«, flüsterte er.
So hat er mich lange nicht mehr geküsst, dachte ich. Nicht seit Uniks Geburt zwei Jahre zuvor, die so schwierig gewesen war, dass sie mich beinahe das Leben gekostet hätte. Gemeinsam hatten wir daraufhin entschieden, dass wir keine weiteren Kinder haben würden, dass wir nur miteinander schlafen würden, wenn mein Zyklus es mir unmöglich machen würde, schwanger zu werden.
Unseren Sohn hatten wir Unik genannt. Das Wort bedeutete Einziger, Einzige, denn wir wussten, er würde unser einziges Kind bleiben. Wir liebten ihn sehr, vielleicht zu sehr. Es hatte mich oft traurig gemacht, dass er nie ein Geschwisterchen haben würde, keine Vertraute, die ihn seit frühesten Kindheitstagen kannte und er sie, die ihn sein Leben lang begleiten würde.
Und immer wieder machte es mich traurig, manchmal, wenn ich nachts wachlag.
Aber nicht an jenem Abend. An jenem Abend ließ ich mich zurück aufs Bett sinken, während Kay meine Finger küsste, einen nach dem anderen. Dann meinen Handrücken, danach das Handgelenk, schließlich meinen ganzen Arm hinauf bis zur Schulter, zu meinem Hals, der Wange, dem Ohr.
Ich spürte seinen Atem an meinem Ohrläppchen, während er sprach: »Ihr hättet beide sterben können.«
Ich verbarg das Gesicht in den Händen. Vor meinem inneren Auge tat sich noch einmal der Spalt auf, der mich von Unik getrennt hatte.
»Erinnere mich nicht daran«, flehte ich.
Er nahm meine Hände, küsste erneut ihre Innenflächen, dann meinen Mund. Seine Lippen fühlten sich warm an, so wunderbar warm, wie sich nur die Lippen eines Mannes anfühlen konnten, der den ganzen Abend vor einem Feuer mit einem Becher Würzwein auf seine Frau und seinen Sohn gewartet hatte, statt hinaus aufs Eis zu stapfen und beinahe im tödlich kalten Fjord zu ertrinken.
Ich vergrub eine Hand in Kays Haar und hielt ihn fest. »Ich mache mir Sorgen ums Eis«, flüsterte ich, denn ich traute mich nicht, die Worte laut auszusprechen. Eine abergläubische Angst hatte mich befallen: als würde das Unglück erst dadurch besiegelt, dass ich es benannte. »Um die Winterstraße.«
Er stützte sich auf den Ellbogen ab, streichelte meine Stirn. Ach, wenn ich nur an seine Berührungen damals denke, seine warme Hand, die weichen Lippen, die silbernen Strähnen an seiner Schläfe …
»Kann der Spalt überbrückt werden?«, fragte er.
»Wenn er sich nicht noch weiter verbreitert«, antwortete ich, aber ich wusste viel über das Eis, vielleicht mehr als jede andere, abgesehen von Ida, die mir gleichkommen mochte. Und ich glaubte nicht, dass der Spalt schrumpfen würde. »Wir haben die meisten Lieferungen vom Festland schon erhalten.«
Im Gegenzug für Holz und Holzkohle, geköhlert von den Menschen im Norden, sandten die Menschen aus der Stadt uns nicht nur Nahrung und Medikamente, sondern auch Bücher, Zeitungen, Kerzen und Öl. Die Burg wies eine stattliche Bibliothek auf, die jedem Bewohner des Nordens zugänglich war, und Ida kümmerte sich gut darum, sie auf dem neuesten Stand zu halten. Mir zuliebe sorgte sie dafür, dass immer neue Märchensammlungen ihren Weg zu uns fanden. Erst vor zwei Jahren war es ihr endlich gelungen, eine Übersetzung der vierten Auflage einer Märchensammlung zweier gelehrter deutscher Männer zu ergattern, die Grimm hießen. Gedacht war die Sammlung für Kinder, und auch ich betonte, wie schön es für die Kinder des Nordens wäre, diese Geschichten zu lesen.
Ich vermied es zu sagen, dass ich nachts manchmal mit einer Öllampe in die Bibliothek schlich, um mich im Dunkeln vor den Geschichten zu gruseln, die ich dort im alten Lesesessel unseres Vaters las, eingewickelt in eine dicke Wolldecke, die Pantoffeln zur Seite getreten und die Knie an die Brust gezogen.
Vor der Hexe in ihrem Knusperhäuschen fürchtete ich mich besonders. Auch die Geschichten des Nordens waren voll von ihnen, aber unsere Hexen waren freundlicher. Oft warteten sie in Bäumen oder auf großen Wurzeln auf die junge Frau oder den jungen Mann, der ausgezogen war, um ein Abenteuer zu leben oder einen geliebten Menschen zu retten, und wiesen ihnen den Weg. Sie versuchten nur selten, Kinder zu essen, Kinder, so klein und speckig wie Unik.
Auch dieses Jahr waren wieder einige Bücher dabei gewesen in der Lieferung, die uns vom Festland erreicht hatte. Mehrere Säcke Korn und Kartoffeln hatten sie noch bringen wollen sowie einige Flaschen Wein, um die es mir sehr leidtat, aber wir waren gut versorgt.
»Alles, was wir für dieses Jahr brauchen, hat uns schon erreicht. Aber was ist nächstes Jahr? Und das Jahr danach?«, mahnte Kay. Sein Gesicht verdüsterte sich. Dann sah er mich wieder an. »Greta, wir müssen endlich umsiedeln. Wir haben lange genug gewartet.«
Ich blickte zur Seite, zum prasselnden Feuer im Kamin. Unter mir spürte ich das warme, weiche Himmelbett, das so gut war zu meinen schmerzenden Schultern. Die samtblauen Vorhänge des Bettes streiften meine Knie. Hell waren sie wie ewiges Eis, die Teppiche auf den Holzböden dunkel wie die sternenklare Nacht. Auf dem Kaminsims und den Fensterbänken standen goldene Kerzenständer mit hohen Kerzen darin, strahlend grün wie die Nordlichter, die im Winter über den Wäldern am Himmel weit im Norden tanzten.
Vom Kamin aus schaute meine Mutter zu mir herab, ihr Antlitz verewigt auf einem Ölgemälde – das einzige Bildnis, das ich von ihr hatte. Darauf trug sie eine Mütze aus Kaninchenfell mit breiten Ohrschützern und lächelte dem Betrachter verschmitzt zu, einen schlanken Weißen Raben auf ihren Schultern, an dessen Bein eine Pergamentrolle gebunden war.
Ihr Bildnis war das jüngste in einer langen Reihe von Gemälden, die in meinem Schlafzimmer hingen: die Herrinnen und Herren der Burg, Züchter der Raben, die Botschaften in die Stadt schickten, welche dafür sorgten, dass die Menschen in den umliegenden Dörfern zu essen und zu trinken hatten.
All die Holzfällerinnen und Holzfäller, die Rentierzüchter, die Schäferinnen, die Köhlerinnen und Fischer, die im Hohen Norden lebten, jenseits des Meeres, jenseits der Stadt. Am Fuß des Hohen Berges, auf dessen Gipfel die Schneekönigin lebte.
Viele von uns gab es nicht mehr. Und wir waren die letzten Menschen, die jeden Mittwinter das Lied der Schneekönigin sangen. Die Letzten, die ihr Fasane, Rehe und Kaninchen darbrachten, die wir am Ende der Mittwinterprozession an den Fuß des Berges legten, bevor wir nach Hause gingen, unsere Lieben in den Arm nahmen und der Schneekönigin dankten für das Eis und den Schnee, den wir so gut kannten.
Auch die Fässer voll Würzwein ließen wir dort zurück, oder jedenfalls das, was am Ende des Abends noch übrig war. Das war mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie durstig Hager war, der in seiner Hütte auf der anderen Seite des Wäldchens Schnaps brannte, welcher sogar in Esnedo nachgefragt wurde, den er aber nie abgab, nur an uns, versetzt mit den Beeren, die er im Sommer und Herbst im Wald sammelte.
Da er seinen Schnaps gewohnt war, konnte er auch viel Wein trinken, unser Hager. Und die Schneekönigin schien es uns nicht übel zu nehmen.
Niemand sah je, wohin das Fleisch und der Wein verschwanden. Aber am nächsten Mittag, wenn die Sonne nicht mal eine Stunde schien, war stets alles fort.
Meine Großmutter hatte mir erzählt, der Wein und die Tiere würden des Nachts von Luchsen in ihren warmen Mäulern den Hang hinaufgetragen, bis zum Palast der Schneekönigin. Meine Mutter hatte hingegen behauptet, die Schneekönigin selbst käme herab auf ihrem Schlitten aus Eis, um die Geschenke zu holen. Sie würden sie dann mit den drei Nornen teilen, die auf dem Berg lebten.
Sie spinnen und schneiden den Faden, der das Schicksal von uns Sterblichen ist, hatte sie mir erklärt. Meine Mutter hatte stets gelächelt, wenn sie von der Schneekönigin und den Nornen und Waldgeistern gesprochen hatte, auf ihre verschmitzte Art, wie auf dem Gemälde, das ich an jenem Abend betrachtete.
Nicht zum ersten Mal wünschte ich mir, meine Mutter wäre noch bei uns. Seit Uniks Geburt wollte ich sie bei hundert Dingen am Tag um Rat fragen, und an diesem Abend, an dem das Eis das erste Mal zum Mittwinter gebrochen war, hätte ich ihn besonders dringend gebraucht.
»Jemand muss die Winterstraße instand halten und die Weißen Raben züchten«, wehrte ich ab, während ich das Porträt meiner Mutter betrachtete. »Wer würde das tun, wenn wir nach Esnedo ziehen?«
Kay machte ein unwilliges Geräusch, dann rollte er sich zur Seite, von mir fort. Beinahe wäre ich ihm gefolgt. Ich wollte nicht, dass das Knistern zwischen uns verpuffte, das selten genug geworden war seit Uniks Geburt.
»Soll unser Sohn nichts anderes werden können als Bauarbeiter und Tierzüchter?«, fragte Kay.
Damit nahm er mir den Wunsch, ihm zu folgen.
Ich setzte mich auf. »Burgherr kann er hier werden, Kay«, erinnerte ich ihn scharf. »Tausend Mal haben wir schon darüber gesprochen.«
»Dann lass es tausendundein Mal sein«, beharrte Kay, der sich ebenfalls aufsetzte, seine Miene verdüstert von Sorge und Wut. »In der Stadt kann er werden, was er möchte. Er kann sogar zur Universität gehen.«
Schon wieder fing er damit an. Und nannte mich starrköpfig! Es machte mich rasend, und er wusste das. »Um Arzt zu werden, so wie sein Vater?«
»Warum nicht?«, entgegnete er hitzig. »Seine Mutter hat schließlich einen Arzt geheiratet!«
»Und sein Vater eine Bauarbeiterin und Tierzüchterin!«
Er sah mich an. So etwas wie Reue huschte über sein Gesicht.
»Burgherrin«, korrigierte er mich und streckte die Hand aus, aber ich war nicht in der Stimmung, mich besänftigen zu lassen. Ich war wütend, und ich fühlte noch immer das Eis unter meinen Stiefeln erzittern.
»Du wusstest, dass ich den Norden nicht verlassen will«, sagte ich. »Von Anfang an wusstest du es. Immer hast du so getan, als würde es dir nichts ausmachen.«
»Es hat mir auch nichts ausgemacht«, beharrte Kay.
»Bis Unik geboren wurde«, sagte ich und konnte die Bitterkeit nicht aus meiner Stimme verbannen. »Bis du einen Sohn hattest und dir auf einmal nichts sehnlicher wünschtest, als dass er in deine Fußstapfen tritt.«
»Das ist doch Unsinn!«, sagte Kay und stand auf.
»Was ist es dann? Warum hast du deine Meinung nach der Geburt auf einmal geändert?«
»Weil du fast gestorben wärst!«
Kay wirbelte herum. Mit blitzenden Augen sah er mich an.
»Du wärst fast gestorben in der Mittwinternacht, als du Unik zur Welt brachtest. Du wärst gestorben, wenn wir dich nicht auf den Schlitten geladen und in die Stadt ins Krankenhaus geschafft hätten, Ida und ich. Da war kein Rabe, der dich gerettet hätte, kein Luchs, keine Schneekönigin, Greta. Zwei Jahre ist das schon her, und immer noch erzählst du mir, du musst Burgherrin bleiben. Wieso? Was hält dich hier?«
Wieder kam er auf mich zu. »Warum willst du nicht mit ihm und mir in der Stadt leben, Greta, wo wir sicher wären? Warum musst du die Herrin der Burg der Weißen Raben sein?«
Ich schwieg, denn ich fürchtete mich davor, was ich sagen würde, mit all der Wut, die in mir kochte, und all der Angst, die noch immer an meinem Innersten rüttelte.
Am meisten Angst machte mir, dass ich nicht zum ersten Mal dachte: Er hat recht. Vielleicht war die Stadt ein besserer Ort für unseren Sohn als die Burg, wo meine Schwester und ich aufgewachsen waren. Wo ich die Herrin war, eine Aufgabe hatte, wo ein Porträt von mir gemalt und Geschichten über mich erzählt werden würden, bis niemand mehr hier im Norden am Fuße des Hohen Berges wohnte, auf dessen Gipfel die Schneekönigin lebte.
Also antwortete ich nicht. Kay schloss kurz die Augen, atmete tief ein, wieder aus.
Dann setzte er sich aufs Bett und nahm meine Hand. »Ich hätte nicht Bauarbeiter und Tierzüchter sagen sollen«, meinte er sanft. »Entschuldige bitte.«
Ich schüttelte müde den Kopf. »Das sind doch gute Berufe. Ich hätte nicht sagen sollen, dass du nicht an unser aller Bestes denkst.«
Er zuckte mit den Schultern und bemühte sich um ein Lächeln. Für einen Moment ließ es ihn wieder jung aussehen, so jung, wie er gewesen war, als wir uns kennengelernt hatten: beide gerade zwanzig, er noch als Student an der Universität in der Stadt, ich noch in der Lehre bei meiner Mutter, der Burgherrin.
Wir hatten uns auf dem zugefrorenen Meeresarm kennengelernt, in einer Mittwinternacht, bei einer Prozession für die Schneekönigin. Meine Mutter hatte die Prozession angeführt, und ich war auf dem Schlitten mitgefahren, um Glühwein zu trinken, noch in Trauer über den letzten jungen Mann, mit dem sich etwas angebahnt hatte, einem Bergmann aus der Stadt, der mich dann hatte fallen lassen, weil er meine Schwester schöner fand und den Norden nicht mochte.
Er war mein Mann fürs Leben gewesen, hatte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, Trübsal geblasen und mir schreckliche Vorwürfe gemacht, dass ich nicht mit ihm in die Stadt hatte gehen wollen, während ich auf dem Schlitten gesessen und meinen Glühwein getrunken hatte, den Hager mit einem guten Schuss Schnaps angereichert hatte, nur für mich.
Bis sich dieser neue junge Mann mit der ledernen Arzttasche und dem roten Haar unter der dicken Fellmütze neben mich auf den Schlitten geschwungen hatte.
»Darf ich auch einen?«, hatte er gefragt, seine Stimme so sanft wie an diesem Abend, an dem das Eis zum ersten Mal gebrochen war. Ebenso sanft sprach er noch immer mit mir, so zärtlich, so liebevoll, zehn Jahre später, in dem Schlafzimmer meiner Mutter, das nun das meine war.
Ich war damals auf dem Schlitten nur überrascht gewesen, dass er mich angesprochen hatte und nicht Ida. Ida war blond und schmal und hatte große blaue Augen und einen schönen Busen, und das schienen viele Männer sehr zu mögen. Ich hingegen hatte breite Schultern und spitze Ellbogen, und mein Busen war kleiner als ihrer.
»Greta«, sagte Kay nun, während wir gemeinsam auf dem Himmelbett in der Burg saßen. »Lass uns endlich nach Esnedo ziehen. Es ist doch gar nicht weit. Du könntest sogar immer noch hierherkommen, die Winterstraße instand halten, zumindest im Winter.«
Ich schloss die Augen. Ich wollte meine Mutter nicht sehen und auch meinen Mann nicht. Meinen Sohn nicht, auch nicht meine Schwester oder die Menschen aus den umliegenden Dörfern, die sich alle darauf verließen, dass ich das Richtige tat, dass ich für sie sorgte, dass ich sie an erste Stelle setzte.
»Wir müssen zuerst einen Raben in die Stadt und in die Dörfer schicken«, sagte ich, als ich die Augen wieder öffnete. »Wir müssen fragen, wer gehen will, wenn das Eis sich weiterhin so benimmt, und ob man in Esnedo bereit ist, uns alle aufzunehmen. Vielleicht müssen wir auch weiterziehen, bis nach Tromsø oder sogar Oslo.«
Und da strahlte mein Mann mich an. Mit einem Mal. Er sah so glücklich aus, ich wollte ihn in meine Arme ziehen, sein ganzes Gesicht küssen, die Wangen, die Stirn, die Ohren, den Hals.
»Das werden wir tun«, antwortete er. »Sofort. Ich hole dir Ida.«
Ich rutschte näher zu ihm und streckte die Hand nach seiner Wange aus.
»Und Agnes«, bat ich ihn. »Das Opfer muss gebracht, das Lied der Schneekönigin zu Ende gesungen werden. Wir könnten frühestens in einem Jahr aufs Festland, wenn das Eis wieder dick genug ist. Das kann nur der Königin gelingen.«
Seine Miene verdüsterte sich so schlagartig, wie sie sich aufgehellt hatte. Er stand auf, bevor ich ihn berühren konnte. »Immer findest du einen Weg, Greta«, sagte er und klang erschöpft. »Immer findest du einen Weg, dich aus allem herauszuwinden.«
»Es ist gerade nicht sicher auf dem Eis, Kay! Wir können nicht in die Stadt, selbst wenn wir wollten.«
Er drehte sich um, krempelte die Ärmel herunter, verschloss sie mit Manschettenknöpfen. Ich sah ihn an, seine breiten Schultern, den schmalen Rücken, die schönen, schlanken Oberschenkel.
»Hörst du das?«, fragte ich, in dem Versuch, geduldig zu sein.
Er hielt inne und lauschte. Dann warf er wortlos seine Anzugjacke über und ging hinaus.
Ich sprach kein weiteres Wort. Stattdessen stand ich auf, warf mir ein Rentierfell über, das auf dem Bett lag, und trat zum Fenster.
Denn da war etwas, da draußen.
Ein Donnern.
Wie das Grollen einer wütenden Gottheit auf der Spitze des Berges.
Unwillkürlich schreckte ich zurück, als ich mit den nackten Fingern den Fensterriegel berührte, so kalt war das Holz. Dann packte ich fest zu, entriegelte das Fenster und stieß es auf.
Der Wind, der hineinfuhr, war eisig. Er zog an dem Fell um meine Schultern, an meinem schneeweißen Nachthemd, das einmal meiner Großmutter gehört hatte. Eiskristalle breiteten sich über die Scheibe aus, während ich hinausblickte, während ich lauschte.
Draußen herrschte tiefste Dunkelheit. Hinter mir erzitterten die Flammen im Kamin, als streckten die Eiskristalle die Finger nach ihnen aus, als würden der Wind und die Kälte sie erdrosseln.
Nichts als Stille und Dunkelheit.
Oder?