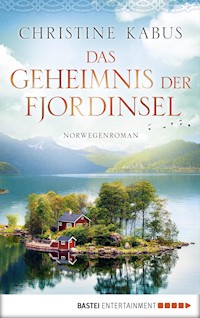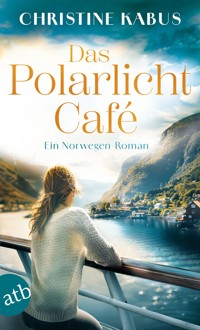
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Familiengeheimnis am Polarkreis.
Jule, eine junge Töpferin aus Erfurt, entdeckt im Nachlass ihres Großvaters den Bericht über seine Norwegentour aus dem Jahr 1961, der sie sofort fesselt. Keiner in der Familie wusste, dass er als Reisejournalist für einen Ostberliner Verlag schrieb. Jule begibt sich auf Spurensuche – auf einer Fahrt mit der legendären Postschifflinie, mit der damals schon ihr Opa unterwegs war. In einem Café weit hinter dem Polarkreis kann sie sein Geheimnis lüften, das auch ihr Leben gehörig durcheinanderbringt …
Hochemotional und vor bildgewaltiger Kulisse: Auf einem Hurtigrutenschiff reist eine junge Frau in den Norden und taucht ein in die Geschichte ihrer Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
2024. Jule, eine junge Töpferin aus Erfurt, entdeckt im Nachlass ihres Großvaters einen Reisebericht von 1961, der sie sofort fesselt. Jule begibt sich auf Spurensuche – in einem Café weit hinter dem Polarkreis stößt sie auf ein Geheimnis, das auch ihr Leben nicht unberührt lässt.
Sommer 1961. Die junge Norwegerin Janne, die als Köchin bei der Hurtigruten arbeitet, ist überglücklich, als ihr eine Arbeit auf einem Kreuzfahrtdampfer angeboten wird. Doch anstatt die Weltmeere zu erkunden, muss sie das Café ihrer Eltern übernehmen. Als dort ein ostdeutscher Journalist auftaucht, verliebt sich Janne Hals über Kopf, und auch er kann sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr vorstellen. Dann erreicht sie die Nachricht, dass in Berlin eine Mauer gebaut wird …
Über Christine Kabus
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren und in Freiburg aufgewachsen, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte zunächst einige Jahre als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. 2013 wurde ihr erster Roman veröffentlicht.
Alle lieferbaren Titel der Autorin sehen Sie unter aufbau-verlage.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christine Kabus
Das Polarlichtcafé
Ein Norwegen-Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Prolog
Kapitel 1 — Sömmerda, Januar 2024
Kapitel 2 — Nordnorwegen, Mai 1961
Kapitel 3 — Sömmerda, Januar 2024
Kapitel 4 — Nordnorwegen, Mai 1961
Kapitel 5 — Leipzig, Februar/März 2024
Kapitel 6 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 7 — Oslo, März 2024
Kapitel 8 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 9 — Oslo und Westküste Norwegen, März 2024
Kapitel 10 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 11 — Westküste Norwegen, März 2024
Kapitel 12 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 13 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 14 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 15 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 16 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 17 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 18 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 19 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 20 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 21 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 22 — Nordnorwegen, Juni 1961
Kapitel 23 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 24 — Nordnorwegen, Juni/Juli 1961
Kapitel 25 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 26 — Nordnorwegen, Juli 1961
Kapitel 27 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 28 — Nordnorwegen, August/September 1961
Kapitel 29 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 30 — Nordnorwegen, Oktober 1961
Kapitel 31 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Kapitel 32 — Nordnorwegen, Dezember 1961
Kapitel 33 — Nordwestküste Norwegen, März 2024
Epilog
Tusen takk!
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Tanja und Django
Så lenge det er liv, er det håp.Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung.
Prolog
Zwei Stunden waren seit seinem Aufbruch vergangen. Die junge Frau schaute alle paar Minuten aus dem Fenster und lauschte mit angehaltenem Atem, ob ein Motorengeräusch seine Rückkehr verkündete. Ein sinnloses Unterfangen, da wegen des dichten Schneetreibens so gut wie nichts zu sehen war und das Tosen des Meeres alle anderen Geräusche verschluckte. Mittlerweile hatte sich der mäßige Westwind, der bei seiner Abfahrt geweht hatte, zu einem regelrechten Orkan gemausert.
Wieder einmal musste die junge Frau feststellen, wie schwierig es war, hier oben Winterstürme genau zu verorten und ihr Ausmaß vorherzusagen. Am Morgen war im Radio für den Norden des Landes wie an den Tagen zuvor lediglich windiges Wetter mit Niederschlägen angekündigt worden. Hätte sie ahnen können, wie falsch diese Einschätzung gewesen war, hätte sie nie zugelassen, dass er losfuhr.
»Keine Widerrede, ich hole jetzt die Hebamme«, hatte er gesagt, als sich die junge Frau beim Frühstück immer häufiger vor Schmerzen krümmte.
»Nein, was ist, wenn das Wetter doch schlechter wird?«
»Warum sollte es heute anders sein als gestern und vorgestern? Ich würde es mir nicht verzeihen, wenn dir etwas passiert, weil ich aus Sorge ums Wetter die Hebamme nicht geholt habe. In spätestens zwei Stunden bin ich wieder zurück. Versprich mir, dass du durchhältst.«
Der Geburtstermin war erst in zwei Wochen. Doch sein sorgenvoller Blick hatte auch diesen Einwand der jungen Frau im Keim erstickt. Tief in ihrem Inneren wusste sie, dass ihr Kind früher kommen wollte – auch wenn die Hebamme bei ihrem letzten Besuch zwei Tage zuvor keine Anzeichen für eine vorzeitige Geburt entdeckt hatte. Die Wehen an diesem Tag fühlten sich anders an als die Vorwehen, mit denen sie schon vertraut war. Diese Wehen jedoch dauerten immer länger, kamen in immer kürzeren Abständen und wurden jedes Mal schmerzhafter.
Die Wartezeit bis zur Ankunft der Hebamme nutzte die junge Frau dazu, alles für die Entbindung vorzubereiten. Ablenkung in Form von körperlichen Tätigkeiten hatten sich als das beste Mittel gegen die düsteren Gedanken bewährt, die sie in den vergangenen Monaten allzu oft geplagt hatten. Sie hatte sich entschieden, die Wohnstube für die Entbindung herzurichten. Dank des Kamins war es dort warm, heißes Wasser konnte sie aus der Küche holen, die sich – wie auch eine Toilette – ebenfalls im Erdgeschoss befand, während das Bad und die unbeheizten Schlafzimmer im ersten Stock lagen.
Als Erstes hatte sie alle Fensterläden geschlossen und sich auf einem Rundgang draußen vergewissert, dass Gegenstände, die dem Wind Angriffsflächen bieten konnten, weggeräumt oder festgebunden waren. Zurück im Haus, hatte sie die Matratze aus ihrem Schlafzimmer nach unten geschleppt, in die Mitte der Wohnstube auf den Boden vor dem Kamin gelegt und mit einem Bettlaken bezogen. Anschließend hatte sie einen Stapel frischer Handtücher, Decken, eine Waschschüssel sowie eine Karaffe mit Wasser samt Trinkglas geholt.
Während sie ihr »Nest« einrichtete, war der Sturm zu einem Orkan geworden, der um das Haus tobte. Sie rechnete nicht mehr damit, dass er zusammen mit der Hebamme den Heimweg hatte antreten können. Es wäre bei diesem Starksturm lebensgefährlich, auf der schmalen Küstenstraße unterwegs zu sein, zu groß war das Risiko, von einer Böe ins Meer gefegt oder von einer Welle weggespült zu werden. Selbst wenn der Sturm bald nachlassen würde, wäre die Straße wegen der Schneeverwehungen vorerst unbefahrbar.
Panik machte sich in ihr breit. Ihr wurde bewusst, dass sie vollkommen auf sich allein gestellt war und allem Anschein nach ohne die kundige Hilfe der Hebamme zurechtkommen musste. Schreckensszenarien, in denen das Kind von der Nabelschnur erdrosselt wurde und erstickte, fluteten ihre Gedanken. Eine Steißlage könnte die Geburt unmöglich machen oder sie selbst könnte an unstillbaren Blutungen zugrunde gehen.
Die nächste Wehe war so stark, dass sie die angsteinflößenden Bilder schlagartig vertrieb. Die Welt der jungen Frau bestand ein, zwei Atemzüge lang nur aus schier unerträglichen Schmerzen, untermalt vom Jaulen der Sturmböen. Ein lautes Krachen ließ sie kurz darauf zusammenzucken. Ein Fensterladen war aus seinen Angeln gerissen worden. Einen Augenblick später zerbarst die Scheibe, und eiskalte Luft strömte ins Zimmer.
Nur weg hier!, schrie es in ihr. Du bist hier nicht sicher. Aber wohin? In die Backstube! Die dicken Steinmauern des Turms versprachen besseren Schutz als das Holzhaus. Sie zog ihren mit Lammfell gefütterten Mantel an und öffnete die Eingangstür. Eine Böe raubte ihr den Atem und drückte sie gegen die Wand. Keine Chance, aufrecht zu gehen. Sie ließ sich auf alle viere nieder und kämpfte sich Richtung Leuchtturm. Die paar Meter schienen sich zu Meilen zu dehnen. Der Sturm saugte alle Kraft aus ihr, eine weitere Wehe tat ihr Übriges. Die Arme der jungen Frau gaben nach, sie sackte zur Seite, ihr Oberkörper versank im Neuschnee. »Ich kann nicht mehr«, schluchzte sie und schloss die Augen.
Nein! Du schaffst das! Das Kind in ihr hatte sich bewegt, als wolle es auf sich aufmerksam machen. Sie schlang die Arme um ihren Bauch. Du hast recht, nahm sie die innere Zwiesprache mit dem Ungeborenen auf. Ich werde nicht aufgeben. Sie raffte sich auf und robbte weiter. Zusammen schaffen wir das. Auch wenn du dir den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für deine Ankunft ausgesucht hast.
In der Backstube wurde sie von Wärme empfangen und dem Duft der Zimtknoten, die sie in der Früh gebacken hatte. Sie schälte sich aus dem Mantel, breitete ihn vor dem großen Ofen aus und bedeckte ihn mit sauberen Küchentüchern. Nachdem eine Wehenwelle sie zum Innehalten gezwungen hatte, legte sie Holzscheite nach und stellte einen Kessel Wasser auf den Gasherd. Während sie eine große Rührschüssel aus einem Schrank holte, in die sie Wasser zum Waschen füllen wollte, rann etwas Feuchtes an den Innenseiten ihrer Schenkel hinab. Ein Schmerz, der alle bisherigen in den Schatten stellte, durchzuckte ihren ganzen Körper. Sie stieß einen Schrei aus, stolperte zu ihrem provisorischen Lager vor dem Ofen und ging in die Hocke.
War das bereits eine Presswehe gewesen? Ging das nicht alles viel zu schnell? Was, wenn der Muttermund noch nicht weit genug geöffnet war? Voller Angst versuchte sie, die nächste Wehe zu veratmen, so wie sie es mit der Hebamme geübt hatte. Es gelang ihr nicht, ihr Körper wehrte sich dagegen.
Mach, dass es aufhört, flehte sie nach einer weiteren Presswehe. Ihr Unterleib schien zu zerbersten. Lag das Kind falsch? Wieder drohte Panik sie zu fluten. Mach dich nicht verrückt! Du darfst dich nicht verkrampfen. Du musst weiteratmen, befahl sie sich. Bei der nächsten Wehe wurde das Heulen des Windes von einem lauten Brüllen begleitet. Erst als es verklungen war, wurde der jungen Frau klar, dass sie selbst es ausgestoßen hatte. Auch bei den folgenden Presswehen ließ sie ihren Schmerzenslauten freien Lauf. In den Zwischenphasen sank sie auf ihr Lager. Was hätte sie für ein wenig Schlaf gegeben. Doch die nächste Wehenwelle rollte unerbittlich heran. Mittlerweile hatte sie jegliches Zeitgefühl verloren, hätte nicht sagen können, wie lange sie bereits in diesem endlosen Albtraum gefangen war – aus dem sie auftauchte, als sie mit einem Mal etwas zwischen ihren Oberschenkeln spürte. Sie tastete danach und schluchzte auf. Das Köpfchen! Mit letzter Kraft presste sie erneut – und gleich darauf lag ein kleiner Körper zwischen ihren Knien. Vorsichtig hob sie das Kind hoch, soweit es die Nabelschnur zuließ. Es schrie kurz, öffnete die Augen und sah sie an. »Mein Kleines«, wisperte sie in das winzige Ohr. »Ich bin es, deine mamma.« Tränen der Freude strömten über ihre Wangen. »Und du bist mein kleines Wunder.«
1
Sömmerda, Januar 2024
An einem Samstagmorgen Ende Januar saß Jule in einem Nahverkehrszug. Als sie in Erfurt umgestiegen war, hatte die Sonne noch hier und da durch die Wolkendecke gespitzt, seither war es draußen immer düsterer geworden. Die erste Teilstrecke hatte sie von Leipzig aus im ICE zurückgelegt. Zwanzig Minuten später verkündete die elektronische Durchsage, dass in Kürze Sömmerda erreicht würde. Jule steckte ihren E‑Reader, auf dem sie einen Artikel der aktuellen Ausgabe des internationalen Keramikmagazins gelesen hatte, in ihren Rucksack, schloss den Reißverschluss ihrer dunkelroten Daunenjacke und zog die blaue Wollmütze über ihre schwarzbraunen Locken.
Der Zug bremste ab und fuhr in den unteren Teil des Turmbahnhofs ein, bei dem zwei übereinanderliegende Etagen die Verbindung zwischen sich kreuzenden Eisenbahnstrecken herstellten. Eine Minute später stieg Jule aus und sah sich unwillkürlich auf dem Bahnsteig nach ihrer Großmutter um, die ihre Enkelin all die Jahre immer abgeholt hatte, wenn sie es einrichten konnte. Das ist vorbei, für immer, schoss es Jule durch den Kopf. Keine regelmäßigen Fahrten mehr mit der Pfeffibahn, die ihren lustigen Namen den Kräutern, allen voran der Pfefferminze verdankte, die Ende des 19. Jahrhunderts in großem Stil im nahen Kölleda angebaut und auf der eigens dafür errichteten Zugstrecke transportiert worden waren. Die Herkunft des Spitznamens gehörte zu dem reichen Schatz an »Oma-Wissen«, wie Jule es nannte, das sich nun nicht mehr erweitern würde.
Der Ostwind, der ihr um die Ohren pfiff, als sie auf den Bahnhofsvorplatz trat, ließ die herrschenden Minusgrade noch frostiger wirken. Jule zog die Schultern hoch und wickelte den Schal, den ihre Großmutter im selben Muster wie die Mütze gestrickt hatte, fester um den Hals. Sie eilte die Freiligrathstraße hinunter, bog in die Fichtestraße ein und folgte dieser bis zur Unstruthalle und den Sportanlagen, denen gegenüber es rechter Hand in kleinere Wohnstraßen ging. Kurz darauf stand sie in der Brahmsstraße vor dem Einfamilienhaus, in dem Oma Beate seit dem Tod ihres Ehemanns Rainer allein gelebt hatte.
Die beiden waren dort nach ihrer Hochzeit und kurz vor der Geburt ihres Sohnes Andreas eingezogen und hatten das heruntergekommene Häuschen, das vor dem Zweiten Weltkrieg erbaut worden war, im Lauf der Jahre eigenhändig renoviert und peu à peu zu einem behaglichen Nest ausgebaut. Erst im vergangenen Sommer hatten Jule und ihr Vater Andreas den Anstrich erneuert und die schadhaften Steinplatten ausgewechselt, die vom Gehweg durch den Vorgarten zum Haus führten.
In Ermangelung eines eigenen großen Gartens hatte Oma Beate in der nahe gelegenen Laubenkolonie »Neue Zeit« eine Parzelle erworben, in der sie bis ins hohe Alter vom Frühling bis spät in den Herbst hinein täglich viele Stunden verbracht hatte. Jule hatte sie gern dorthin begleitet und ihr beim Unkrautjäten, Setzlinge pflanzen, Obstbäume pfropfen, Bohnenranken hochbinden, Ernten und anderen Tätigkeiten geholfen.
Ebenfalls in Laufweite vom Haus befand sich der Friedhof, auf dem Großvater Rainer vor nun schon über fünfunddreißig Jahren beerdigt worden war. Seine Frau hatte ihm mindestens einmal in der Woche einen Besuch abgestattet, sein Grab in Ordnung gehalten und es mit selbstgezogenen Blumen bepflanzt. Jetzt lag sie seit drei Wochen neben ihm, und die Pflege ihrer letzten Ruhestätte würde von einer Gärtnerei übernommen. Die Vorstellung versetzte Jule einen Stich, ebenso wie das Vorhaben ihres Vaters, das Anwesen in der Brahmsstraße zu verkaufen. So sehr es sie auch schmerzte, es war die richtige Entscheidung. Mit dem Tod von Oma Beate gab es nichts mehr, was sie nach Sömmerda gelockt hätte. Auch ihr Vater hatte nie den Wunsch geäußert, seinen Wohnsitz in Erfurt aufzugeben, wo er in einem Betrieb für Heiztechnik arbeitete.
Jule hielt einen Moment inne, bevor sie auf den Klingelknopf drückte. Wie oft war sie durch das Gartentor gegangen? Wie oft hatte Oma Beate sie auf der Schwelle der Eingangstür empfangen oder ihr zum Abschied nachgewinkt? Bei dem Gedanken, dass sie das liebe Gesicht ihrer Großmutter nie wiedersehen und das Haus als einen Hafen in ihrem Leben verlieren würde, wurde ihr Hals eng. In ihrer Kindheit und Jugend war es für Jule ein Ort der Geborgenheit gewesen, an dem sie viele Ferien und unzählige Wochenenden verbracht hatte, wenn ihr Vater sich wegen seiner Arbeit nicht um sie kümmern konnte. Oma Beate war für Jule zur zweitwichtigsten Person in ihrem Leben geworden, nachdem ihre Mutter kurz nach ihrem zehnten Geburtstag gestorben war. Im Haus ihrer Oma hatte sie sich mehr daheim gefühlt als in ihrer jetzigen Bleibe in Leipzig oder früher in der Erfurter Wohnung, in der sie bis zum Abitur gelebt hatte.
»Willst du nicht reinkommen?«
Der Ruf ihres Vaters, der auf der Schwelle der Haustür erschien, holte Jule ins Hier und Jetzt zurück. Sie eilte zu ihm, flog in seine Arme und vergrub ihre Nase in seinem Pullover, der den typischen »Paps-Duft« verströmte, der ihr schon als kleines Mädchen Geborgenheit und Trost gespendet hatte. Andreas drückte seine Tochter, die wie er mittelgroß und stämmig war, fest an sich.
»Erst mal einen Kaffee?«, fragte er, nachdem er sich von seiner Tochter gelöst hatte und sie aufmerksam musterte. »Du siehst müde aus.«
Und du erst, lag es Jule auf der Zunge. »Kaffee ist mega«, antwortete sie stattdessen, entledigte sich des Rucksacks, hängte ihre Jacke an die Garderobe und folgte ihrem Vater in die Küche, deren Fenster zur Straße hinausging.
»Vielen Dank, dass du mir beim Sortieren und Ausmisten hilfst.« Andreas holte zwei Becher aus einem Schrank.
»Das ist doch selbstverständlich«, sagte Jule und setzte sich an den Tisch mitten im Raum.
»Ist es nicht. Schließlich hast du genug um die Ohren mit der Lernerei für die Meisterprüfung.«
»Stimmt schon. Aber das hier ist mir wichtig. Ich hab das Gefühl, dass ich dann erst so richtig Abschied von Oma nehmen kann. Die Beerdigung war für mich … wie soll ich sagen … irgendwie unwirklich.« Jule hob die Schultern. »Ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen, dass sie nicht mehr da ist.«
»Ich weiß, was du meinst.« Ihr Vater setzte sich ihr gegenüber, nachdem er die Kanne von der Wärmplatte der Kaffeemaschine geholt hatte. »Mir geht es ähnlich.«
Jule ertappte sich dabei, wie ihr Blick zur Tür wanderte. »Ich denke ständig, dass sie gleich hereinkommt und sich zu uns setzt.« Sie räusperte sich. »Wie kommst du denn mittlerweile klar?«, fragte sie und sah ihm in die grünbraunen Augen, die er von seinem Vater geerbt und seiner Tochter weitergegeben hatte. Die schwarzen Locken dagegen hatte Jule von ihrer Mutter.
Nach Oma Beates Herzinfarkt kurz nach Silvester hatte sich Andreas Schuster zunächst in die Organisation der Beerdigung und anschließend in seine Arbeit gestürzt. Drei Wochen lang war es Jule nicht gelungen, zu ihm durchzudringen, was sie zunehmend beunruhigt hatte. Zwar konnte sie verstehen, dass er noch nicht bereit war, sich seiner Trauer zu stellen – schließlich hatte sie genau wie er nach Ablenkung gesucht. Dennoch war ihre Erleichterung groß gewesen, als ihr Vater einige Tage zuvor angerufen, sich für seinen Rückzug entschuldigt und sie um ihre Hilfe beim Räumen des Hauses in Sömmerda gebeten hatte.
»Ich vermisse sie sehr«, antwortete Andreas. »Aber ich bin dankbar, dass sie so lange ein wichtiger Teil in unserem Leben war.« Er presste kurz die Lippen aufeinander. »Anders als mein Vater.«
Jule nickte. Opa Rainer hatte lange vor ihrer Geburt einen Schlaganfall erlitten und war mit gerade einmal achtundfünfzig Jahren gestorben.
»Und ich bin froh, dass sie nicht jahrelang an einer schweren Krankheit leiden musste.«
»Das tröstet mich auch ein wenig.« Jule drückte den Arm ihres Vaters. »Wenn man mir an Weihnachten gesagt hätte, dass wir zum letzten Mal mit ihr feiern, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Sie wirkte so vital und munter wie eh und je.«
Während Andreas sich die geschäftlichen Unterlagen seiner Mutter vornahm, war Jule in den folgenden Stunden damit beschäftigt, die Kleider ihrer Großmutter zu sichten und gut erhaltene Stücke für ein Hilfswerk in Kisten zu verpacken, während sie abgetragene Sachen in Säcke für die Altkleidersammlung stopfte. Ebenso verfuhr sie mit Bettwäsche, Handtüchern, Tischdecken und Stoffservietten. Ab und zu hielt sie inne, schnupperte an Pullovern oder Schals und sog den Duft ein, der für sie seit ihrer Kindheit mit Geborgenheit und Wärme verbunden war. Eine selbstgestrickte Stola aus blauer Mohair-Wolle legte sie beiseite. Dieses Lieblingsstück ihrer Oma wollte sie behalten.
Nachdem sie im Badezimmer gebrauchte Seifen, Shampoos, Bürsten und andere Körperpflegeartikel in einen Müllsack gesteckt hatte, ging sie in die Küche, wo ihr Vater mittlerweile begonnen hatte, den Schrank mit den Töpfen, Pfannen und Backformen auszuräumen.
»Könnt ihr in der WG vielleicht etwas davon gebrauchen?«
Jule schüttelte den Kopf. »Wir sind bestens ausgestattet.«
»Dachte ich mir schon.« Andreas massierte sich den Nacken. »Wahnsinn, was sich so alles ansammelt im Laufe eines Lebens.« Er deutete auf mehrere große Schüsseln, in die er ordentlich sortiert Kochlöffel, Trichter, Siebe und Reiben sowie Quirle und Sparschäler gelegt hatte. »Damit könnte man eine Großküche bestücken.«
»Manche sehen geradezu museumsreif aus.« Jule nahm einen Kohlstrunkschneider in die Hand, dessen beidseitig geschärfte Klinge Rostflecken aufwies. »Apropos Geräte«, fuhr sie fort. »Weißt du, wo ich eine Zange finde? Ich will Nägel aus der Wand ziehen.«
»Hm, gute Frage«, sagte Andreas. »Hier in der Küche habe ich bislang nichts dergleichen entdeckt. Dabei bräuchte ich dringend einen Schraubenzieher.« Er ging zur Tür. »Ich seh mal rasch im Keller nach.«
»Hast du auch Hunger?«, fragte Jule. »Ich könnte uns Pizza bestellen.«
»Prima Idee. Ich nehme gern eine mit …«
»Schinken und Pilzen«, ergänzte Jule und grinste. »Ich kann mich nicht erinnern, dass du je einen anderen Belag gewählt hast.«
Ihr Vater schmunzelte und verließ die Küche. Nachdem sie beim Italiener angerufen hatte, inspizierte sie die Schränke, in denen ihre Großmutter das Geschirr verstaut hatte – bis auf das »gute« Meissener für besondere Anlässe, das im Wohnzimmer in einer Vitrine stand. In der Küche hatte sich während der vergangenen Jahrzehnte ein buntes Sammelsurium von Teilen aus verschiedenen Services und Einzelstücken angehäuft. Voller Rührung stellte Jule fest, dass Oma Beate alle Becher, Schalen und Teller, die sie ihr je getöpfert und geschenkt hatte, aufgehoben hatte.
Die ältesten waren noch in der Grundschule entstanden, unförmige Gebilde aus Tonwürsten geformt. Später hatte Jule an der Volkshochschule Keramikkurse besucht und sich zunehmend für das Gestalten mit Ton begeistert. Nach dem Abitur war ihr schnell klar geworden, dass es sie nicht wie die meisten ihrer Mitschüler an eine Universität zog. Sie liebte die Arbeit mit den Händen, wobei sie sich eine Zeit lang nicht entscheiden konnte, welche ihrer beiden Leidenschaften sie zum Beruf machen sollte: das Gärtnern oder das Töpfern. Sie entschied sich fürs Töpfern, machte eine Ausbildung zur Keramikerin in Leipzig und wurde von ihrem Lehrbetrieb als Gesellin übernommen.
Oma Beate hatte den Werdegang ihrer Enkelin mit Interesse verfolgt und sie ermutigt, die Meisterschule zu besuchen, um sich später selbstständig zu machen. »Sei ehrlich mit dir«, hatte sie gesagt. »Du willst doch nicht bei deinem jetzigen Arbeitgeber ewig Fliesen und Kacheln herstellen, so nett dort das Umfeld auch sein mag. In dir steckt eine wahre Künstlerin. Und der solltest du Raum geben.« Sie hatte ihre Enkelin angelächelt und ihr eine ausgeschnittene Zeitungsannonce gegeben. »Du bist ja noch jung. Du könntest anschließend noch studieren.« Die Anzeige hatte den Masterstudiengang Product Design and Design of Porcelain, Ceramics and Glass beworben, der in Halle angeboten wurde. Nach dem Motto: Working like a craftsman – thinking like a designer, wurden dort die Kompetenzen des klassischen Produktdesigns mit aktuellen und zukunftsweisenden Strategien und Techniken des Studiodesigns und mit angewandter Kunst verbunden.
Die Erinnerung an das Gespräch ließ Jules Augen feucht werden. Ihre Großmutter hatte schneller als sie selbst erkannt, wie ausgeprägt ihr Bedürfnis war, ihre Kreativität auszuleben. Ihren Einwand, es gäbe schon mehr als genug Kunsthandwerkerinnen auf dem Gebiet und es sei fraglich, ob es ihr je gelingen werde, sich mit einer eigenen Werkstatt über Wasser zu halten, hatte Oma Beate mit einer der Redewendungen gekontert, die sie für jede Lebenslage in petto hatte: »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.«
Das Klingeln des Pizzaboten holte Jule in die Gegenwart zurück. Warum war ihr Vater noch nicht zurückgekehrt? Er hatte die Küche vor gut zwanzig Minuten verlassen. Nachdem sie die Kartons entgegengenommen und bezahlt hatte, steckte sie den Kopf durch die Tür zum Keller, zu dem eine Wendeltreppe hinunterführte. »Paps? Wo bleibst du denn?«
Keine Antwort. Stille. Jules Herz begann schneller zu schlagen. Vor ihrem inneren Auge erschienen Bilder von ihrem Vater, der gestürzt war und nun leblos am Ende der steilen Stufen lag. Seit dem Tod von Oma Beate wurde Jule häufig von der Angst übermannt, ihrem Vater könnte etwas zustoßen und sie würde mit ihm ihren letzten nahen Verwandten verlieren. Sie stellte die Pizzakartons auf den Telefontisch neben der Garderobe und hastete die Treppe hinunter. Der schmale Gang war leer. Linker Hand befand sich die Waschküche, gegenüber war ein Raum, in dem sich Dutzende Gläser mit eingemachten Gemüsen und Früchten, Marmeladen und Obstwein neben Kartoffeln und Äpfeln in den Regalen türmten. Erst auf den zweiten Blick entdeckte Jule ihren Vater, der hinten in einer Ecke vor einem geöffneten Metallschrank hockte, in dessen Fächern Werkzeuge aller Art verstaut waren.
»Paps? Alles in Ordnung bei dir?«
Er zuckte zusammen und drehte sich zu ihr. In der Rechten hielt er eine armlange Metallstange. Die Enden waren abgeflacht und etwas nach oben gebogen, eines hatte einen keilförmigen Spalt, der an den Huf einer Kuh erinnerte.
»Was um alles in der Welt willst du denn mit der Brechstange?«
»Den Boden von dem Schrank aufbrechen.«
»Wie bitte?« Jule sah ihn überrascht an. »Ich dachte, du wolltest Zangen und Schraubenzieher suchen. Die liegen doch direkt vor …«
»Da unten ist ein Zwischenraum«, unterbrach er sie. »Hab ich durch Zufall entdeckt, als mir ein Hammer runtergefallen ist und es hohl klang.«
»Du denkst, dass es ein Versteck ist«, stellte Jule mehr fest, als zu fragen. Sie fühlte sich in ihre Kindheit zurückversetzt, in der sie – inspiriert von den »Indiana Jones«-Filmen – oft mit ihrem Vater Glücksritter oder Erforscher unbekannter Gegenden gespielt hatte. Nur waren damals die Schätze in Form von Schokoladenmünzen oder Glasperlenketten, die Jule fand, zuvor von Andreas versteckt worden. Ein Kribbeln breitete sich in Jule aus. Was verbarg sich in dem Hohlraum? Ein spannendes Geheimnis oder gar ein echter Schatz? Sie ging zu ihrem Vater, der den Kuhfuß am untersten Brett ansetzte.
»Warte«, rief sie. »Wenn es ein Geheimfach ist, dann gibt es doch sicher einen weniger gewaltsamen Weg, es zu öffnen. Irgendeinen Schiebemechanismus oder so?«
»Wie in den Abenteuerfilmen, in denen man in einem Grabmal oder einer Kultstätte auf einen bestimmten Punkt drücken muss, damit der Zugang aufspringt?« Andreas Lippen kräuselten sich. »Das hatte ich auch angenommen. Aber hier hat jemand dafür gesorgt, dass die Abdeckung felsenfest sitzt.« Er deutete auf die Seitenränder. »Siehst du die weiße Masse in den Fugen? Das ist ein Klebstoff. Und ein ziemlich guter dazu. Rauskratzen lässt der sich nicht.«
Er setzte erneut das Werkzeug an und zog mit aller Kraft daran. Jule hielt den Atem an. Schließlich splitterte das Holz mit einem Knirschen, die Platte löste sich und ließ sich aus ihrer Fassung zerren.
Gemeinsam beugten sie sich über den freigelegten Hohlraum, in dem einige Bücher, eine Reiseschreibmaschine sowie ein prall gefüllter Aktendeckel lagen.
Jule nahm ein backsteindickes Buch mit blauem Leineneinband heraus, auf dessen Vorderseite in Goldprägung die Umrisse eines Landes zu sehen waren. Sie schlug die erste Seite auf.
»Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark. Reisen mit Nutzen und Genuß«, las sie laut vor. »Von einem Hans Eberhard Friedrich. 1958 in einem Darmstädter Verlag erschienen.«
»Und hier ist ein alter Bildband über Norwegen«, sagte ihr Vater. »Ebenfalls von 1958.«
»Warum hat die jemand hier versteckt?«, fragte Jule und verzog enttäuscht das Gesicht. »Was ist so geheimnisvoll an diesen alten Schinken?«
»Ich bin sicher, dass die Sachen meinem Vater gehört haben.« Andreas zog die Aktenkladde aus dem Geheimfach.
»Wieso?«
»Weil das seine Handschrift ist.« Er tippte auf den Deckel, auf dem Aufzeichnungen stand.
»Schau mal«, sagte Jule und zeigte auf einen flachen Kasten, der unter den Büchern zum Vorschein gekommen war. »Was da wohl drin ist?«
Die Seiten waren türkisgrün, der Deckel schwarz. Darauf waren zwei Weintrauben mit hellen Beeren samt Blättern gemalt sowie ein gefülltes Kelchglas. Die Aufschrift verriet, dass sich einst Flaschen der VEB Rotkäppchen-Sektkellerei Freyburg/Unstrut darin befunden hatten. Die Farben waren verblichen, die Kanten bestoßen.
Erneut sprang Jules Kopfkino an. War die Kiste voller Geldscheine? Oder hatte Opa Rainer darin Liebesbriefe aufbewahrt, die von einer heimlichen Affäre stammten? Oder war …
Andreas hob den Kasten heraus und öffnete den Klappdeckel. Enttäuscht atmete Jule aus, als sie den Inhalt musterte: Straßenkarten, ein Kästchen mit Diapositiven und ein paar Schriftstücke.
»Warum hat dein Vater dieses Zeug wohl so sorgfältig versteckt? Was wollte er geheim halten?«
»Offenbar, dass es eine Zeit in seinem Leben gab, in der er einen anderen Beruf ausübte und nicht in Sömmerda gelebt hat«, sagte Andreas nüchtern.
»Wie kommst du denn darauf?«
»Deswegen.«
Er reichte ihr ein abgegriffenes, dunkelblaues Pappbüchlein, das er aus einem Schutzumschlag gezogen hatte. Auf der Vorderseite prangte mittig ein rundes, goldfarben eingeprägtes Emblem, das einen Ährenkranz darstellte, der einen Hammer und einen Zirkel umrahmte – das Staatswappen der DDR. Darüber standen – ebenfalls in Gold geprägt – die Wörter Deutsche Demokratische Republik, unten in größerer Schrift Reisepass.
Das Erste, was Jule beim oberflächlichen Durchblättern ins Auge sprang, waren die dicken roten Striche, die diagonal von Hand über alle Seiten gezogen worden waren, daneben jeweils die gestempelte Angabe: UNGÜLTIG ab August 1961 – obwohl der Ausweis laut Ausstellungsdatum erst drei Jahre später hätte verlängert werden müssen.
Auf der dritten Seite war das Lichtbild eines jungen Mannes eingestanzt, der ernst in die Kamera schaute. Darunter hatte er seine Unterschrift in das dafür vorgesehene Feld geschrieben: Rainer Schuster. Es folgten in einer anderen Handschrift ausgefüllte Angaben zu Größe (182 cm), Augenfarbe (grünbraun) sowie Besondere Kennzeichen (keine). Auf der gegenüberliegenden Seite nochmals der Name, dazu Geburtsdatum (6. 11. 1930), Geburtsort (Berlin), Wohnadresse (Lottumstraße 4, Berlin), Beruf (Journalist) und Familienstand (ledig).
»Ich glaub’s ja nicht«, rief Jule. »Oma Beate hat das nie erwähnt.« Sie zog die Stirn kraus. »Ich dachte immer, dass deine Eltern beide aus Sömmerda stammten.«
»Das hatte ich auch angenommen«, sagte Andreas. »Aber so wie es aussieht, ist mein Vater wohl erst Anfang der Sechzigerjahre hierhergezogen.«
»Und das hat er dir nie erzählt?«
Andreas schüttelte den Kopf.
»Das ist krass«, entfuhr es Jule.
»Jetzt kapiere ich auch, warum es hier in der Gegend keine Verwandten von ihm gibt«, sagte Andreas. Er strich sich mit Zeige- und Mittelfinger über die Nasenwurzel. »Wenn ich so drüber nachdenke, hat er eigentlich so gut wie nie von seiner Familie erzählt. Wobei er generell eher wortkarg und in sich gekehrt war.«
»Ob Oma Beate das alles wusste?« Jule schürzte die Lippen und überlegte kurz. »Hm, … das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und falls sie ihrem Mann hatte versprechen müssen, es niemandem zu verraten, dann hätte sie mir das doch gesagt, als ich sie nach Großvaters Herkunft gefragt habe. Sie hätte mich niemals angelogen, das war nicht ihre Art.«
»Das stimmt«, pflichtete ihr Andreas bei. »Einen ehrlicheren Menschen als sie kann ich mir kaum vorstellen.«
Jule rief sich die Gespräche ins Gedächtnis, in denen sie ihre Oma ermuntert hatte, ihr von früher zu erzählen; von dieser für sie so weit zurückliegenden Zeit in einem fremd anmutenden Land namens DDR. Wenn ihre Großmutter an die Stelle kam, in der Rainer in ihr Leben getreten war, hatten auch nach all den Jahrzehnten ihre Augen aufgeleuchtet, und ihre Wangen waren von einem rosigen Hauch überzogen worden.
Als Kind hatte Jule der Gedanke befremdet, dass ihre Oma einmal ein junges, verliebtes Mädchen gewesen war. Später fand sie die Vorstellung faszinierend und vor allem romantisch. Während sie ihrer Großmutter lauschte, spulte sich vor ihrem geistigen Auge ein alter Schwarz-Weiß-Film ab, vermutlich weil es aus jenen Jahren nur ein paar wenige Schwarz-Weiß-Fotos gab.
Jule setzte sich zu ihrem Vater und kramte in der Kiste. Offenbar hatte die gerade einmal neunzehnjährige Beate kurz vor dem Abschluss ihrer Lehrzeit im Volkseigenen Betrieb (VEB) Robotron-Büromaschinenwerk »Ernst Thälmann« 1964 den fünfzehn Jahre älteren Rainer kennengelernt, der dort kurz zuvor eine Stelle angetreten hatte. Eines der Fotos zeigten Rainer am Fließband in der Fertigungshalle für Staffelwalzen, die für Buchungsmaschinen benötigt wurden.
Beate hatte sich Hals über Kopf in den gut aussehenden Kollegen verliebt, wobei sie – mehr noch als von seinem Äußeren – von seiner leicht melancholischen Ausstrahlung angezogen worden war, die ihm eine geheimnisvolle Note verliehen hatte. Dass ausgerechnet sie Rainers Aufmerksamkeit und bald auch sein Herz gewinnen konnte, hatte sie mit Staunen und Glückseligkeit erfüllt. Kurz nachdem sie begonnen hatten »miteinander zu gehen«, war Beate »guter Hoffnung« gewesen, und Rainer hatte ihr, ohne zu zögern, einen Heiratsantrag gemacht.
Ein tiefer Seufzer ihres Vaters riss Jule aus ihren Erinnerungen. Aus seinem Gesicht war alle Farbe gewichen. Die Geheimnisse seines Vaters schienen ihm mehr zu schaffen zu machen als der Tod seiner Mutter. Kein Wunder, er musste das Gefühl haben, mit einem Fremden zusammengelebt zu haben. Wobei er ja noch sehr jung war, als Rainer starb. So alt wie sie. Der Gedanke jagte Jule einen kalten Schauer über den Rücken. Die Vorstellung, ihr Vater könnte jetzt sterben, war schrecklich. Nach dem Tod ihrer Mutter war sie von Andreas und Oma Beate aufgefangen und getröstet worden. Wenn sie ihren Vater verlieren würde, hätte sie niemanden mehr. Erst in diesem Augenblick wurde ihr richtig bewusst, dass sie beide die Letzten der Familie waren.
2
Nordnorwegen, Mai 1961
»Ach, ist das herrlich. Sich zur Abwechslung mal bedienen zu lassen«, sagte Borghild, ließ sich gegen die Lehne ihres Stuhls sinken und nahm einen Schluck Kaffee, den eine Kellnerin eben erst nachgeschenkt hatte. »Findest du nicht?«
»Und wie«, pflichtete Janne ihrer Freundin bei, der sie bei einem späten Frühstück im Speisesaal der »MS Harald Jarl« an einem Fenstertisch gegenübersaß. »Einfach die Hände in den Schoß legen und in Ruhe die Aussicht genießen.«
Sie deutete auf die Küste von Helgeland, an der sie seit Stunden entlangfuhren. Sie galt als einer der schönsten Abschnitte auf der Postschiffroute mit ihren unzähligen Inseln, hoch aufragenden Gebirgsketten, Fjorden und kleinen Fischerdörfern, die sich harmonisch in die raue Natur einfügten.
»Wobei … lange würde ich das Nichtstun wohl nicht aushalten«, schob Janne nach.
»Stimmt, dazu hast du zu viele Hummeln im Hintern.« Borghild zwinkerte ihr zu und biss in ihr Marmeladenbrot.
Janne löffelte einen Joghurt, in den sie Haferflocken und frischen Obstsalat gerührt hatte, und schaute aus dem Fenster. War wirklich erst eine halbe Woche seit dem Ende ihres letzten Arbeitstages vergangen? Um diese Zeit hatte sie in der Kombüse der »Sanct Svithun« gestanden und im Akkord Erdbeertörtchen und Waffeln hergestellt, die den Passagieren später zum Nachmittagskaffee angeboten worden waren.
Während ihrer Arbeit hatte Janne selten Muße gehabt, die vorbeiziehende Landschaft zu betrachten. Die Küchenräume der Postschiffe lagen unter Deck und boten keine Sicht nach draußen. Nach den Schichten sank Janne meistens erschöpft auf eine Liege im Aufenthaltsraum für die Angestellten und schlief ein paar Stunden, bevor sie wieder zum Dienst gerufen wurde. Während ihrer 22‑tägigen Einsätze, bei denen sie jeweils mit dem Schiff zweimal die Strecke von Bergen nach Kirkenes und zurückfuhr, fühlte sie sich oft übermüdet.
»Es hat so gutgetan, nach Herzenslust auszuschlafen und keinen Wecker stellen zu müssen«, sagte Borghild nach einem herzhaften Gähnen.
Als hätte sie meine Gedanken gelesen, schoss es Janne durch den Kopf, so vertraut waren sie sich. Ein Gefühl der Dankbarkeit durchströmte sie. Es war Jahre her, dass sie Borghild kennengelernt hatte. Sie absolvierte damals bei der Hurtigruten eine Lehre zur Köchin, und Borghild zur Servicekraft. Beide waren anschließend von der Reederei übernommen worden und arbeiteten seit fünf Jahren auf den Postschiffen. Auch wenn sie sich manchmal wochenlang nicht sahen, weil sie auf unterschiedlichen Dampfern eingesetzt wurden, hatte sich ihre Freundschaft immer mehr vertieft. Nicht zuletzt, weil sie beide in Trondheim bei einer Witwe gewohnt hatten, die Zimmer an alleinstehende Frauen vermietete.
Vom Aussehen her hätten die beiden kaum unterschiedlicher sein können. Borghild war einen Kopf kleiner als ihre hochgewachsene Freundin, war mit Rundungen »an den richtigen Stellen« ausgestattet, wie Janne einmal ein paar Kollegen hatte tuscheln hören, und trug eine Pagenfrisur, die ihrem herzförmigen Gesicht einen vorteilhaften Rahmen gab. Janne hielt ihre langen goldblonden Haare gern mit einem breiten Band aus der Stirn oder flocht sie zu einem Zopf. Ihre Mutter hatte sie wegen ihrer dichten Brauen über ihren kornblumenblauen Augen verrückt gemacht (»Kind, du solltest sie regelmäßig zupfen und ausdünnen«) und auch an ihrem Mund mit den vollen geschwungenen Lippen nicht viel Gutes gelassen. Wie oft hatte Ragna Moen ihre Tochter ermahnt, ihn besonders beim Lachen nicht zu weit aufzureißen. (»Die Leute denken sonst, dass du sie verschlingen willst.«) So sehr sich Janne auch bemüht hatte, es gelang ihr nicht, diesen Ratschlag zu beherzigen. Ihr Lachen ließ sich nicht zügeln. Ebenso wenig verspürte sie Lust, ihre Brauen mit einer Pinzette zu malträtieren.
»Nirgendwo lässt es sich so erholsam schlafen wie in einer eigenen Kabine auf dem modernsten Schiff der Flotte«, stellte Borghild fest und riss Janne aus ihren Gedanken.
»O ja, wir haben wirklich Glück, dass wir mit der ›MS Harald Jarl‹ fahren dürfen.«
Der Dampfer war erst kürzlich in einer Trondheimer Werft vom Stapel gelaufen und damit nicht nur das vorläufig modernste Schiff der Hurtigruten, sondern auch das erste, das nach dem Krieg in Norwegen gebaut worden war. Die Ausstattung war komfortabler als bei den älteren Modellen, wobei die charakteristischen Merkmale der Postschiffe auch bei der »MS Harald Jarl« vorhanden waren: Sie war nicht nur für den Transport von Menschen vorgesehen, sondern auch für den von Automobilen und Gütern aller Art, darunter Lebensmittel, die in eigens dafür eingebauten Kühlräumen gelagert werden konnten. Außerdem legte der Dampfer stets mit der Backbordseite an den Hafenkais an, da sich nur an dieser Seite die Frachtluken, Lastenkräne sowie die Gangways befanden.
Am Tag zuvor waren Janne und Borghild mittags in Trondheim an Bord gegangen und fuhren nordwärts. Borghild würde in wenigen Stunden in Bodø aussteigen und die Feiertage dort bei ihrer Familie verbringen. Janne musste noch anderthalb Tage weiterfahren und würde am Pfingstsamstag gegen 23 Uhr in Kongsfjord eintreffen. Seit ihrem letzten Besuch bei ihren Eltern war viel Zeit vergangen. An Ostern, das sie gern mit ihnen verbracht hätte, war Janne zum Dienst eingeteilt gewesen. Umso mehr freute sie sich auf das Wiedersehen, dem sie allerdings auch ein wenig bang entgegensah. Sie hatte ihren Eltern noch nicht davon erzählt, dass sie die Stelle bei der Hurtigruten gekündigt hatte, Norwegen verlassen, monatelang auf hoher See verbringen und nur noch selten die Gelegenheit haben würde, ihre Heimat zu besuchen.
Sie wollte es ihnen persönlich mitteilen. Es war ihr wichtig, ihr Einverständnis zu erhalten. Auch wenn sie längst volljährig war – etwas gegen den Willen von Vater und Mutter durchzusetzen, widerstrebte Janne. Nicht zum ersten Mal wünschte sie sich, Geschwister zu haben. Dann hätten die Erwartungen ihrer Eltern nicht allein auf ihren Schultern gelastet.
Einige Wochen zuvor war der Traum in Erfüllung gegangen, den sie mit ihrer Freundin Borghild teilte: Eines Tages die Weltmeere zu bereisen und ferne Länder kennenzulernen. Sie hatten in einer Zeitung eine Annonce der P&O-Orient Line Ltd. entdeckt, die für einen neu in Dienst gestellten Passagierdampfer Personal suchte. Janne und Borghild hatten ihr Glück kaum fassen können, als ihre Bewerbungen zügig mit Zusagen beantwortet worden waren.
»Wie es wohl sein wird, auf einem Schiff zu arbeiten, das über zweitausend Gästen Platz bietet?«
»Das hab ich mich auch gerade gefragt«, antwortete Borghild.
»Und dazu kommen ja noch die rund fünfhundert Crewmitglieder. Zehnmal so viele wie auf diesem Dampfer«, sagte Janne.
»Mit denen wir monatelang zusammen sein werden, kein Personalwechsel wie bei der Hurtigruten.«
»Das wird alles so aufregend.« Janne strahlte ihre Freundin an. »Ich kann es kaum glauben, dass wir bereits Anfang Juni in Richtung Südhalbkugel unterwegs sein werden.«
»Weit weg von der Enge, die mir hier oft die Luft abschnürt.« Borghild atmete tief durch. »Wenn ich doch nur schon den Besuch bei meinen Eltern hinter mir hätte. Garantiert haben sie wieder irgendeinen grässlichen Burschen aufgetrieben, den sie mir als Heiratskandidaten unterjubeln wollen. Damit ich nicht als alte Jungfer ende.«
»Mit fünfundzwanzig?«, rief Janne. »Das ist doch nicht alt.«
»Verklickere das mal meiner Mutter. Die war bereits mit neunzehn Jahren unter der Haube und will endlich Enkelchen haben.« Sie zuckte mit den Achseln. »Da kann sie lange warten. Ich will erst mal was von der Welt sehen. Und ob ich je eine Familie gründen werde?« Sie schob die Unterlippe vor. »Sicher nicht, wenn es bedeutet, ein Dasein wie meine Mutter zu fristen. Als treusorgendes Faktotum, das seinem Mann jeden Wunsch von den Lippen abliest und seinen Lebenszweck darin sieht, eine perfekte Hausfrau zu sein.« Sie grinste. »Da bleibe ich lieber solo.«
»Macht es dir denn gar nichts aus, wenn deine Eltern deine Entscheidung nicht billigen?«
»Lieber wär’s mir natürlich, wenn sie mir ihren Segen geben«, antwortete Borghild. »Aber falls sie es nicht tun, ändert das nichts an meinem Entschluss.« Sie sah Janne prüfend an. »Was ist mir dir? Muss ich befürchten, dass du einen Rückzieher machst, wenn deine Eltern nicht einverstanden sind?«
»Das wird schon nicht passieren«, sagte Janne mit mehr Überzeugung in der Stimme, als sie verspürte. »Was sollten sie dagegen haben, dass ich mich beruflich weiterentwickle?«
»Meine Rede!«, rief Borghild. »Unsere Eltern haben allen Grund, stolz auf uns zu sein. Wären wir Männer, würden sie keine Sekunde zögern.«
»Stimmt, ich finde es auch ungerecht, dass man Söhne und Töchter mit zweierlei Maß misst.«
»Aber jetzt winkt uns die Freiheit.« Borghild hob ihre Kaffeetasse und prostete Janne zu.
Am Wochenende nach Pfingsten würden sie ihre erste Fahrt antreten. Zuvor sollten sie in London ihre Arbeitsverträge unterschreiben und anschließend nach Southampton weiterfahren, von dessen Hafen die »MS Oriana« in See stechen würde. Der Ozeandampfer war erst wenige Monate im Einsatz und hatte die Aufgabe, das Vereinigte Königreich mit Australien und Neuseeland zu verbinden. Die Hinfahrt führte durch den Suezkanal, zurück ging es über Neuseeland, den Pazifischen Ozean, Kanada und die USA. Nach der Passage durch den Panamakanal würde schließlich der Atlantik überquert und der Heimathafen Southampton angelaufen.
Die »MS Oriana« war nicht nur das größte Schiff der Orient-Linie, sondern auch das schnellste, weswegen sie mit dem Golden Cockerel (Goldenen Hahn) ausgezeichnet worden war. Mit ihrer maximalen Geschwindigkeit von über 30 Knoten hatte sich die Reisezeit nach Australien von achtundzwanzig Tagen auf drei Wochen verkürzt. Die »MS Harald Jarl« brachte es im Vergleich gerade einmal auf achtzehn Knoten.
»Wir werden so viele unbekannte Gegenden sehen«, sagte Borghild. »Und die erste Etappe unseres Abenteuers dürfen wir sogar in einem Flugzeug zurücklegen.« Sie rieb sich mit einem vergnügten Lächeln die Hände.
Ihr künftiger Arbeitgeber zahlte nicht nur den Flug vom 1955 eröffneten Bergen Lufthavn, sondern bot darüber hinaus an, seinen neuen Angestellten eine Unterkunft für ihre Aufenthalte in England zur Verfügung zu stellen.
»Bist du schon mal geflogen?«, fragte Janne.
Borghild schüttelte den Kopf. »Noch eine Premiere. Ich kann es kaum erwarten.«
»Ich hab, ehrlich gesagt, etwas Angst davor.« Janne schluckte trocken. »Ich bevorzuge es, festen Boden unter den Füßen zu haben.«
Borghild lachte auf. »Wie auf den Postschiffen, wenn sie bei Sturm wie wild im aufgepeitschten Meer auf und ab tanzen?«
»Hast ja recht.« Janne schmunzelte. »Ich bin jedenfalls froh, dass wir zusammen reisen und gemeinsam all das Neue erleben werden.«
»Darauf freue ich mich auch.« Borghild beugte sich vor und legte kurz ihre Hand auf Jannes Unterarm. »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit meiner besten Freundin ans andere Ende der Welt zu schippern.«
Am Samstagabend stand Janne lange vor Erreichen ihres Ziels an der Reling und betrachtete die Varangerhalbinsel, an deren Küste sie entlangfuhren. Diese lag wie die Nordkinnhalbinsel, auf der sie zuvor einige kleine Häfen angelaufen hatten, östlich der Insel Magerøy mit dem Nordkap, das sie um die Mittagszeit passiert hatten.
An vielen Berghängen sah Janne noch Schneefelder, die in der mittlerweile tief über dem Horizont stehenden Sonne, die seit gut einer Woche gar nicht mehr unterging, rotgolden glitzerten. Am Himmel trieb der böige Wind weiße Wölkchen vom Meer landeinwärts. Janne hatte den Reißverschluss ihres Anoraks hochgezogen und war froh, Mütze und Schal nicht im Koffer verstaut zu haben. Bei ihrer Abfahrt in Trondheim war es fast zehn Grad wärmer gewesen als hier im hohen Norden mit seinem subpolaren Klima.
Die felsigen Böden von Varanger wurden nur spärlich von Pflanzen bewachsen, an Ackerbau war nicht zu denken. Dennoch lebten im Inneren der Halbinsel einige Sámi-Familien, deren Rentiere sich von Flechten und Moosen ernährten. Janne war den Angehörigen dieses indigenen Nomadenvolkes nur selten begegnet. Zuweilen kamen sie in eines der Fischerdörfer an der Küste, um Fleisch, Felle sowie Schnitzereien aus Rentierknochen und ‑geweihen gegen Lebensmittel und andere Dinge einzutauschen, die sie nicht selbst erzeugen konnten.
Endlich bog die »MS Harald Jarl« in den Kongsfjord ein. Als Janne die kleine Insel mit dem Leuchtturm und dem weiß getünchten Wohngebäude erblickte, die vor der Küste der Halbinsel Veines lag, beschleunigte sich ihr Herzschlag. Es war eine Weile her, seit sie das letzte Mal die Gelegenheit gehabt hatte, im Vorbeifahren ihr Elternhaus auf Fyrøya zu sehen. Auf der nordgehenden Tour der Hurtigrutendampfer lag Janne meistens nach einem langen Arbeitstag im Tiefschlaf, wenn die Schiffe den Hafen des Dorfes Kongsfjord nachts kurz nach elf Uhr erreichten. Und auf der Fahrt zurück nach Bergen hatte sie nach dem Abendessen noch alle Hände voll mit dem Aufräumen und Putzen der Küche zu tun, während der kleine Fischerort gegen 21:30 Uhr angelaufen wurde.
Das Leuchtfeuer, das ihr Vater wartete, diente den Fischern der Umgebung und den Kapitänen größerer Schiffe – darunter den Postdampfern – zur Orientierung beim Anlaufen von Kongsfjord. Im letzten Sommer hatten Ornithologen, die regelmäßig die reichen Vogelbestände der Leuchtturminsel untersuchten, eine Brücke errichten lassen, um auch ohne Boot, vor allem bei widrigen Wetterverhältnissen, zu ihrem Beobachtungsstützpunkt gelangen zu können.
Bald erblickte Janne die Häuser von Kongsfjord, das einst wegen seines Hafens und wegen der Nähe zu ergiebigen Fischvorkommen gegründet worden war. Allein die Halbinsel Veines schützte den Ort vor der tosenden Brandung der Barentssee und den Nordwinden. Erst zwei Jahre zuvor war ein befestigter Weg eingeweiht worden, der das Dörfchen mit dem gut dreißig Kilometer westlich gelegenen Fischerdorf Berlevåg sowie dem weiter südlich verlaufenden riksvei 50 verband, der Hauptstraße zwischen Oslo und Kirkenes. Zuvor war Kongsfjord wie viele andere Küstensiedlungen jenseits des Nordkaps nur über den Seeweg erreichbar gewesen.
Janne ließ ihren Blick über die Menschen wandern, die am Kai warteten, und entdeckte schließlich die vertrauten Gestalten ihrer Eltern, die Hand in Hand nebeneinanderstanden. Einige Minuten später rannte sie zu ihnen, ließ Koffer und Reisetasche fallen und schloss sie in die Arme.
»Ich bin so froh, euch endlich …« Janne blieben ihre Worte im Hals stecken, als sie sich von den beiden löste. Der Anblick ihres Vaters Sverre erschreckte sie zutiefst. Sein Gesicht war blass, die Wangen eingefallen, die Lippen bläulich. Dunkle Ringe lagen unter seinen Augen. Mit seinem abgemagerten Körper und der gebeugten Haltung wirkte er weitaus älter als gerade mal sechzig Jahre. Vor allem der rasselnde Atem versetzte Janne in Angst. Sie suchte den Blick ihrer Mutter, die unmerklich den Kopf schüttelte und mit den Lippen ein lautloses »Nicht jetzt« formte.
Janne griff nach ihrem Gepäck und ging hinter ihren Eltern her. Ragna Moen, die ihrem Mann nur bis zur Schulter reichte, hatte ihren Arm um dessen Taille gelegt. Um ihn zu stützen, begriff Janne. Als könne er sich kaum allein aufrecht halten. Panik stieg in ihr auf.
Dass ihr Vater seit Jahren »etwas schwach auf der Brust« war, wie er es nannte, gehörte zu ihm wie der Kautabak, die rot-blau gestreiften Halstücher oder seine Angewohnheit, leise vor sich hin zu summen, wenn er sich auf eine Arbeit konzentrierte.
Ursprünglich hatte Sverre Moen bei der Hurtigruten als Kapitän gearbeitet. Anfang der 1930er-Jahre war er jedoch nach einer schweren Lungenentzündung, die er nur knapp überlebt hatte, nicht mehr imstande gewesen, seinen Beruf weiter auszuüben. Um seinem geliebten Meer und den Schiffen weiterhin nahe sein zu können, hatte er die Stelle als Leuchtturmwärter angetreten. Ragna, die auf den Postdampfern als Köchin gearbeitet hatte, zog mit ihm auf die Insel, wo Janne 1935 zur Welt kam.
Offensichtlich hatte sich sein Zustand in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Als Janne ihn Weihnachten zum letzten Mal gesehen hatte, war ihr nichts aufgefallen, was diese Entwicklung hätte erahnen lassen.
Sie hievte Koffer und Reisetasche auf die Ladefläche des Goliath Goli, der am Rand der Straße geparkt war, die aus dem Ort hinausführte. Ragna Moen hatte den hellblauen Dreirad-Pritschenwagen im vergangenen Sommer angeschafft, um die Kuchen und süßen Teilchen zu transportieren, mit denen sie die Postschiffe belieferte. Im nahe dem Hafen gelegenen Landhandel Guldbrandsen konnte sie das Gebäck abgeben, das später vom Ladenbesitzer zur Anlegestelle gebracht wurde, wo er die Briefe, Zeitungen und Pakete für die Bewohner von Kongsfjord und Umgebung entgegennahm. In dem um die Jahrhundertwende gegründeten Gemischtwarengeschäft gab es nicht nur Lebensmittel, Seifen, Zahnpasta, Tabak, Spielzeug, Waschmittel, Scheuerlappen und Bohnerwachs, Werkzeuge und Medikamente, sondern auch eine Schusterwerkstatt. Zudem fanden eine Poststelle sowie eine Telegrafenstation unter seinem Dach Platz. Vor dem Haus bot eine Benzinzapfsäule die Möglichkeit zum Tanken.
Bevor die Brücke gebaut worden war, hatte Ragna ein Boot mit Außenbordmotor benutzt. Immer wieder hatte sie die bestellten Backwaren insbesondere in der kalten Jahreszeit nicht zum Festland bringen können, wenn die See zu aufgewühlt war, Schneestürme oder Starkregen herrschten. Zwar gab es auch jetzt Tage, an denen Unwetter eine sichere Autofahrt gefährdeten, im Vergleich zu früher waren die Ausfälle jedoch deutlich zurückgegangen.
Janne quetschte sich auf die Sitzbank neben ihren Vater, auf dessen anderer Seite Ragna am Steuer saß und den Zweitaktmotor startete. Das ohrenbetäubende Knattern erstickte jedes Gespräch im Keim und hielt Janne davon ab, ihren Eltern die Fragen zu stellen, die ihr auf der Zunge brannten: Warum hatten sie ihr die Krankheit des Vaters verschwiegen? Seit wann ging es ihm so schlecht? Und wie waren seine Chancen auf Genesung? Janne starrte aus dem Fenster. Sie hatten die letzten Häuser hinter sich gelassen, fuhren in nördlicher Richtung etwa drei Kilometer zum unweit der ehemaligen Küstenbatterie gelegenen Westufer der Veineshalbinsel und überquerten wenige Minuten später die schmale Brücke hinüber nach Fyrøya.
Der ungeteerte Weg endete auf einer Anhöhe vor dem Anwesen der Familie Moen. Dicht am steil abfallenden Ufer stand der Leuchtturm. Er war Ende des 19. Jahrhunderts aus unverputzten Steinen gemauert worden und mit seinen sieben Metern nicht besonders hoch. Im Gegensatz zu den meisten anderen Küstenfeuern in der Finnmark hatte er jedoch den Krieg unbeschadet überstanden. Janne vermutete, dass die deutschen Besatzer, die sich 1944 vor der Roten Armee aus Nordnorwegen zurückziehen mussten, ihn für unbedeutend gehalten oder in der Hektik vergessen hatten. Das Gleiche galt wohl auch für das Örtchen Kongsfjord, das ebenfalls wie durch ein Wunder unversehrt davongekommen war.
Auf ihrem Marsch Richtung Süden war die Wehrmacht Hitlers Befehl gefolgt, alles zu vernichten, was dem Feind irgendwie nützlich sein konnte. Dieser Taktik der »verbrannten Erde« fielen so gut wie alle Privathäuser, Kirchen, Fabriken und Fischfarmen zum Opfer, Nutztiere wurden massakriert, Vorräte, die von den Deutschen nicht weggeschleppt werden konnten, gingen in Flammen auf, und Fischerboote wurden versenkt. Einheimischen, die ihr Zuhause nicht verlassen wollten, drohte die Erschießung.
Janne konnte sich noch gut an die Angst erinnern, die sie als Neunjährige ausgestanden hatte, als die Soldaten auch ihre Familie gezwungen hatten, ihr Haus zu verlassen. Zusammen mit den Bewohnern von Kongsfjord und anderer Fischerdörfer der Gegend waren sie auf einem Schiff in den Süden transportiert worden und hatten den Rest des Krieges sowie die ersten Monate danach auf einem Bauernhof im Hinterland von Trondheim verbracht.
Sobald sie nach Fyrøya zurückgekehrt waren, hatte Sverre das zweistöckige Wohnhaus errichten lassen, das seiner Familie mehr Platz und Komfort bot als die engen Räume in dem runden Leuchtturm. Die unteren nutzte seine Frau fortan als Backstube und Vorratskammer, die beiden Zimmer im ersten Geschoss wurden zeitweise an die Vogelbeobachter vermietet. Nach dem Bau der Brücke hatte Ragna begonnen, bei gutem Wetter Tagesausflügler und Touristen auf einer kleinen Terrasse am Rand des Steilufers mit Kaffee und Kuchen zu bewirten. Seit einigen Jahren hielt sie außerdem ein paar Milchziegen und Hühner, für die Sverre einen Stall hinter dem Haus gebaut hatte.
Nach ihrer Ankunft waren sie sofort schlafen gegangen, Janne hatte keine Gelegenheit erhalten, sich nach dem Gesundheitszustand ihres Vaters zu erkundigen. Sobald sie am nächsten Morgen Schritte auf der Treppe und gleich darauf Geschirrklappern hörte, eilte sie aus ihrem Zimmer, das neben dem ihrer Eltern lag, nach unten zur Küche.
»Warum hast du mir nichts gesagt, Mutter?«, platzte es aus Janne heraus.
Ragna bereitete gerade das Frühstück vor, Sverre war noch nicht aufgestanden. Das passte nicht zu ihm. Es musste ihm wirklich schlecht gehen. Auszuschlafen oder sich nachmittags hinzulegen war für Jannes Vater selbst an Feiertagen stets ein Zeichen von mangelnder Selbstdisziplin gewesen. Spätes Aufstehen oder ein Nickerchen am helllichten Tag waren seiner Überzeugung nach allenfalls für kleine Kinder, stillende Mütter und sehr alte Menschen vertretbar.
»Es tut mir leid«, sagte Ragna. »Aber ich musste ihm versprechen, dir vorerst nichts zu sagen. Er war so zuversichtlich, dass es ihm bald wieder besser gehen würde. Und da wollte er dich nicht unnötig in Sorge versetzen.
»Seit wann ist er denn so krank?«
»Ganz genau weiß ich das gar nicht. Auch mir gegenüber hat er lange alles runtergespielt.«
Jannes Mutter hob den Deckel von einem Topf und rührte durch die Hafergrütze. Es roch nach Zimt. Unwillkürlich leckte sich Janne die Lippen. Gleichzeitig schämte sie sich. Wie konnte sie in diesem Moment ans Essen denken?
»Das ist so typisch für pappa«, murmelte sie.
»Das kannst du laut sagen.« Ragna drehte sich zu Janne. »Bis der mal zugibt, dass es ihm nicht gut geht.« Sie presste die Lippen aufeinander. »Als er es nicht mehr leugnen konnte, musste ich trotzdem noch ewig mit Engelszungen auf ihn einreden, bis er endlich bereit war, sich untersuchen zu lassen.«
»Von Doktor Bergson? Praktiziert der noch?« Vor Jannes innerem Auge erschien das faltige Gesicht des alten Arztes, den sie als Kind wegen seines weißen Bartes und den buschigen Augenbrauen für einen Bruder des Weihnachtsmannes gehalten hatte.
»Nein, er hat schon vor zwei Jahren seine Praxis aufgegeben. Leider hat er keinen Nachfolger gefunden. Darum mussten wir nach Kirkenes ins Krankenhaus.«
»Schlimm, wie schlecht hier oben die medizinische Versorgung ist«, sagte Janne.
»Will halt kaum jemand hier als Arzt arbeiten.« Ragna hob die Schultern.
»Was haben sie im Krankenhaus gesagt?«, fragte Janne.
»Dass Sverre dringend eine Klimaveränderung braucht. Man hat ihm einen Kuraufenthalt weiter unten im Süden empfohlen.«
»Eine Kur?« Janne verengte die Augen. »Das wird pappa niemals …«
»O doch, er hat eingesehen, dass er sich seine Abneigung gegen so eine dekadente Maßnahme nicht länger leisten kann.«
»Dann geht es ihm wirklich sehr schlecht«, stellte Janne fest und ließ sich auf eine der beiden Bänke sinken, die den Ecktisch unter dem Fenster einrahmten.
»Ja, das ist leider der Fall.« Ragna setzte sich über Eck zu ihr auf einen Stuhl.
»Was genau fehlt ihm denn?«
»Ich dachte, dass er Tuberkulose haben könnte«, antwortete Ragna. »Da gibt es ja mittlerweile gute Medikamente.«
»Aber?«
»Dein Vater leidet unter einer Lungenfibrose.«
»Fibrose? Nie gehört«, sagte Janne. »Klingt aber beunruhigend.«
»Das ist es auch.« Ragna seufzte. »Der Doktor hat uns erklärt, dass bei dieser Krankheit die Lunge durch chronische Entzündungen des Bindegewebes angegriffen wird. Dadurch vernarbt diese und versteift zunehmend. Das beeinträchtigt die Lungenfunktion, weil der Sauerstoff schlechter umgesetzt werden kann. Und das führt zu Kurzatmigkeit und Atemnot.«
»Ist das heilbar?«
»Leider nicht. Man kann lediglich das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen.«
»O mein Gott, das ist ja furchtbar!« Janne sah ihre Mutter erschrocken an. »Wie geht es denn jetzt weiter?«
»Wie gesagt, zunächst soll Sverre in einem Sanatorium aufgepäppelt werden. Der Arzt hat seine Beziehungen spielen lassen und ein Zimmer im ›Glittre Sanatorium‹ für uns reservieren lassen. Das liegt in Nittedal, nicht weit von Oslo entfernt.«
»Uns?«
»Ja, ich werde deinen Vater begleiten.«
Janne zog die Stirn kraus. »Und was ist mit dem Leuchtturm? Und der Bäckerei?«
»Für die Wartung des Leuchtfeuers haben wir schon einen Mann gefunden, der für Sverre einspringt. Er heißt Mikkel Balto und scheint ein zuverlässiger, fleißiger Bursche zu sein«, antwortete Ragna. »Er wird morgen oder übermorgen zu uns stoßen und in die Wohnräume im Turm einziehen. Und was die Bäckerei, unsere Tiere und das Café betrifft.« Sie hielt kurz inne und sah Janne in die Augen. »Da müsstest du ran.«
»Ich?« Janne spürte, wie sich ihr Zwerchfell anspannte. »Das geht nicht. Ich muss …«
»Dein Chef hat sicher Verständnis, wenn du ihn um ein paar Wochen unbezahlten Urlaub bittest. Es handelt sich schließlich um einen familiären Notfall.«
»Aber ich wollte …« Janne unterbrach sich, als sie sah, wie sich die Miene ihrer Mutter verfinsterte.
»Wir können es uns nicht leisten, den Vertrag mit der Hurtigruten nicht zu erfüllen«, sagte diese. »Wenn wir die Lieferungen aussetzen, müsste ich nicht nur eine Konventionalstrafe zahlen, sondern liefe auch Gefahr, meinen wichtigsten Kunden zu verlieren.« Sie fixierte Janne. »Und dass ich deinen Vater jetzt nicht allein lassen kann, verstehst du doch, oder?«
»Natürlich.« Janne rang sich ein Lächeln ab. »Ihr könnt auf mich zählen.«
Das war’s mit dem Traum von der weiten Welt, dachte sie und biss sich in die Unterlippe.
Ragna erhob sich, holte drei tiefe Teller aus einem Buffetschrank und verteilte sie auf dem Tisch. »Sagst du bitte deinem Vater, dass wir gleich essen.«
»Mach ich.« Janne stand auf.
»Und dann musst du uns unbedingt berichten, wie es dir in den letzten Wochen ergangen ist, und was du alles erlebt hast.«
Janne nickte und unterdrückte ein Seufzen. Das wichtigste Ereignis würde sie nicht erwähnen: die in greifbare Nähe gerückte Erfüllung ihres Traums, der soeben geplatzt war. Davon zu erzählen würde nichts an der Forderung ihrer Mutter ändern. Für sie war es selbstverständlich, dass Janne zur Stelle sein und ihre Eltern in dieser schwierigen Situation nicht im Stich lassen würde.
Was du dir im Übrigen auch nicht verzeihen könntest, flüsterte ein Stimmchen in Janne. Du bist eben nicht so wie Borghild, die sich von solchen Erwartungen freigemacht hat.
3
Sömmerda, Januar 2024
»So muss es Leuten gehen, die feststellen, dass eine ihnen nahestehende Person ein Doppelleben führt.« Andreas stand auf und streckte die verspannten Glieder. »So langsam glaube ich, dass ich meinen Vater überhaupt nicht gekannt habe. Echt ein beschissenes Gefühl.«
»Das kann ich gut verstehen.« Jule erhob sich ebenfalls. »Ich begreife einfach nicht, warum er so ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit gemacht hat.«
»Ich kann mir das nur so erklären, dass das Ereignis, das zu diesem Bruch in seinem Leben geführt hat, ganz furchtbar für ihn war.«
»Und er es verdrängen, einen Schlussstrich ziehen und hier in Sömmerda neu anfangen wollte?« Jule zog die Stirn kraus. »Wirklich gelungen ist ihm das ja nicht. Du und Oma Beate habt ihn mir immer als melancholisch und in sich gekehrt beschrieben. Ein Neustart in ein glückliches Leben sieht anders aus.«
»Hoffentlich erfahren wir hier mehr.« Andreas deutete auf die Sachen, die sich in dem Geheimfach befanden. »Jetzt lass uns aber erst mal was essen. Mit leerem Magen denkt es sich nicht gut.«
Jule kannte ihn gut genug, um sich von seinem lockeren Tonfall nicht täuschen zu lassen. Seine angespannten Kiefermuskeln verrieten ihr, wie sehr ihn der Fund im Schrank aufwühlte. Während sie ihm mit der Kiste und der Aktenmappe mit den Aufzeichnungen von Opa Rainer folgte, fragte sie sich, wie sie sich in der Situation ihres Vaters wohl fühlen würde. Wenn sie nach dessen Tod herausfände, dass er ihr wichtige Ereignisse aus seinem Leben vorenthalten hatte. Vermutlich wäre sie enttäuscht über sein mangelndes Vertrauen. Und traurig, dass es keine Gelegenheit mehr gäbe, die Wahrheit aus seinem Mund zu erfahren.
Jule kannte ihren Großvater nur aus Erzählungen und einigen gerahmten Fotos, die Oma Beate in ihrem Schlafzimmer aufgehängt hatte. Sie stammten alle aus der Zeit ihrer Ehe, angefangen mit einem Hochzeitsbild von 1965, auf dem die Braut unübersehbar schwanger gewesen war, und der Bräutigam ernst in die Kamera geschaut hatte. Kurz darauf war Andreas zur Welt gekommen und auf dem Arm seines sichtlich stolzen Vaters abgelichtet worden – das einzige Foto, auf dem Rainer entspannt lächelte.
»Was wissen wir bis jetzt?«, fragte Jule eine Stunde später. »Beziehungsweise, was wissen wir noch nicht?«
Sie saß ihrem Vater gegenüber am Küchentisch. Nach dem Essen hatten sie eine Weile schweigend in den alten Dokumenten gelesen. Nun griff Jule nach einem Notizblock, den ihre Großmutter für Einkaufslisten und andere Erledigungen verwendet hatte, und schrieb mit dem dazugehörenden Bleistift auf das oberste Blatt: Offene Fragen.