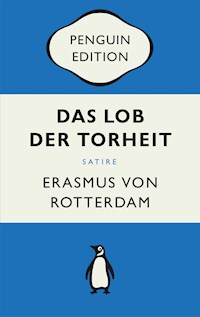
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Penguin Edition
- Sprache: Deutsch
Ein Meisterwerk der Ironie und Satire
Wer spricht nicht über die Dummheit der Menschen. Doch wie kommen wir dazu, über die Dummheit zu lachen? Gäbe es ohne sie doch keine Leidenschaft und keine Liebe. Erst die Torheit lässt unser Leben erträglich werden. – Launig und hochironisch, mit poetischem wie provokantem Blick auf unsere Welt ergreift hier die Torheit höchstselbst das Wort und führt uns in einer einzigartigen Lobrede unsere Schwächen und Laster vor Augen. Denn: Torheit ist die wahre Weisheit, eingebildete Weisheit ist Torheit.
Erstmals 1511 gedruckt, ist Erasmus von Rotterdams »Lob der Torheit« ein Hauptwerk des Humanismus und bis heute ein Weltbestseller.
PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt. – Ausgezeichnet mit dem German Brand Award 2022
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Große Emotionen, große Dramen, große Abenteuer – von Austen bis Fitzgerald, von Flaubert bis Zweig.Ein Bücherregal ohne Klassiker ist wie eine Welt ohne Farbe.
Erasmus von Rotterdam (1469–1536) wurde als unehelicher Sohn eines Geistlichen geboren. 1487 trat er dem Augustinerorden bei, studierte in Paris und England Theologie, Philosophie, Griechisch und Hebräisch. Zunächst stand er der Reformationsbewegung nahe, wurde wegen seiner kirchenkritischen Äußerungen 1517 durch den Papst sogar von seinem Klostergelübde entbunden. Später überwarf er sich jedoch mit Luther. Erasmus gilt als herausragender Vertreter des europäischen Humanismus.
«Die Basis aller literarischen Giftspritzerei … Gäbe es eine Bestsellerliste für Bücher voll Lebensklugheit und Esprit, Das Lob der Torheit würde ganz oben stehen.» Andreas Trojan, SWR 3
«Wer wissen will, was Humanismus sein kann, der lese Erasmus von Rotterdam. Sein Lob der Torheit zeigt den eleganten Polemiker … leichtfüßig, ironisierend, anschaulich.» Kurt Flasch, FAZ
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Erasmus von Rotterdam
DAS LOB DER TORHEIT
Aus dem Lateinischen übersetzt und mit einem Nachwort von Kurt Steinmann
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Moriae Encomium.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2002 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Regg Media in Adaption der traditionellen Penguin Classics Triband-Optik aus England
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-28234-9V001
www.penguin-verlag.de
Erasmus von Rotterdam grüßt seinen Freund Thomas Morus
Als ich mich jüngst auf der Rückreise von Italien nach England befand, wollte ich all die Zeit, die ich zu Pferde sitzen musste, nicht mit nichtssagenden und seichten Unterhaltungen vergeuden, sondern zog es vor, mehr als nur einmal Betrachtungen über unsere gemeinsamen Studien anzustellen und in der Erinnerung an unsere überaus gelehrten und liebenswerten Freunde zu schwelgen, die ich hier1 zurückgelassen hatte. Von all diesen tratest du mir, mein lieber Morus, am häufigsten vor mein inneres Auge: Ich pflegte ja aus der Ferne nicht weniger herzlich an dich zu denken als damals, da ich den Umgang mit dir fast täglich genoss, der, so wahr ich lebe, das Köstlichste ist, was mir je in meinem ganzen Leben zuteilwurde. Da ich also glaubte, unbedingt etwas schaffen zu müssen, die Umstände aber zu ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit wenig geeignet schienen, verfiel ich darauf, zum Zeitvertreib einen Lobpreis auf die Torheit zu schreiben. Welche Pallas2, so wirst du fragen, hat dich auf diese Idee gebracht? Zunächst legte mir dies dein Familienname nahe, der dem Wort moria3 so ähnlich ist, wie du selbst mit dem Inhalt des Wortes nichts zu tun hast. Damit hast du nach dem Urteil aller aber auch wirklich nicht das Mindeste zu tun. Ferner, so vermutete ich, werde diese Spielerei meines Geistes besonderen Beifall bei dir finden, da du dich für gewöhnlich an Scherzen dieser Art, das heißt an solchen, wenn ich mich nicht täusche, die nicht gehaltlos und nicht völlig fade sind, außerordentlich freust und überhaupt im alltäglichen Leben auf gewisse Weise die Rolle Demokrits4 spielst. Obgleich du dich durch deine außerordentlich scharfe Intelligenz denkbar weit vom einfachen Volk abhebst, verstehst du es doch – und es bereitet dir dabei noch Freude –, dank einer unglaublichen Herzlichkeit und Freundlichkeit bei allen in jedwedem Gespräch den richtigen Ton zu treffen.5 Du wirst also diese bescheidene Stilübung nicht nur wohlwollend aufnehmen als eine Erinnerungsgeste deines Freundes, sondern wirst sie auch in sichere Obhut nehmen, denn da sie ja dir gewidmet ist, gehört sie mir schon nicht mehr.
Es wird nämlich vermutlich nicht an Kritikastern fehlen, die herummäkeln, derartige Scherze seien teils zu leichtfertig, als dass sie sich für einen Theologen ziemten, teils zu bissig, als dass sie sich mit der christlichen Zurückhaltung vereinbaren ließen; sie werden zetern, ich erweckte die alte Komödie6 oder einen gewissen Lukian7 wieder zum Leben und hechelte alles mit bissiger Schärfe durch. Wer aber an der inhaltlichen Oberflächlichkeit und am spaßigen Charakter der Darstellung Anstoß nimmt, den bitte ich zu bedenken, dass ich damit keine Vorreiterrolle spiele, sondern dass schon vor langer Zeit bedeutende Autoren in dieser Weise verfahren sind. Vor vielen Jahrhunderten dichtete Homer zum Spaß den «Froschmäusekrieg»,8 Vergil die «Mücke» und das «Kräuterkäsegericht»,9 Ovid die «Nuss».10 Busiris11 haben Polykrates und auch dessen Kritiker Isokrates gelobt, Glaukos schrieb ein Preislied auf die Ungerechtigkeit,12 Favorinus auf Thersites und das viertägige Fieber,13 Synesios auf die Glatze,14 Lukian auf die Fliege und das Schmarotzertum.15 Seneca trieb dichtend ein närrisches Spiel mit der Apotheose des Kaisers Claudius,16 Plutarch schrieb einen Dialog zwischen Gryllos und Odysseus,17 Lukian und Apuleius priesen den Esel,18 und irgendjemand verfasste das Testament des Schweinchens Grunnius Corocotta,19 das auch der heilige Hieronymus erwähnt.
Mögen demnach jene Kritiker, wenn ihnen der Sinn danach steht, sich einfach vorstellen, ich hätte zum Zeitvertreib Schach gespielt oder, wenn sie so wollen, auf meiner Schreibfeder, meinem Steckenpferd, einen langen Ausritt unternommen.20 Ist es nicht eine krasse Ungerechtigkeit, wo wir doch einräumen, dass alle Bereiche des Lebens ihnen eigentümliche Spiele kennen, den Werken der Literatur überhaupt keinen Spaß zuzugestehen, zumal wenn diese poetischen Scherze ernsthafte Erkenntnis vermitteln und die kurzweiligen Tändeleien so daherkommen, dass ein Leser, dessen Urteilskraft nicht völlig abgestumpft ist, daraus bedeutend mehr Nutzen zieht als aus den finster-strengen und blendenden Darstellungen gewisser Gelehrter, von denen der eine in einer von Zitaten überwucherten Rede die Rhetorik oder Philosophie verherrlicht, ein anderer die Ruhmestaten eines Fürsten aufzeichnet, dieser zum Krieg gegen die Türken anfeuert, jener die Zukunft prophezeit und ein weiterer sich neue wissenschaftliche Traktätchen ausdenkt, lauter Zänkereien um des Kaisers Bart. Wie nämlich nichts einfältiger ist, als mit ernsten Fragen unernst umzugehen, so ist andererseits nichts ergötzlicher, als albernes Zeug so vorzutragen, dass man keineswegs den Eindruck erweckt, Unsinn zu treiben. Andere werden darüber richten, ob mir das gelungen ist; immerhin habe ich, wenn mich die Eigenliebe nicht blendet, die Torheit nicht gänzlich töricht gelobt.
Dem Vorwurf bissigen Spottes möchte ich mit dem Hinweis begegnen, dass sich talentierte Köpfe schon immer die Freiheit herausnehmen durften, sich ungestraft und mit gepfeffertem Witz über das Leben der Menschen im Allgemeinen lustig zu machen, vorausgesetzt, die Freimütigkeit artet nicht in blindwütige Gehässigkeit aus. Umso mehr wundere ich mich darüber, wie verhätschelt heutzutage unsere Ohren sind, die bald fast alles unerträglich finden, was nicht mit feierlichem Anstrich daherkommt. Sodann kann man den einen oder anderen beobachten, dessen Frömmigkeit so verkehrt ist, dass er selbst die heftigsten Schmähungen gegen Christus eher duldet, als dass der Papst oder sein Fürst mit dem harmlosesten Scherz bekleckert wird, vor allem, wenn Andeutungen auf deren Geldquellen gemacht werden. Doch wer die Lebensgewohnheiten der Menschen so durchhechelt, dass er dabei überhaupt niemanden namentlich angreift, ist der, mit Verlaub, in euren Augen ein bissiger Hund oder eher ein Lehrer und Erzieher? Und bitte bedenkt, unter wie vielen Namen ich schon mit mir selbst ins Gericht gehe! Und überdies: Wer keinen Stand unbehelligt lässt, dessen Groll zielt doch augenscheinlich nicht auf einen bestimmten Menschen, sondern auf alle denkbaren Laster. Wenn also jemand lautstark jammert, er sei beleidigt worden, so verrät er damit entweder sein schlechtes Gewissen oder doch zumindest seine Angst. Der heilige Hieronymus hat sich diesbezüglich viel rückhaltlosere und bissigere Scherze erlaubt und dabei gelegentlich sogar diesen oder jenen Namen genannt. Abgesehen davon, dass ich auf Namensnennung völlig verzichte, habe ich zusätzlich meine Ausdrucksweise entschärft, und so wird ein vernünftiger Leser leicht erkennen, dass es mir mehr um das Vergnügen als um bissige Attacken gegangen ist. An keiner Stelle habe ich nämlich wie Juvenal die verborgene Stinkbrühe der Verbrechen aufgerührt, sondern mich bemüht, mehr das Lächerliche als das Scheußliche kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wen nun auch diese Argumente nicht beschwichtigen können, der möge wenigstens daran denken, dass es eine Ehre ist, von der Torheit getadelt zu werden; da ich sie sprechend auftreten ließ, muss sie sich ganz nach ihrer vorgegebenen Rolle richten. Doch wozu setze ich dir, einem so exzellenten Anwalt, all dies auseinander, der du auch in Prozessen, die nicht sehr günstig stehen, höchst erfolgreich zu plädieren weißt? Leb denn wohl, Morus, du Meister wohlgesetzter Rede, und verteidige deine moria mit Tatkraft.
Auf dem Lande, 9. VI. 1508
Die Torheit spricht
Wie abschätzig auch immer die Sterblichen allerorts über mich reden mögen – denn ich weiß genau, in welch schlechtem Ruf die Torheit sogar bei den ärgsten Toren steht –, so bin doch ich es, ich allein, behaupte ich, die durch meine Macht Götter und Menschen heiter zu stimmen vermag. Und hier gleich ein schlagender Beweis: Kaum hatte ich mich vor dieser so vielköpfigen Versammlung zu Wort gemeldet, erstrahlten plötzlich die Gesichter aller in einer geradezu unerhörten und ungewohnten Heiterkeit. Eure Stirnfalten glätteten sich im Nu, und euer vergnügtes und gefälliges Lachen bekundet mir euren Beifall, sodass ihr mir, so zahlreich ich euch hier anwesend sehe, wie die homerischen Götter von Nektar und Nepenthes21 trunken erscheint, während ihr doch vorhin noch betrübt und besorgt dasaßet, als wäret ihr gerade erst aus der Höhle des Trophonios22 zurückgekommen. Wie die erste Morgensonne der Erde ihr schönes und goldenes Antlitz zeigt oder nach einem garstigen Winter ein neuer Frühling mit schmeichelnden Lüften sie belebt, alsbald in alle Dinge ein frisches Aussehen, frische Farbe und in jeder Beziehung jugendlicher Zauber zurückkehrt, so haben sich eure Züge sofort verwandelt, wie ihr mich erblickt habt. Was sonst nämlich bedeutende Redner mit einer ausufernden und in langen Nächten einstudierten Rede kaum je erreichen können, das habe ich allein auf der Stelle durch mein Erscheinen zuwege gebracht.
Weswegen ich aber heute in diesem befremdlichen Kostüm23 auftrete, werdet ihr bald hören, sofern es euch nichts ausmacht, meinen Ausführungen euer Ohr zu leihen, allerdings nicht das Ohr, das ihr für die ehrwürdigen Kanzelredner, sondern ein solches, wie ihr es für die Marktschreier, Possenreißer und Narren zu spitzen pflegt, Ohren, wie sie einst Midas, einer meiner Getreuen, dem Pan zuwandte.24 Mich hat nämlich die Lust gepackt, vor euch ein Weilchen die Sophistin zu spielen, freilich nicht nach der Art jener, die heutzutage Kindern peinigende Spitzfindigkeiten eintrichtern und ihnen eine mehr als weibische Rechthaberei im Falle eines Streites empfehlen, nein, ich will es den Alten gleichtun, die es vorzogen, Sophisten25 genannt zu werden, um so die verrufene Bezeichnung eines Weisen zu vermeiden. Ihr Sinnen und Trachten ging dahin, die Glanztaten von Göttern und Helden in Lobreden zu preisen. Eine Lobrede also werdet auch ihr hören, nicht auf Herkules, auch nicht auf Solon26, sondern – auf mich selbst, das heißt die Torheit.
Ich halte nicht das Geringste von jenen Klüglern, die betonen, es sei ein Gipfel der Narrheit und Unverfrorenheit, wenn einer sich selbst lobt. Es mag so närrisch sein, wie sie wollen, wenn sie nur zugeben, dass es zum Charakter passt. Was aber ist für die Torheit angemessener, als dass sie ihr eigenes Lob ausposaunt und sich selbst die Flöte bläst? Wer könnte mich denn besser darstellen als ich selbst? Keiner, es müsste denn einer sein, der mich besser kennt als ich mich selbst. Freilich halte ich dieses Betragen auch in anderer Hinsicht für viel bescheidener als jenes, welches die große Masse der Vornehmen und Weisen an den Tag legt, die aus einer geradezu abartigen Scham heraus gegen gutes Geld irgendeinen Süßholz raspelnden Redner oder einen schwadronierenden Dichter anzustellen pflegen, um von ihm Lobeshymnen zu hören, das heißt, nichts als Lug und Trug. Dabei spreizt dieser Saubermann wie ein Pfau seine Federn, und der Kamm schwillt ihm, wenn der dreiste Lobhudler ihn, diesen Taugenichts, mit den Göttern vergleicht, wenn er ihn gar als vollkommenes Muster aller Tugenden hinstellt, obwohl er doch weiß, dass jener Lichtjahre davon entfernt ist, wenn er eine alberne Krähe mit fremden Federn27 ausstaffiert, wenn er einen Mohren weiß wäscht, kurz, wenn er aus einer Mücke einen Elefanten macht. Und ich halte es mit dem im Volk geläufigen Sprichwort: «Mit gutem Recht lobt sich selbst, wer keinen andern findet, der ihn lobt.»
Ich wundere mich bisweilen über die Undankbarkeit der Menschen. Oder soll ich es Gleichgültigkeit nennen? Obwohl mir alle hingebungsvoll huldigen und sich meine Segnungen freudig gefallen lassen, ist doch in so vielen Jahrhunderten niemand aufgetreten, der in einer Dankesrede feierlich das Lob der Torheit angestimmt hätte. Dennoch hat es zugleich nicht an Autoren gefehlt, die einen Busiris, einen Phalaris28, das viertägige Fieber, die Fliege, die Glatze und dergleichen Geißeln mit eingehenden und in langen Nächten ausgefeilten Lobeshymnen gepriesen haben – und das nicht ohne große Einbuße an Lampenöl und Schlaf. Von mir hingegen werdet ihr eine Stegreifrede hören, die zwar des stilistischen Schliffs entbehrt, dafür aber umso wahrhaftiger ist. Glaubt nicht, dies sei nur dahergeflunkert, um die geistigen Fähigkeiten zur Schau zu stellen, wie das die Redner allgemein praktizieren. Denn ihr wisst ja: Wenn diese mit einer Rede, an der sie volle dreißig Jahre herumgebastelt haben und die manchmal gar nicht ihr geistiges Eigentum ist, an die Öffentlichkeit treten, schwören sie hoch und heilig, sie hätten sie innerhalb von drei Tagen gleichsam zum Zeitvertreib niedergeschrieben oder sogar nur diktiert. Mich hingegen lockte es immer am meisten, alles zu sagen, was mir gerade auf der Zunge lag.
Es soll nun aber keiner von mir erwarten, dass ich nach dem Brauch dieser herkömmlichen Redner mich selbst mit einer Definition erläutere, und noch viel weniger, dass ich mich begrifflich zergliedere. Beiden Bemühungen wäre nämlich das Scheitern vorbestimmt, sowohl wenn man mich, deren Macht sich so weit erstreckt, mit Begriffsbestimmungen einzuschränken, als auch wenn man mich logisch zu zergliedern versuchte, wo doch alle Welt sich in meiner Verehrung einig weiß.
Indessen, welchen Sinn hat es eigentlich, euch durch begriffliche Abgrenzung gleichsam das Schatten- und Trugbild meiner selbst vor Augen zu stellen, da ihr mich doch leibhaftig hier unter euch von Angesicht zu Angesicht anschauen könnt? Wie ihr seht, bin ich nämlich die wahre Spenderin alles Guten, die man im Lateinischen stultitia, im Griechischen moria nennt.
Doch wozu war es überhaupt nötig, dies hervorzuheben, als ob ich nicht schon in meinen Zügen und auf meiner Stirn, wie man sagt,29 mein Wesen nach außen kehre? Sollte aber jemand behaupten, ich sei Minerva oder Sophia, die Göttin der Weisheit, so könnte er sofort allein durch einen raschen Blick auf mich eines Besseren belehrt werden, auch wenn ich keine Silbe verlauten ließe, ist doch mein Äußeres der untrügliche Widerschein meines Geistes. Schminke und Verstellung haben bei mir nichts zu suchen, und mein Gesicht spiegelt immer meine Gedanken. Ich bleibe mir immer und überall völlig gleich, sodass mich selbst jene nicht verleugnen können, die besonders beflissen für sich Maske und Ehrentitel eines «Weisen» beanspruchen, Affen, die im Purpurgewand, Esel, die in einer Löwenhaut umherstolzieren. Mögen sie sich aber noch so beflissen verstellen, so verraten doch die hier oder dort hervorstehenden Öhrchen ihren Midas.30 Undankbar, beim Herkules, ist auch dieser Menschenschlag: Sie gehören eindeutig zu meinen Anhängern, schämen sich aber doch so sehr, in aller Öffentlichkeit zu meinem Namen zu stehen, dass sie ihn allerorts andern als große Schande vorwerfen. Da sie wirklich Narren ohnegleichen sind und doch als Weise und Philosophen vom Rang eines Thales31 gelten möchten, nennen wir sie darum nicht mit vollem Recht Narrosophen?
Es scheint, dass sie auch in dieser Beziehung unsere zeitgenössischen Redner nachäffen, die sich rundweg für Götter halten, wenn sie wie die Blutegel32 doppelzüngig auftreten, und sie halten es für eine Meisterleistung, in lateinische Reden immer wieder einige griechische Wörtchen wie Glitzersteinchen einzustreuen, selbst dort, wo diese völlig fehl am Platz sind. Gebricht es ihnen aber an Fremdwörtern, so stöbern sie aus vermodernden Folianten vier oder fünf Wortfossile auf, mit denen sie den Geist des Lesers verdunkeln, natürlich zu dem Zweck, dass diejenigen, die die Vokabeln verstehen, immer mehr Wohlgefallen an sich selbst finden, die sie aber nicht verstehen, eben dadurch umso mehr in Erstaunen versetzt werden, je weniger sie sie verstehen. Es ist nun einmal unbestreitbar ein erlesenes Vergnügen meiner Anhänger, mit größter Ehrfurcht zu dem emporzublicken, was von möglichst weit her kommt. Wer etwas ehrgeiziger ist, lächelt verständnisinnig, klatscht Beifall und wackelt wie der Esel mit den Ohren, um bei den andern den Eindruck zu erwecken, er kenne sich mit diesen exotischen Vokabeln bestens aus. Nun, sei es drum!
Aber zurück zum Thema! Den Namen des Mannes wisst ihr nun. Doch welches schmückende Beiwort soll ich ihm geben? Wie wär’s mit Erztor? Denn gibt es einen schicklicheren Namen, mit dem die Göttin Torheit ihre Verehrer, die in ihre Geheimnisse eingeweiht werden, anreden könnte? Da meine Abstammung nicht gerade vielen bekannt ist, will ich mit tatkräftiger Unterstützung der Musen versuchen, sie euch darzulegen. Nicht Chaos, nicht Orkus, nicht Saturn, nicht Japetos oder sonst irgendeiner dieser längst abgetakelten und altersmorschen Götter war mein Vater.33 Nein, Plutos, der Gott des Reichtums, war es, er, der allein der «Vater der Götter und Menschen» ist, mag es auch Hesiod, Homer und sogar Jupiter gar nicht in den Kram passen.34 Ein Wink seiner Augenbrauen genügt, um auch heute noch, wie ehedem, alles, Heiliges und Unheiliges, in einen tollen Wirbel zu stürzen. Seinem Ermessen unterstehen Kriege, Friedensschlüsse, Befehlsgewalten, Ratsentscheide, Rechtsurteile, Wahlen, Eheschließungen, Verträge, Bündnisse, Gesetze, Künste, Scherz und Ernst – ich bin schon ganz außer Atem –, kurz, alle Tätigkeiten der Menschen, ob im Staat oder im privaten Kreis. Ohne seine Mitwirkung würde das ganze Heer der in Dichterköpfen ausgeklügelten Götter, kühner gesagt, sogar die Götterelite35, entweder überhaupt nicht existieren oder sich dann gewiss mit schmaler Hausmannskost bescheiden müssen. Wer sich seinen Zorn zugezogen hat, dem vermag nicht einmal Pallas36 ausreichend zu helfen, wer dagegen seine Gunst genießt, der darf sogar Jupiter, dem Haupt der Götter, den Strick bestellen. «Von diesem Vater abzustammen, rühme ich mich.»37 Und er ließ mich nicht aus seinem Gehirn entspringen wie Jupiter jene finstere und ernste Pallas, sondern er zeugte mich mit Neotes, der leibhaftigen Jugend, der bei Weitem liebreizendsten und witzigsten Nymphe. Er war nicht im schalen Bund der Ehe gefesselt, dem zum Beispiel der lahme Schmied38 seine Geburt verdankt – nein, mein Vater hat sich ihr, was viel reizvoller ist, «in Liebe beigesellt», wie unser Homer sagt. Damit ihr euch aber nicht täuscht: Mein Vater war nicht jener mit einem Bein im Grab stehende, blinde Plutos, wie er uns bei Aristophanes39 entgegentritt, sondern er war der einst kraftstrotzende und immer noch von der Hitzigkeit der Jugend durchglühte Gott, und nicht allein von ihr, sondern noch viel mehr vom Nektar, den er damals bei einem Göttergelage nicht zu knapp und ziemlich unverdünnt in sich hineingeschüttet hatte.
Wollt ihr auch meinen Geburtsort wissen – heutzutage nämlich, meint man, sei es für die edle Abkunft von entscheidender Bedeutung, wo man das erste Wimmern von sich gegeben hat –, so muss ich einräumen, dass ich weder auf der ziellos treibenden Insel Delos40 noch auf dem wogenreichen Meer41 oder in einer gewölbten Höhle42 geboren wurde, sondern auf den Inseln der Seligen43, wo alles ungesät und ungepflügt hervorsprießt. Dort weiß man nichts von Knochenarbeit, von den Gebrechen des Alters oder von Krankheit, und nirgends auf den Feldern sieht man Asphodill, Malven, Zwiebeln, Lupinen, Bohnen oder anderes derartiges Firlefanzgewächs44, wohl aber, was Augen und Nasen auf Schritt und Tritt umschmeichelt: das Zauberkraut Moly45, die Allheilpflanze Panazee, Nepenthes, Majoran, Ambrosia, Lotos, Rosen, Veilchen, Hyazinthen und die Gärtlein des Adonis46. Inmitten solcher Herrlichkeiten wurde ich geboren und begann darum mein Erdendasein keineswegs mit Plärren und Tränenvergießen, sondern lachte meine Mutter sofort innig an.47
Mitnichten missgönne ich dem obersten Gott, dem Saturnsohn Jupiter, dass eine Ziege ihn nährte,48 haben mich doch zwei der drolligsten Nymphen an ihrer Brust genährt: Methe49, ein Spross des Bacchus, und Apaedia50, eine Tochter des Pan. Sie beide seht ihr hier im Gefolge meiner übrigen Begleiterinnen und Zofen. Wenn ihr wirklich auch ihre Namen kennenlernen wollt, bitte sehr, aber von mir werdet ihr sie nur auf Griechisch hören. Die also dort mit den hochgezogenen Augenbrauen, das ist die Eigenliebe. Und diese hier, deren Augen euch gleichsam zulächeln und deren Hände Beifall klatschen, heißt Schmeichelei. Die Dritte dort, die schlaftrunken ist und einzunicken scheint, hört auf den Namen Vergesslichkeit, die nächste, die beide Ellbogen aufstützt und die Hände ineinander verschränkt, wird Faulheit genannt. Die folgende, die mit einem Kranz aus Rosen umwunden und ringsum mit Salben bestrichen ist, ist die Lust, und diese mit ihrem fahrigen und hin und her irrenden Blick der Wahnsinn. Und schließlich trägt diese hier, deren Haut vor Wohlsein glänzt und deren Leib ausladende Rundungen zeigt, den Namen Üppigkeit. Unter diesen Mädchen seht ihr auch zwei Götter, von denen einer Ausgelassenheit und der andere Tiefschlaf heißt. Dank der treuen Mitarbeit dieser Dienerschaft unterwerfe ich alle Welt meiner Macht und bin Königin selbst über Könige.
Über meine Abkunft, Erziehung und mein Gefolge seid ihr nun im Bild. Damit ich aber bei niemandem den Eindruck erwecke, ich würde mir unberechtigterweise den Titel einer Göttin anmaßen, spitzt nun die Ohren und vernehmt, mit welchen Annehmlichkeiten ich Götter und Menschen beglücke und wie weit sich meine göttliche Macht erstreckt. Denn wenn jener Mann51 mit seiner nicht unklugen Bemerkung ins Schwarze traf, erst den Sterblichen das Leben zu erleichtern qualifiziere zum Gott, und wenn verdienterweise die in den Rat der Götter aufgenommen wurden, die den Menschen den Wein- und Getreideanbau oder eine andere ihr Dasein entlastende Errungenschaft gezeigt hatten – warum soll da nicht ich mit gutem Recht «Allererste» unter allen Gottheiten genannt und als solche verehrt werden, ich, die ich allein allen alles reichlich schenke?
Zum Ersten: Was könnte köstlicher, was wertvoller sein als das Leben selbst? Aber dass es entsteht – wer darf das auf der Habenseite verbuchen, wenn nicht ich? Denn nicht die Lanze der Pallas, des Gewaltigen Tochter, und auch nicht die Ägis52 des wolkenballenden Zeus erzeugen das Menschengeschlecht und pflanzen es fort. Nein, der Vater der Götter und König der Menschen höchstpersönlich, der den gesamten Olymp durch einen einzigen Wink erbeben lässt, muss seinen dreizackigen Blitz ablegen und auf seinen grimmigen Titanenblick verzichten, mit dem er je nach Laune alle Götter in Schrecken versetzt, und er muss, der Ärmste, ganz nach Schauspielermanier eine fremde Maske aufsetzen, wenn er einmal Lust hat, das zu tun, was er fast immer tut, nämlich ein Kind zu machen. Die Stoiker erheben ihrerseits den Anspruch, den Göttern am nächsten zu kommen. Aber zeigt mir einen, der dreifach, vierfach oder meinetwegen tausendfach Stoiker ist; dieser muss sich zwar nicht vom Zeichen der Weisheit, seinem Bart, trennen – den die Stoiker übrigens mit den Ziegenböcken gemeinsam haben –, aber doch seine dünkelhaften Augenbrauen senken, seine Stirnfalten glätten, seine stahlharten Maximen über Bord werfen und für ein Weilchen herumblödeln und den Kopf verlieren. Kurz und gut, mich, so behaupte ich, mich muss der Weise aufbieten, wenn er Vater werden will.
Und warum sollte ich eigentlich meinem Naturell entsprechend nicht noch offener mit euch reden? Mit Verlaub, zeugen etwa der Kopf, das Gesicht, die Brust, die Hand, das Ohr, lauter Körperteile, die für anständig gelten, die Götter und Menschen? Ich denke, nein; vielmehr ist es jenes so blöde und so lächerliche Zipfelchen, das man nicht ohne in Gelächter auszubrechen nennen kann, dem das Menschengeschlecht seine Fortpflanzung verdankt. Genau dies ist jener heilige Quell, aus dem alles sein Leben schöpft – und nicht die Vierzahl des Pythagoras53. Und weiter: Welcher Mann, ich bitte euch, fände sich bereit, sein Maul der ehelichen Kandare anzubieten, wenn er, wie die Weisen es in der Regel tun, vorher die Kehrseiten dieses Standes gründlich erwogen hätte? Und welche Frau würde denn noch einen Mann erhören, wenn sie um die gefahrvollen Strapazen der Geburt und um den Verdruss bei der Kindererziehung wüsste oder darüber nachgedacht hätte? Wenn ihr also euer Leben dem Ehestand verdankt, den Ehestand aber meiner Zofe, dem Wahnsinn, so müsstet ihr doch zur Einsicht kommen, in welch tiefer Schuld ihr zweifelsohne bei mir steht. Würde sich eine Frau, die jenes einmal durchgemacht hat, wohl nochmals daran wagen, wenn nicht die göttliche Macht Vergesslichkeit hilfreich auf sie einwirkte? Venus höchstselbst – mag Lukrez54 noch so wortreich protestieren – muss sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ohne mein Eingreifen ihre Wirkung schwach und untauglich ist. Somit ist klar: Unserem rauschhaften und grotesken Spiel entstammen sie alle – die finsteren und wissensstolzen Philosophen, deren Stelle heutzutage diejenigen einnehmen, die das Volk «Mönche» nennt, die in Purpur gehüllten Könige, die frommen Priester und die dreimal hochheiligen Päpste und schließlich auch jene ganze Zunft der Götter von Dichters Gnaden, die mit Mitgliedern so reich gesegnet ist, dass sogar der Olymp, der doch weiß Gott weitläufig ist, sie kaum fassen kann.
Aber es würde meinen Ansprüchen gewiss nicht genügen, wenn man mir bloß die Pflanzstätte und Quelle des Lebens zu verdanken hätte und ich nicht auch zeigen könnte, dass alles, was das Leben lebenswert macht, ausschließlich meiner Leistung und Gunst zuzuschreiben ist. Was aber ist dieses Leben – wenn es denn überhaupt «Leben» genannt werden darf –, wenn man ihm die Lust nimmt? Ihr klatscht mir Beifall. Nun, ich wusste ja, dass niemand von euch so vernünftig (oder so närrisch? – Nein, doch eher so vernünftig) sein würde, dieser Meinung zu sein. Nicht einmal die Stoiker zeigen der Lust die kalte Schulter, wenngleich sie geflissentlich Interesselosigkeit heucheln und diese mit tausend Scheltreden vor dem Volk verteufeln; die Absicht ist klar: Den andern wird die Sache madig gemacht, damit sie selbst umso ausgiebiger der Lust frönen können. Aber beim Jupiter! Diese Heuchler sollen mir doch einmal sagen, welcher Abschnitt des Lebens denn nicht traurig, freudlos, reizlos, fad und mühevoll wäre, wenn man nicht Lust und Vergnügen, das heißt die Würze der Torheit, hinzufügte? Zwar ist Sophokles, den man nicht genug rühmen kann, hinreichend berufen, diese Wahrheit zu bezeugen, er, dessen wunderschöner Preis auf uns bekanntlich lautet: «Im Unverstand liegt ja des Lebens reinstes Glück»,55 doch wir wollen den gesamten Sachverhalt bis in die Einzelheiten ausleuchten.
Zunächst: Wer wüsste nicht, dass die Kindheit der bei Weitem unbeschwerteste und von allen mit der größten Zuneigung bedachte Lebensabschnitt ist? Nun, was an den Kleinen bringt uns dazu, dass wir sie so abküssen, so liebkosen, so umsorgen, dass sogar der Feind sie aus der Not errettet, wenn nicht der verführerische Reiz der Torheit, den die Natur den Neugeborenen vorsätzlich und fürsorglich verliehen hat, damit sie sozusagen durch eine Ausgleichszahlung an Vergnügen die Plagen der Erzieher abmildern und die Gunst der sie Umsorgenden erschmeicheln können? Und dann die Jugendzeit! Wie ist sie doch bei allen beliebt, wie rückhaltlos sind ihr alle gewogen, wie beflissen fördert man sie, wie zuvorkommend streckt man ihr hilfsbereite Hände entgegen! Woher aber hat denn die Jugend ihr so gewinnendes Wesen? Woher anders als von mir? Meinem Liebesdienst hat sie es zu verdanken, dass sie fast keinen Verstand hat und deshalb auch fast keinen Verdruss. Ich will eine Lügnerin heißen, wenn die jungen Menschen nicht binnen Kurzem, sobald sie etwas älter sind und sich durch ihren Umgang mit der Welt und den Erwerb von Kenntnissen ein gewisses Maß an männlicher Verständigkeit anzueignen beginnen, unversehens erleben müssen, wie der Glanz ihrer blühenden Schönheit verwelkt, ihr feuriges Temperament erschlafft, ihre Anmut erkaltet und ihre Lebenskraft sich zersetzt. Und je weiter sich der Mensch von mir entfernt, desto mehr schwinden seine Lebensgeister, bis endlich das beschwerliche und widrige Greisenalter folgt, das nicht mehr nur andern, sondern sogar sich selbst hassenswert ist. Gewiss hielte kein Sterblicher diese Hinfälligkeit aus, wenn nicht wiederum ich voll Erbarmen mit ihrer Not ihnen gnädig zu Hilfe käme und die dem Grab Zutaumelnden noch einmal in die Kindheit zurückriefe, solange es geht, genauso wie die Götter in den Dichtungen die unmittelbar vom Tod Bedrohten durch irgendeine Verwandlung entrücken. So pflegt sie der Volksmund trefflich als «Abermalskinder» zu bezeichnen. Sollte sich aber jemand nach dem Prozedere dieser Verwandlung erkundigen, so will ich ihm selbst diesen Punkt nicht vorenthalten. Zur Quelle meiner lieben Lethe führe ich sie – denn sie entspringt auf den Inseln der Seligen und fließt in der Unterwelt bloß als dünnes Bächlein dahin –, damit sie dort langes, tiefes Vergessen trinken und allmählich, wenn die Drangsal des Lebens gewichen ist, ihre jugendliche Frische wiedergewinnen.
Deine Alten, so wirft man ein, plappern irres Zeug und sind nicht ganz richtig im Kopf. Einverstanden – aber genau das heißt, wieder zum Kind zu werden! Oder heißt jung sein denn etwas anderes, als irres Zeug zu plappern und nicht ganz richtig im Kopf zu sein? Ist es nicht gerade der völlige Mangel an Vernunft, der uns an diesem Alter am meisten fesselt? Wer würde ein Kind denn nicht wie ein Missgebilde hassen und verwünschen, wenn es die Abgeklärtheit eines Mannes besäße? Dem pflichtet auch das vom Volksmund gern zitierte Sprichwort vorbehaltlos bei: «Ein altkluges Knäblein mag ich nicht.»56 Wer hielte es andererseits aus, mit einem Alten in Verbindung zu stehen oder gar geselligen Umgang zu pflegen, der zu seiner umfassenden Lebenserfahrung noch eine ihr ebenbürtige Geisteskraft und Urteilsschärfe mitbrächte?
Deshalb ist der Greis dank meiner Huld närrisch im Kopf. Allein, mein Narr weiß nichts von den quälenden Sorgen, die den Weisen foltern. Im Übrigen ist er ein durchaus witziger Zechbruder. Er spürt nichts von Lebensüberdruss, den ein strammeres Alter kaum verkraftet. Hin und wieder kehrt er wie der Alte aus Plautus’ Komödie zu den berühmten drei Buchstaben57 zurück – ein todunglücklicher Narr, wenn er bei Verstand wäre! Doch bei alledem ist er dank meiner Gunst glücklich, bei seinen Freunden beliebt und ein launiger Spießgeselle. So ist es kein Zufall, dass bei Homer aus dem Mund Nestors die Rede süßer als Honig fließt,58 während die Worte Achills voll Bitterkeit sind,59 und beim gleichen Dichter sitzen die Greise auf den Stadtmauern und ergehen sich mit ihren dünnen Stimmchen in frivolem Geplapper.60 So betrachtet, sind die alten Menschen der Jugend sogar voraus, der bei aller Köstlichkeit doch die Gabe der Rede abgeht und die auf den bevorzugten Zeitvertreib im Leben verzichten muss – aufs Plappern. Nehmt hinzu, dass die Alten gerade an den Jüngsten ihr besonderes Pläsier finden und umgekehrt die Jüngsten die Alten in ihr Herz geschlossen haben, «wie ja immer der Gott den Gleichen hinführt zum Gleichen».61 Was trennt sie denn auch, außer dass der Greis runzliger ist und mehr Geburtstage auf seinem Konto hat? Abgesehen davon ist beiden gemeinsam das helle Haar, der zahnlose Mund, der knirpsige Wuchs, das Verlangen nach Milch, das Stammeln, die Schwatzhaftigkeit, die Albernheit, die Vergesslichkeit, die Zerstreutheit – kurz, alles Übrige. Je mehr der Mensch auf das Greisenalter zugeht, umso mehr nähert er sich wieder der Kindheit, die jenem so ähnlich ist, bis er wie ein Kind, ohne des Lebens überdrüssig zu sein und das Eintreten des Todes wahrzunehmen, aus dem Leben hinauswandelt.
Es komme nun, wer dazu Lust hat, und vergleiche meine Wohltaten mit der Verwandlungskunst der übrigen Götter! Was die im Zorn anrichten, darüber mag ich kein Wort verlieren; aber selbst die von ihnen am meisten bevorzugten Günstlinge verwandeln sie in einen Baum62, einen Vogel63, eine Grille64 oder gar in eine Schlange65, als ob Gestaltwandel und Sterben nicht genau aufs Gleiche hinausliefen! Ich jedoch belasse dem Menschen seine Natur und versetze ihn wieder in die schönste und glücklichste Zeit seines Lebens. Wenn die Sterblichen sich schlechthin jeden Umgang mit der Weisheit versagten und ununterbrochen die Zeit mit mir verbrächten, dann gäbe es überhaupt kein Greisenalter, sondern die Menschen würden in Glück und Segen immerwährende Jugend genießen.
Seht ihr denn nicht, dass diese finsteren Kerle, die sich philosophischem Grübeln oder andern ernsten und verzwickten Geschäften verschrieben haben, meistens noch bevor sie recht zu Jünglingen erblühen, schon vergreist sind, da Sorgen und andauernde unerbittliche Denkanstrengung ihnen offensichtlich nach und nach all ihre geistige Kraft und ihren Lebenssaft aussaugten? Dagegen sind meine lieben Jünger, die Narren, richtige Dickerchen, im Fett glänzend und gut im Fleisch, echte akarnanische66 Schweine, wie man so sagt, und es steht außer Frage, dass sie niemals auch nur die geringste Plage des Alters verspüren würden, wenn sie sich nicht doch mitunter, wie es eben vorkommt, durch den Umgang mit gescheiten Leuten anstecken ließen. Aber das Leben der Menschen lässt es nun einmal nicht zu, dass einer bis ans Ende seiner Tage in jeder Beziehung glücklich ist.
Hinzu kommt das gewichtige Zeugnis des landläufigen Sprichworts, dem zufolge die Torheit das einzige Mittel sei, die so flüchtige Jugend in ihrem eilenden Lauf aufzuhalten und das unerquickliche Alter zu bannen. Es hat schon seinen tieferen Sinn, wenn der Volksmund von den Brabantern67 sagt, sie bauten geistig immer mehr ab, je mehr sie sich dem Greisenalter näherten, während die übrigen Menschen doch für gewöhnlich mit zunehmendem Alter vernünftig werden. Aber es gibt auch kein anderes Volk, das begabter wäre, heiteren Umgang untereinander zu pflegen, und das die Verdüsterung des Alters weniger spürte. Diesen nicht nur hinsichtlich des Siedlungsraumes eng benachbart, sondern auch der Lebensart nach verwandt sind meine Holländer – warum sollte ich sie denn nicht «meine»68 nennen, da sie mich so hingebungsvoll verehren, dass sie sich damit vor aller Welt einen auf mich verweisenden Ehrentitel verdient haben.69 Dessen schämen sie sich ganz und gar nicht, nein, sie brüsten sich damit sogar noch über die Maßen.
Die erzdummen Menschenkinder sollen nun zu einer Medea, Kirke, Venus, Aurora oder ich weiß nicht zu was für einem Quell pilgern,70





























