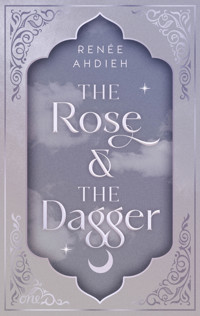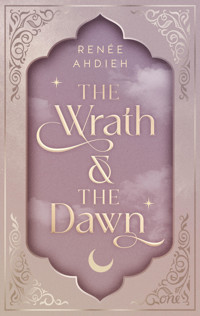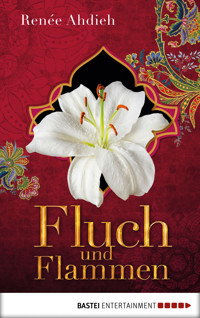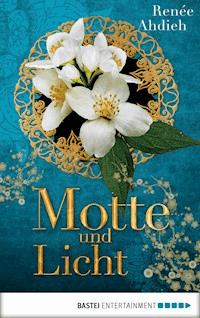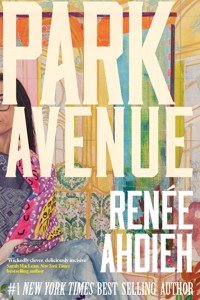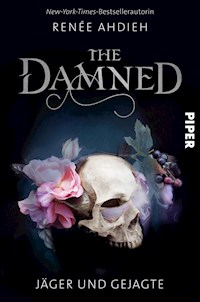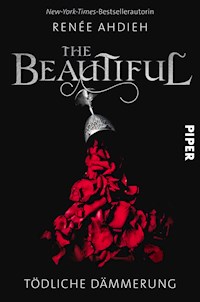5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Samurai-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen, dazu bestimmt, des Kaisers Sohn zu heiraten.
Ein Junge, der den Glauben an das Gute in seinem Herzen begraben hat.
Eine große Liebe, die alles verändern kann.
Mariko, Tochter eines hochrangigen Samurai, weiß, dass sie ihre Zukunft nicht selbst bestimmen darf. Sie ist klug und erfinderisch, aber eben ein Mädchen. Mit 17 wird sie dem Sohn des Kaisers versprochen. Doch auf dem Weg zu ihrer Hochzeit wird ihr Geleitzug vom berüchtigten Schwarzen Klan vernichtet. Mariko überlebt als Einzige und nutzt ihre Chance, dem vorgegebenen Pfad zu entkommen! Als Junge verkleidet schmuggelt sie sich unter die Banditen. Zum ersten Mal in ihrem Leben erntet sie Anerkennung. Und sie verliert ihr Herz - ausgerechnet an den Feind ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungDie sieben Tugenden des Bushidõ: Der Weg des KriegersWie alles begannIllusionen und ErwartungenDas NachtungeheuerKein MädchenDer Drache von KaiDas goldene SchlossEin kalkuliertes RisikoNach vorne fallen, um in Bewegung zu bleibenEine unverdiente GnadeDie WahlDie FolgeJuwelenstahl und NachtregenViele Arten von StärkeDie Schwäche des GeistesDer JubokkoDer WurfsternGoldnieten und Blütenrosa WasserHanamiDie schwingende LaterneEin ehrlicher AustauschDie heißen QuellenVerdrehte GeschichtenFingerhutEine wichtige LektionDer Wald von Blut und FeuerEin mörderischer WutanfallRauchschilde und SorgenEine Provinz der SchmerzenDer ÜberfallMein Name ist MarikoIn Schutt und Asche verlorenDie SchattenkriegerinDie schwarze OrchideeEin Berg aus FeuerDer PhoenixEin EndeGlossarDanksagungenÜber dieses Buch
Ein Mädchen, dazu bestimmt, des Kaisers Sohn zu heiraten. Ein Junge, der den Glauben an das Gute in seinem Herzen begraben hat. Eine große Liebe, die alles verändern kann. Mariko, Tochter eines hochrangigen Samurai, weiß, dass sie ihre Zukunft nicht selbst bestimmen darf. Sie ist klug und erfinderisch, aber eben ein Mädchen. Mit 17 wird sie dem Sohn des Kaisers versprochen. Doch auf dem Weg zu ihrer Hochzeit wird ihr Geleitzug vom berüchtigten Schwarzen Klan vernichtet. Mariko überlebt als Einzige und nutzt ihre Chance, dem vorgegebenen Pfad zu entkommen! Als Junge verkleidet schmuggelt sie sich unter die Banditen. Zum ersten Mal in ihrem Leben erntet sie Anerkennung. Und sie verliert ihr Herz – ausgerechnet an den Feind …
Über die Autorin
Renée Ahdieh hat die ersten Jahre ihrer Kindheit in Südkorea verbracht, inzwischen lebt sie mit ihrem Mann und einem kleinen Hund in North Carolina, USA. In ihrer Freizeit ist die Autorin eine begeisterte Salsa-Tänzerin, sie kann sich für Currys, Schuhe, das Sammeln von Schuhen und Basketball begeistern. Mit »Zorn und Morgenröte« legt sie ihren ersten Roman vor, zu dem es eine Fortsetzung geben wird, an dem die Autorin gerade arbeitet.
Renée Ahdieh
Band 1
Aus dem amerikanischen Englisch vonMartina M. Oepping
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Renée Ahdieh/Penguin Random House LLC
Published by arrangement with Baror International
Originalverlag: Headline Book Publishing, A division of Hodder Headline
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: © Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von shutterstock: Susan Fox; Gordan; 100ker; arborelza; Breslavtsev Oleg; Elina Li; umiko
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-46484-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für und Mama Joon – dafür, dass sie mir beigebracht hat, dass Schwäche in Wahrheit nichts als die Schwäche des Geistes ist
DIE SIEBEN TUGENDEN DES BUSHIDÕ:DER WEG DES KRIEGERS
Gi – Rechtschaffenheit
Rei – Respekt
Makoto – Wahrhaftigkeit
Meiyo – Ehre
Chü(gi) – Loyalität
Yü(ki) – Mut
Jin – Nächstenliebe
»In diesem Zeitalter der Dekadenz, in dem wir leben, sind die Geister der Menschen verwirrt, und nur Worte werden geschätzt, nicht praktische Taten.«
Aus: Band des Bansenshukai, dem ursprünglichen Handbuch über den Shinobi no Mono oder Die Kunst des Ninja
Wie alles begann
Am Anfang gab es zwei Sonnen und zwei Monde.
Die Sicht des Jungen verschwamm, und er konnte hinter die Wahrheit sehen. Hinter die Schande. Er konzentrierte sich auf die Geschichte, wie sie ihm seine Uba am Abend zuvor erzählt hatte. Eine Geschichte von Gut und Böse, Hell und Dunkel. Eine Geschichte, in der die siegreiche Sonne hoch über ihren Feinden aufging.
Instinktiv tasteten seine Finger nach der schwieligen Wärme der Hand seiner Uba. Kisuns Kindermädchen war bei ihm gewesen, solange er denken konnte, aber jetzt – wie alles andere – war sie weg.
Jetzt war niemand mehr da.
Gegen seinen Willen klarte sich die Sicht des Jungen auf und gab den Blick auf den klaren blauen Mondhimmel über ihm frei. Seine Finger umklammerten das steife Leinen seiner Hemdsärmel.
Sieh nicht weg. Wenn sie bemerken, dass du wegsiehst, werden sie dich für feige halten.
Und wieder hörte er in Gedanken seine Uba mahnen.
Er senkte den Blick.
Der Innenhof vor ihm war mit flatterndem Weiß behangen, an drei Seiten von Reispapierparavents umgeben.
Wimpel mit dem goldenen Wappen des Kaisers tanzten in der flüchtigen Brise. Zur Linken und zur Rechten standen Zuschauer mit ernstem Blick – Samurai in der dunklen Seide ihrer formellen Hakama.
In der Mitte des Innenhofes befand sich der Vater des Jungen. Er kniete auf einer kleinen Tatanmimatte, die mit ausgebleichtem Segeltuch bedeckt war. Auch er war ganz in Weiß gehüllt, seine Züge wie in Stein gemeißelt. Vor ihm stand ein niedriger Tisch mit einem kurzen Schwert darauf. An seiner Seite stand der Mann, der einstmals sein bester Freund gewesen war.
Der Junge versuchte, mit seinem Vater Augenkontakt herzustellen. Einen Moment lang bildete er sich ein, sein Vater blicke in seine Richtung, aber es konnte sich auch um eine Täuschung durch den Wind handeln. Ein Trick des parfümierten Rauchs, der sich über den gedrungenen Kupferfeuerschalen kräuselte.
Der Vater wollte seinem Sohn nicht in die Augen sehen. Der Junge wusste das. Die Schande war zu groß. Und sein Vater würde lieber sterben, als die Schande von Tränen an seinen Sohn zu übergeben.
Die Trommeln begannen, einen langsamen Rhythmus zu schlagen. Eine Totenklage.
In der Ferne, jenseits der Tore, konnte der Junge das unterdrückte Geräusch lachender und spielender Kinder hören. Sie wurden schnell mit einem knappen Ruf zum Schweigen gebracht.
Ohne Zögern löste sein Vater den Knoten an seiner Taille und riss sein weißes Gewand auf, entblößte die Haut seines Bauches und seiner Brust. Dann stopfte er die Enden der Ärmel unter seine Knie, um zu vermeiden, dass er hintenüberfiel.
Denn selbst ein in Ungnade gefallener Samurai sollte ehrenhaft sterben.
Der Junge sah, wie sein Vater nach dem kurzen Tanotō-Schwert auf dem kleinen Tisch vor sich griff. Er wollte ihm zurufen aufzuhören. Um einen Augenblick Aufschub bitten. Um einen letzten Blick.
Nur einen.
Aber der Junge blieb stumm, die Finger, die er zur Faust geballt hatte, wurden blutleer. Er schluckte.
Sieh nicht weg.
Sein Vater packte das Schwert mit beiden Händen an dem Strang aus weißer Seide an seinem Knauf. Dann stieß er die Klinge in seine Mitte, wobei er langsam nach links schnitt, dann hoch nach rechts. Seine Gesichtszüge blieben unbewegt. Nicht ein Hinweis auf Schmerz war auszumachen, obwohl der Junge danach suchte – ihn fühlte –, trotz aller Anstrengung seines Vaters.
Sieh niemals weg.
Endlich, als sein Vater den Hals vorreckte, sah der Junge es. Ein schmales Zucken, eine Grimasse. Im selben Moment bebte dem Jungen das Herz in der Brust. Ein heißer Ausbruch von Schmerz erglühte darunter.
Der Mann, der der beste Freund seines Vaters gewesen war, machte zwei lange Schritte, dann schwenkte er ein schimmerndes Katana in einem perfekten Bogen auf den freigelegten Hals seines Vaters zu. Der Aufprall des Kopfes seines Vaters auf der Tatanmimatte brachte die Trommelschläge zu einem abrupten Ende.
Und immer noch sah der Junge nicht weg. Er beobachtete, wie der Purpur aus dem zusammengesunkenen Körper seines Vaters spritzte, über die Matte hinaus und auf die grauen Steine dahinter. Der penetrante Geruch des frischen Bluts erreichte seine Nase – warmes Metall und Seesalz. Er wartete, bis der Körper seines Vaters in die eine Richtung getragen wurde, der Kopf in eine andere, auf dass er als Warnung zur Schau gestellt würde.
Nicht die kleinste Andeutung von Verrat würde geduldet werden. Nicht einmal ein Flüstern.
Während der ganzen Zeit war niemand an die Seite des Jungen getreten. Niemand wagte, ihm in die Augen zu sehen.
Die Last der Schande nahm in der Brust des Jungen Form an, schwerer als irgendeine Last, die er tragen konnte.
Als sich der Junge schließlich abwandte, um den leeren Innenhof zu verlassen, fiel sein Blick auf eine knarzende Tür in der Nähe. Ein Kindermädchen begegnete seinem unerschütterlichen Blick, ihre Hand glitt von der Türverriegelung ab, mit der anderen Hand umklammerte sie zwei Spielzeugschwerter. Einen Augenblick lang errötete sie.
Sieh niemals weg.
Die Kinderfrau senkte unbehaglich ihren Blick. Der Junge beobachtete, wie sie schnell einen Jungen und ein Mädchen durch das hölzerne Tor schob. Sie waren ein paar Jahre jünger als er und entstammten offenbar einer wohlhabenden Familie. Vielleicht waren sie die Kinder eines der Samurai, die heute in Bereitschaft gewesen waren. Der kleine Junge zog die feine Seide seines Kimonokragens gerade und schoss an dem Kindermädchen vorbei. Er hielt nicht einmal lange genug inne, um die Gegenwart eines Verrätersohnes wahrzunehmen. Das Mädchen hingegen blieb stehen. Sie sah ihm direkt ins Gesicht, ihre kessen Züge in ständiger Bewegung. Sie rieb sich mit dem Handballen die Nase, zwinkerte und ließ ihren Blick an ihm auf und ab gleiten, bis er auf seinem Gesicht anhielt.
Er hielt ihrem Blick stand.
»Mariko-sama!«, schalt das Kindermädchen. Sie flüsterte dem Mädchen etwas ins Ohr, dann zog sie es am Ellbogen weg.
Trotzdem flackerten die Augen des Mädchens nicht. Nicht einmal, als sie an der Pfütze vorbeikam, die die Steine verdunkelte. Selbst als sich ihre Augen voller Erkenntnis zusammenzogen.
Der Junge war dankbar, dass er kein Mitleid in ihrem Ausdruck erkennen konnte. Stattdessen musterte ihn das Mädchen unbeirrt weiter, bis die Kinderfrau sie um die Ecke schob.
Sein Blick suchte nun wieder den Himmel, das Kinn hoch erhoben, ohne Rücksicht auf seine Tränen.
Am Anfang gab es zwei Sonnen und zwei Monde.
Eines Tages würde die siegreiche Sonne aufgehen …
Und alle Feinde seines Vaters in Brand setzen.
Illusionen und Erwartungen
Zehn Jahre später
Oberflächlich betrachtet schien alles in bester Ordnung.
Eine elegante Sänfte. Eine pflichtbewusste Tochter. Eine Ehre wurde erwiesen.
Dann, als ob sie sie verspotten wollte, kam die Sänfte ins Schlingern und Marikas Schulter wurde gegen die Innenwand der Norimono geschleudert. Die erhabenen Perlmutter-Einlegearbeiten würden ganz sicher Spuren hinterlassen. Mariko holte tief Luft und unterdrückte das Bedürfnis, im Schatten herumzunörgeln wie eine wütende alte Schrulle. Der Lackgeruch der Sänfte stieg ihr in den Kopf und erinnerte sie an die klebrigen Drachenbartsüßigkeiten, die sie als Kind so geliebt hatte.
Ihr dunkler, ekelhaft süßer Sarg, der sie zu ihrer letzten Ruhestätte brachte.
Mariko sank tiefer in die Kissen. Nichts an der Reise in die Kaiserstadt Inako war so gelaufen wie geplant. Ihr Geleitzug war später aufgebrochen als beabsichtigt und hatte viel zu oft angehalten. Wenigstens konnte Mariko jetzt an der Art, wie die Sänfte sich nach vorn neigte, erkennen, dass es ein Gefälle hinabging. Was bedeutete, dass sie sich hinter den Hügeln um das Tal befanden und die Hälfte des Weges nach Inako bereits hinter sich gelassen hatten. Sie lehnte sich zurück und hoffte, ihr Gewicht könnte die Last ausbalancieren.
Als sie sich gerade zurechtgesetzt hatte, hielt die Sänfte plötzlich wieder an.
Mariko hob den seidenen Schleier, der das winzige Gitter zu ihrer Rechten bedeckte. Die Dämmerung setzte gerade ein. Der Wald vor ihnen war nebelverschleiert, die Bäume nichts als gezackte Silhouetten vor einem silbrigen Himmel.
Als Mariko sich anschickte, den Soldaten anzusprechen, der ihr am nächsten stand, kam ein junges Dienstmädchen herbeigestolpert. »Meine Herrin!«, keuchte das Mädchen und richtete sich neben der Sänfte auf. »Ihr müsst verhungert sein. Ich war so nachlässig. Bitte vergebt mir, dass ich euch vernachlässigt habe.«
»Es ist schon gut, Chiyo-chan«, erwiderte Mariko freundlich lächelnd, aber die Augen des Mädchens blieben weit aufgerissen vor Sorge. »Ich war nicht diejenige, die den Geleitzug angehalten hat.«
Chiyo verneigte sich tief, sodass die Blumen auf ihrer wenig kunstvollen Hochsteckfrisur verrutschten. Als sie sich wieder aufrichtete, reichte die Dienerin Mariko ein ordentlich verpacktes Bündel. Dann zog sich Chiyo auf ihren Posten neben der Sänfte zurück, nicht ohne Marikos warmes Lächeln zu erwidern.
»Warum haben wir angehalten?«, fragte Mariko einen Soldaten der Ashigaru in ihrer Nähe.
Der Soldat wischte sich den Schweiß von der Stirn, dann nahm er den langen Stock seiner Naginata in die andere Hand. Das Sonnenlicht spiegelte sich in der scharfen Klinge. »Es ist der Wald.«
Mariko wartete, überzeugt, dass seine Erklärung noch nicht ihren vollen Umfang erreicht hatte.
Schweißperlen sammelten sich auf der Oberlippe des Soldaten. Er öffnete den Mund, um zu sprechen, aber das Getrappel von herannahenden Hufen lenkte ihn ab.
»Herrin Hattori …« Nobutada, einer der Vertrauten ihres Vaters und sein getreuester Samurai, zügelte sein Streitross auf der Höhe von Marikos Norimono. »Ich entschuldige mich für die Verzögerung, aber einige der Soldaten haben ihrer Sorge Ausdruck gegeben, den Jukaiwald zu durchqueren.«
Mariko blinzelte zweimal, ihre Züge nachdenklich. »Gibt es einen bestimmten Grund?«
»Nun da die Sonne untergegangen ist, fürchten sie die Yōkai, und sie haben Sorge …«
»Dumme Geschichten über Spukgeister im Dunkeln.« Mariko machte eine wegwerfende Handbewegung. »Sonst nichts.«
Nobutada hielt inne. Zweifellos nahm er ihre Unterbrechung zur Kenntnis. »Sie behaupten auch, dass der Schwarze Clan erst kürzlich hier in der Nähe gesehen wurde.«
»Sie behaupten?« Mariko zog eine dunkle Augenbraue hoch. »Oder haben sie sie wahrhaftig gesehen?«
»Es sind nur Behauptungen.« Nobutada lockerte den Kinnbügel unter seinem gehörnten Helm. »Obwohl es ungewöhnlich für den Schwarzen Clan wäre, uns zu berauben, denn sie greifen für gewöhnlich keine Geleitzüge mit Frauen und Kindern an. Vor allem nicht solche, die von Samurai begleitet werden.«
Mariko blieb nachdenklich. »Ich füge mich deiner Meinung, Nobutada-sama.« In Gedanken an den Soldaten von eben bemühte sie sich um ein Lächeln. »Und bitte sieh zu, dass die Ashigaru genügend Zeit haben, sich auszuruhen, und bald Wasser bekommen, denn sie scheinen übermüdet.«
Nobutada machte ein finsteres Gesicht, als er diesen Wunsch hörte. »Wenn wir gezwungen sind, den Jukaiwald zu umrunden, bedeutet das einen zusätzlichen Reisetag.«
»Dann bedeutet es eben einen zusätzlichen Reisetag.« Sie fing schon an, den Vorhang zu senken, das merkwürdige Lächeln immer noch auf ihren Lippen.
»Ich würde lieber nicht riskieren, den Kaiser zu verärgern.«
»Dann ist die Entscheidung einfach. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Das hast du mir beigebracht, als ich noch ein kleines Mädchen war.« Mariko senkte nicht den Blick, als sie mit ihm sprach. Genauso wenig, wie sie sich für die Schroffheit ihrer Erwiderung entschuldigte.
Sein finsterer Blick verdüsterte sich noch mehr. Mariko unterdrückte einen Seufzer. Sie wusste, dass sie schwierig war. Wusste, dass sich Nobutada wünschte, sie würde ihm die Entscheidung abnehmen. Oder wenigstens ihre Meinung kundttun.
Um ein nutzloses Machtspiel zu spielen. Ein Spiel, das Nobutada dann als der Ältere selbstgefällig untergraben könnte.
Als Mann.
Sie konnte sich nicht helfen: Sie spürte Verbitterung unter der Oberfläche brodeln.
Kontrolle ist eine Illusion. Erwartungen sollen meine Tage nicht bestimmen.
Jetzt nicht mehr.
»Vielleicht ist es nicht ganz einfach«, verbesserte sich Mariko, ihre Finger spielten mit dem Saum des Vorhangs. »Aber es ist leicht.« Sie mäßigte ihren Ton – ein erbärmlicher Versuch, ihn zu besänftigen. Ein Versuch, der andere nur noch nervöser machte, wie es ihr widerspenstiges Wesen oft tat. Kenshin schalt sie oft deswegen. Wie oft bat er sie, weniger … eigensinnig zu sein.
Sich anzupassen, wenigstens in diesen kleinen Dingen.
Mariko neigte den Kopf. »Wie dem auch sei: Auf alle Fälle beuge ich mich deinem weisen Urteil, Nobutada-sama.«
Ein Schatten fiel auf seine Züge. »Sehr wohl, Herrin Hattori. Wir werden den Jukaiwald durchqueren.«
Mit diesen Worten trieb er sein Pferd zurück an die Spitze des Geleitzuges.
Wie erwartet hatte Mariko ihn verärgert. Sie hatte, seit sie heute Morgen das Heim ihrer Familie verlassen hatten, keine klare Meinung geäußert. Und Nobutada wollte, dass sie damit spielte, ihm Befehle zu erteilen. Ihm Aufgaben zuwies, die sich für einen Mann in seiner vielgepriesenen Position ziemten.
Aufgaben, wie sie einem Samurai entsprachen, der eine königliche Braut an den Hof zu geleiten hatte.
Mariko nahm an, dass sie sich eigentlich Gedanken darüber machen sollte, verspätet am Kaiserpalast Heian einzutreffen.
Mit Verspätung zu ihrem Treffen mit dem Kaiser zu kommen. Mit Verspätung zu ihrem Treffen mit seinem zweiten Sohn.
Ihrem zukünftigen Ehemann.
Aber es machte Mariko nichts aus. Seit dem Nachmittag, als ihr Vater sie darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass Kaiser Minamoto Masaru ein Eheangebot im Namen seines Sohnes Raiden abgegeben hatte, war ihr vieles gleichgültig geworden.
Mariko sollte die Ehefrau von Prinz Raiden werden, dem Sohn des Kaisers und seiner Lieblingsgemahlin. Eine politische Eheschließung, die den Stand ihres Vaters innerhalb der regierenden Daimyō-Klasse erhöhen sollte.
Sie sollte sich daran stören, dass sie wie Eigentum ausgetauscht wurde, um sich damit bei jemandem anzubiedern. Tat sie aber nicht.
Nicht mehr.
Als die Sänfte wieder weiterschlingerte, griff Mariko in ihr Haar, um die schmale Schildpattnadel in ihren dicken Haarwellen zurechtzurücken. Kleine Silber- und Jadestreifen baumelten von ihren Enden und verhedderten sich unaufhörlich. Als Mariko alles wieder festgesteckt hatte, ertastete ihre Hand die schmalere Jadespange darunter.
Die Züge ihrer Mutter nahmen in ihrer Erinnerung Gestalt an – der Ausdruck bewusster Resignation auf ihrem Gesicht, als sie ihrer einzigen Tochter den Jadezierschmuck ins Haar gesteckt hatte.
Ein Abschiedsgeschenk. Aber kein echtes Zeichen von Trost.
Genauso wenig wie die letzten Worte ihres Vaters.
Sei eine Ehre für deine Familie, Mariko-chan. Deiner Erziehung gemäß. Schwöre deinen kindischen Wünschen ab. Sei mehr als … das.
Mariko presste die Lippen aufeinander.
Es spielt keine Rolle. Ich habe meine Rache schon verübt.
Es gab keinen Grund für Mariko, sich mit diesen Dingen länger aufzuhalten. Ihr Leben würde nun auf einem klar gezeichneten Weg verlaufen.
Es spielte keine Rolle, dass der Weg nicht der war, den sie wollte. Es spielte keine Rolle, dass es noch so viel zu sehen und zu lernen und zu tun gab. Sie war zu einem einzigen Zweck bestimmt. Wenn auch zu einem törichten – die Ehefrau eines Mannes zu sein, wo sie genauso gut etwas anderes hätte sein können. Mehr. Aber es spielte keine Rolle. Sie war ja kein Junge. Und obwohl sie kaum siebzehn war, kannte Hattori Mariko ihre Stellung im Leben. Sie würde Minamoto Raiden heiraten. Ihre Eltern erhielten so das Renommee einer Tochter im Kaiserpalast Heian.
Und Mariko war die Einzige, die von den Flecken auf diesem Renommee wusste.
Als die Dämmerung einsetzte, machte sich der Geleitzug auf seinen Weg tiefer in den Wald hinein. Der Geruch nach warmer, feuchter Luft nahm ein Eigenleben an. Er vermischte sich mit dem Eisen der Erde und dem Grün gerade niedergetretener Blätter. Ein ganz besonderes, berauschendes Parfum. Scharf und frisch, trotzdem sanft und düster, alles auf einmal.
Mariko erschauderte, eine Kältewelle erfasste ihre Knochen. Die Pferde um ihre Sänfte wieherten, wie als Erwiderung auf eine unsichtbare Bedrohung. Auf der Suche nach einer Zerstreuung griff Mariko nach dem kleinen Essenspäckchen, das Chiyo ihr gegeben hatte. Sie wehrte die Kälte ab, indem sie sich in ihre Kissen grub.
Vielleicht hätten wir doch um den Jukaiwald herumgehen sollen.
Schnell verwarf sie diese Zweifel wieder, dann schenkte sie ihre Aufmerksamkeit dem Päckchen in ihren Händen. Darin waren zwei Reisbällchen, bedeckt mit schwarzer Sesamsaat, dazu sauer eingelegte Pflaumen, in Lotus-Blätter gewickelt. Nachdem sie ihre Mahlzeit ausgewickelt hatte, verlagerte Mariko ihr Gewicht, um die winzige gefaltete Papierlaterne anzuzünden, die über ihr baumelte.
Sie war eine ihrer ersten Erfindungen gewesen. Klein genug, um sie in einem Kimono-Ärmel zu verstecken. Ein besonders langsam brennender Docht, aufgehängt an dünnsten Drähten. Der Docht wurde aus Baumwolle hergestellt, mit Flussschilf umsponnen, dann in Wachs getaucht. Die Laterne behielt ihre Form trotz der geringen Größe und lieferte unermüdlich ein gleichmäßig brennendes Licht. Mariko hatte sie als Kind gebastelt. In der undurchdringlichen Dunkelheit der Nacht war diese kleine Erfindung ihr Retter gewesen. Sie hatte die Laterne neben ihre Decken gestellt, wo sie ein warmes, freundliches Licht ausstrahlte, in deren Schein Mariko ihre neuesten Ideen skizziert hatte.
Das Mädchen lächelte bei der Erinnerung. Sie begann zu essen. Ein paar schwarze Sesamsamen fielen auf die bemalte Seide ihres Kimonos, und Mariko wischte sie beiseite. Der Stoff fühlte sich unter ihren Fingerspitzen wie Wasser an. Während der Kimono die Farbe von gesüßtem Rahm hatte, blitzte durch den Saum dunkelstes Indigo durch. Blassrosa Kirschblüten zierten dicht gedrängt die langen Ärmel und entfalteten sich bei Marikos Füßen zu Ästen.
Ein kostbarer Kimono. Angefertigt aus der seltenen Tatsamura-Seide. Nur eines der vielen Geschenke, die der Sohn des Kaisers ihr geschickt hatte. Der Kimono war wunderschön. Schöner als alles, das Mariko jemals in ihrem Leben besessen hatte.
Vielleicht hätte sich ein Mädchen, das solche Dinge schätzte, gefreut.
Als noch mehr Sesamsamen auf die Seide fielen, machte Mariko sich nicht mehr die Mühe, sie wegzuwischen. Sie aß in der Stille zu Ende und beobachtete, wie die kleine Laterne hin- und herschwang.
Die Ansammlung von Schatten draußen verlagerte sich und drang immer näher. Marikos Geleitzug bewegte sich jetzt tief unter einem Baldachin von Baumkronen. Tief unter einem Umhang von ächzenden Ästen und flüsternden Blättern. Merkwürdig, dass sie draußen kein Zeichen von Leben hörte – weder das Krächzen eines Raben noch den Schrei einer Eule, noch das Sirren eines Insekts.
Dann blieb die Norimono wieder stehen. Viel zu abrupt.
Die Pferde begannen zu schnauben. Fingen an, mit den Hufen auf der blätterbedeckten Erde zu stampfen.
Mariko hörte einen Schrei. Ihre Sänfte schwankte. Wurde gegengelenkt. Nur um dann mit einem dumpfen Aufprall auf den Boden zu fallen. Ihr Kopf prallte gegen lackiertes Holz, dass ihr Sterne vor den Augen tanzten.
Und Mariko wurde von einem Nichts verschluckt.
Das Nachtungeheuer
Mariko erwachte von dem Geruch nach Rauch. Von einem dumpfen Dröhnen in den Ohren.
Von stechendem Schmerz in einem Arm.
Sie war immer noch in ihrer Sänfte, aber die war auf die Seite gekippt, der ganze Inhalt lag zerschmettert in einer Ecke. Der Körper ihrer vertrauten Magd lag über ihr. Chiyo, die so gerne geeiste Khakifrüchte gegessen und Mondblüten in ihrem Haar arrangiert hatte. Chiyo, deren Augen immer so groß und so ehrlich gewesen waren.
Diese Augen waren jetzt in der endgültigen Maske des Todes erstarrt.
Mariko brannte es in der Kehle. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und ihre Sicht verschwamm.
Ein Rascheln draußen brachte sie wieder zu sich. Ihre rechte Hand stützte sich auf einen weichen Klumpen neben ihrem Kopf. Sie holte tief Luft, bis sie wieder voll bei Bewusstsein war, es war wie ein unterdrücktes Schluchzen. Ihr Arm pochte schmerzhaft, schon bei der geringsten Bewegung.
Mariko schüttelte den Kopf, damit er wieder klar wurde. Und sah sich um.
Aus der Art, wie Chiyo über ihr lag – und aus der Art, wie Marikos lackierte Sandalen der Dienerin aus der Hand gefallen waren –, war ersichtlich, dass das Mädchen versucht hatte, Mariko aus der umgestoßenen Sänfte zu befreien. Versucht hatte, sie zu befreien, und bei dem Versuch gestorben war. Überall war Blut. Es war über die glänzenden Einlegearbeiten gespritzt. Es war aus der klaffenden Wunde in Marikos Kopf gelaufen. Und aus der tödlichen Wunde in Chiyos Herz. Ein Pfeil war direkt durch die zarten Knochen des Mädchens gedrungen; seine Spitze hatte sich in die Haut von Marikos Unterarm gebohrt und ein purpurnes Rinnsal ausgelöst.
Verschiedene Pfeilspitzen steckten in dem Holz der Norimono. Weitere ragten in widerlichen Winkeln überall aus Chiyos Körper. Pfeile, die sicher nicht alle abgeschossen worden waren, um eine Dienerin zu töten. Und wenn diese aufopferungsvolle Dienerin nicht gewesen wäre, hätten diese Pfeile ohne Zweifel Mariko getroffen.
Marikos Augen liefen vor Tränen über, als sie Chiyo fest umklammerte.
Danke, Chiyo-chan. Sumimasen.
Mariko blinzelte ihre Tränen weg und versuchte, den Kopf zu wenden. Versuchte, sich zu orientieren. Der pochende Schmerz an ihrer Schläfe hielt Takt mit dem Rasen ihres Herzens.
Gerade als Mariko sich das erste Mal bewegte, kam das Grollen männlicher Stimmen näher. Sie spähte durch einen Riss in dem zersplitterten Gitter über sich. Alles, was sie erkennen konnte, waren zwei Männer, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Ihre Waffen strahlten hell im Licht ihrer Fackeln, die Klingen verschmiert von einem finsteren Rot.
Es können nicht …
Aber der Beweis war unumstößlich. Der Schwarze Clan hatte ihren Geleitzug überfallen.
Mariko hielt den Atem an und drückte sich in die Ecke, als die Männer sich der Sänfte näherten.
»Sie ist also tot?«, fragte der Größere der Männer schroff.
Der maskierte Mann rechts betrachtete die umgeworfene Sänfte. Sein Kopf neigte sich zu einer Seite. »Entweder das oder sie ist hinüber von …«
Ein Heulen in der Ferne schluckte den Rest ihres Gesprächs.
Die Männer sahen einander an. Wissend.
»Sieh noch mal nach«, sagte der erste Mann. »Ich möchte nicht berichten müssen, dass wir bei unserer Mission versagt haben.«
Der zweite Mann nickte kurz und ging auf die Sänfte zu, seine Fackel hoch erhoben.
Panik erfasste Mariko. Sie biss ihre klappernden Zähne zusammen.
Zwei Dinge waren klar geworden, als diese maskierten Männer gesprochen hatten: Erstens wollte der Schwarze Clan offenbar Marikos Tod. Zweitens hatte irgendjemand ihnen den Auftrag erteilt, sie umzubringen.
Mariko rutschte ein ganz klein wenig zur Seite, als ob sie sich so vor ihren forschenden Augen verbergen könnte. Als ob sie so zum Nichts schrumpfen könnte. Chiyos Kopf sank nach vorn und schlug gegen das ramponierte Holz der Norimono.
Mariko unterdrückte einen Fluch und verwünschte ihre Gedankenlosigkeit. Sie atmete durch die Nase ein, als ob sie so ihr Herz am unaufhörlichen Hämmern hindern könnte.
Warum stank es plötzlich so stark nach Rauch?
Marikos Blicke schossen ängstlich hin und her. Die Ränder von Chiyos blutbeflecktem Gewand färbten sich schwarz.
Streiften den zerkrümelten Docht von Marikos winziger Laterne.
Fingen Feuer.
Sie benötigte all ihre Zurückhaltung, um ruhig und leise zu bleiben.
Angst bedrängte sie von allen Seiten. Zwang sie, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Wenn Mariko zögerte, würde sie bei lebendigem Leib verbrennen. Wenn sie sich jedoch aus ihrem Versteck wegbewegte, würden die maskierten Männer ihren düsteren Auftrag ohne Zweifel zu Ende bringen.
Die Flammen leckten schon am Saum von Chiyos Gewand und griffen nach Marikos Kimono wie die Arme eines Kraken.
Ihre Panik wuchs, und Mariko rutschte noch einmal zur Seite und unterdrückte ein Husten.
Es war höchste Zeit, eine Entscheidung zu treffen.
Wie muss ich heute sterben? Im Feuer oder durch das Schwert?
Der Mann, der auf sie zugekommen war, blieb eine Haaresbreite entfernt stehen. »Die Sänfte brennt.«
»Dann lass sie brennen.« Der größere Mann zuckte nicht einmal. Er sah auch nicht in ihre Richtung.
»Wir sollten gehen.« Der Mann draußen blickte über seine Schulter. »Bevor der Blutgeruch und das verbrannte Fleisch die Nachtungeheuer anziehen.« Er war zum Greifen nahe. Nahe genug, um zuzuschlagen, hätte Mariko den Mut.
Der größere Mann nickte. »Wir brechen noch früh genug auf. Aber nicht, bevor du dich überzeugt hast, dass das Mädchen tot ist.«
Das klagende Bellen wurde lauter. Kam näher. Umzingelte sie.
Als der Mann neben ihr nach dem zerstörten Gitter griff, brach eine der zerbrochenen Stangen der Norimono entzwei. Das zerberstende Holz traf ihn am Arm und spritzte Splitter in alle Richtungen.
Er sprang zurück und fluchte unterdrückt. »Das Mädchen ist so gut wie tot.« Er sprach entschlossen, seine Fackel wütete im Wind. In der Hitze des aufsteigenden Feuers lief Mariko der Schweiß in gleichmäßigen Rinnsalen den Hals hinunter. Die anwachsende Glut neben ihren Füßen knisterte, als sie Chiyos Haut versengte.
Bei dem Geruch drehte sich Mariko der Magen um. Schweiß rann ihr in den steifen weißen Kragen.
Entscheide dich, Hattori Mariko! Wie willst du sterben?
Ihre Zähne klapperten. Mariko schluckte energisch und ballte ihre Finger zur Faust. Ihre Blicke huschten durch den winzigen zerschmetterten Raum. Mut lag ihr nicht im Blut. Sie verbrachte viel zu viel Zeit damit, ihre Möglichkeiten abzuwägen, um als mutig zu gelten. Zu viel Zeit, in der sie die vielen Wege, die vor ihr lagen, berechnete.
Aber Mariko wusste, dass es Zeit wurde, mehr zu tun. Zeit, mehr zu sein.
Sie wollte nicht als Feigling sterben. Mariko war die Tochter eines Samurai. Die Schwester des Drachen von Kai.
Aber vor allem hatte sie immer noch Macht über ihre Entscheidungen.
Jedenfalls an diesem einen, ihrem letzten Tag.
Sie würde ihrem Feind gegenübertreten. Und in Ehre sterben.
Ihre Sicht vom dichter werdenden Rauch getrübt, stieß Mariko Chiyo beiseite. Sie zitterte trotz ihrer großen Anstrengungen.
Ein Schrei ertönte in der Dunkelheit. Der Mann bei der Norimono fuhr bei dem knackenden Geräusch herum.
Auf die Schreie folgte das Knurren eines Tiers. Dem Geheul nach folgten noch weitere.
Noch ein gellender Schrei. Das Echo einer Totenglocke. Gleichzeitig die Schreie reißender Tiere.
»Die Nachtungeheuer!« Der Mann mit der Fackel schwenkte noch einmal um, seine Flamme folgte all seinen Bewegungen.
»Sie greifen uns von der Seite an!«
»Sieh nach dem Mädchen«, beharrte der erste Mann. »Das Mädchen ist wichtiger als …«
»Die Braut des Prinzen ist so gut wie tot!« Mit diesen Worten warf er seine Fackel oben auf Marikos Norimono, und wirbelte herum, nachdem er ihr Schicksal besiegelt hatte. »Kümmern wir uns um unsere Gefallenen. Lasst nichts zurück!«, rief er Männern zu, die sie nicht sehen konnte.
Mariko verbiss sich einen Schrei, als klirrendes Metall und sich bewegende Körper in den nahen Schatten zusammenkrachten. Das Chaos wuchs mit jedem Augenblick. Die Flammen der Norimono schlugen höher. Rascher. Die Hitze färbte Marikos Haut rosa. Sie ballte die Fäuste, erstickte ihren Husten und drückte sich weiter in die Ecke. Tränen strömten ihr über das Gesicht, raubten ihr jegliche Entschlossenheit.
Feigling.
Die Fackel entfachte auf dem lackierten Holz der Norimono ein prasselndes Feuer.
Es würde nicht lange dauern, bis Mariko darin verbrennen würde. Der lackierte Zunder um sie herum knallte und zischte, das geschmolzene Harz loderte in einer blauen Flamme.
Schaudernd holte sie Luft.
Ich bin kein Feigling. Ich bin … größer als das hier.
Ihre Tränen benetzten die Kimonoseide. Sie wehrte sich dagegen, wie ein in einem Käfig eingesperrtes Tier zu sterben. Wie ein Mädchen, dem nichts blieb als nur ihr Name.
Dann lieber durch das Schwert sterben. Besser den Nachtungeheuern ausgeliefert sterben.
In der Nachtluft sterben. Frei.
Ihr Puls pochte bis in die Fingerspitzen. Mariko schob Chiyos Leiche mit einer endlich entschiedenen Bewegung von sich. Sie stieß die Tür der Norimono auf. Eine glänzende Sandale fiel zu Boden, als sie sich abmühte, sich hochzuhieven, gierig nach Luft schnappend, um den Rauch in ihren Lungen zu löschen. Mariko taumelte aus den Trümmern, ihre Augen wild, als sie sich umsah, verzweifelt.
Der Wald lag in tiefster Dunkelheit da.
Und ihr Kimono brannte.
Ihr Gehirn arbeitete fieberhaft. Instinktiv. Mariko wickelte das seidene Material dicht um sich und nahm dem Feuer so die Luft, die es brauchte, um zu brennen. Ihr Handgelenk wurde unter den Kimonofalten angesengt, Rauch stieg in grauen Kringeln aus der flammenden Seide auf. Mit einem krächzenden Schrei riss Mariko an ihrem Obi und verfluchte die Art und Weise, wie er um ihre Taille gewickelt war. So aufwendig. So überflüssig. Durch das Unterholz taumelnd riss sie sich den wunderschönen Kimono von den Schultern, torkelte weg von der brennenden Norimono wie eine Trunkene.
Ihre Augen durchsuchten die Dunkelheit nach irgendeiner Spur von Licht. Alles, was sie sehen konnte, war ihre vor Flammen lodernde Sänfte. Ihr Kimono schwelte auf dem Waldboden.
Wenn die Männer zurückkommen, finden sie den Kimono. Sie werden wissen, dass ich entkommen bin.
Ohne zu zögern, packte Mariko den Seidenkimono und schleuderte ihn zurück auf den Stoß zischender Flammen.
Die Seide loderte auf, als sie den schmelzenden Lack berührte. Brennende Seide und glühender Lack. Schmelzende Drachenbartsüßigkeiten.
Vermischt mit dem Geruch nach versengendem Fleisch.
Chiyo.
Sie blinzelte heftig und bemühte sich, aufrecht zu bleiben.
Überall um sie herum lagen die Leichen des Geleitzuges ihres Vaters. Mägde, Samurai, Fußsoldaten.
Alle abgeschlachtet wie eine einzige Person.
Mariko stand in den Schatten gehüllt, ihre Brust hob und senkte sich, während ihre Augen den feuchten Boden absuchten.
Alles, was irgendeinen Wert besaß, war gestohlen worden. Zügig. Effizient. Truhen waren geleert worden. Kaiserliche Streitrösser waren wie bewegliches Hab und Gut einkassiert worden. Übrig blieben nur die Zügel mit den Quasten. Bänder in Rot und Weiß und Gold übersäten den Boden.
Aber Mariko wusste, dass Raub nicht der vorrangige Anlass gewesen war.
Der Schwarze Clan wollte mich umbringen. Obwohl ich Prinz Raiden heiraten sollte, haben sie den Auftrag dennoch ausgeführt.
Jemand mit Macht über den Schwarzen Clan will meinen Tod.
Ein eiskalter Schock überlief sie unvermittelt. Ihre Schultern gaben plötzlich dem Druck nach. Und wieder – als ob es instinktiv geschähe – richtete Mariko sich auf, ihr Kinn hochgereckt, wie um weitere Tränen abzuwehren. Sie wollte dem Schock nicht erliegen. Genauso wie sie sich gegen ihre Ängste wappnete.
Denk nach, Hattori Mariko. Weitergehen.
Sie taumelte vorwärts, bereit, ohne einen einzigen Blick zurück zu fliehen. Genau zwei zögerliche Schritte weit kam sie, bevor sie ihre Meinung änderte. Es sich noch einmal genau überlegte, ob es so weise sei, ohne Waffen und in nichts als ihren Unterkleidern durch den finsteren Wald zu laufen.
Sie wappnete ihren Geist, so gut es ging, gegen das viele Blut und ging auf einen gefallenen Samurai zu. Sein Katana fehlte, aber sein kürzeres Wakizashi steckte noch in der Schwertscheide, die an seine Taille gebunden war. Sie nahm die kleine, handliche Waffe an sich. Sie hielt nur an, um Erde über ihre Spuren zu streuen, lief durch den Wald, einfach los, ohne Ziel, ohne Zweck. Ohne alles, nur in dem Wunsch zu überleben.
Die Dunkelheit um sie herum war beklemmend. Sie stolperte über Wurzeln, unfähig, etwas zu sehen. Nach einer Weile verschärfte das Fehlen des einen Sinnes alle anderen. Das Knicken eines Zweiges oder Trappeln eines Insekts drang mit dem Widerhall eines Gongs an ihre Ohren. Als es in einigen Büschen in der Nähe klirrte – Stahl, der sich gegen Stein rieb –, drückte sich Mariko an die Rinde eines Baumes, und der Schrecken raubte ihr die letzte Wärme aus dem Blut.
Ein tiefes Knurren kroch aus der Erde, fuhr durch sie hindurch wie das Donnern einer sich nähernden Armee. Darauf folgte sogleich das Geräusch von schweren Pfoten, die über tote Blätter schritten.
Wild. Verstohlen.
Ein Nachtungeheuer, das sich an sein letztes Beutestück heranpirschte.
Marikos Magen verkrampfte sich, und ihre Finger zitterten, als sie sich innerlich auf den Tod vorbereitete.
Nein, ich verstecke mich nicht in einer Ecke.
Nie wieder.
Sie stolperte von dem Baum weg, ihr Fußknöchel verfing sich in einem Steinhaufen. Jede Bewegung rüttelte sie durch, und sie landete auf dem Waldboden, kam aber sofort wieder auf die Füße. Ihr Körper fühlte sich lebendig an, Kraft überrollte in Wellen ihre Haut, während das Blut durch ihren Körper raste. Es gab nichts, wo sie sich verstecken konnte. Die weiße Seide ihrer Unterkleider half nicht, sie vor den unheilvollen Waldmonstern zu schützen.
Das Knurren hinter ihr war zu einem beständigen Grollen geworden. Unverzagt. Es kam immer näher. Als Mariko herumwirbelte, um ihrem Angreifer ins Auge zu sehen, nahmen zwei gelbe Echsenaugen in der Dunkelheit Form an. Wie die einer riesigen Schlange. Die Kreatur, die um diese Augen herum Gestalt annahm, war riesig, ihre Umrisse glichen einem Jaguar, ihr Körper aber war kompakt wie der eines Bären. Ohne gereizt worden zu sein, stellte sich das Biest auf die Hinterbeine, Speichel lief aus seinen gefletschten Fangzähnen. Es warf den Kopf zurück und heulte. Das Geräusch wurde von der Nacht zurückgeworfen.
Ihre Knie wurden weich, als wären sie aus Wasser, aber Mariko kämpfte, um sich zu wappnen.
Doch das Wesen griff nicht an.
Es blickte zur Seite, dann sah es sie wieder an. Seine gelben Augen glühten hell. Es neigte den Kopf, als ob es hinter ihre Schulter sehen wollte.
Lauf!, rief eine Stimme in Marikos Innerem. Lauf, du kleine Närrin!
Sie holte Luft, trat einen langsamen Schritt zurück.
Das Tier griff immer noch nicht an. Es sah weiterhin in dieselbe Richtung, sein Heulen wurde schriller und wilder.
Als ob es sie warnen wollte.
Dann – ohne ein weiteres Geräusch – glitt das Tier auf sie zu. Wie ein Geist. Wie ein Dämon des Waldes, der auf einem Wirbel aus schwarzem Rauch gleitet.
Marikos Schrei gellte in den Nachthimmel.
Das Ungeheuer verschwand in einem zischenden Luftsog.
In einem Wirbel von tintenschwarzer Dunkelheit.
»Nun gut«, sagte eine ruppige Stimme hinter ihr. »Das Glück meint es heute anscheinend gut mit mir.«
Kein Mädchen
Ein verdreckter Mann tauchte wie aus dem Nichts auf. Zweige zerknickten unter seinen bloßen Füßen, als er auf sie zugestakst kam.
»Was machst du hier, Mädchen?« Von seinen Lippen troff Speichel. »Weißt du nicht, dass dieser Teil des Waldes gefährlich ist?« Seine Knopfaugen glitten über ihre zitternde Gestalt.
Noch nie hatte ein Mann es gewagt, sie so anzusehen.
Mit solch ungehemmter Bosheit, die seinen Blick aufblitzen ließ.
»Ich bin …« Mariko hielt inne, um nachzudenken, bevor sie antwortete. Um den sichersten Weg zu gehen. Sie konnte ihn nicht rügen, wie ihre Mutter es wohl getan haben würde. Dies war keiner der Vasallen oder Diener ihres Vaters. Tatsächlich wusste sie – nach dem, was sie gerade erlebt hatte – nicht einmal sicher, ob der Mann überhaupt aus Fleisch und Blut war.
Schluss mit diesem Unsinn.
Sie würde sich von ihrer Angst nicht so weit treiben lassen, sich eine menschliche Form aus Schatten und Rauch einzubilden.
Mariko stellte sich hoch erhobenen Hauptes hin und verbarg das Wakizashi notdürftig in ihren Unterkleidern. Außer Sichtweite. Anstatt den herrischen Ton ihrer Mutter anzunehmen, sprach sie ganz ruhig. Sanft. »In Wahrheit wäre ich auch lieber nicht hier. Deshalb versuche ich ja, hier hinauszufinden.« Sie sah ihm still, aber herausfordernd in die Augen.
»In so einem Aufzug?« Er blickte sie anzüglich an, sein Lächeln nichts als Schmutz und Zahnlücken.
Sie sagte nichts, obwohl sie die Angst am ganzen Körper spürte.
Der Mann rückte näher. »Ich nehme an, du hast dich verlaufen?« Seine Zunge schoss aus dem Mund wie eine Eidechse auf der Suche nach Beute.
Mariko schluckte das Verlangen zu antworten herunter. Das Bedürfnis, ihm eine Lektion zu erteilen. Kenshin hätte ihn in Ketten abgeführt, nach nur einem knappen Nicken zu seinen Gefolgsleuten. Den Männern, die das Wappen des Hattori-Clans trugen. Aber Kenshin hatte die Macht eines Soldaten. Den starken Willen eines Samurai.
Und es wäre unklug von Mariko, einen Unbekannten zu provozieren.
Was sollte sie also sagen?
Wenn ihr Drohungen als Waffen nicht zur Verfügung standen, würde Gerissenheit vielleicht helfen. Mariko blieb stumm. Obwohl ihre freie Hand zitterte, blieb die Hand, in der sie das Wakizashi hielt, unerschütterlich.
»Du hast dich verirrt.« Der Mann kam noch näher. So nah, dass Mariko den Geruch von ungewaschener Haut und saurem Reiswein wahrnahm. Und das Kupfer gerade vergossenen Bluts. »Wie hast du es geschafft, dich hierhin zu verirren, wunderschönes Wesen?«
Ihr stockte der Atem. Sie packte den Griff des kurzen Schwerts fester. »Ich denke, wenn irgendjemand die Antwort auf diese Frage wüsste, gälte ich nicht mehr als verirrt«, sagte sie ruhig.
Der Mann gluckste und verpestete die Luft mit seinem ätzenden Atem. »Kluges Mädchen! So vorsichtig. Aber nicht vorsichtig genug. Wenn du wirklich vorsichtig wärst, wärst du nicht im Wald verloren gegangen … ganz alleine.« Er legte seinen Bō zwischen ihnen beiden auf dem Boden ab. Frisches Blut bedeckte ein Ende der hölzernen Stange. »Bist du sicher, dass du nicht zu dem Geleitzug weniger als eine Meile von hier gehörst? Der mit all den Toten …« – er lehnte sich sogar noch näher, seine Stimme jetzt ein Flüstern – »… und ohne Geld?«
Er war ihr gefolgt. Trotz all der Mühe, die Mariko sich gegeben hatte, ihre Spuren zu verwischen, hatte dieser Mann es geschafft, sie zu finden. Diese faule Krähe, die sich von den Brocken nährte, die die anderen übrig ließen. Wieder zog sie es vor zu schweigen, versteckte aber das Wakizashi vollkommen hinter sich.
Worte würden ihr bei diesem Mann keine guten Dienste leisten.
»Wenn du dich verlaufen hast«, fuhr er gemächlich fort, »dann betrachte ich das als gutes Omen für dich. Der Schwarze Clan nimmt keine Gefangenen. Er hinterlässt auch keine Überlebenden. Das ist schlecht fürs Geschäft, weißt du. Ihr Geschäft und meins.«
Mariko dämmerte eine Erkenntnis, drängte sich geradezu auf. Wie sie vermutet hatte, war er kein Mitglied des Schwarzen Clans. Schon nach dem wenigen, das sie vorher verstanden hatte, wusste sie, dass diese Bande aus maskierten Mördern weitaus besser organisiert war.
Weitaus präziser.
Dieser Mann – mit seinen dreckigen Füßen und der verschmutzten Kleidung – war weder das eine noch das andere.
Als Mariko ihm wieder keine Antwort gab, runzelte er die Stirn und zeigte Zeichen von Beunruhigung.
»Was ist, wenn ich dich ihnen ausliefern würde?« Er schlich sich noch näher an sie heran – bis auf eine Armeslänge – und zog seinen Bō planlos durch die dunkle, lehmige Erde zu seinen Füßen. Das hätte bedrohlich wirken sollen, aber dem Mann fehlte die notwendige Schärfe. Die erforderliche Disziplin eines wahren Kriegers. »Ich bin sicher, der Schwarze Clan wüsste es sehr zu schätzen, wenn ich dich ihnen brächte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihnen daran gelegen ist, dass dieses Versagen ihren Auftraggebern zu Ohren kommt. Oder ihren Rivalen.«
Als sie sah, wie er über eine Wurzel stolperte, konnte Mariko eine kleine Spöttelei nicht unterdrücken: »Nun, dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mich zu ihnen brächtest. Es scheint, sie haben ein paar meiner Besitztümer an sich genommen. Und die hätte ich gerne zurück.«
Er krächzte noch einmal ein Lachen heraus, und der Klang lief ihr eiskalt den Rücken hinunter.
»Du könntest fast unterhaltsam sein, wenn du mehr lächeln würdest.« Seine Lippen bogen sich nach oben. »Nur für den Fall, dass deine Mutter es dir nie gesagt hat, hübsche Mädchen wie du sollten lächeln. Besonders, wenn sie einen Mann dazu bringen wollen, nach ihrer Pfeife zu tanzen.«
Mariko erstarrte. Sie hasste solche Worte. Hasste die Andeutung, dass sie einen Mann brauchte, der alles für sie regelte.
Hasste die Richtigkeit dieser Worte.
»Mach dir keine Sorgen.« Der Mann schwenkte seinen Bō langsam und deutete ihr an, vor ihm herzugehen. »Wir werden den Schwarzen Clan finden. Es könnte eine Weile dauern. Aber ich kenne zufällig ihre Lieblingswirtschaft am westlichen Rand des Waldes. Sie müssen dort früher oder später auftauchen. Und ich bin ein geduldiger Mann.« Mit einem verschlagenen Grinsen nahm er eine Rolle fransigen Seils ab, die an seinem Gürtel hing.
Mariko machte sich auf einen Kampf gefasst und stellte ihre Füße locker auseinander. Sie gab in den Knien leicht nach. Versuchte, ihren Schwerpunkt tiefer zu legen.
»Außerdem …« Sein breiter werdendes Grinsen ließ sie innerlich erschauern. »Du siehst aus wie eine tolle Begleitung.«
Als er das Tau abrollte, machte Mariko ihre Waffe bereit. Kenshin hatte ihr beigebracht, wo sie zuschlagen musste. Weiche Stellen, frei von Knochen, wie Magen und Kehle. Wenn sie ihn an der Innenseite oberhalb seiner Knie aufschlitzen könnte, würde der Mann schnell genug Blut verlieren, um in wenigen Augenblicken zu sterben.
Mariko rechnete. Dachte nach.
Sie war so mit Nachdenken beschäftigt, dass sie nicht mit seiner plötzlichen Bewegung rechnete.
In einem Sekundenbruchteil hatte der Mann Mariko am Unterarm gepackt und an sich gezerrt.
Sie kreischte auf und drängte ihn zurück. Der Bō wurde ihm aus der Hand geschlagen und polterte gegen einen Baumstumpf.
In dem nachfolgenden Tumult suchte Mariko nach einem Winkel, aus dem sie seinen Griff abwehren könnte. Sie schwenkte das Wakizashi weit, zielte nicht einmal, hoffte, überhaupt zu treffen.
Kaltschnäuziges Gelächter drang über seine Lippen, als der Mann nach dem Wakizashi griff. Sein Ellbogen traf ihr Gesicht an der Seite und brachte Mariko mit weniger Kraft zu Fall, als nötig ist, um ein wimmerndes Kalb zu bändigen.
Eins ihrer Handgelenke in seinem dreckigen Griff, versuchte der Mann, ihr die Hände zusammenzubinden.
Es blieb keine Zeit mehr für Angst oder Wut oder Gefühle, welcher Art auch immer, die sie ablenkten. Mariko schrie lauthals, trat nach ihm und rang mit ihm um die Kontrolle über ihre Waffe. Die Spitze ritzte ihr oben in den Ärmel, schnitt ihr den Stoff vom Leib und enthüllte so noch mehr von ihrem Körper.
Der Mann stieß Marikos Wange in den Dreck.
»Es hat keinen Sinn zu kämpfen, Mädchen«, sagte er. »Es gibt keinen Grund, warum du es so unangenehm für uns beide machst.«
»Ich bin kein Mädchen.« Wut sammelte sich in ihrer Brust. »Ich bin Hattori Mariko. Und dafür wirst du sterben. Durch meine Hand.«
Das schwöre ich.
Er schnaufte belustigt, seine Unterlippe ragte selbstgefällig hervor, glänzend vor Speichel. »Diejenige, die dem Tod geweiht ist, bist du. Wenn der Schwarze Clan dich töten will, schaffst du es nie im Leben durch diesen Wald.« Er wischte seinen Mund an einer Schulter ab, dann hielt er inne, als ob er gründlich nachdächte. »Aber ich wäre bereit, über andere Möglichkeiten nachzudenken.« Sein Blick blieb an dem Streifen nackter Haut oberhalb ihres Ellbogens hängen.
Der Ausdruck in seinem Gesicht ließ Mariko wünschen, sie könnte ihm die Gurgel herausreißen, und zwar mit nichts als ihren Zähnen. »Ich treffe keine Abkommen mit Dieben.«
»Wir sind alle Diebe, Mädchen. Gerade du und die Deinen.« Er legte ihr die Schneide des Wakizashi ans Kinn. »Entscheide dich. Gehe mit mir einen Handel ein, und ich bringe dich wohlbehalten zurück zu deiner Familie. Gegen einen angemessenen Preis, versteht sich.« Sein faulig riechender Atem überwältigte sie. »Oder warte und schließe deinen Handel mit dem Schwarzen Clan. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich lieber mit mir einig werden. Ich bin viel netter. Und ich werde dir nichts tun.«
In der Lüge erkannte sie die Wahrheit. Sah sie, in seinem Blick verborgen.
Ich werde mich nicht mehr von Männern bestimmen lassen. Ich bin keine Trophäe, die man kaufen oder verkaufen kann.
Mariko gab das Verlangen zu kämpfen auf, tat, als ob sie nachdächte. Als ob sie kapitulierte. Das Wakizashi ließ von ihrem Kinn ab, genau in dem Moment, als ihre Hände herabsanken. Ohne auch nur eine Sekunde machzudenken, warf sie dem Mann eine Handvoll Dreck genau in die Augen. Er schlug wild um sich, seine Finger trafen die Erdklumpen, sein weicher Unterbauch lag frei. Mariko schlug ihm von unten gegen den Hals, dann rollte sie sich weg, als er hustete und würgte, voller Not, Luft zu bekommen. Mariko versuchte aufzustehen – versuchte wegzulaufen –, aber ihr dünnes weißes Unterzeug verhedderte sich in seinen Beinen. Sie fiel auf ihn, und er packte sie blindlings.
Ohne nachzudenken, zog Mariko die Schildpattnadel aus ihren Haaren …
Und stach sie direkt in sein linkes Auge.
Der Schmuck durchbohrte seinen Augapfel wie eine Nadel eine Traube.
Sein Schrei kam langsam. Gequält.
Dem Geräusch folgte ein plötzlicher Moment der Klarheit. Er wuchs in Marikos Brust, verteilte sich wie ein Schluck perfekt gebrauten Tees.
Einfach. Instinktiv.
Sie entriss ihm das Wakizashi und schlitzte dem Mann die Kehle auf, von einem Ohr zum anderen.
Sein Schrei wurde von Gurgeln erstickt. Purpurne Blasen spritzten über seine Lippen, als er versuchte, seine letzten Worte zu formen. Nach einigen Augenblicken war er still. Bewegungslos, nur dass noch Blut aus seinem Auge und seiner Kehle tropfte.
Mariko schleppte sich weg und erbrach sich in das Unterholz.
***
Hattori Mariko kauerte sich an den borkigen Stamm einer alten Pinie. Ihr Körper schaukelte vor und zurück. Sie sah, wie ihre weißen Tabi-Socken von dem beschlagenen Moos feucht wurden. Das Gestrüpp um sie herum war eine Zuflucht geworden, die Flechten zu ihren Seiten so etwas wie ein Umhang. Rauschende Pinienwipfel wiegten sich über ihrem Kopf. Ihr nachklingendes Stöhnen brachte die Rastlosigkeit verlorener Seelen in Erinnerung. Die vielen rastlosen Seelen, die ihren Untergang im Schatten des Jukaiwaldes gefunden hatten. Weniger als einen Steinwurf von ihr entfernt lag eine dieser verlorenen Seelen.
Den Sternen sei Dank, dass ich nicht unter ihnen bin.
Jedenfalls jetzt noch nicht.
Mariko schlang ihre Arme um die Beine. Als ob sie sich selbst Halt geben könnte.
Der Wald hatte sie vielleicht bisher noch nicht für sich selbst gefordert, aber es war klar, dass sie schrecklich verloren war. Außerhalb jeder Vorstellung. In einem Labyrinth aus Holz, bevölkert von allerlei Kreaturen – sowohl menschlichen als auch nicht menschlichen –, die sie umbringen konnten, wann immer ihnen der Sinn danach stand. Die Dunkelheit, die ihr gerade zur Zuflucht gereicht hatte, würde ihr wahrscheinlich auch das Verderben bringen. Ihre unmittelbare Bedrohung erinnerte sie an eine Gelegenheit vor zehn Jahren, als Kenshin sie herausgefordert hatte, mit ihr unter die Oberfläche des Sees am Rand der Ländereien ihrer Eltern zu tauchen. Es war der Nachmittag nach einem Sommersturm gewesen. Das Wasser war schlammfarben gewesen, der Schlick auf seinem Grund in ständigem Wirbel.
Obwohl sie normalerweise solche unsinnigen Wettbewerbe mied, war Mariko aber immer eine exzellente Schwimmerin gewesen. Und Kenshin hatte sich an diesem Tag besonders selbstgefällig aufgeführt. Er hatte sich den Denkzettel geradezu erbettelt. Also war sie bis zum Grund getaucht, ihre Hände pflügten in selbstbewussten Zügen durch das trübe Wasser. Als sie ihr Ziel berührt hatte, hatte ein Zweig mit verdrehten Blättern ihre Wange gestreift und sie verwirrt. In diesem Moment hatte sie die Orientierung verloren. Mariko wusste nicht mehr, wohin sie schwimmen sollte. Sie fand den Weg zurück nicht mehr, egal, in welche Richtung. Sie hatte einen Mundvoll Wasser nach dem anderen geschluckt, und die Angst hatte ihr Selbstvertrauen gebrochen. Hatte an ihrem Selbstvertrauen gekratzt, bis es ganz auseinandergefallen war.
Wenn nicht der Trost von Kenshins beruhigenden, sicheren Händen gewesen wäre, hätte Mariko an diesem Tag umkommen können. Genauso fühlte es sich hier an. In dieser Dunkelheit voller Bedrohung. In diesem Wald, der in seinem Schoß die Albträume von Jahrtausenden barg.
Der Ruf einer Eule durchbrach die Stille. Sie stieß herab, auf der Jagd nach ihrer Abendbeute.
Zu ihrer Linken bemerkte Mariko ein Spinnennetz in einer Astgabel ganz in der Nähe. Tautropfen hingen in den seidenen Fäden. Sie konzentrierte sich auf die Art, wie die Tropfen anschwollen. Wasser sammelten. Hinunterliefen an der schimmernden Seide, um sich in der Mitte zu treffen.
Ehe sie zwinkern konnte, spritzte das Wasser in einer Kaskade von Diamanten aus dem Spinnennetz. Seine Herrin war zurückgekehrt, acht lange Beine, die sich über die Oberfläche streckten.
Hockte da und wartete auf Beute.
Mariko wäre am liebsten aus ihrer Haut gefahren. Sie wollte etwas anderes sein, egal was, überall, nur nicht hier.
Ein Windstoß strich durch die dornigen Brombeerbüsche, die sie umgaben. Seine Brise wehte unter ihre Haare und hob die losen Strähnen. Sie verfingen sich auf ihren klebrigen Wangen. Auf der salzigen Nässe, die ihre Tränenströme hinterlassen hatten.
Sie musste den Weg nach Hause finden. Zurück zu ihrer Familie. Zurück dahin, wo sie vermeintlich hingehörte.
Aber Mariko konnte das Karussell ihrer Gedanken nicht zum Stillstand bringen.
Konnte ihre Neugierde nicht unterdrücken.
Sie wollte – nein, musste – herausfinden, warum der Schwarze Clan beauftragt worden war, sie umzubringen.
Wer wollte sie tot sehen? Und warum?
Sie holte sorgfältig Luft. Umschlang ihre Knie, bis sie sich in ihre Brust drückten, und zwang sich, mit dem Schaukeln aufzuhören.
Und fing an zu denken.
Was würde Kenshin tun?
Die Antwort darauf war einfach. Ihr Bruder würde nicht eher ruhen, als bis er herausgefunden hatte, wer versucht hatte, ihn umzubringen. Wer seine Familie ausgeraubt und ihn beinahe ums Leben gebracht hatte. Kenshin würde nicht ruhen, bis er die Köpfe seiner Feinde nach Hause gebracht hätte, in Säcken, die von ihrem Blut rot gefärbt waren.
Aber ihr Bruder durfte sich solch selbstständiges Ermessen erlauben. Nach seinem Gutdünken handeln. Schließlich hatte er den Namen »Drache von Kai« nicht erworben, indem er sicher in den Wänden des Familienanwesens geblieben war.
Er hatte ihn sich auf dem Schlachtfeld verdient. Mit jedem einzelnen Schwertstreich.
Wenn Mariko nach Hause zurückkehrte, würde ihre Familie ihr umgehend die Tränen trocknen und sie wieder zurückschicken. Auf demselben Weg zurückschicken. Ein jegliches Wort, das über die Ereignisse im Jukaiwald ausgesprochen worden war, würde bis zum Tod im Stillen bewahrt werden. Wenn der Kaiser oder der Prinz oder ein anderes Mitglied des Adels erführen, dass Mariko auf dem Weg nach Inako angegriffen worden war, könnte die kaiserliche Familie das Ehe-Arrangement vielleicht auflösen. Könnte behaupten, dass dieses Unglück ein schlechtes Omen sei. Eines, das kaiserlichem Blut nicht zugemutet werden könne.
Ganz zu schweigen von der unvermeidlichen Frage, die sicher folgen würde. Die Gerüchte, die hinter ihrem Rücken verbreitet würden.
Die Frage nach Marikos Tugend. Verloren im Wald, allein unter Mördern und Dieben. Eine Frage, die bestehen bleiben würde, trotz der aufrichtigen Proteste ihrer Familie.
Mariko verzog den Mund.
Genau die Frage, die sie aus Rache schon beantwortet hatte. An einem Nachmittag in berechnender Wut. Aber wenn …
Wenn.
Wenn sie die Wahrheit erführe – wenn sie erführe, wer den Schwarzen Clan ausgesandt hatte, sie zu ermorden –, könnte Mariko ihren Eltern die Beschämung ersparen, dass ihre Tochter abgelehnt würde. Könnte ihnen das Risiko ersparen, dass der Name ihrer Familie mit einem Schatten von Verdächtigungen beschmutzt würde.
Die Gedanken begannen sich langsam durch die Windungen ihres Geistes zu wühlen, mit der Hartnäckigkeit einer Schlange.
Und wenn jemand aus Inako den Schwarzen Clan geschickt hatte? Wenn eine rivalisierende Adelsfamilie ihren Tod arrangiert hatte, um das anwachsende Vermögen der Hattoris zu vernichten?
Wenn es sich so verhielte, dann käme jeder in der kaiserlichen Stadt infrage.
Wenn Mariko erst die Wahrheit hinter den Vorfällen von heute Abend kennen würde, könnte sie die Gegner ihrer Familie entlarven und sich so als dienlich für den Namen Hattori erweisen. Und das nicht nur, indem sie eine vorteilhafte Ehe einging.
Außerdem hätte sie ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen, die sie nach eigenem Gutdünken umherstreichen konnte.
Dann würde sie zurückkehren und auf immer und ewig eine pflichtbewusste Tochter sein.
Mariko schluckte. Sie konnte den Hauch von Freiheit geradezu schmecken. Sein süßes Versprechen reizte ihre Zungenspitze.
Wieder kam eine kühle Brise auf und brachte ihr Haar vollends durcheinander. Ein leichter Duft nach Kamelien erfüllte ihre Nase. Das Öl, das sie benutzte, um ihre widerspenstigen Strähnen zu bändigen. Sie gefügig zu machen.
Was sie daran erinnerte …
Hattori Mariko konnte das Reich Wa nicht mit Muße durchstreifen.
Ein Mädchen aus nobler Familie konnte so etwas nicht wagen. Ganz zu schweigen davon, dass Hattori Kenshin einer der besten Spurensucher des Landes war. Sobald ihr Bruder entdeckte, dass Mariko vermisst wurde, würde er seine Suche beginnen. Daran bestand kein Zweifel. So war es immer gewesen. Obwohl Kenshin nur ein paar Augenblicke älter war als Mariko, hatte er sich immer um sie gekümmert, immer auf sie aufgepasst, seit sie Kinder gewesen waren.
Ihr Bruder würde sie finden. Das stand außer Frage.
Verärgert wischte sie sich mit einem ihrer weißen Ärmel über die Stirn. Ein Streifen schwarzen Rußes rieb sich in die weiße Seide. Das verkohlte Paulownia-Holz, das benutzt worden war, um ihre Augenbrauen zu verschönern. Mariko rieb an dem befleckten Ärmel, dann gab sie mit einem leisen Fluch auf, ihr kurzes Glücksgefühl zerstört von dem unvermeidbaren Zusammenprallen mit der Wahrheit.
Ihr Blick fiel auf das blutbefleckte Wakizashi, das in Reichweite lag. Da sie sich nicht weiter um den Verlust ihrer feinen Unterkleider kümmerte, wischte sie das Blut am Saum ab. Verschmutzte sie nur noch mehr. Blut und Paulownia-Kohle.
Es stimmte, dass Hattori Mariko das Reich nicht nach ihrem Gutdünken durchstreifen konnte. Aber wenn.
Wenn.
Mariko entfernte die Jadespange aus dem letzten Haarring in ihrer Hochsteckfrisur. Die schwarzen Strähnen fielen ihre Schultern hinab bis zu ihrer Taille wie eine Welle aus parfümiertem Ebenholz. Sie fasste ihr Haar in einer Hand zusammen, direkt am Nacken.
Später würde sie sich wundern, dass sie überhaupt nicht gezögert hatte. Nicht einen Augenblick.
Mariko durchtrennte die zusammengefassten Strähnen mit einem Schnitt.
Dann stand sie auf. Mit nur einem einzigen Blick der Reue verstreute Mariko ihre Haare in dem dornigen Brombeergestrüpp, sorgfältig darauf bedacht, die Strähnen tief im Schatten zu verbergen.