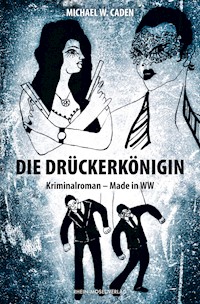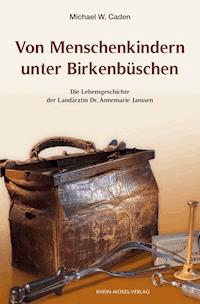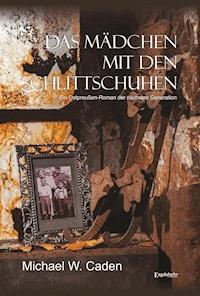
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Paar Schlittschuhe bleiben in den Kriegstagen im Januar 1945 in einem Haus in Ostpreußen zurück und landen 60 Jahre später in den Händen eines kleinen polnischen Mädchens, das sie auf einem Dachboden entdeckt. Albert Steinky, dem diese Schlittschuhe einst gehörten, reist nach dem Fall des Eisernen Vorhangs als Nostalgie-Tourist in das Land, in dem er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Während seiner Reise durch das frühere Ermland tauchen sie alle wieder in seiner Erinnerung auf, die einstigen Bewohner seines Heimatdorfes Klotainen: Karlchen, sein kleiner, wortgewandter Bruder. Adolf Willumeit, der Sonderling. Der schwerhörige Pfarrer Brieskorn und die verlotterten Schibulskis. Urbschat, der Schmied, und seine Tochter Sophie mit ihren feuerroten Haaren. Und auch Maluck, der Schattenmann aus dem KZ. Es ist eine Reise mit schönen, aber auch mit schmerzlichen Erinnerungen. Albert trifft das Mädchen mit den Schlittschuhen, das mit seiner Mutter und dem Großvater das einstige Elternhaus der Steinkys bewohnt, und er entdeckt, welch dunkles Geheimnis dieses Kind umgibt. Ein Geheimnis aus einer längst vergangenen Zeit ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael W. Caden
DAS MÄDCHEN MIT DEN SCHLITTSCHUHEN
Ein Ostpreußen-Roman der nächsten Generation
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2014
Dieses Buch beruht in großen Teilen auf wahren Begebenheiten.
Einige Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Uwe Moldenhauer,
Fotostudio Röder-Moldenhauer, Bad Marienberg
Gefördert durch Villa Sonnenmond in Neustadt/Westerwald
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
»Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann.«
Jean Paul
Ankunft in Danzig
Klotainen – Kreis Heilsberg – Ostpreußen. Diese Namen begleiteten ihn sein Leben lang. Wie oft hatte er sie schon geschrieben? Er wusste es nicht. Dutzende Male, das war gewiss. In der Schulzeit, während seiner Ausbildung, bei Bewerbungen, immer, wenn er sie zu Papier brachte, erinnerten sie ihn an ein Leben vor dieser Zeit. An ein Leben, das er beinahe verdrängt hatte. Doch diese Namen waren untrennbar verbunden mit ihm, sie waren Identität, mehr als bloße Worthülsen, mehr als ein gelebtes Gefühl, und sie waren für ihn auch immer eng verknüpft mit Wehmut.
Gedankenversunken blickte der ältere Herr in Reihe 25 aus dem Fenster des Flugzeuges. Der Himmel war wolkenverhangen, dazwischen schimmerte vereinzelt etwas blau. Nach knapp eineinhalb Flugstunden würde er in wenigen Minuten wieder festen Boden unter den Füßen haben – polnischen Boden.
Viele Länder hatte er in den vergangenen 60 Jahren bereist, aber Klotainen, dieses kleine ermländische Dorf im Herzen Ostpreußens, dieser 200-Seelen-Ort, der kaum auf einer Landkarte vermerkt war, blieb für ihn stets unerreichbar. Über Jahrzehnte lag es fern jenseits des Eisernen Vorhangs. Ein Landstrich mit einem unvergleichbaren Zauber. Der Himmel hoch und weit. Und jetzt war es so unvorstellbar nahe – nur einige wenige Stunden trennten ihn noch von diesem Ort.
Planmäßig setzte der Airbus 320 auf der Landebahn von Rebiechowo auf. Ein paar Fluggäste applaudierten verhalten. Nicht alle der 150 Sitzplätze waren besetzt, hier und da klafften Lücken.
»War eigentlich gar nicht so schlimm«, dachte der ältere Mann. Er war Mitte 70, hoch gewachsen, kräftig. Brillenträger. Die vollen grauen Haare hatte er zurückgekämmt. Er trug eine dunkle Faltenhose, dazu ein helles Karo-Hemd, Schlips und ein beiges Sakko. Vor eineinhalb Stunden war er als Passagier von Frankfurt-Hahn in Richtung Danzig gestartet – zum ersten Mal in seinem langen, arbeitsreichen Leben hatte er ein Flugzeug bestiegen.
Kurz bevor der Airbus seine endgültige Halteposition erreichte, setzte reges Treiben im Passagierraum ein. Stauraumfächer wurden aufgestoßen, Handtaschen, Rucksäcke, Pakete hastig herausgezogen. Alles schien der Bewegungsstarre entronnen, die sich noch kurz vor der Landung eingestellt hatte.
Dem Mann dort am Fenster machte die plötzliche Hektik nichts aus – eigentlich schien er sie nicht einmal zu bemerken. Noch immer in Gedanken versunken blickte er über den Rand seiner Brille durch das kleine Seitenfenster zum Flughafengebäude hinüber. »Lech Walesa Airport« stand dort in dicken Lettern zu lesen.
Er spürte, wie sein Puls an Tempo zunahm, fühlte, wie er am Kragen schwitzte, wie die Nässe stromlinienförmig über seine Hände glitt. 1945 war er in Danzig am Bahnhof nur knapp dem Beschuss durch sowjetische Tiefflieger entkommen. Es war mit einem Male so, als hätte sich die Uhr von einem Augenblick auf den anderen um sechzig Jahre zurückgedreht. Hunderttausende befanden sich auf der Flucht vor der sowjetischen Kriegsfurie. Bilder schossen ihm durch den Kopf. Fragmente von schmerzverzerrten Gesichtern. Grauenhafte Bilder. Bilder, von denen er glaubte, dass er sie längst verdrängt hätte. Ihm war, als höre er die Kommandos der Offiziere. Verwundete wurden in die Waggons gehoben, vor allem Soldaten, notdürftig verbunden, die Uniformen zerfetzt, dazwischen auch Zivilisten: alte Männer, Frauen und Kinder. Er sah, wie Projektile durch die Vertäfelung des Waggons schlugen, Holzsplitter flogen umher. Er hörte die Detonationen, das Schreien der Flüchtlinge, die nichts als nur noch das bloße Leben bei sich trugen. Die Luft roch nach Metall und Schwefel. Flammen schlugen aus dem Bahnhof, ganze Wände des riesigen Gebäudes brachen ein. Eine Mutter blickte ihn wortlos mit großen, starren Augen an, in den Armen hielt sie ihr lebloses Kind.
Wie aus heiterem Himmel tauchten urplötzlich zwei Tiefflieger mit einem ohrenbetäubenden Dröhnen neben den Gleisen auf. Sie luden ihre Salven über der Menschenmenge ab. Zwei Soldaten brachen nur wenige Meter von ihm entfernt tödlich getroffen zusammen. Direkt neben ihm schlugen lange Reihen von kleinen Blitzen in den Boden. Zwei Sanitäter, die einen Verwundeten auf einer Trage transportieren, sackten getroffen zusammen. Ein Soldat stieß ihn in den offenen Waggon, er spürte einen stechenden Schmerz im Bein, dort, wo er Tage zuvor von einem Granatsplitter getroffen worden war. Der Zug setzte sich in Bewegung. Hoffentlich sind die Gleise heil geblieben, schoss es ihm durch den Kopf. Nur weg von hier, dachte er. Nur weg!
»Entschuldigen Sie bitte, mein Herr!« Der Mann am Fenster reagierte nicht.
»Entschuldigen Sie …, Sie müssen aussteigen!«
Aussteigen? Der ältere Herr auf Platz 25a drehte sich in die Richtung, aus der er die Stimme wahrgenommen hatte.
»Der Flug ist zu Ende, gleich kommen die Reinigungskräfte. Sie müssen das Flugzeug jetzt verlassen.«
Die junge Dame mit dem frisch aufgetragenen Make-up war freundlich, aber bestimmt. Sie lächelte.
»Ja gut, ich komme.«
Der ältere Herr rückte die Hemdsärmel noch einmal gerade. Er packte seine kleine Reisetasche, die er unter dem Sitz verstaut hatte, zupfte kurz an der Krawatte und ging in Richtung Ausgang.
»Wir hoffen, Sie beehren uns bald wieder«, meinte die Flugbegleiterin, als er die Maschine verließ.
Noch immer in Gedanken versunken blickte der Mann zur Stewardess.
»Was meinten Sie?«
»Wir hoffen, Sie beehren uns bald wieder.«
»Hm ja«, brummelte er. »Ja, ja…«
Zielstrebig steuerte der ältere Herr das Eingangstor zum mehrstöckigen Passagierterminal an. Auf halber Strecke kreuzte er einen Container. Durch eine große Glasscheibe erblickte er mehrere Männer in Uniform. Es waren Soldaten, die an einem Tisch saßen und redeten. Einer lachte. Zwei andere gestikulierten mit den Händen. Einer der Uniformierten blickte flüchtig zu ihm hinüber. Der Mann schaute angestrengt weg. Was niemand sehen konnte: Seine Hände waren immer noch schweißgebadet.
Was ist mit den Soldaten? Werden sie dich kontrollieren? Wirst du die Tasche öffnen müssen? Was, wenn sie deinen deutschen Pass sehen?
Nur nicht auffallen!, dachte der Mann. Auf gar keinen Fall auffallen!
Doch nichts von alldem geschah. Die Uniformierten nahmen den letzten Passagier des Fluges 3093 nicht einmal zur Kenntnis.
Als er seinen Koffer vom Fließband geholt hatte und die Ankunftshalle durch die geöffnete elektronische Schiebetür verließ, fiel sein Blick auf ein Namensschild, das jemand gut sichtbar über eine kleine Menschentraube hielt. »Albert Steinky«, stand auf diesem Schild handschriftlich geschrieben.
Steinky, das war kein Allerweltsname. Nein, er war eben typisch ostpreußisch, dachte der alte Mann. Manche Familien dort hießen Wölky, Langanki oder Kutschki. Und er hieß eben Steinky. Albert Steinky, das war sein Name. Das war der Junge, der vor rund 60 Jahren aus dem Osten des Deutschen Reiches vor der russischen Kriegsfurie flüchten musste und der jetzt am Ende seines Lebens als alter Mann zurückkehrte. Albert Steinky. 74 Jahre alt. Gelernter Stuckateur. Verwitwet. Katholisch. Kinderlos. Geboren in Klotainen, Kreis Heilsberg. Ein Mann auf der Reise in seine Vergangenheit. Ein Mann auf der Reise in seine alte Heimat Ostpreußen.
»Willkommen in Danzig«, grüßte ihn der Mann mit dem Schild. Er war ein paar Jahre jünger als Albert Steinky, trug ein helles Sakko von der Stange und eine dunkelblaue Jeans, die schon bessere Tage gesehen hatte.
»Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug!«
»Angenehm?! Na ja, es war mein erster! Hätte schlimmer kommen können!«, scherzte Steinky.
»Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle: Heinrich Ostrowski. Ich bin Ihr Reisebegleiter. Ich komme aus der Nähe von Allenstein, aus Guttstadt. Darf ich Ihren Koffer nehmen?«
»Ja, gerne«, antwortete Albert Steinky und reichte ihn rüber.
»Kommen Sie, der Wagen steht gleich um die Ecke.«
Die beiden verließen das Flughafengebäude und gingen zu einem silberfarbenen Ford Fiesta.
»Wir brauchen etwa drei bis vier Stunden bis zum Hotel Pod Klobukiem nach Heilsberg – je nachdem wie stark der Verkehr auf der E 77 ist.«
Ostrowski öffnete die Hecklappe des Autos. Dann legte er den Koffer und die Reisetasche hinein. Albert Steinky nahm derweil Platz auf dem Beifahrersitz. Ostrowski startete das Fahrzeug, der Wagen rollte aus der Ausfahrt des Flughafengeländes und bog auf die Kartuska-Schnellstraße in Richtung Danzig ein. Der Autoverkehr hielt sich in Grenzen.
»Kennen Sie die Altstadt von Gdansk, äh Danzig?«, fragte Ostrowski.
»Nein« , antwortete Steinky. »Ich kenne nur den Bahnhof, und den habe ich auch nur einmal kurz gesehen – das war nachts im Februar 1945. Da blieb jedoch keine Zeit für Sightseeing, wie das auf Englisch so schön heißt«, scherzte Steinky. »Da haben die Russen ein Riesenfeuerwerk veranstaltet. Ich hatte wahnsinniges Glück!«
»Ja, Danzig«, seufzte Ostrowski, wurde aber im nächsten Moment geradezu euphorisch. »Die Stadt war nach dem Krieg bis zu 60 Prozent zerstört, die Polen haben in den Jahren danach wirklich eine tolle Aufbauarbeit geleistet. Die Altstadt, die müssen Sie einmal besuchen, Herr Steinky.«
»Ja, ja – mal sehen, wenn später noch Zeit ist – gerne.«
Albert Steinky schaute nachdenklich aus dem Fenster. Überall blickte er auf Reklametafeln in polnischer Schrift. Alles wirkte fremd auf ihn. War es wirklich richtig, diese Reise anzutreten? Würden nicht zu viele Gräben wieder aufgerissen? Vielleicht waren die alten Wunden in seiner Seele noch nicht ausgeheilt! Doch wenn er nicht jetzt gereist wäre – wann dann? Sicher hätte er seine Heimat niemals wieder gesehen. Nein, so sollte sein Leben nicht zu Ende gehen. Nicht ohne ein Wiedersehen. Nein, ein Zurück, das würde es für ihn jetzt nicht mehr geben …
Ostpreußen war tabu
Schon eine ganze Weile fuhren sie jetzt über die E 77 Richtung Südosten – Albert Steinky und Heinrich Ostrowski, sein deutsch-polnischer Fremdenführer. August Raschke, ein Bekannter Alberts aus einem Nachbardorf im Westerwald, hatte ihn empfohlen. Vor ein paar Jahren hatte dieser den alten Ostpreußen bei einer Angelreise durch Masuren kennen gelernt. »Heinrich, der weiß alles über Ostpreußen und das Ermland. Er ist wie ein Ostpreußen-Lexikon auf zwei Beinen, spricht fließend Deutsch und Polnisch«, hatte Raschke den älteren Herrn mit dem großen Schnauzer gerühmt. Er sei zudem immer froh, wenn er sich zu seiner kleinen Rente ein paar Zloty dazu verdienen könne. Für die nächsten neun Tage würde Heinrich Ostrowski seinem Begleiter aus dem Westerwald nicht mehr von der Seite weichen.
»Was gibt es Neues zuhause?«, fragte Albert. Irgendwie musste er die Konversation ja wieder in Gang bringen. Schon vor geraumer Zeit war es im Auto merklich ruhig geworden. Lediglich aus dem Radio sprudelte gedämpfte Musik. Ein paar polnische Wortfetzen konnte Albert verstehen. Mehr nicht. Es ging wohl um Liebe. Um was auch sonst?! Hier ist es auch nicht anders als in Deutschland, dachte er.
Aber hatte er eben wirklich zu Hause gesagt? Nachdenklich blickte Albert Steinky aus dem Fenster. War dort, wo er hinfuhr, zu Hause? War es nicht der Westerwald? Nicht dieses kleine, idyllische Dörfchen unweit des Elbbaches, wo er seit mehr als 60 Jahren wohnte? Dort wo man jeden kannte und wo man mehr über den anderen wusste, als über sich selbst?
»Unser Zuhause ist woanders«, hatte sein Vater früher immer gesagt, wenn im Westerwald die Sprache auf Heim und Herd im Ermland kam. Doch viel gesprochen über dieses Land, das er jetzt nach vielen Jahren wieder für sich neu entdecken wollte, wurde nicht. Ostpreußen war tabu. Zuhause, das war eben woanders. Und ein bisschen war es wohl auch so. Doch war dieses winzige Stückchen Land in Klotainen, das noch nicht einmal seiner Familie gehört hatte, war das sein eigentliches, sein wahres Zuhause? Sollte das die Heimat in seinem Herzen sein? War es das, was seine alte rastlose Seele suchte?
Albert Steinky fiel es schwer, seine Gedanken zu ordnen. In den unterschiedlichsten älteren Atlanten hatte er vor der Abreise nach Heilsberg und Klotainen gestöbert. »Unter polnischer Verwaltung« stand zumeist quer über dieses Gebiet geschrieben. Albert hatte diesen Schriftzug nie akzeptiert. Für ihn war und blieb alles Deutschland. Es konnte für ihn nicht sein, dass solch ein riesiges Gebiet wie Ostpreußen mit Millionen von deutschen Menschen schlichtweg abgetrennt, die dort Heimischen umgebracht oder rausgeschmissen wurden und mit anderen Menschen, die nichts aber auch gar nichts mit diesem Land zu tun hatten, besiedelt wurde. Dieses Gefühl beherrschte ihn bis heute, besonders in diesem Augenblick, als er jetzt gen Osten fuhr. Sein Verstand versuchte auch nach all den vielen Jahren immer noch das Unfassbare des wirklichen Verlustes zu verarbeiten. Innerlich akzeptieren würde er es wohl aber nie.
»In Elbing wird viel gebaut«, erzählte Heinrich, der jetzt mit seinem Wissen unter Beweis stellen wollte, dass er sein Geld wert ist. »Seit 1990 wurde die Altstadt unter Verwendung historischer Bauformen wieder aufgebaut. Jetzt gibt es sie wieder, die spitzen Giebel zur Straße hin. Es ist eine Art Fachwerkimitation. Seit dem Jahr 2000 stehen auch wieder viele Gebäude an der Elbinger »Waterkant.« Wissen Sie, Herr Steinky, 1945 wurde Elbing durch die Rote Armee stark zerstört und die deutsche Bevölkerung fast vollständig vertrieben. Es hat recht lange gedauert, bis die Stadt wieder ganz auf die Beine kam.«
»Mein Vater stammte aus Elbing«, fügte Albert für seinen Begleiter völlig unerwartet ein. »Als Kind lebte er dort, ist wohl dann irgendwann ausgerissen, weil er zu Hause Probleme hatte.«
»Ach ja, das ist interessant. Wo hat es ihn denn hingetrieben?«
»Ins Ermland, bis nach Heilsberg. In der Nähe hat er später auf einem Rittergut meine Mutter kennen gelernt.«
»Ach übrigens, ich heiße Albert.«
»Weiß ich«, meinte Heinrich Ostrowski scherzhaft und deutete mit dem Finger auf das Namensschild auf dem Rücksitz, mit dem er Albert am Flughafen in Empfang genommen hatte. Beide gaben sich die Hand.
»Ich bin der Heinrich, geboren am 17. August 1935 auf einem Gutshof bei Guttstadt. Dort lebe ich schon ein Leben lang. Dort möchte ich auch begraben sein. Aber noch nicht so bald. Ich hoffe, der liebe Herrgott gibt mir noch ein Quäntchen Zeit.«
Albert erblickte auf der Konsole über dem Handschuhfach einen Christophorus. Ob man den hier braucht? Gerade nach dem Zerfall des Ostblocks hörte man immer wieder, dass sich die jungen Polen mit den schnellen, neuen Westautos in den Alleen Ostpreußens zu Tode fuhren. Abholzen wollte man diese prachtvollen Baumbestände – für Albert unvorstellbar. Allein der Gedanke daran für ihn ein Stich mitten ins Herz.
»Schau, Albert, da drüben – der Turm der Nikolaikirche.« Heinrich deutete nach links aus dem Fahrzeugfenster.
Albert hatte den Turm schon seit einiger Zeit bemerkt. Und auch die Hinweisschilder hatte er keinen Moment aus den Augen gelassen. Elblag, der polnische Name für Elbing, hatte ihn schon seit Beginn der Fahrt in Danzig begleitet. Doch er konnte sich nie so recht daran gewöhnen, nicht in 60 Jahren, nicht hier und nicht heute. Elbing, das war für Albert die Stadt, in der Loeser & Wolff 1878 die größte Zigarrenfabrik Kontinentaleuropas gründeten. Hier stand die größte ostdeutsche Molkerei. Hier wurde das erste protestantische Gymnasium Preußens eingerichtet und der Preußische Bund gegründet. Elbing das war auch Schiffsbau, das war deutsch und mehr als nur ein Wort – Elbing, das war der Geburtsort seines Vaters, auch ein Teil seines Lebens.
»Wie sehen die Polen das heute eigentlich, wenn immer mehr Deutsche zu Besuch kommen?«, fragte Albert. Mittlerweile hatten sie Elbing schon ein Stück weit hinter sich gelassen und steuerten auf Preußisch Holland zu.
»Wissen Sie Herr Steinky, ähm Albert, die Leute sind verunsichert. Kaczynski hat den Eindruck erweckt, und viele Boulevard-Zeitungen sind drauf angesprungen, dass die Deutschen nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zurückkommen werden. In Ostpreußen hat Kaczynski den polnischen Familien »hundertprozentige Rechtssicherheit« versprochen; sie dürften keine Angst haben, dass ihnen jemand ihr Land wegnehme. Kaczynski will deutschen Ansprüchen auf Eigentum in Polen endgültig einen Riegel vorschieben. Er kündigte an, er werde das Problem der Rückgabe von Immobilien an frühere deutsche Eigentümer ‘ein für alle Mal’ regeln. Die Ansprüche Deutscher, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben und enteignet wurden, lösen in den betroffenen polnischen Gebieten große Sorge aus.«
Albert hatte davon gehört. Doch er sagte nichts, schaute stattdessen nur aus dem Fenster. Sie passierten gerade einen kleinen Ort. Er sah, wie ein paar Kinder an einer Schule Seilhüpfen spielten.
»Ich stamme aus einem kleinen Ort namens Klotainen. Das liegt in der Nähe von Heilsberg«, begann Albert ganz unverhofft zu erzählen. »Dort gab es auch ein gleichnamiges Rittergut. Mein Vater arbeitete dort. Er war Kutscher und für die Pferdestallungen verantwortlich. Meine Mutter arbeitete auf dem Gut als Köchin. Wir waren zu fünft: Mein Vater Willi, Mutter Elisabeth, ich, mein jüngerer Bruder Karl und Lieschen, unser Nesthäkchen.«
»Ja, Pferde, die hatten wir auch auf unserem Hof bei Guttstadt«, wandte Heinrich ein. »Die stammten zwar nicht aus großen Züchtungen, doch wie sagte mein seliger Vater doch immer so schön: ‚Schwarze Kehj gewe ok witte Melk’. Sie haben ihren Zweck erfüllt, und es waren wunderbare Arbeitstiere.«
In ein paar Hundert Meter Entfernung entdeckte Heinrich einen Kirchturm.
»Da schauen Sie, Albert, wir sind schon in Preußisch Holland. Jetzt geht’s nur noch gen Osten.«
»Mein Gott, wie schön – die ersten Alleen.« Wie sehr hatte sich Albert nach ihnen gesehnt. Er kannte diesen Anblick nur noch aus Reisereportagen im Fernsehen. Wie ihn dieser Anblick faszinierte.
Direkt hinter Preußisch Holland nahm der Straßenverkehr merklich ab. Nur noch ab und zu begegnete den beiden ein Fahrzeug.
»Ich wusste gar nicht mehr, dass es hier so einsam sein kann.«
»Ja, das kann es. Besonders im Winter.«
»Wie weit ist es noch bis Heilsberg?«
»Vielleicht so fünfzig Kilometer.«
Die Landschaft nahm Albert gefangen. Beim Blick aus dem Fenster fielen ihm sofort die vielen Wegekreuze und Kapellen an den Straßen und in den Vorgärten auf. Wie früher, dachte Albert. Doch was nicht passen wollte, das waren die verlassenen und verfallenen Bauernhöfe, die wie stumme Zeugen einer verfehlten Agrarpolitik in der hügeligen Landschaft standen.
Albert blickte kurz zu seinem Begleiter.
»Gibt es hier noch viele Bauernhöfe?«
»Ja, die gibt es.«
»Das war früher auch schon so. Es hat sich nicht viel verändert. Meine Mutter stammte von solch einem Hof in der Nähe von Raunau am Rande des Ermlandes.«
»Ja, ja, das Ermland. Eine katholische Insel in der evangelischen Provinz Ostpreußen, es war ein Bauernland mitten im Gebiet des Großgrundbesitzes«, schwärmte Heinrich, aus dem es jetzt nur so heraussprudelte. Er hatte, so schien es, seine Hausaufgaben gemacht.
»Es gab keine natürlichen Grenzen, die es von den Nachbargebieten trennten, nur durch die geschichtliche Entwicklung ist die Sonderstellung des Ermlandes innerhalb Ostpreußens zu erklären. Obwohl im Herzogtum Preußen nach 1520 die Reformation eingeführt wurde, behauptete der Bischof von Ermland seine Selbstständigkeit. Das Bistum blieb katholisch.«
»Ich dachte immer, dass es heutzutage ärmlich hier aussehen würde. Das tut es aber gar nicht«, meinte Albert nachdenklich.
»Die Gegend gehört auch heute noch zu den fruchtbarsten Gebieten Ostpreußens. Es gibt zwar keine großen Güter mehr, dafür aber überall wohlhabende Dörfer. Neben dem Ackerbau widmeten sich die ermländischen Bauern schon immer der Vieh- und Pferdezucht und der Milchwirtschaft. Die mittelschweren Pferde hier wurden immer sehr geschätzt. Zwischen den wohl bestellten Feldern und fetten Weiden fehlte es nie an Naturschönheiten. Im Walschtal fand der naturfrohe Wanderer ein unberührtes Naturschutzgebiet mit seltenen Pflanzen, an der Simser und der Alle anmutige Flusstäler, und im Kreis Allenstein war er mitten im Land der dunklen Wälder und kristallenen …«
Völlig unverhofft beendete Heinrich seinen Monolog. Er stoppte den Fiesta und setzte den Blinker. Dann bog er mit dem Wagen nach links in eine kleine Einfahrt.
»Wir sind da! Da oben links ist das Hotel.«
Albert und Heinrich hatten sich lange über das Land und seine Menschen unterhalten. Dabei war es Albert ganz entgangen, dass sie das Ortseingangsschild von Heilsberg bereits passiert hatten. Die letzten 50 Kilometer waren wie im Fluge verstrichen.
»Da ist es also, das Pod Klobukiem«, sagte Heinrich und betonte es dabei so, als habe er gerade ein Fünfsterne-Luxushotel angesteuert.
Na ja, ganz nett von außen, dachte sich Albert. Das Gebäude schaute mit diesen dicken Leuchtreklamebuchstaben an der Außenfassade zwar noch etwas sozialistisch drein, doch Heinrich hatte es ihm angepriesen wie warme Semmeln. Vor ein paar Jahren hatte der Besitzer gewechselt. Der neue Eigentümer brachte das Hotel wieder auf Vordermann. Heinrich hatte schon am Telefon mit ihm Bekanntschaft gemacht.
Heinrich stoppte den Wagen vor dem Hotel. Sie stiegen aus und holten das Reisegepäck aus dem Kofferraum. Da kam ihnen auch schon jemand aus der Eingangstür des Hotels entgegen.
»Guten Tag, die Herrschaften. Herzlich willkommen im Pod Klobukiem. Ich heiße Janusz und bin der Manager dieses Hotels. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise.«
Der Hotelier war ein kleiner, quirliger Mann, leicht untersetzt, etwa Mitte 30, im eleganten Anzug. Er sprach einwandfreies Deutsch mit einem leichten Akzent.
»Ja, das hatten wir. Woher können Sie so gut Deutsch«, interessierte sich Albert.
»Ich habe es von meiner Mutter gelernt. Sie war Deutsche und hat nach dem Krieg einen Polen geheiratet. Später habe ich ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet.«
Sie gingen durch den Hoteleingang zur Rezeption, stellten die Koffer ab und erledigten die Formalitäten. Der Hotelier fischte den Zimmerschüssel vom Schlüsselbrett hinter dem Tresen, nahm eine der Taschen und trug sie die Treppe hoch bis zum Zimmer.
»So, da sind wir, das sind Ihre beiden Einzelzimmer. Ich habe Ihnen die 110 und die 111 gegeben. Ich hoffe, Sie werden sich wohl bei uns fühlen.«
»Vielen Dank, ich denke schon«, meinte Albert.
Der Hotelier reicht den beiden die Zimmerschlüssel und verabschiedete sich. Es war bereits spät am Nachmittag, in Kürze würde sich die Dunkelheit über das Land legen. An diesem Abend würden sie nichts mehr unternehmen. Albert und Heinrich richteten sich in ihren Zimmern ein, dann gingen sie gemeinsam zum Abendessen. Es gab Gegrilltes. In der Ecke neben dem Eingang zum Restaurant erblickte Albert einen in Holz gearbeiteten Spruch unter der angedeuteten Silhouette des Bischofsschlosses. Er war in deutscher Sprache verfasst: »Willkommen in Heilsberg, im Herzen des Ermlandes«, stand dort zu lesen.
Am See
Als Albert am Morgen aufwachte, grüßte ihn von draußen Vogelgezwitscher. Er hatte am Abend vergessen, das Fenster zu schließen. Es stand auf Kipp. Es war ein herrlicher Tag, der Himmel strahlend blau. Albert brachte seine Morgentoilette hinter sich. Er verließ das Zimmer, schloss die Tür hinter sich und ging die Treppe hinunter ins Restaurant. Dort traf er auf Heinrich, seinen Begleiter, der sich bereits Kaffee eingegossen hatte. Es war erst kurz nach acht. Albert belegte zwei Brötchen mit Wurst und Käse, dazu nahm er ein gebackenes Ei und zwei leckere Pfannkuchen. Er schüttete sich Kaffee ein. Heinrich mochte es eher herzhaft, er blieb bei der polnischen Leberwurst.
»Wo geht es heute hin, Albert?«, fragte Heinrich, während er genüsslich an der zweiten Tasse Kaffee schlürfte.
Albert brauchte nicht lange zu überlegen. Er hatte sich seinen Tagesplan schon zurechtgelegt.
»Ich dachte, wir fahren als erstes zum See, der liegt auf dem Weg. Dann machen wir einen Abstecher nach Klotainen und schließlich, wenn die Zeit noch reicht, sollten wir der Kirche in Siegfriedswalde noch einen Besuch abstatten.«
Heinrich wischte sich zufrieden den Mund mit einer Serviette ab, faltete sie und legte sie auf den leeren Teller.
»Bevor es losgeht, müssen wir den Wagen noch betanken«, meinte Heinrich. »Wir haben kaum noch Sprit. Ein paar Meter weiter Richtung Stadtmitte befindet sich eine Tankstelle.«
Die Rucksäcke hatten sie nach dem Aufstehen bereits gepackt und noch vor dem Frühstück im Kofferraum verstaut. Sie gingen zum Auto. Heinrich entriegelte mit der Fernbedienung die Wagentüren.
»So, jetzt kann das Abenteuer losgehen«, zwinkerte er Albert zu.
Das Fahrzeug verließ das Hotelgelände, nach dem Tanken ging es – wie geplant – Richtung Simsersee.
Die Fahrt dauerte nicht lange, höchstens zehn Minuten. Unterwegs fielen Albert die vielen kleinen Gehöfte in der Gegend auf. Wie idyllisch es hier ist, das hatte er ganz vergessen.
Heinrich stoppte den Fiesta auf einem Parkplatz am See. Beide stiegen aus. Es war bereits kurz nach zehn. Noch lag der Morgentau über den Wiesen. Mit der Fernbedienung verriegelte Heinrich das Fahrzeug. »Für alle Fälle«, wie er meinte und grinste.
Albert hielt es jetzt nicht mehr auf dem Schotter. Schon als Heinrich den holprigen Parkplatz ansteuerte, hatte er den kleinen Steg ausgemacht. In schnellen Schritten zog es ihn jetzt dorthin. Er schritt über die morschen Holzplanken. Hastig streifte er im Gehen zuerst die Schuhe ab, dann die Socken. Schließlich krempelte er mit ein paar Handbewegungen noch die Hosenbeine hoch. Am Ende des Steges setzte er sich auf die Planken und ließ die Füße langsam ins kalte Wasser gleiten.
Ein paar Äste einer Erle ragten über den Steg. Wie ein silbernes Tablett schimmerte der See zwischen dem Gehölz hindurch. An den Ästen brachen sich die Strahlen der Morgensonne. Von weitem hörte Albert das Klappern eines Storches.
Wie lange hatte er auf diesen Augenblick gewartet? Mehr als ein halbes Leben lang. Noch einmal die Füße im klaren und kühlen Wasser des Simsersees baumeln lassen. Wie er es genoss. Noch vor Jahren hätte er nicht im Traum daran gedacht. »Ach, hätte Vater Willi das alles doch vor seinem Tode noch einmal erleben dürfen …«, ging es ihm durch den Kopf. Der Gedanke schmerzte.
»Weißt du, Heinrich, hier habe ich als Kind oft gebadet », erzählte Albert, während er mit einer Hand sanft, ja fast zärtlich über die Oberfläche des Wassers glitt und dabei dem Spiel der Libellen zuschaute. »Als Kinder verbrachten wir jede freie Minute hier am See – sommers wie winters. Auch die Frauen aus unserem Dorf kamen an lauen Sommerabenden nach der Feldarbeit noch zum Baden hier vorbei. An der Stelle, an der die Simser in den See floss, fing ich damals jede Menge Krebse. Richtig stattliche Burschen. Ihre Scheren und der Schwanz waren eine Delikatesse. Doch außer mir wollte sie keiner. Mutter und meine kleine Schwester Lieschen machten sich nichts draus. Meinem Bruder Karl waren sie zu suspekt«, meinte Albert, grinste und hob den Kopf. Er blickte den Hang hinauf und deutete mit dem Zeigefinger nach Osten. »Da, hinter dem Hügel, da liegt Klotainen!«
»Ja, ich weiß«, entgegnete Heinrich. »Ich bin schon das ein oder andere Mal dort durchgekommen.«
»Ist das nicht eine wunderbare Landschaft, wie geschaffen von eines Künstlers Hand?« Albert kam ins Schwärmen.
»Ja, das ist es wohl«, meinte Heinrich und sein Blick schweifte weit über das Gewässer. »Die Natur braucht in diesem Landstrich immer etwas länger, bis sie ihre Pracht zeigen kann. Die Buschanemonen an den Bächen und feuchten Waldrändern sind immer die ersten, die den Frühling ankündigen. Schließlich gesellen sich die Sumpfdotterblumen, der Löwenzahn und die Glockenblumen hinzu.«
»Was konnte man da herrlich über die Wiesen rennen. Im Herbst gingen wir sogar barfuß über die Stoppelfelder, und es machte keinem etwas aus.«
Albert genoss den Augenblick, die frühen Sonnenstrahlen, das glitzernde Schimmern des Sees. Er fühlte sich als Zaungast der Natur – mittendrin, aber doch außen vor.
.»Was meinst du, was wäre geworden, wenn uns niemand vertrieben und alles in deutscher Hand geblieben wäre?«, wandte er sich fragend Heinrich zu.
»Wahrscheinlich wäre von der Natur heute nicht mehr viel übrig geblieben«, antwortete dieser.
Albert blickte kurz unter sich. Dann schoss sein Kopf geradezu in die Höhe.
»Ei, war das ein Spaß im Winter. Du glaubst ja gar nicht, was dann hier los war.«
Ja, die Winter, sie konnten eisig sein in Ostpreußen. Das wusste auch Heinrich. Manchmal hielten Schnee und Frost das Land sogar noch im Mai in ihren eisigen Krallen. Heinrich lebte in diesem Land, seit er denken konnte. In der Nähe von Guttstadt war er geboren, auf einem Gutshof als der jüngste Spross von fünf Geschwistern. Seit Generationen war der Hof in Familienbesitz. Schon früh musste er hart bei der Landarbeit anpacken. Doch das Land, es hat ihn nie losgelassen. Auch nicht, als er Ende Januar 1945 als 10-Jähriger mit seiner Familie auf der Flucht von der russischen Front überrollt wurde und er wieder in seinen Heimatort zurückkehrte. Gerne sprach er nicht über diese Zeit. »Zu vieles erlebt«, meinte er stets, wenn er darauf angesprochen wurde, und winkte ab. Darüber reden wollte er nie. Auch jetzt nicht. Heinrich hatte gelernt, was vergessen heißt.
»Das war vielleicht ein Spaß. Da drüben am Hang Richtung Siegfriedswalde wurde Schlitten gefahren, manchmal gleich über den See«, sprudelte es jetzt aus Albert heraus. »Was für eine Rodelpartie! Ein Bauer stellte ein Pferd und einen Kutscher zur Verfügung. 10 bis 15 Schlitten wurden hintereinander befestigt, und das Pferd zog die Schlitten den Berg hinauf. Wenn die Eisdecke es zuließ, liefen wir Kinder auch Schlittschuh. Wir hatten uns kleine Kufen bei Urbschat, unserem Dorfschmied, anfertigen lassen. Mit kräftigen Schlägen schlug er die Eisen unter die Holzpantoffeln – und ab ging es danach aufs Eis …«
Eine Weile hatte Albert monologisierend in die Ferne geblickt, als er sich wieder seinem Begleiter zuwandte.
»Weißt du, Heinrich, nicht jeder im Dorf konnte sich ein Paar Schlittschuhe leisten, dafür gab es aber Schlorren – manche hatten unter jedem Fuß ein Brett, das mit einem Riemen am Fuß festgeschnallt war. Auf dem Brett waren runde Drähte aufgenagelt – eine ganz primitive Anfertigung, die man sich praktisch selbst machen konnte. Dann gehörte zu den Schlorren noch ein Stab, so lang wie ein Besenstiel, mit einem unten eingeschlagenen Nagel. So spielten wir oft sogar Eishockey.«
Auch Albert hatte solche Schlorren besessen. Bis zu dem Tag, als er von seinem Vater Willi diese wundervollen Schlittschuhe erhielt. Jahrelang hatte dieser sie gehütet wie einen Schatz.
»Weißt du, Heinrich, zu meinem 12. Geburtstag schenkte mein Vater mir ein paar wundervolle Schlittschuhe. Mann, wie die blinkten und funkelten. Er muss sie ständig poliert haben. Mein Vater hatte sie von seiner Mutter ebenfalls zum 12. Geburtstag erhalten. Damals in Elbing.«
»Eine schöne Geste und ein schönes Geschenk«, fand Heinrich.
»Er hat sie offenbar so gehütet, weil sie ihn so sehr an seine Mutter erinnerten. Weißt du Heinrich, sie starb ziemlich jung an einer Lungenembolie. Er hat ihren Tod nie richtig überwinden können.«
»Was ist aus den Schlittschuhen geworden?« Heinrich interessierte die Geschichte.
»Weiß ich nicht. Bei der Flucht blieben sie zurück im Haus. Die Schlittschuhe sind sicherlich so wie ganz Ostpreußen mit dem Krieg untergegangen.«
Heinrich strich sich mit der Hand durch die Haare.
»Wollen wir ins Dorf fahren?«
Albert fuhr es in den Magen. Ins Dorf? Nach Klotainen? Er spürte wie das Herz schneller schlug, so wie bei der Landung in Danzig. Klotainen – wie sehr war dieser Name mit Sehnsucht und mit Schmerz verbunden.
»Nach Klotainen!?«
»Ja! In fünf Minuten sind wir da. Länger brauchen wir kaum«, war sich Heinrich sicher.
Was waren schon fünf Minuten im Vergleich zu 60 Jahren. Ein Wimpernschlag, ein winziges Nichts – und für Albert in diesem Augenblick doch eine ganze Ewigkeit.
Albert zog die Füße aus dem Wasser, rieb sie mit den Händen kurz trocken, streifte sich die Socken und Schuhe über. Dann stand er auf.
»Ja, lass uns fahren, Heinrich. Fahren wir… Fahren wir nach Hause!«
Heinrich steuerte den Wagen zunächst Richtung Heilsberg. Die Straße führte durch einen dicht bewachsenen Erlenwald. Die Teerdecke war bestückt mit unzähligen Schlaglöchern, die aneinander gereiht Albert stark an einen Schweizer Käse erinnerten. Nachdem sie die Chaussee erreicht hatten, setzte Heinrich den Blinker nach rechts und fuhr Richtung Seeburg.
Albert fühlte, wie sein Herz raste. Unentwegt starrte er auf die Landschaft, die in einem Rausch von Farben an ihm vorüberflog.
War das die Straße nach Klotainen? War das der vereiste Weg, den er vor 60 Jahren bei bitterer Kälte mit der Mutter und seinen Geschwistern auf der Flucht vor der sowjetischen Kriegsfurie genommen hatte? Albert war sich nicht sicher. Alles hatte sich verändert. Früher waren die Straßen hier nicht asphaltiert. Sie waren zu einer Hälfte gepflastert und zur anderen Hälfte mit Sand bedeckt. Und die Bäume waren gewachsen, sie überzogen die Straße mit ihren wuchtigen Kronen wie ein grünes Dach.
Völlig unverhofft schossen Albert Fetzen von Bildern durch den Kopf. Ganz plötzlich waren sie da. Deutlich sichtbar. Schmerzend. Er sah, wie sich dieser endlose Flüchtlingstreck den Weg nach Heilsberg hinunter schlängelte – alte Männer, Frauen und Kinder, dick vermummt auf Pferdewagen oder mit Handkarren, vom Kampf gezeichnete Soldaten in Militärfahrzeugen oder zu Fuß. Der Horizont war rot, blutrot, und die Straßen hatte der Frost mit einem zentimeterdicken Eis überzogen. Die Fuhrwerke kamen ins Rutschen, Granaten flogen über die Köpfe der Flüchtlinge. Man hörte ein ständiges Pfeifen und in der Ferne ein dumpfes Dröhnen der Geschütze.
Albert wandte sich seinem Begleiter zu. Er versuchte, diese alten Gespenster aus den Tagen von Flucht und Vertreibung aus seinem Kopf zu verbannen und blickte zu den wuchtigen Baumkronen empor.
»Heinrich, schau diese Bäume! Wie gewaltig sie doch in den sechs Jahrzehnten gewachsen sind. Da, die Brücke über die Simser – die war damals anders. Sie ist neu gemacht worden! Und dort, der Weg nach Blumenau: Er ist nicht geteert. Geradeso wie damals. Herrlich, diese sandigen ostpreußischen Wege«, schwärmte Albert, während sein Herz laut pochte. Immer wieder schossen Erinnerungsfetzen durch seinen Kopf. Wie er als Kind mit seinem Bruder Karl zum kleinen Bahnhof nach Blumenau ging. Hier in der Nähe gab es die besten Blaubeervorkommen. In der Nähe von Blumenau musste er beim Torfstechen helfen.
»Schau, gleich sind wir da.« Heinrich deutete auf das Ortseingangsschild.
Klutajny stand dort. Klutajny! Nicht Klotainen. Eigentlich hatte Albert es auch nicht anders erwartet. Und doch wirkte es befremdlich auf ihn.
Und auf der linken Seite? Statt auf das Rittergut blickte er auf einen ehemaligen Kolchose-Betrieb. Landwirtschaftliche Maschinen standen verlassen und wie stumme Zeugen einer vergangenen Epoche verrostet umher. Hier arbeitete niemand mehr. Ein trauriger Anblick. Und an der Straße, wo früher vereinzelt Wohnhäuser und Miggegrets Gaststätte standen, thronten nunmehr Plattenbauten, farblos und grau in grau.
»Dort wohnen die Leute, die früher in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft tätig waren. Viele von ihnen sind heute arbeitslos. Auf der anderen Straßenseite hat sich manch einer seinen Schrebergarten angelegt«, erläuterte Heinrich, der die Fahrt verlangsamte. Er schien bemerkt zu haben, was Albert bewegte.
»Das Rittergut, das haben die Kommunisten dem Erdboden gleichgemacht. Ich glaube, es ist nur noch ein alter Pferdestall übrig geblieben. Aber Euer Reihenhaus von damals, das steht noch.«
»Unser Haus, es steht noch?«
Albert erschrak. Damit hatte er nicht gerechnet. Zugleich empfand er aber eine tiefe Freude. Wird er es wiedererkennen? Hat sich vieles verändert? Warum hatte er nicht schon früher danach gefragt? Wer wohnt heute dort? Jetzt war er so nah dran, doch jeder Meter Straße schien ihm endlos lang.
»Sind wir gleich da, Heinrich?«
»Ja, gleich. Da unten links, da ist es…«
Wie konnte er nur fragen. Natürlich da unten in der Senke ging es nach links und dann waren es noch 200, 300 Meter.
Heinrich setzte den Blinker.
Eine Betonpiste hatten sie über den einstmals schönen sandigen Boden gezogen. Harten Beton …! Der Wagen ruckte unentwegt. Dann sah Albert bereits die Hausecke. Es war ein Reihenhaus. Vier Familien wohnten dort. Die Koslowskis, die Wohlgemuths, Wagners und … die Steinkys.
Der Wagen stand vor dem Eingang zur Wohnhaushälfte. Der Motor lief leise. Ohne etwas zu sagen blickte Albert auf das alte Backsteinmauerwerk. Ja, das war sein Elternhaus. Kaum etwas hatte sich verändert. Sicher, es war in die Jahre gekommen. Die vergangenen sechzig Jahre waren keinesfalls spurlos an dem Gebäude vorbeigegangen. Das Dach war nie erneuert worden, der Putz marode. Farbe hatte das Haus offenbar in den letzten Jahrzehnten ebenfalls nicht zu sehen bekommen. Aber das alles spielte für Albert jetzt keine Rolle. Das Haus, es stand noch, und es war ein schönes Haus. Das schönste in Klotainen, im ganzen Ermland, in ganz Ostpreußen. Es war sein Elternhaus, und das sollte es bleiben, so lange er auf dieser Welt weilte.
»Sollen wir aussteigen und anklopfen?«, fragte Heinrich.
Albert war tief in seine Gedanken versunken. Heinrich hakte nach.
»Sollen wir reingehen?«
»Was?
»Möchtest du in das Haus gehen?«
Albert war nicht wohl bei dem Gedanken. Er zögerte, konnte keinen klaren Gedanken fassen. Die Gefühle spielten verrückt.
»Ich weiß nicht. Ich… Ich glaube, ich kann es nicht. Vielleicht wollen die Leute uns gar nicht hier haben. Vielleicht verängstigen wir sie nur? Vielleicht hassen sie die Deutschen …? Nein, Heinrich. Später … lass uns später noch einmal herkommen. Komm Heinrich – fahr. Wir kommen später noch einmal wieder. Fahr! Bitte fahr!«
Heinrich zögerte einen Augenblick.
»Wohin?«, fragte er vorsichtig.
»Ich weiß nicht. Nur weg von hier, Heinrich. Nur weg…!«
Heinrich legte den Rückwärtsgang ein.
»Dann fahren wir nach Siegfriedswalde zur Kirche – oder?«
»Ja, zur Kirche…. Das ist eine gute Idee. Komm Heinrich, fahr zur Kirche!«
Heinrich steuerte den Fiesta zurück zur Chaussee. Auf der gegenüber liegenden Seite zur Ausfahrt war ein kleiner Altar aufgebaut. Eine alte Frau steckte ein paar Blumen in eine Vase. Albert nahm keine Notiz davon. Seine Gedanken zu ordnen, es fiel ihm schwer in diesem Augenblick. Warum war er nicht in das Haus gegangen? Hatte er Angst davor, dass ihn die Vergangenheit auf diesen wenigen Quadratmetern Wohnfläche einholen würde? Dass sie ihn lähmen, ihm die Luft abschnüren würde? Nach etwa fünf Kilometer Wegstrecke erreichten sie Siegfriedswalde. Albert wollte nur jetzt noch eins: raus aus dem Auto.
»Halt an, Heinrich. Ich muss mir etwas die Beine vertreten.«
Heinrich versuchte seinen Begleiter zu beruhigen.
»Schau doch, wir sind gleich da. Schau, da vorne ist schon die Kirche.«
»Zum heiligen Johannes von der lateinischen Pforte« hatte man das kleine, stolze Kirchlein einst getauft. Auf den ersten Blick schien es kaum verändert. Das Gotteshaus war am 4. Juli 1912 eingeweiht worden. Es war die dritte Kirche in der langen Geschichte der Gemeinde.
Heinrich stoppte das Auto auf dem kleinen Parkplatz vor dem Gotteshaus. Sie stiegen aus und gingen durch das unverschlossene Tor. Neben dem Pfarrhaus hinter dem mächtigen Backsteinbau hatte sich ein Storchenpaar in einem Nest auf dem Mast einer Überlandleitung häuslich eingerichtet. Das Männchen klapperte mit dem langen Schnabel, was das Zeug hielt.
Kurz vor dem Kirchenportal blieb Albert stehen. Er musste daran denken, wie er als Kind hier mit seinen Eltern jeden Sonntag zur Heiligen Messe pilgerte. Den ganzen Weg von Klotainen hinauf, immerhin fünf bis sechs Kilometer.
»Hier sind wir sonntags immer zur Kirche gegangen. An Sonntagen wurden sogar zwei Messen gehalten, die eine um 7 Uhr, die andere um 10 Uhr.«
Heinrich nickte, so als wolle er ihm beipflichten.
»Wir gingen meistens zu Fuß. Bei ganz besonderen Anlässen fuhren wir auch schon mal mit dem Pferdewagen unserer Nachbarn. Bei meiner Kommunion etwa.«
Albert grinste.
»Männlein und Weiblein mussten immer getrennt voneinander sitzen. Einmal, da hatte ich meine Matrosenmütze noch aufbehalten. Da kam Mutter von hinten und fegte sie mir mit einer Handbewegung vom Kopf.«
Albert wollte seinem Begleiter gerade erzählen, wie er als Messdiener mit einem Burschen aus der Nachbarschaft heimlich den Messwein des Pfarrers verkostet hatte, als er ein Geräusch wahrnahm. Er drehte sich um und erblickte einen Mann in einem schwarzen Talar, der höflich grüßte.
»Dzien dobry.«
Albert und Heinrich erwiderten den Gruß. Es handelte sich ganz offensichtlich um den Gemeindepfarrer. Es war ein Mann mittleren Alters. Er trug eine runde Brille, hatte dunkle Haare, die er mit einem Seitenscheitel nach links gekämmt hatte.
Heinrich und der Geistliche redeten ein paar Sätze in Polnisch miteinander, dann wandte sich der Dolmetscher Albert zu.
»Ich habe den Herrn Pfarrer über den Grund unseres Besuches aufgeklärt. Er findet das wohl recht interessant und lädt uns ins Pfarrhaus ein. Möchtest du?«
Albert nickte zustimmend.
Das Pfarrhaus, ebenfalls aus roten Backsteinen gebaut, lag direkt hinter der Kirche. Dort wartete die Haushälterin, eine kleine, korpulente Frau, schon an der Eingangstür. Der Pfarrer rief ihr etwas zu, was Albert nicht verstehen konnte. Er schien ihr offensichtlich zu verstehen gegeben zu haben, dass er einen Gast aus Deutschland mitbringt, denn sie begrüßte die unerwarteten Gäste nunmehr in gebrochenem Deutsch.
»Sind Sie willkommen ganz herzlich. Bitte, kommen Sie herein.«
Die Haushälterin reichte den Gästen die Hand und führte sie durch die Diele in einen Wirtschaftsraum.
»Wir haben Kaffee und Kuchen für Sie. Nehmen Sie doch Platz, bitteschön», forderte sie die Gäste auf und reichte jedem als Willkommenstrunk ein kleines Gläschen Wodka, dem auch der Pfarrer nicht abgeneigt war.
Der Pfarrer und seine Gäste nahmen Platz an einem Tisch, während die Wirtschafterin den Kaffee in die Tassen goss. Dann reichte sie einen Erdbeerkuchen dazu, den sie zuvor aus der Küche geholt hatte. Albert, Heinrich und der Pfarrer bedankten sich.
Zwei Stunden blieben sie im Pfarrhaus. Albert erzählte dem Pfarrer von seiner Jugendzeit in Klotainen, von seinem Elternhaus, von der Schule und von der Arbeit auf dem Rittergut. Der polnische Geistliche hörte andächtig zu, während Heinrich Satz für Satz übersetzte.
Nach einer Weile stand der Pfarrer auf und fischte ein altes Kirchenbuch aus einem Bücherregal neben der Zimmertür. Dann setzte er sich wieder und reichte es Albert über den Tisch. Albert begann darin zu blättern, zunächst langsam, dann immer schneller – bis zur Jahreszahl 1941. In dem Jahr ging er hier in Siegfriedswalde zur Kommunion. Und tatsächlich, da stand zwischen all den Namen plötzlich der seinige: Albert Steinky, Klotainen, geboren am 16. Juni 1932 in Klotainen/Kreis Heilsberg.
Albert war gerührt. Er bedankte sich, zog eine kleine Pocketkamera aus der linken Hosentasche und fotografierte den Eintrag. Zum Abschied schenkte der Pfarrer ihm einige Zweige von einem Fliederstrauch, der vor der Kirche wuchs. Er reichte sie ihm und sagte etwas. Albert wandte sich Heinrich zu und schaute ihn mit großen Augen fragend an.
»Der Pfarrer wünscht dir, dass der Fliederzweig in deiner jetzigen Heimat ausschlagen und zu einem neuen Baum heranwachsen möge. Er bedankt sich für unseren Besuch und sagt, dass wir jederzeit wiederkommen können. Und du solltest auch keine Angst davor haben, in euer altes Haus zurückzukehren. Der Pfarrer sagt, er kennt die Leute. Sie heißen Wójcik, und es seien gottesfürchtige und gastfreundliche Menschen.«
Albert bedankte sich bei dem Geistlichen. Dann gingen Heinrich und er wieder zu dem kleinen Parkplatz vor der Kirche, wo Heinrich den Fiesta geparkt hatte. Offenbar hatte Heinrich mit dem Pfarrer über den Vorfall in Klotainen gesprochen. Alberts Entschluss stand nunmehr fest.
»Komm«, meinte er zu Heinrich, »wir fahren noch einmal zum Haus.«
Kaum angekommen, drückte Heinrich den stark verrosteten Klingelknopf neben der Eingangstür. »Stanislaw Wójcik und Danuta Laski« stand auf einem kleinen Türschild in Handschrift geschrieben. Sie warteten eine Weile. Doch nichts geschah. Heinrich betätigte den Knopf ein zweites Mal.
»Dzien dobry.«
Ein älterer Mann, etwa 80 Jahre alt, war um die Hausecke gekommen und grüßte die Ankömmlinge. Er trug eine gewöhnliche Arbeitshose und kam offenbar von der Gartenarbeit. In einer Hand hielt er einen Rechen.
Heinrich und der Fremde redeten miteinander. Der alte Pole schaute Albert kurz an, lächelte und nickte. Dann öffnete er die Tür. Die beiden gingen hinein. Albert folgte ihnen, während er bemerkte, wie der ältere Herr ihn in der Diele beäugte.
»Albert, das ist Herr Wójcik. Ich habe ihm erzählt, warum wir hier sind und dass du früher einmal in diesem Haus gewohnt hast. Er hat uns ins Haus gebeten und möchte wissen, wo du jetzt beheimatet bist. Und warum wir beim ersten Besuch nicht hinein gekommen sind?«
Albert reichte ihm die Hand, tat zunächst aber einmal so, als habe er die Fragen nicht verstanden.
Der Alte hatte sie also ganz offensichtlich bemerkt. Egal! Zum ersten Mal seit Jahren stand Albert wieder im Flur seines Elternhauses. Sein Blick fiel sofort auf die Holztreppe, während Heinrich sich angeregt mit dem alten Mann auf Polnisch unterhielt. Hier vom Flur aus gelangte man über diese Treppe direkt zum Speicher. Dort befand sich eine große Räucherstube. Hinter einem Balken hatten Albert und sein Bruder Karl ein kleines Messer versteckt – für den Schinken und die Grützwurst. Auch die kleinen Steinkys waren eben Selbstversorger.
Heinrich winkte Albert zu.
»Wir sollen doch bitte in die Wohnstube kommen, meint Herr Wójcik.«
Höflich, dieser alte Pole, dachte Albert.
»Er wohnt hier mit seiner Tochter Danuta und seiner Enkelin Patricya. Seine Frau ist vor einigen Jahren an Krebs gestorben«, erzählte Heinrich, während sie gemeinsam durch die Küche den Wohnraum betraten.
Was der in der kurzen Zeit alles rausbekommen hat, wunderte sich Albert. Er spürte die Anspannung. In der Wohnstube war alles noch wie früher, lediglich die Möbel waren andere. Albert traute seinen Augen kaum: Da stand ja noch der alte, gewaltige Kachelofen. Er war ein Allesfresser. Er fraß Holz, Briketts oder Torf. Lediglich die Sitzbank war verschwunden. Wie oft hatte Mutter am Abend dort mit ihm und seinen beiden Geschwistern gesessen und Geschichten aus ihrem Heimatdorf Raunau erzählt, von dem Hof, den ihr Vater dort hatte, von ihren Geschwistern oder von der Arbeit auf dem Rittergut. Manchmal lauschten sie aber auch nur der Musik aus dem Grammophon, das der Vater vom Frankreichfeldzug mitgebracht hatte. Man konnte sich so herrlich am Ofen anlehnen, und im Winter strich einem die Wärme angenehm über den Rücken, während man aus dem Fenster blickte, wo sich an eisigen Tagen bizarre Eisblumen bildeten.
»Schau Heinrich, hier oben ist ein kleines Türchen.«
Albert deutete auf den Kachelofen.
»Hier konnte man Äpfel zum Schmorren reinlegen. Mann, was waren die lecker!«
Heinrich und ihr polnischer Gastgeber hatten bereits Platz an einem Tisch genommen.
»Herr Wójcik fragt, ob du auch einen kurzen Blick ins Schlafzimmer werfen möchtest.«
Natürlich wollte er. Als Kind hatte er es nie so richtig gemocht. Schließlich musste er sich diese kleine Stube mit seinen beiden Geschwistern teilen. Doch hier und heute, das war etwas anderes. Wie oft war er von dort aus durchs Fenster gestiegen, nur weil ihm der Weg durch die Haustür zu weit war.
»Ja«, meinte Albert. »Gerne.«
Auch im Schlafzimmer schien die Zeit stehengeblieben, nur eben die Möbel waren auch hier nicht mehr dieselben. Beim Blick in dieses Zimmer bekam Albert Gänsehaut. Die Eindrücke und die Erinnerungen überwältigten ihn.
»Früher war dies das Schlafzimmer der Kinder«, erzählte er. »In einer hinteren Ecke stand ein großer Kleiderschrank mit vielen kleinen Fächern. Dort wurden auch unsere Kleider und Schuhe aufbewahrt. Schuhe hatte ich nur zwei Paar, ein Paar für jeden Tag und dann meine Sonntagsschuhe, auf die ich nichts kommen lassen durfte. Da war unsere Mutter ganz penibel.«
Albert hörte, wie der alte Pole leise mit Heinrich sprach.
»Albert! Herr Wójcik sagt, dass es den alten Schrank, der früher in diesem Zimmer stand, noch gibt. Er hat ihn auf den Speicher gebracht und bewahrt darin Dinge auf, die er nicht mehr braucht.«
Albert wollte es kaum glauben. Hatte er richtig gehört? Den alten Schrank, es gab ihn noch. Ja, warum auch nicht. Er war massiv aus Eiche. Deutsche Wertarbeit, wie es so schön heißt. Robust. Etwas, was man nicht so schnell kaputt kriegt. Etwas für die Ewigkeit. Wenn der alte Schrank noch existierte, vielleicht befanden sich darin auch noch seine Schlittschuhe, die er bei der Flucht zurücklassen musste, schoss es ihm unwillkürlich durch den Kopf.
»Heinrich, kannst du dich noch erinnern? Ich hatte dir am See doch von den Schlittschuhen erzählt, die mir mein Vater zum 12. Geburtstag geschenkt hatte.«
»Ja, Albert! Was ist damit?«
Heinrich schaute Albert fragend an.
»Meine Mutter hatte sie in dem Schrank in einem geheimen Staufach versteckt, als ich mir damit einmal einen Schuhabsatz kaputt fuhr. Sie dachte immer, wir Kinder hätten keine Ahnung von der Existenz dieses Faches.«
Albert wirkte geradezu euphorisch.
Wieder sprach Heinrich mit dem Gastgeber.
»Herr Wójcik sagt, dass er noch nie irgendwelche Schlittschuhe in dem Schrank gesehen hat. Er sagt, wenn du möchtest, können wir gerne nach oben gehen und uns den Schrank und das Fach anschauen.«
Die drei hielt es jetzt nicht mehr in dem Schlafzimmer. Sie eilten durch die Wohnstube und die Küche wieder in den Flur. Dann stiegen sie die alte Speichertreppe hinauf.
Stanislaw Wójcik öffnete die Tür zum Dachboden. Sie knarrte laut, was wohl daran lag, dass sich in den letzten Jahren wohl selten jemand hier obenhin verirrt hatte. Albert betrat als Erster den Raum. Sofort fiel sein Blick auf den Schrank. Aus Tausenden von Schränken hätte er ihn wiedererkannt. Diesen Schrank gab es nur einmal auf der Welt. Alle Schrecken und Wirren des Krieges hatte er überstanden, um nunmehr in wenigen Minuten sein Geheimnis preisgeben zu können.
»So, nun passt mal auf, was hier gleich geschieht!«
Albert war geradezu entzückt. Er bückte sich und öffnete die untere linke Schublade, zog sie heraus und legte sie zur Seite. Dann griff er – so als habe er es schon tausend Mal zuvor geübt – mit der rechten Hand in den Hohlraum. Als seine Finger wieder zum Vorschein kamen, hielt er einen kleinen runden Holzstopfen in Händen, der als Entriegelung für eine weitere Schublade gedient hatte.
»Schaut mal her!«, strahlte er.
Und tatsächlich, was zuvor wie eine Zierblende aussah, ließ sich jetzt bequem nach vorne schieben.
Albert zuckte. Was war das? Das Fach, es war leer!
Für einen Augenblick war es gespenstisch still auf dem Dachboden geworden.
Albert konnte es nicht glauben. Das Fach, von dessen Existenz niemand im Haus etwas wissen konnte, war leer. Fassungslos starrte er in die verstaubte Schublade.
Albert erinnerte sich, dass er schon einmal vor dieser leeren Schublade gestanden hatte. Das war Ende 1944 …
Der erste Wagen
»Suchst du etwa die hier?«
Die Stimme, die Albert hinter sich vernahm, kannte er nur zu gut.
Ist das nicht …?
Noch immer sprachlos, drehte er sich um.
Karlchen? Natürlich! Es war Karlchen, sein kleiner Bruder. Geschniegelt und gestriegelt stand er im Eingang zum Schlafzimmer, etepetete, wie aus einem Ei gepellt. Pechschwarze Haare, akkurater Seitenscheitel, Knickerbocker mit Hosenträger, darunter sein Lieblingshemd – ein weißes, langarmiges. Die Schuhe blitzblank geputzt, dass man sich fast darin hätte spiegeln können.
Albert hatte ihn gar nicht bemerkt. Doch immer dann, wenn man überhaupt nicht mit ihm rechnete, war er plötzlich da.
»Woher hast du gewusst, wo die Schlittschuhe sind?«
Die Schlittschuhe an den Schnüren gepackt, hielt er sie zwei Trophäen gleich in die Höhe und stand dabei wie angewurzelt in der Zimmertür. Ein breites schelmisches Grinsen legte sich auf sein Gesicht, so wie er immer grinste, wenn ihm irgendetwas durch den Kopf schoss, was nichts taugte. Karlchen war zehn Jahre alt, aber ein ausgekochtes Schlitzohr, wie es in Klotainen kein zweites gab.
»Willumeit hat es mir zugeflüstert!«, antwortete Karl.
»Willumeit? Nie und nimmer!«, fauchte Albert ihn an.
Adolf Willumeit galt im Dorf als Sonderling, von der Statur her war er ein stangenlanges Gerebbel mit ausgesprochen großen Ohren, die er zumeist unter einer Mütze zu verstecken versuchte. Sommer wie Winter lief er mit der gleichen, zigfach gestopften Jacke durchs Dorf, die er vor dem Anziehen ausschlackerte und die aussah, als hätten die Mäuse daran geknabbert. Willumeit galt als wortkarg, er redete nicht viel, was aber nichts damit zu tun hatte, dass er nichts zu sagen gehabt hätte. Im Gegenteil. Wenn er etwas mitzuteilen hatte, dann fanden sich in dem ansonsten ereignisarmen Klotainen auch rasch ein paar Zuhörer. Das lag wohl daran, dass manche Leute im Dorf glaubten, er habe so etwas Ähnliches wie seherische Fähigkeiten. Im Jahr 1933, als ein kleiner Weltkriegsgefreiter, der eigentlich gar kein Deutscher war, Deutschland auf Kosten anderer zur Weltmacht machen wollte, erzählte Willumeit im Dorf von einem großen Krieg, der das Land überziehen würde. »Millionen von Menschen werden ihr Leben lassen«, erzählte er den Leuten im Dorf, den Kleinen wie den Großen. Und dass es am Firmament geschrieben stand, von wo er es nur habe ablesen müssen, was ihm in dem kleinen ermländischen Dörfchen stets größte Aufmerksamkeit zuteil werden ließ.
Jemand hatte also für andere unsichtbar am Himmel herum gepinselt, und Adolf Willumeit, der Sonderling aus Klotainen, brauchte es nur noch zu lesen. Die meisten im Dorf hielten ihn für einen Schossel, für jemanden, der einfach nur dumm daher redete. Sie zeigten mit dem Finger an den Kopf, wenn die Rede auf Willumeit und seine Prophezeiungen kam. Auch seiner Frau war das Gerede nicht geheuer. »Schlabber nuscht so kariert«, meinte sie zu ihm. »Du machst mir in Klotainen noch alle ganz meschugge! Ja sie drohte ihm sogar damit, dass sie ihm sein Klunkermus, eine Art Milchsuppe mit eingerührten Mehlklößen, seine Lieblingsspeise, entziehen würde, wenn er nicht damit aufhören würde, von irgendwelchen Himmelserscheinungen zu faseln. Fortan hielt Willumeit zwar immer häufiger seinen Mund, wenn es um die Dinge ging, die es da oben zwischen den zumeist tief liegenden Wolken zu lesen gab, aber dennoch sah man ihn stets mit erhobenem Kopf durchs Dorf stolzieren. Im Laufe der Zeit entwickelte er dabei sogar eine ganz eigene Technik, indem er mit einem Auge zum Boden blickte, mit dem anderen zum Himmel hoch linste – immer auf der Suche nach irgendwelchen überirdischen Neuigkeiten.
Albert fand ihn auch immer etwas sonderlich. Karlchen aber, der mochte ihn.
»Dem Karlchen, mit dem ist was gefällig«, pflegte Willumeit immer zu sagen. Das Karlchen, das sei kein Glumskopp, meinte er, das sei so schlau, das könne sogar Katzendreck im Dunkeln riechen. Dem kleinen Karl imponierte das mächtig. Einen ellenlangen Vortrag über das ostpreußische Rindvieh an sich und insbesondere über die klotainische Kuh hatte er Willumeit während eines Spaziergangs gehalten. Und der hatte andächtig zugehört. Karlchen klärte ihn darüber auf, warum die Viecher in Klotainen mehr Milch geben als ihre Artgenossen in Wernegitten und wieso die Kuh von Frau Glupsch die größten Fladen fallen lässt. Karlchen wusste alles übers Viehzeug, zumindest tat er so. Selbst der Kuhschwanzastronom aus Heilsberg, womit er den örtlichen Tierarzt meinte, und da war er sich sicher, hätte von ihm noch etwas lernen können. Und was Willumeit an Karlchen besonders gefiel, war die Tatsche, dass er auch über Klunkermus sprach, welche Sorten von Klunkermus es gibt, darüber, wie man die Mehlklöße zubereitet, damit sie nicht auseinanderfallen und wie lange man sie in der Milchsuppe garen muss. Willumeit war stets fasziniert von so viel Gourmetwissen.
Karlchen war stolz darauf, Katzendreck im Dunkeln riechen zu können. Er verstand es als Kompliment und fühlte sich geehrt, geradeso als habe ihm der alte Willumeit mit diesem Satz einen Orden verpasst. Mit Stolz geschwellter Brust ging er fortan durchs Dorf, erzählte jedem, der seinen Weg kreuzte, von Kühen und Katzen, und wenn der Tag zu Ende ging und Karlchen in den Schlaf fiel, dann fing er am nächsten Morgen wieder damit an. Er hatte eben einen ausgeprägten Missionsgeist. An klaren Tagen erwischte er sich sogar manchmal dabei, wie er zum Himmel hochblickte. Doch außer Cumulus- oder Cirruswolken konnte er dort nichts ausmachen.
Doch der alte Willumeit – er sollte Recht behalten. Man schrieb das Jahr 1944. Der große Krieg war bereits im fünften Jahr. Tausende und Abertausende waren auf den Schlachtfeldern gestorben. Vielleicht konnte Willumeit die Dinge tatsächlich voraussehen, vielleicht war er aber auch nur etwas verwirrter als andere. Aber woher zum Teufel sollte dieser seltsame Mensch wissen, wo sich Mutters Geheimfach befand und dass die Schlittschuhe darin lagen? An der Sache, das roch Albert sofort, an der war irgendetwas faul.
Es gab Tage, da hätte er Karlchen zum Mond schießen können und vielleicht auch noch ein Stückchen weiter. Und heute, da war so ein Tag. Ständig nervte er, und nie blieb er bei der Wahrheit. Und stur konnte er sein. Ein Esel hätte sich vor Neid in den Schwanz gebissen. Was dieser kleine schwarzhaarige Ermländer sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, das bekam da so schnell keiner mehr heraus.
»Du kannst die Schuhe gerne haben. Aber nur unter einer Bedingung«, machte Karlchen seinem Bruder unmissverständlich klar.
»Und unter welcher?«, fragte Albert ungläubig.
»Wenn ich heute Abend deinen Nachtisch bekomme!«
»Den eingemachten Kürbis?«
»Ja, den Kürbis!«
»Muss das sein?«
Eingemacht mochte ihn Albert für sein Leben gern.
»Ja!«
»Na denn … Ja, kannste haben. Also her mit den Schlittschuhen!«
Ungeduldig griff Albert nach den blinkenden Kufen. Es war Ende 1944, der erste längere Frost hatte Besitz vom Land ergriffen. Seit Tagen war es bitterkalt geworden. Eine dicke Eisdecke hatte den See überzogen.
»Ich bin in einer Stunde wieder zurück. Sag mir Bescheid, wenn Mutter früher von der Arbeit kommen sollte«, rief Albert seinem Bruder zu, während er die Schlittschuhe unter die Arme packte und zur Haustür rannte.
»Mach ich. Und nicht vergessen: Den Kürbis bekomme ich!«, rief Karlchen ihm hinterher.
»Natürlich! Kriegste.«
Albert lief zum Teich, der sich direkt hinter dem Haus befand. Er hockte sich auf eine kleine Bank, die dort stand. Mit zwei, drei Griffen streifte er den blinkenden Stahl über die Schuhe. Es waren seine Sonntagsschuhe, die er immer zum Kirchgang anziehen oder zu anderen festlichen Anlässen tragen musste. Wenn das Mutter wüsste …! Dann würde es etwas setzen.
Mit wenigen schnellen Schritten glitt er über den vereisten Teich weiter auf der eisigen Rinne des kleinen Baches Richtung See. In der Senke nahm Albert auf der Straße in Richtung Siegfriedswalde einen dunklen Punkt wahr, der sich langsam bergabwärts bewegte. Albert stoppte abrupt. Die Kufen krallten sich ins Eis. Eiskristalle spritzten über den kleinen Bachlauf. Was zum Teufel ist das?
Albert wartete, bis sich aus dem kleinen schwarzen Punkt erste Konturen abzeichneten. Er erkannte einen Wagen. Es war ein alter, klappriger Leiterwagen, so wie in Klotainen einer bei Urbschats hinter der Schmiede stand. Vorne auf saß ein vermummter pummeliger Mann, eine Kapuze über den Kopf geschlagen, darunter einen Hut. Sein Atem dampfte. Hinten an dem seltsamen Gespann hatte er eine Kuh angebunden. Der Wagen selbst war mit einer Plane zugedeckt. An der Seite klapperte ein Eimer am Holz, so alt wie ein Gewehr aus der Rüstkammer von Plibischken. Nebenher lief ein bis fast auf die Knochen abgemagerter Schäferhund.
Bei dieser Kälte zieht jemand mit dem Wagen übers Land?
Albert kam dies nicht geheuer vor.
Der Mann mit dem Gespann hielt an.
»Na, Jungelchen. Wo willste denn hinne? Schlittschuhlaufen?«
»Ja, drüben auf dem See«, stammelte Albert leicht verdutzt. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Fremde ihn ansprechen würde.
»Wo wollen Sie denn bei dieser Kälte hin?«
»Gen Westen will ich. Da wo du und deine Leute auch bald hingehen werden. Gen Westen.«
Albert versuchte, sich den seltsamen Mann näher anzuschauen. Doch er sah kaum seine Nasenspitze.
»Warum, Väterchen, sollten wir denn nach dem Westen gehen?«
»Deiwel noch eins! Hat man dir das noch nicht gesagt? Weil de Russen kommen! Deshalb!«
Die Russen kommen? Nach Ostpreußen? Albert wusste, dass die Front näher gerückt war. Mutter hatte heimlich am Volksempfänger gelauscht, und sie hatte ihm erzählt, dass sie Klotainen möglicherweise verlassen müssen. Sollte es wirklich bald soweit sein? Alles lief doch so wie sonst! 1944 war ein gutes Jahr, hatten die Bauern im Dorf gesagt. Die Ernte war ohne große Verluste geborgen worden, die Scheunen gefüllt. Mitte Oktober war auch die Hackfruchternte abgeschlossen worden. Die Keller waren ebenfalls gefüllt, und die Bauern hatten schon vor Wochen die Winterfurchen auf ihren Äckern gezogen.
»Ach wo, hier kommen doch keine Russen. Das würde der Führer niemals zulassen.«
»Das, Jungchen, das Zeugs haben die Leute in meinem Heimatdorf auch gefaselt. Doch zum Schluss hat keiner dort mehr an den Endsieg geglaubt, nicht mal die Nazibonzen selbst. Und diejenigen, die geblieben sind, die sind fast alle tot. Glaub mir Jungchen: Der Tod macht keinen Unterschied zwischen Nazis und einem aufrechten Ostpreußen.«
Noch immer sah Albert nur den Dampf des Atems, der sich wie ein undurchdringlicher Schleier vor das vermummte Gesicht gelegt hatte.
»Wo kommen Sie her?«
»Aus dem Memelland, aus der Nähe von Tilsit. Und ihr, ihr solltet auch auf der Hut sein. Unterwegs habe ich die ersten russischen Aufklärungsflugzeuge gesehen. Die waren ziemlich hoch. Aber man konnte sie deutlich ausmachen.«
»Ach Väterchen, das waren bestimmt die unsrigen!«, versuchte Albert ihm entgegen zu halten.
»Jungchen, sag deinen Eltern, sie sollen den Wagen packen. Auch wenn sie euch etwas anderes erzählen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird hier die Hölle los sein. Glaub mir.«
Jetzt wurde es Albert zu bunt.
»Unsere Soldaten werden die schon aufhalten«, keifte er.
»1,5 Millionen Russen? Schabber nuscht so kariert, Jungchen! 1,5 Millionen, die kann man nicht mal eben so aufhalten!«
»Aber es werden doch jetzt auch überall Gräben ausgehoben«, meinte Albert fast verlegen.
»Willst du diese roten Teufel vielleicht mit der Schaufel aufhalten? Etwa mit Schipp-schipp-hurra? Glaub mir, ihr werdet alle noch einmal nach eurer Mutter schreien!«
Der Alte lachte laut und hämisch.
»Glaub mir, Jungchen, die hält niemand auf! Seht zu, dass ihr fortkommt. Noch ist Zeit. Weggehen ist besser als Schipp-schipp-hurra …«
Der Alte lachte immer noch, brachte das Pferd wieder auf Trab und zog auf der Landstraße weiter in Richtung Heilsberg. »Schipp-schipp-hurra … Schipp-schipp-hurra …«, hörte Albert ihn noch in der Ferne rufen, und er sah, wie sich das merkwürdige Gespann langsam über den Hügel entfernte.