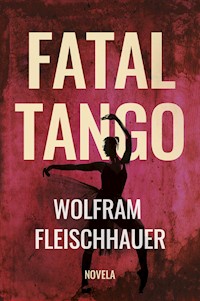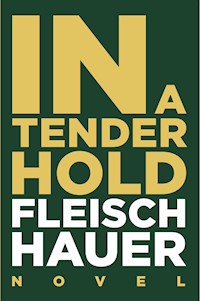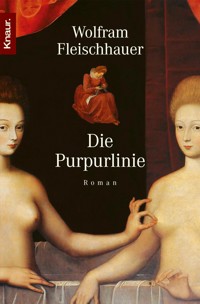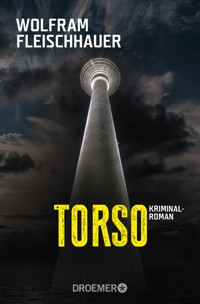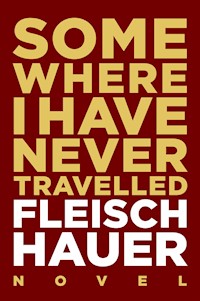9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Meer: Ursprung des Lebens. Der Mensch: Ursprung der Zerstörung. Ein Roman über Gut und Böse, über Leben und Tod. Dramatisch und erschreckend realistisch: Wolfram Fleischhauer versteht es wie kein anderer, brisante Themen mit atemloser Spannung zu verknüpfen. Teresa verschwindet spurlos im Einsatz auf einem modernen Fischfangschiff auf hoher See. Entsetzt ist nicht nur ihr Geliebter und Ausbilder John Render von der zuständigen EU-Behörde in Brüssel. Genauso am Boden zerstört sind Ragna di Melo und ihre Truppe von radikalen Umweltaktivisten, die eine mörderische Methode entwickelt haben, die skrupellose Ausbeutung der Meere zu beenden. Als Ragnas Vater, ein schillernder Schweizer Lobbyist, Wind von den Aktivitäten seiner Tochter bekommt, die auch seine eigenen Geschäftsinteressen berühren, muss er handeln. Noch bevor das ganze Ausmaß der Bedrohung bekannt wird, reist er nach Südostasien, wo Ragna sich versteckt halten soll. Er weiß, dass seine Tochter niemals mit ihm sprechen wird. Daher heuert er den jungen Dolmetscher Adrian an, der zu Schulzeiten eine leidenschaftliche Affäre mit Ragna hatte – ohne ihn jedoch in die wahren Gründe einzuweihen … Drei Männer auf einer verzweifelten Suche, zwei Frauen in Todesgefahr – und zwischen ihnen der brutale Apparat der globalen Fischereimafia, eine gleichgültige Öffentlichkeit und eine handlungsunfähige Politik: Wolfram Fleischhauer entwirft ein erschreckend realistisches Katastrophenszenario und erzählt zugleich von den Grenzen der Liebe und unserer Sehnsucht nach einem neuen Umgang mit der Natur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wolfram Fleischhauer
Das Meer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der neue Fleischhauer: ein bewegender Thriller und ein leidenschaftlicher Aufruf, den Lebensraum zu schützen, dem wir entstammen: das Meer.
Eine junge Biologin verschwindet mitten auf hoher See von einem spanischen Fangschiff, wo sie als Fischereibeobachterin eingesetzt war. Eine desillusionierte Öko-Aktivistin greift zu radikalen Methoden, um endlich die Zerstörung der Meere zu stoppen. Drei Männer – ein Umweltpolitiker, ein Vater und ein Ex-Geliebter – versuchen alles, um das Leben der beiden Frauen zu retten und das Schlimmste zu verhindern. Doch welche Chance haben sie gegen politische Skrupellosigkeit und die hochmodern ausgerüstete, weltweit agierende Fischereimafia?
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Render
2. Teresa
3. Di Melo
4. Buzual
5. Di Melo
6. Render
7. Di Melo
8. Madrid
9. Adrian
10. Render
11. Paulsen
12. Adrian
13. Render
14. Buzual
15. Teresa
16. Paulsen
17. Adrian
18. Buzual
19. Adrian
20. Paulsen
21. Adrian
22. Render
23. Ragna
24. Di Melo
25. Adrian
26. Köln
27. Adrian
28. Render
29. Adrian
30. Teresa
31. Adrian
32. Render
33. Adrian
34. Di Melo
35. Render
36. Ragna
37. Teresa
38. Adrian
39. Render
40. Adrian
41. Di Melo
42. Ragna
43. Render
44. Adrian
45. Teresa
46. Adrian
47. Di Melo
48. Adrian
49. Suphatra
50. Render
51. Adrian
52. Render
53. Adrian
54. Suphatra
55. Adrian
56. Render
57. Luxemburg
58. Adrian
Epilog
Nachwort
Prolog
Als sie die Augen öffnete, war alles schwarz. Sie spürte, dass sie schweißnass war. Zugleich hatte sie nur ein vages Körpergefühl. Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder. Kein Unterschied. Sie versuchte, ihre Beine zu bewegen, ihre Arme, aber ihre Gliedmaßen gehorchten ihr nicht. Dann war da ein Vibrieren, das sich über ihre Haut zog. Alles um sie herum hob und senkte sich leicht. Sie versuchte erneut, ihre Arme zu bewegen, und diesmal war da etwas. Ein Widerstand zunächst und dann ein jäher Schmerz, der sie sofort wieder erstarren ließ. Ganz ruhig, dachte sie. Es ist nichts. Deine Arme sind eingeschlafen. Das Blut beginnt wieder zu zirkulieren. Das ist alles.
Aber das war nicht alles. Weit davon entfernt! Sie wartete und lauschte, gleichzeitig bemüht, in der vollständigen Dunkelheit irgendetwas auszumachen. Was war mit ihr geschehen? Woher rührte dieses Brummen, diese Vibration? Plötzlich gab es einen Schlag, und ohne die geringste Vorwarnung begann ein Kreischen – der langgezogene Schrei eines übernatürlichen Wesens. Sie zuckte zusammen und schrie auf, denn nun raste ein Schmerz durch ihre Glieder, den sie nicht kannte, nicht einordnen konnte. Sie atmete schwer, versuchte nun zaghafter, vorsichtiger, ihre Arme und Beine zumindest ein wenig zu bewegen. Aber die Fesselung war unerbittlich, schnitt ihr bei jeder Bewegung ins Fleisch, staute ihr Blut und gab ihr das Gefühl, als würden ihre Arme und Beine von Nadeln durchstochen.
Das Abendessen in der Messe! Es war das Letzte, woran sie sich noch erinnerte. Wie lange war das her? Ein zweiter harter Schlag gegen die Wand ließ den Raum, in dem sie lag, erzittern. Wumm! Ihr Magen zog sich instinktiv zusammen, um das Heben und Senken ihres Körpers in der Dunkelheit auszugleichen. Wumm. Wumm. Die Stahlwand hinter ihrem Kopf dröhnte. Obwohl sie wusste, dass es sinnlos war, versuchte sie sich aufzurichten, hob den Kopf, so weit sie es trotz der Fesselung irgendwie vermochte. Allmählich wurde ihr klar, wo sie sich befand. Sie war in ihrer Kabine im Schiffsrumpf. Gedämpft drangen gebrüllte Befehle an ihr Ohr. Dann hörte sie das Stampfen und Dröhnen einer Schiffsmaschine. Ein zweites Schiff, durchfuhr es sie. Sie laden um. Natürlich. Bevor sie weiter nachdenken konnte, legte sich plötzlich alles schief. Scheppernd fiel in ihrer Kabine irgendetwas um. Die Rufe draußen wurden lauter. Erneut stieß etwas krachend gegen den Rumpf. Sie zuckte zusammen. Durch die Schieflage des Schiffes wäre sie unter normalen Umständen längst aus der Koje gerollt, doch ihre Fesseln hielten sie fest, schnürten ihr erneut das Blut ab und schnitten wie ein stumpfes Messer in ihre Haut. Doch das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass nun etwas Kratziges über ihren Oberkörper glitt. Erst begriff sie es nicht. Doch als die Decke, die auf ihr gelegen hatte, Zentimeter für Zentimeter von ihr herunterrutschte und sie die Luft auf ihrer nackten Haut spüren konnte, weiteten sich ihre Augen. Sie war völlig nackt! Panisch versuchte sie, sich loszureißen, und schrie vor Schmerz, den jede Bewegung auslöste. Aber ihr Schreien ging unter in einem erneuten grellen Kreischen, das sie jetzt klar zuordnen konnte. Es war das zornige Aufjaulen von Metall, das sich an Metall rieb.
Ihr Atem ging stoßweise, und ihr war kalt. Sie versuchte sich zu beruhigen, sich nicht zu bewegen, ihre Erinnerungen zu sortieren. Sie hatte mit ihnen zu Abend gegessen. Das wusste sie noch. Natürlich hatte sie die Feindseligkeit der Mannschaft gespürt. Die Blicke. Die Bemerkungen. Aber daran war sie gewöhnt. Das kannte sie von früheren Einsätzen. Sie hatte sich wie immer verhalten, auf keine der Provokationen reagiert, ihre Mahlzeit zu sich genommen und sich in ihre Kabine zurückgezogen, um ihre Proben zu ordnen und ihre Eintragungen vorzunehmen. Doch was war dann geschehen? Ihre Benommenheit konnte nur eines bedeuten: Man hatte sie betäubt! Und dann? Ihr wurde übel. Sie schaute an sich herunter. Sie konnte absolut nichts sehen. Aber mit jeder Sekunde, die verging, bohrte sich die Gewissheit tiefer in sie hinein. Sie spürte, dass sie seit Minuten instinktiv die Schenkel gegeneinandergepresst hielt. Als ob das jetzt noch etwas ändern würde. Ein Würgereiz stieg in ihr auf. Die Gesichter der Matrosen zogen an ihr vorüber. Verzweifelt warf sie den Kopf hin und her, als könnte sie diese Bilder abschütteln. Wie lange hatte es wohl gedauert, bis sie das Bewusstsein verloren hatte? Die Fratzen dieser Kerle! Was hatten sie ihr angetan? Sie? Mehrere? Oder nur einer? Nur!
War sie Stunden oder gar Tage betäubt gewesen? Sie hatte keinerlei Zeitgefühl. Ihre Kehle war ausgetrocknet, und ihr war speiübel. Sie lag in einer fensterlosen Kabine an Bord eines Trawlers, zwei Meter unterhalb der Wasserlinie irgendwo im Nordatlantik. Das war alles, was sie mit Sicherheit wusste.
Ihre Schenkel begannen sich zu verkrampfen. Sie versuchte, sie zu entspannen und einen klaren Gedanken zu fassen. Aber es gelang ihr nicht, sich zu konzentrieren. Ein Stöhnen entfuhr ihr. Ein verzweifeltes, wütendes Stöhnen, fremd und ungewohnt, so dass sie fast selbst darüber erschrak. Gleich darauf ergriff sie erneut Panik. Die Ampullen! Obwohl es sinnlos war, stierte sie in die Dunkelheit und versuchte, die Gegenstände auf dem kleinen Tisch an der gegenüberliegenden Kabinenwand zu erkennen. Der Abstand war gering, etwas mehr als ein Meter trennte das Bett, auf dem sie lag, von der Arbeitsfläche. Doch sie konnte nichts sehen. Ihre Zähne schlugen gegeneinander. Die Kälte kroch über ihren nackten Körper, und der Umstand, dass sie unter der kratzigen Decke zuvor geschwitzt hatte, ließ sie jetzt nur umso schneller auskühlen.
Allmählich fielen ihr weitere Einzelheiten ein. Das merkwürdige Gefühl, das sie auf dem Rückweg in die Kabine überkommen hatte. Das war keine normale Müdigkeit gewesen. Sie dachte an all das, was man ihr während ihrer Ausbildung immer wieder eingeschärft hatte. »Sie lassen eure Laptops verschwinden«, hatte man sie gewarnt. »Sie vernichten eure Unterlagen, wenn sie können. Sie lassen auch Proben über Bord gehen und vergesst nie: Ihr seid der einzige Polizist an Bord, und niemand, aber wirklich niemand, will euch dort haben. Es ist sogar schon vorgekommen, dass sie Beobachter betäuben. Oder noch schlimmer.«
Ihr Atem beschleunigte sich. Und wenn sie die Ampullen gefunden und mitgenommen hatten? War sie überhaupt noch selbständig in ihre Kabine gelangt oder vorher zusammengebrochen? Sie wusste es einfach nicht.
»Heey!«, schrie sie. Ihre Stimme war rauh und brach rasch ab. Sie schluckte und verzog das Gesicht vor Schmerzen. Ihre Kehle brannte. Sie sammelte Speichel, schluckte, atmete tief ein und setzte erneut an. »HEEY!«
Der Lärm draußen hielt unvermindert an. Waren das Schritte an Deck? Ein Motor ratterte, vermutlich eine Seilwinde. Aber vor ihrer Tür rührte sich nichts. Sie wollte erneut schreien, besann sich jedoch eines Besseren. Wer immer hereinkäme, würde sie so sehen. Nackt. Geschändet. Sie bäumte sich auf, bis der Schmerz in ihren Gliedmaßen ihr fast die Besinnung raubte. Kälte, Schmerz, Hilflosigkeit und Erniedrigung lähmten sie. Denk nach, denk nach! Du musst hier raus, bevor sie zurückkommen. Du MUSST.
Eine Winde ratterte. Schreie und Rufe gingen hin und her. Die Dünung musste enorm sein, denn das Schiff hob und senkte sich unablässig. Raus, dachte sie erneut. Und dann wieder: Die Ampullen. Sind die Ampullen in Sicherheit?
Sie versuchte, mit dem Mittelfinger die Art ihrer Fessel zu ertasten. Zweimal ließ sie davon ab, weil der Schmerz zu stark wurde. Doch schließlich stieß ihre Fingerspitze gegen etwas Hartes, einen schmalen Riemen, der tief in ihre Haut schnitt. Er war leicht geriffelt. Sie strich mehrmals darüber und ließ dann resigniert davon ab. Aussichtslos. Kabelbinder. Sie hatte keine Chance. Ohne Hilfe würde sie sich niemals befreien können.
Mit angstgeweiteten Augen lauschte sie in die undurchdringliche Dunkelheit. Aber vor ihrem inneren Auge sah sie von Minute zu Minute klarer, was sich an Deck abspielte. Die Finsternis schärfte ihre Sinne. Diese Geräusche kannte sie. Das regelmäßig wiederkehrende Poltern, gepaart mit feinen Erschütterungen, die sie am ganzen Körper spürte, konnte nur eines bedeuten: Das Schiff nahm Ladung auf. Von wem? Warum hier? Bei diesem Seegang? Dann hörte sie Schritte. Obwohl sie genau wusste, dass sie allein völlig hilflos war, wurde ihr nun himmelangst. Sie hörte, wie ein Riegel zurückgeschoben wurde. Dann schwang die schwere Metalltür auf. Sie konnte nichts sehen. Eine Taschenlampe, die ihr direkt ins Gesicht leuchtete, blendete sie.
»Wer ist da?«, rief sie und wollte mutig klingen. Aber ihre Stimme zitterte. Der Lichtschein wanderte langsam über sie hinweg. »Du Schwein!«, schrie sie. »Zeig dich wenigstens, du feiges Dreckschwein!«
Wer immer in der Tür stand und sie ausleuchtete wie ein Vieh auf der Schlachtbank, schwieg. Tränen traten ihr in die Augen. Was kam jetzt? Würde einer dieser perversen Hunde über sie herfallen? Wechselten sie sich ab und war nun der nächste an der Reihe?
»Komm doch her, du Memme«, schrie sie. »Und dann stell dir vor, ich wäre deine Schwester oder deine Mutter. Ja, dann macht es dir vielleicht richtig Spaß, du Abschaum. Los, worauf wartest du?«
Sie wusste selbst nicht, woher sie kamen, aber etwas in ihr würgte diese Worte der Verzweiflung und Verachtung aus ihr heraus. Der Lichtschein fiel wieder auf ihr Gesicht und kam dann plötzlich rasch näher. »Gute Nacht, du Schlampe«, hörte sie auf Spanisch.
Im nächsten Augenblick stach sie etwas in ihren linken Oberschenkel. Der Lichtschein war unverändert auf sie gerichtet und blendete sie, bis ihre Lider nach einigen Sekunden schwerer und schwerer wurden und sich allmählich herabsenkten.
Ein schwerer Wellenschlag erschütterte das Schiff, aber das spürte sie bereits nicht mehr.
Die Mayday-Nachricht ging um 04:37 bei der Seenotleitstelle von Falmouth ein. Der Kapitän hatte die Vermisstenmeldung über DSC-Funk abgesetzt, und sie war über Satellit an die zuständige Koordinierungsstelle in Südengland weitergeleitet worden.
Die Valladolid, ein unter spanischer Flagge fahrender Gefriertrawler vom Typ Atlantik 333, befand sich zum Zeitpunkt des Notrufs auf Position 52° 10’ Nord, 23° 48’ West. Die Hörwache nahm sofort Kontakt mit dem Kapitän auf und registrierte alle durchgegebenen Daten. Ein weibliches Besatzungsmitglied wurde vermisst. Der genaue Zeitpunkt des Verschwindens war nicht bekannt, ihr Fehlen erst eine halbe Stunde zuvor bemerkt worden. Die Vermisste war dreiunddreißig Jahre alt und in gutem gesundheitlichem Zustand. Ob sie einen Überlebensanzug oder eine Schwimmweste getragen hatte, war nicht bekannt, jedoch unwahrscheinlich, da keine Westen fehlten und an Bord kein Fangbetrieb geherrscht hatte. Sie war nach dem Abendessen zwischen 19 und 20 Uhr das letzte Mal in Freizeitkleidung in der Nähe ihrer Kabine gesehen worden. Kurz nach vier Uhr morgens wurde das Schlagen ihrer unverschlossenen Kabinentür bemerkt. Die Kabine war leer, das Deckenlicht eingeschaltet. Eine Suche unter Deck verlief erfolglos. Nach Meldung an die Brücke und sofort durchgeführtem Zählappell wurde das Schiff komplett durchsucht, ohne dass die vermisste Person gefunden wurde. Es stand zu befürchten, dass sie über Bord gegangen war.
Nach Eingabe aller verfügbaren Daten begann die Berechnung des theoretischen Suchgebiets. Unter Berücksichtigung des Kurses der Valladolid während der letzten Stunden, ihrer Geschwindigkeit, Position zum Zeitpunkt des Notrufs, der Windstärke, der Drift- und Strömungsverhältnisse in diesem Sektor entsprach das Suchgebiet in etwa der Größe Luxemburgs. Anhand der Berechnungen wurde eine Liste aller derzeit im betroffenen Sektor befindlichen Schiffe erstellt und der Notruf an diese mit der Aufforderung weitergeleitet, sich für eine Seenotrettung zur Verfügung zu stellen. Kurz darauf lagen die Antworten und voraussichtlichen Ankunftszeiten von vierzehn Schiffen im Zielgebiet vor.
Die Leitstelle in Falmouth übertrug die Koordinierung vor Ort an einen kanadischen Frachter, der als erster an Ort und Stelle eintreffen würde und ausreichend Personal zur Verfügung stellen konnte. Er erreichte das Zielgebiet um 07:12. Im Laufe der Morgenstunden eilten weitere Schiffe zu Hilfe, unter anderem ein Passagierschiff, ein Tanker, ein Frachter, zwei zuvor noch nicht klassifizierte Schiffe, die sich als französische Militärschiffe herausstellten, sowie zwei Fischereischiffe. Bis zum Abend suchten sie systematisch das betroffene Gebiet ab.
Der Kapitän der Valladolid informierte seine Reederei in Vigo, die es auf sich nahm, die Angehörigen der vermissten portugiesischen Fischereibeobachterin unverzüglich über den Zwischenfall zu unterrichten. Die Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik NAFO, in deren Auftrag die junge Frau im Einsatz gewesen war, erstattete noch am selben Tag bei der Staatsanwaltschaft Pontevedra Anzeige gegen unbekannt. Die Valladolid wurde von ihrer Reederei angewiesen, ihren Fangeinsatz unverzüglich abzubrechen und ihren Heimathafen Vigo anzulaufen. Das spanische Amt für die Untersuchung von Unfällen und Vorkommnissen auf See CIAIM wurde mit der Angelegenheit betraut.
Bei Einbruch der Dunkelheit war trotz intensiver Suche keine Schiffbrüchige gesichtet worden. Um neunzehn Uhr wurde die Suche eingestellt.
1. Render
Die Kapelle Nossa Senhora da Luz in Carvalhais war ein einfaches, kleines, weißes Haus mit einem blau gestrichenen Sockel, einer backsteinroten Tür und drei bleiverglasten Fenstern. Ein steinernes Kreuz ragte über dem Giebel auf. Die rechte Seite der Kapelle hatte man etwas breiter gebaut, so dass auf Höhe der Dachrinne ein Mauervorsprung entstanden war, auf dem ein kleiner Glockenturm stand. Es hing auch eine kleine Glocke darin, aber sie wurde nicht mehr genutzt. Stattdessen hatte man am Glockenturm zusätzlich eine senkrecht aufragende Stange angebracht, an dem drei Megafonlautsprecher hingen.
Aus diesen erschallte seit kurzem zu Laudes, Sext und Vesper Angelusgeläut, aber das wusste Johann Render nicht. Er nahm überhaupt eher wenig von seiner Umgebung wahr. Er war soeben erst mit einem Polo, den er am Flughafen von Lissabon gemietet hatte, in Carvalhais angekommen. Auf dem Dorfplatz hatte er nach der Kapelle gefragt und sie dann problemlos gefunden, obwohl er von der Wegbeschreibung bis auf die Handzeichen absolut gar nichts verstanden hatte.
Er parkte vor der Kapelle, stieg aus und ging direkt auf die rote Tür zu. Sie war geschlossen, aber nicht verriegelt. Er drückte die Klinke herunter. Die Tür gab leise quietschend nach und schwang nach innen zurück. Er trat über die Schwelle. Die Luft war stickig, und er entdeckte auch gleich den Grund dafür: eine stattliche Ansammlung von Kerzen, die auf einem kleinen Seitenaltar zu seiner Linken unter einem Madonnenbild standen. Die meisten Kerzen waren bereits weit heruntergebrannt. Durch den Luftstrom beim Öffnen der Tür flackerten sie kurz. Aus der Ferne war gedämpft der Stundenschlag der Dorfkirche zu vernehmen. Ansonsten war es völlig still in dem winzigen Gotteshaus. Er war allein, den Blick auf den Altar gerichtet, und atmete schwer.
Niemand wusste von seinem Kommen. Er war spontan aufgebrochen. Das zermürbende Warten auf Nachrichten und die mit jedem verstreichenden Tag wahrscheinlicher werdende Gewissheit, dass alle Hoffnung vergeblich war, hatten es ihm unmöglich gemacht, noch länger untätig am Schreibtisch zu sitzen und nur zu hoffen und zu beten, was er tatsächlich bereits zweimal getan hatte. Und möglicherweise würde er es gleich wieder tun. Langsam, als könnte er sich verbrennen, trat er näher an den kleinen Altar heran. Ihr Foto stand da. Sie lächelte. Das Bild musste während des Studiums entstanden sein. Ihr langes Haar verbarg eine Wollmütze, und man sah nur ihr schönes, junges Gesicht. Sie stand am Bug eines auf der Seite liegenden großen Holzbootes und blickte versonnen in die Welt irgendwo hinter der Kamera. Sein Magen verkrampfte sich. Aber er schaute nicht weg, sondern zwang sich, alles genau zu betrachten. Frische und bereits verwelkte Blumen lagen da, die offenbar niemand zu entfernen wagte.
Wie lange würde das hier so bleiben, fragte er sich. Bei auf See Vermissten wartete man keine zehn Jahre, bis man sie für tot erklärte. Sechs Monate vielleicht, maximal. Teresa stammte aus einer Fischerfamilie. Die Menschen hier wussten sehr gut, dass kaum einer jemals wieder auftauchte, der bei der Rückkehr zum Hafen nicht mit an Bord war.
Ein Kondolenzbuch mit nur noch wenigen unbeschriebenen Seiten lag neben dem Foto. Er blätterte und las. Render sprach kein Portugiesisch, aber der Sinn der meisten Trauerbotschaften erschloss sich ihm auch so. Jemand hatte ein weinendes Gesicht gezeichnet und ein kurzes Gedicht darunter geklebt. Er schlug die erste Seite auf, die Eintragung war in unregelmäßiger, ungeübter Handschrift vorgenommen: »Mein Herz ist bei Dir, in Deinem kalten, nassen Grab und wärmt Dich mit all meiner Liebe. Mamã.«
Die krakeligen Buchstaben verschwammen ihm vor den Augen. Er setzte sich auf eine der Holzbänke, holte ein Taschentuch heraus, hielt es dann jedoch einfach nur in der Hand und ließ seinen Tränen freien Lauf. Was hätte er geschrieben, wenn er dazu überhaupt in der Lage gewesen wäre? Sie war nicht mehr. Und damit war auch er nicht mehr. Vor knapp zwei Jahren hatte ihm das Leben ein unfassliches Geschenk gemacht. Nun war es ihm wieder genommen worden.
Der Anruf hatte ihn aus dem Schlaf gerissen. Die Stimme der Anruferin war absolut ruhig geblieben. Viertel vor sechs. Er sah nur den Namen auf dem Display und ahnte sofort, dass etwas Außergewöhnliches passiert sein musste.
»Vivian?«
»John.«
»Yes?«
Allein die Art, wie sie seinen Namen gesagt hatte!
»What happened«, fragte er mit einer Mischung aus Ungeduld und Furcht. »Warum rufst du mich in aller Herrgottsfrühe an?«
»Du weißt es also noch nicht?«
»Was denn, verdammt noch mal? Was ist los, Vivian?«
Die Stimme zögerte sicher nur einen Sekundenbruchteil. Oder lag es an der aufsteigenden Panik, dass sich alles um ihn herum verlangsamte?
»Teresa wird vermisst.«
Er war mit einem Schlag hellwach.
»Was?«, stammelte er.
»Ich habe die Meldung gerade erst bekommen«, hörte er wie durch ein Rauschen. »Es ist irgendwann heute Nacht passiert. Es wird gerade eine Suchflotte zusammengezogen. Sobald sie Tageslicht haben, werden sie das Gebiet durchkämmen.«
Das Atmen fiel ihm auf einmal unendlich schwer. Er wollte etwas sagen, aber es gelang ihm nicht. Er saß einfach da, das Telefon am Ohr, und starrte fassungslos in das Zwielicht seines Schlafzimmers.
»Ich fahre jetzt sofort ins Büro«, sagte sie.
Er vermochte nicht, zu antworten.
»John?«
»Ja«, keuchte er.
»Noch wissen wir nichts Genaues. Teresa ist eine erfahrene Beobachterin. Ich stehe mit allen Stellen in Kontakt und informiere dich sofort, sobald ich etwas erfahre. Du weißt, wo du mich findest.«
»Ja«, wiederholte er kaum hörbar. »Danke.«
»Bis nachher.«
Sie hatte aufgelegt. Er ließ die Hand sinken. Das Telefon fiel mit einem Knall auf den Holzfußboden. So musste es sein, wenn man einen Arm oder ein Bein verlor. In den ersten Sekunden spürt man keinen Schmerz. Nur eine dumpfe elementare Panik. Als er aufstehen wollte, begann er zu zittern. Er spürte etwas Warmes zwischen seinen Oberschenkeln. Er hastete ins Bad, schaffte es auf die Toilette, doch kaum saß er dort, wurde das Zittern noch schlimmer. Ein Kälteschauer nach dem anderen jagte ihm über den Rücken. Er keuchte. Sein Herz raste. Seine Brust hob und senkte sich wie fremdgesteuert, als schlage jemand wie wild darauf ein. Teresa vermisst! Im Nordatlantik! Er stürzte zum Waschbecken und erbrach sich.
Irgendwie schaffte er es, zu duschen und sich anzuziehen. Ein Gefühl von Taubheit und Unwirklichkeit umgab ihn. Alles schien beschlagen, gedämpft, unwahr. Er stand in der Küche, völlig durcheinander, ratlos. Ins Büro, dachte er. Ich muss sofort ins Büro fahren.
Er taumelte ins Wohnzimmer und ließ sich auf der Couch nieder. Das Ungeheuerliche, Unfassbare war geschehen. Teresa vermisst. Er weinte. Die Minuten verstrichen. Allmählich wurde es hell. Ein grauer Novembertag. Das Rauschen des Brüsseler Berufsverkehrs drang gedämpft durch die Fenster. Er musste ins Büro. Vielleicht war die Meldung falsch?
Er zog seinen Mantel an, griff nach seiner Aktentasche, verschloss die Wohnungstür. Alles schien wie immer. Für den Bruchteil einer Sekunde bildete er sich ein, nur geträumt zu haben. Aber als er in der Tiefgarage im Wagen saß, begann das Zittern erneut. Er fuhr vorsichtig die Rampe hinauf, wartete, bis das Rolltor scheppernd in der Decke verschwunden war, und fädelte sich in den Verkehr auf der Avenue Louise ein.
Auf seiner Etage war alles still. Kaum jemand erschien hier vor neun Uhr, und es war gerade einmal kurz nach acht. Er ging den verwaisten Flur entlang, öffnete seine Bürotür, wusste jedoch plötzlich nicht mehr, was er hier sollte. Mechanisch machte er Licht und startete den Computer. Draußen hörte er plötzlich Schritte. Die Tür ging auf. Vivian Blackwood stand vor ihm. Seine Chefin war blass. Sekundenlang fiel kein Wort. Er wollte etwas sagen, aber seine Lippen zitterten zu sehr.
Vivian schloss kurz die Augen und schüttelte den Kopf.
»Es gibt noch keinerlei Gewissheit. Eine halbe Armada ist dort draußen und sucht nach ihr. Es …«
»Wie viele Stunden, Vivian?«, unterbrach er sie. »Wie viele?«
Sie erwiderte nichts.
»Sechs? Sieben?«, beantwortete er seine Frage selbst. »Du weißt so gut wie ich, dass es nur Minuten dauert.«
»Wir werden jeden Stein umdrehen, John. Wir werden …«
Er hob die Hand und unterbrach sie erneut.
»Danke, Vivian. Aber was immer wir tun, es wird sie nicht zurückbringen. Und was wir nicht getan haben …«
Die Stimme versagte ihm. Vivians Handy piepte zweimal, aber sie reagierte nicht.
»Ich muss nach oben, John«, sagte sie dann. »Ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um alle Informationen zu bekommen. Ich verspreche dir, es wird alles getan werden. Alles.«
»Danke.«
Sie ging zu ihm und umarmte ihn. Der Duft ihres Parfüms hüllte ihn ein. Ihre Wange, die sich kurz gegen die seine presste, fühlte sich unnatürlich kühl an. Sie löste sich wieder von ihm, ihre Hand suchte seine und drückte sie. Er ließ es geschehen. Vivian hatte ihn noch nie umarmt. Sie war ihm überhaupt noch nie näher gekommen als auf Schreibtischdistanz. Und jetzt hielt sie seine Hand.
Würde es den ganzen Morgen über so weitergehen, wenn die anderen kamen und hörten, was geschehen war? Teresa, seine Freundin, vermisst. Vermutlich im Atlantik ertrunken. Bald würde sich die Nachricht im ganzen Hause verbreiten. Er starrte auf seinen Computer, auf dem sich schon jetzt ständig kleine Fenster eingehender E-Mails öffneten. Der Header war immer der gleiche: An Johann RENDER Section C/2 GDMARE Fisheries conservation and control – Atlantic and Outermost Regions. Alle schrieben ihm. Neil von der APFO, Gregg von der NAFO, sogar Viktor Bach von Interpol. Er öffnete die ersten Mails und überflog deren Inhalt. Sie ähnelten einander, brachten Fassungslosigkeit und Mitgefühl zum Ausdruck, gleichzeitig die Entschlossenheit, dem Vorfall auf den Grund zu gehen und lückenlose Aufklärung zu fordern. Render schloss das Mailprogramm und starrte auf die gegenüberliegende Wand. Postkarten hingen dort. Und jede Menge dumme Sprüche. Von zwei Dingen sollte man nie wissen wollen, wie sie gemacht werden: Politik und Würste.
Er verließ das Büro, schaltete sein Telefon aus und ging in die Tiefgarage. Da er antizyklisch unterwegs war und der allmorgendliche Megastau sich nach Brüssel hinein quälte, gelangte er durch die Tunnels rasch auf die E40. Er fuhr in Richtung Gent. Die Sonne brach durch die Wolken und schien hell auf die Felder und Wälder links und rechts der Autobahn. Die gegenüberliegende Fahrbahn war bis Ternat hoffnungslos verstopft. Hinter Gent bog er auf die Landstraße ab und folgte ihr an die Küste. In Breskens parkte er auf einem verlassenen Parkplatz am Deich. Das Wasser erstreckte sich bleigrau bis zum Horizont, wo die Welt in einem schmutzig weißgrauen Nebel aufzuhören schien. Den ganzen Vormittag lief er den Dünenweg entlang. In Cadzand aß er spät zu Mittag, ließ die Hälfte des Essens jedoch stehen und trank nur den Weißwein, der ihn angenehm betäubte. Auf der Rückfahrt hatte sich das Gehupe und Geschiebe der Pendler auf die Gegenspur verlagert, und er kam wieder gut durch, was indessen nichts daran änderte, dass seine Gedanken immer verzweifelter, immer finsterer wurden. Er schaltete sein Telefon wieder ein, aber die Nachrichten bestätigten nur, dass alles so war, wie es war. Einen Tag lang hatte man nach ihr gesucht. Um neunzehn Uhr würden alle Suchmaßnahmen eingestellt werden. In den nationalen und internationalen Medien fand der Zwischenfall keine Erwähnung. Allein im Internet wurde spekuliert, aber er brach die Lektüre nach wenigen Absätzen ab. Vivian textete ihm: Er sei für den Rest der Woche freigestellt, und falls sie irgendetwas für ihn tun könne, so möge er sich bitte melden.
Tun? Ja, was denn?! Zurück in Brüssel, ging er vor lauter Verzweiflung ins Kino. Aber es funktionierte nicht. Ganz gleichgültig, was auf der Leinwand geschah, er sah immer dasselbe Gesicht. Eine halbe Stunde später verließ er das Kino wieder. Unschlüssig machte er ein paar Schritte in Richtung Porte de Namur, verwarf aber einen Kneipenbesuch und trottete stattdessen zur Tiefgarage, wo sein Wagen stand.
Wie sollte er sich ablenken, nicht verrückt werden? Ein Kloß im Hals nahm ihm fast die Luft. Er hatte Mühe, die Parkkarte in den Schlitz des Automaten zu stecken, so sehr zitterte seine Hand. Irgendwann fand er sein Auto, setzte sich hinein, blieb jedoch untätig sitzen. Vor ihm breitete sich die geisterhafte Umgebung aus leeren Wagen, Betonpfeilern und trüber Beleuchtung aus. Er war schuld, hämmerte es in seinem Kopf. Er war schuld an ihrem Tod! Ganz gleich, was alle anderen sagten.
Render umklammerte sein Lenkrad, drückte zu, bis seine Knöchel weiß wurden, und wartete, dass der Kloß in seiner Kehle sich allmählich löste. Irgendwann startete er den alten BMW und kroch die enge, schneckenförmige Auffahrt hinauf. Vor ein paar Wochen hatte sie noch hier neben ihm im Wagen gesessen. Sie hatten in einem kleinen Restaurant in der Rue de la Régence zu Abend gegessen und waren dann am Petit Sablon vorbei auf der Rue de Namur zum Parkhaus zurückgelaufen. Sie hatte sich bei ihm untergehakt. Er erinnerte sich an den Duft ihres Parfüms. Sie trug ihr Haar offen, und manchmal blies der Wind eine ihrer langen Strähnen in sein Gesicht. Die Erinnerung war unerträglich. Er beschleunigte, streifte dabei leicht die stark gekrümmte Wand der Auffahrt, bremste abrupt und fuhr dann im Schritttempo bis zur Schranke. Ohne den Schaden an seinem Kotflügel zu beachten, steckte er das Parkticket in den Automaten und reihte sich in den Abendverkehr ein.
Weit war es nicht. Seine Wohnung lag in einem der modernen Mietshäuser aus den dreißiger Jahren am unteren Ende der Avenue Louise. Sie war nicht besonders schön, aber sie lag im vierten Stock mit Blick auf den Square du Jardin du Roi und hatte Dreifachverglasung, so dass der Lärm der vierspurigen Brüsseler Prachtstraße nur gedämpft zu ihm heraufdrang, solange er die Fenster geschlossen ließ. Sein Leben spielte sich vor allem im hinteren Teil der Wohnung ab, wo sich Bad und Küche, sein Arbeitszimmer und sein Schlafzimmer befanden. Wohn- und Esszimmer benutzte er so gut wie nie. Die Zeiten, als er noch Dinnerpartys gegeben hatte, waren lange vorbei. Sie hatten eher selten auf seine Initiative hin stattgefunden, sondern waren fast immer von den beiden Ehefrauen organisiert worden, mit denen er zunächst sechzehn und dann zwei Jahre seines Lebens verbracht hatte.
Er hatte drei Kinder aus erster Ehe. Seine zwei Töchter lebten mit ihrer Mutter in den Niederlanden, sein Sohn und Ältester studierte in den USA. Mit seiner zweiten Frau, einer österreichischen Juristin, die er bei einer Konferenz in Wien kennengelernt hatte, war schon nach zwei Ehejahren alles wieder zu Ende gewesen. Wenigstens hatte er mit ihr keine Kinder mehr gehabt. So unbegreiflich es ihm heute auch erschien, er hatte nach jeder Hochzeit sofort ein Haus gekauft und sich in monatelange Renovierungsarbeiten gestürzt. Nach jeder Scheidung hatte er sofort wieder verkauft, das erste Mal mit Gewinn, das zweite Mal mit einem derartigen Verlust, dass der Gewinn aus der ersten Transaktion gleich mit verlorenging. Inzwischen empfand er jede Form von Besitz nur noch als lästig. Er wollte an gar nichts mehr gebunden sein. Am liebsten hätte er sogar seine Kleider nur noch gemietet. Seine Zeit in Brüssel war so gut wie vorüber. Im Gegensatz zu manchen Kollegen, die sich am Ende ihrer Karriere lukrative Beraterverträge angelten, um ihre saftigen Pensionen noch saftiger zu machen, indem sie weiterhin mehr oder weniger das Gleiche taten wie zuvor, würde er unter seinen Einsatz für Europa dann endgültig einen Schlussstrich ziehen.
Wohin er gehen würde, war ihm lange schleierhaft gewesen. In Deutschland kannte er niemanden mehr. Er hatte immer mit den USA geliebäugelt, erwogen, in die Nähe seines Sohnes zu ziehen, mit dem er sich von den drei Kindern am besten verstand. Oder Amsterdam. Aber die Beziehung zu seinen beiden Töchtern war schwierig. Sie waren in jungen Jahren massiv dem Gift ausgesetzt gewesen, das seine erste Frau nach der Scheidung über Jahre hinweg abgesondert hatte. Sie weigerten sich inzwischen sogar, Deutsch mit ihm zu sprechen, eine Absurdität, denn sein Niederländisch war zwar ganz passabel, aber er sah einfach nicht ein, mit seinen eigenen Kindern fremdsprachig kommunizieren zu müssen. Seit fast dreißig Jahren war er gezwungen, tagaus, tagein Französisch oder Englisch zu sprechen. Es hing ihm inzwischen manchmal einfach zum Hals heraus. Wie so vieles.
»Du bist auslandsmüde«, hatte Teresa zu ihm gesagt. Sie hatte das so klar und simpel ausgedrückt, als hätte sein Arzt ihm eröffnet, er habe Diabetes. Keine lebensbedrohende Krankheit, aber ein das gesamte Leben beeinträchtigender Zustand. »Du musst nach Hause«, erklärte sie. »In deine Sprache. In deine Welt. Du lebst hier wie auf einer Mondstation. Man kann nicht nur Europäer sein. Das ist zu abstrakt. Man muss es auch sein. Aber wer nur Europäer ist, ist gar nichts. Da fällst du irgendwann ins Nichts.«
Er betrat die dunkle Wohnung, schloss die Tür und spürte, wie ihn eine unendliche Leere überkam. Nach Hause? Wo sollte das jetzt noch sein? Mit ihr, so hatte er gedacht, würde alles eine ganz neue Wendung nehmen. Mit Teresa war die Zukunft plötzlich wieder weit offen gewesen. Vielleicht hätte er sich in Lissabon niedergelassen. Oder er wäre mit ihr in der Welt herumgereist und hätte sie bei ihren Projekten unterstützt. Das hatte er sich manchmal so ausgemalt. Aber jetzt? Vorbei! Auf See vermisst. Über Bord gegangen. Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.
Render ging in die Küche, schenkte sich ein Glas Rotwein aus einer halbvollen Flasche ein und steckte sein Mobiltelefon auf ein Dock neben der Mikrowelle. Nach ein paar Sekunden erfüllte Bill Evans’ Klaviermusik den Raum. Render lauschte. Dann stellte er das Glas ab und erwog ernsthaft, mit ausreichend Anlauf ins Wohnzimmer zu laufen und durch eine der großen Scheiben zu springen.
Wenn sie ihn in Brüssel besuchte, hatte sie oft dort am Fenster gestanden und auf die Straße hinuntergeschaut. Im Mantel. In Jeans. Auch einmal fast nackt, nur mit einer Decke um die Schultern geworfen. Sie hatte diesen Blick auf die Brüsseler Variante der Champs Elysées gemocht. Der Vergleich mit Paris hielt natürlich nicht stand, abgesehen vielleicht vom dreistündigen Dauerstau jeden Morgen oder den edelmarkenbewussten Shoppern, die den Rest des Tages dominierten. Spätestens nach Ladenschluss verödete die Gegend. Nach zweiundzwanzig Uhr kamen die Prostituierten.
Er setzte sich wieder und vergrub seinen Kopf in den Händen. Er fühlte sich, als habe er ein großes, unsichtbares Loch in der Brust, durch das der Wind strich. Er musste ständig ohne jeden Grund schlucken. Wie sollte das nur weitergehen? Warum sollte überhaupt irgendetwas weitergehen? Sein Büro in der Rue Joseph II erwartete ihn morgen nicht. Er würde sich nicht über die Avenue Louise quälen, durch die Tunnel bis zur Rue Belliard, wie tausendmal zuvor. Keine Akten. Keine Sitzungen. Um elf Uhr würde irgendein anderer Kollege Vivian in den Haushaltsausschuss begleiten. Der Termin beim Verbraucherschutz? Das Treffen mit dem Berichterstatter des Fischereiausschusses des Europaparlaments? Alles auf nächste Woche verschoben. Nächste Woche!
Er war aufgestanden und in sein Arbeitszimmer gegangen. Der Monitor des Computers schaltete sich ein, sobald er die Maus berührte, und mit einem leisen Summen startete die Back-up-Festplatte. Drei Minuten später hatte er die schnellste Verbindung nach Carvalhais gefunden. Er buchte den frühesten Flug nach Lissabon und reservierte einen Mietwagen. Dann packte er einen kleinen Koffer, bestellte für sechs Uhr ein Taxi zum Flughafen, nahm eine Schlaftablette und ging zu Bett.
So hatte sich seine Schockstarre plötzlich in blinden Aktionismus verwandelt. Es hatte ihm gar nicht schnell genug gehen können. Die Frühmaschine war um elf Uhr in Portela gelandet, eine halbe Stunde später saß er in seinem Mietwagen. Die Strecke nahm keine zwei Stunden in Anspruch, und jetzt stand er in der Kapelle des Ortes, wo sie zur Welt gekommen und aufgewachsen war. Und nun? Was sollte er jetzt tun? Weiter warten? Aber worauf? Auf Trost? Auf irgendein Zeichen, dass sie durch einen unvorstellbaren Zufall lange genug im Wasser überlebt hatte und von einem anderen Schiff gerettet worden war?
Er zwang sich, wieder aufzustehen, trat erneut an den Altar und musterte die hilflosen Zeichen von Anteilnahme, Trauer und Verzweiflung. Ihre Geburtsanzeige lag da, eine kleine Karte mit dem Foto eines Babys. Teresa Maria da Carvalho. 14. April 1989. Ein flaumiges Bündel Kinderhaar war darunter festgeklebt. Daneben lag ein goldenes Kettchen mit einem Kreuz.
Wie musste es erst für ihre Mutter sein, dachte er. Für ihren Vater. Ihre Brüder und Schwestern. Er kannte sie nicht. Nur aus Erzählungen. Niemand aus ihrer Familie hatte ihn kontaktiert. Sie wussten nichts von ihm. Er nahm eine frische Kerze aus einem Blechbehälter, der neben dem Kondolenzbuch stand, zündete sie an einer der fast niedergebrannten Kerzen an und drückte sie auf den erlöschenden Docht in das flüssige Wachs. Nach einigen Sekunden ließ er los, prüfte kurz, ob sie stehen blieb, und wandte sich ab.
Als er wieder vor die Kapelle trat, war weit und breit niemand zu sehen. Der Himmel lag strahlend blau über ihm, die Luft war mild und zugleich frisch. Er atmete tief ein, setzte sich ans Steuer seines Wagens und wartete. Nach einer Weile kamen ein paar Gestalten langsam zu Fuß vom Dorf her. Zwei Frauen in Schwarz und ein junger Mann in dunkelbraunen Cordhosen, kariertem Flanellhemd und einer abgewetzten Lederjacke. Render rührte sich nicht. Sie gingen direkt an seinem Wagen vorbei, aber sie beachteten ihn nicht. Er sah ihre Gesichter. Die Frauen waren alt, ihre Gesichter völlig ausdruckslos und leer. Der Mann wirkte erheblich jünger. Sein Schritt war fest. Er hatte volles, schwarzes Haar und dunkle, ernste, suchende Augen. Ihr Bruder, fragte er sich. Aber er brachte es nicht über sich, auszusteigen und sie anzusprechen. Sie betraten die Kapelle, die Tür schloss sich hinter ihnen, und alles war wie zuvor. Der Himmel lag leer über ihm. Der Wind strich über die umliegenden Felder und ließ das hoch stehende Gras hin- und herwogen. Schwalben schossen geräuschlos über ihn hinweg. Er startete den Motor und fuhr davon.
2. Teresa
From: [email protected]
Sent: Sunday, November 08, 2015 16:34 PM
Subject: Valladolid
My love,
seit vorgestern bin ich auf der Valladolid. Mein Gott, welch ein Unterschied zur Ariana! Schon das Übersetzen war eine Katastrophe, enormer Seegang, und der Kapitän tat alles, um mir einen unmissverständlichen Empfang zu bereiten, drehte ständig in den Wind wegen angeblicher Manövrierprobleme.
Ich mache mir keine Illusionen. Die zwei Wochen auf der Valladolid werden schwierig. Ich fühle mich wie ein unbewaffneter Hilfssheriff in der Bronx, umgeben von zwielichtigen Figuren, die mir unmissverständliche Blicke zuwerfen. Glücklicherweise habe ich ausnahmsweise eine abschließbare Kabine und die Gewissheit, dass viele offizielle Augen auf dieses Schiff gerichtet sind. Sie werden es also nicht wagen, mir irgendetwas anzutun. Aber einen angenehmen Arbeitsplatz stelle ich mir anders vor.
Die Stimmung an Bord und in der Mannschaft ist schlecht, was aber sicher nicht nur daran liegt, dass man ihnen einen Kontrolleur aufs Schiff geschickt hat. Und dazu auch noch eine Frau. Seeleute sind abergläubisch, wie Du weißt. Und wer nicht bei Windstärke fünf über eine Reling pinkeln kann, hat an Bord nichts verloren. Auf der Brücke habe ich tatsächlich zwei alte, verstaubte Scheren hinter der Steuerkonsole herumliegen sehen, was ja bekanntlich gegen Hexerei helfen soll. Tja, jetzt haben sie leider eine Hexe mit einem Doktortitel in Meeresbiologie an Bord. Da werden ihnen ihre Scheren nicht viel nützen.
Die Laune des Fischerei-Kapitäns wäre auch ohne meine Anwesenheit hier vermutlich nicht besser. Sie sind seit fünf Tagen unterwegs und die Fänge sind miserabel, 40% unter Soll, was mich wundert, denn sie verfügen über ein Arsenal an technischer Ausrüstung wie ein Flugzeugträger für elektronische Kriegsführung. Das Schiff ist recht alt, aber gut gepflegt, ein 60 Meter langer Gefriertrawler mit siebenunddreißig Mann Besatzung. Die Gesamtkapazität liegt bei fast 250 Tonnen. Sie haben eine Fischmehlanlage, die zehn bis zwölf Tonnen pro Tag schafft, und eine Leberölanlage, die es auf vier Tonnen bringt. Eine hocheffiziente schwimmende Fischvernichtungsmaschine also. Ich habe in den Laderäumen Proben gezogen und geschlechtsreife Jungfische gefunden. Die Katastrophenspirale dreht sich weiter abwärts, und Mutter Natur dreht durch. Manche Arten schaffen es nicht einmal mehr, den Nachwuchs bis zur normalen Geschlechtsreife durchzubringen, weil wir überall zu früh abfischen. Die Natur gibt das Notsignal und greift zum allerletzten Mittel der Arterhaltung: fortpflanzungsfähige Kinder! Vielleicht einer Erwähnung wert im nächsten Fischereirat, bevor die Herren und Damen Minister aus den Mitgliedstaaten das nächste Fischquotenmassaker genehmigen.
Beim gegenwärtigen Stand der Dinge wäre die Valladolid übrigens rentabler, wenn man sie einfach nur verschrotten würde. Das Schiff verbraucht acht Tonnen Schweröl am Tag, beim Schleppen neun. Trotz der Subventionen für Schiffsdiesel übersteigen nach meiner Rechnung schon die Treibstoffkosten den Fangertrag. Dazu die Löhne, die miserabel genug sind. Solange die Netze voll sind, rechnet es sich gerade noch so, auch für die Arbeiter, die ja am Fangerlös beteiligt sind. Von vollen Netzen kann hier aber keine Rede mehr sein, und entsprechend mies ist die Stimmung. Der Kapitän hat offenbar bereits Weisung, an allem zu sparen, was nur geht: Essen, Alkohol, Zigaretten. You get the picture: frustrierte Seeleute unter extremem ökonomischem Druck, zusammengepfercht auf einem knapp über eine Million Euro teuren Schiff im Nordatlantik, das sein Netz kreuz und quer über ein bereits weitgehend verwüstetes Seebett schleppt und kaum etwas fängt. Und Deine Teresa mitten unter ihnen.
Das Schicksal dieser Totengräber unseres Planeten kümmert mich nicht sehr, lediglich die Deckarbeiter tun mir leid, diese armen Hunde aus Burma, Vietnam, Kambodscha oder wo sie alle herkommen. Was können sie dafür, dass eine durchgedrehte Fischereiindustrie einen irreversiblen Biozid betreibt? Bei sich zu Hause finden sie keine Arbeit oder Nahrung mehr, weil unsere Megatrawler ihre Fischgründe einfach leer saugen. Also heuern sie auf unseren Riesenstaubsaugern an und vollenden die Katastrophe, was sie vielleicht noch ein paar Jahre in Lohn und Brot halten wird, ihre Kinder jedoch gewiss nicht mehr.
Wenn ich sie sehe, muss ich an meinen Vater denken. Ich habe Dir ja erzählt, dass er in den sechziger und siebziger Jahren wie so viele Portugiesen auf euren Gefrierschiffen gefahren ist und im Akkord Fische geschlachtet, zerlegt und eingefroren hat. Inzwischen überlasst ihr das ja anderen. Habe ich Dir eigentlich gesagt, dass er am Ende sogar in der DDR angeheuert hat, weil ihm die Arbeitsbedingungen im Westen zu unmenschlich geworden waren? Schade, ich hätte mir gewünscht, dass Du ihn kennenlernst. Obwohl, wenn er erfahren hätte, dass ich mich mit einem zweimal geschiedenen sechsundfünfzigjährigen Deutschen eingelassen habe, hm …?!?
Ich habe ein ziemliches Programm vor mir. In vier Tagen muss ich meinen nächsten Bericht absenden, dann müssen sie mich wieder in den Funkraum lassen, und ich kann Dir eine Mail schicken. So lange musst Du nun leider auf Nachrichten von mir warten. Es fällt mir schwer, Dich so lange nicht zu sehen. Ich zähle die Tage.
Wir fahren gerade ein neues Gebiet an, und es ist bereits dunkel, so dass ich nicht viel tun kann. Das Fanggerät schaue ich mir nach dem ersten Fang an. Nachher mache ich noch einmal einen Rundgang unter Deck, damit ich mit den Wegen und Örtlichkeiten besser vertraut bin und morgen nicht ständig allen im Weg stehe. Vielleicht kann ich mich auch ein wenig nützlich machen. Auf der Ariana kam es ganz gut an, dass ich mit angepackt habe. Je mehr sie vergessen, warum ich eigentlich hier bin, desto besser.
Meine Karteikarten und die Probengläschen für meine Otolithen warten auf mich. Ich kann es kaum erwarten, Dich wiederzusehen. Wünsche mir, dass uns keine Delphine oder Seehunde ins Netz gehen. Es bricht mir immer das Herz, sie schreien zu hören. Eine Seehundschnauze abschneiden und auskochen zu müssen, um die Zähne sicherzustellen, ist so ziemlich das Letzte, was ich mir wünsche.
Ich küsse und umarme Dich. Teresa.
3. Di Melo
Die junge Frau strich sich die hellbraunen Haare aus dem Gesicht und schien konzentriert etwas zu lesen, das vor ihr auf dem Tisch lag. In ihrer linken Hand glomm eine Zigarette. Rauch schlängelte sich durch die windstille Luft nach oben. Sie saß allein am Tisch, aber es standen zwei Gläser da. Offenbar war sie in Begleitung.
Alessandro Di Melo schluckte. Die Person auf der Aufnahme war fast unwirklich real. Es sollte ihn eigentlich nicht wundern. Jedes bessere Handy schoss heutzutage derartige Bilder. Um was für eine Örtlichkeit es sich handelte, war schwer zu sagen. Ein Restaurant? Ein Café? Ein Hotel? Beim nächsten Foto blickte die junge Frau direkt in die Kamera und lächelte. Di Melo versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
Er spürte Ignacio Buzuals eisigen Blick und schaute kurz zu ihm hin. Der Mann saß ihm gegenüber am anderen Ende des Konferenztisches. Sein Sohn Ibai war neben ihm über den Laptop gebeugt und steuerte den Beamer, der an der Decke hing. Außer ihnen war niemand im Raum.
Di Melo konzentrierte sich wieder auf die Leinwand. Weitere Fotos folgten. Ein Mann saß nun mit am Tisch der jungen Frau. Eine rasche Folge von Aufnahmen zeigte die beiden aus unterschiedlichen Richtungen. Vielleicht Mitte dreißig, schätzte Di Melo. Typ Seewolf. Krauses, braunes Haar. Ebensolcher Vollbart. Gleichmäßige, ansprechende Gesichtszüge, die man jedoch sofort wieder vergaß. Nur seine Tochter offenbar nicht. Auf einem der Bilder hatte sie ihre Hand auf seine gelegt und sagte etwas zu ihm, das Di Melo nie erfahren würde.
»Steve Riess«, hörte er Ignacios Stimme. »Kanadier. Ist zweimal bei diesem Watson mitgefahren und inzwischen bei Interpol auf der Liste. Wenigstens nach Europa und in die USA kann er nicht einreisen, ohne verhaftet zu werden. Leider lassen die Australier ihn unbehelligt, und er kann dort kommen und gehen, wie er will.«
Di Melo antwortete nicht. Na und? Was änderte das? Was interessierte ihn irgendein Steve Riess? Und vor allem: Woher um alles in der Welt hatte Buzual diese Aufnahmen?
»Es ist also deine Tochter?«, fuhr Ignacio nach einer Pause fort.
Di Melo nickte nur stumm. Natürlich war sie es. Er hatte Ragna seit fünf Jahren nicht gesehen und kein Lebenszeichen von ihr erhalten. Aber erkannt hatte er sie sofort. Ohne jeden Zweifel. Er war noch nicht in der Lage zu überschauen, was das für ihn bedeutete. Er dachte gerne nach. Dafür bezahlte man ihn schließlich. Und sogar sehr gut. Nur nicht unter Zeitdruck. Er war ein guter Stratege. Aber das hier war ein Alptraum.
Gerade lächelte eine schwarzhaarige junge Frau in die Kamera. Offenbar war sie mit Ragna befreundet, denn auf dem nächsten Foto standen sie Arm in Arm vor irgendeinem asiatischen Tempel. Eine Urlaubsreise?
»Woher sind die Aufnahmen?«, fragte er. Er hatte die Frage schon einmal gestellt, aber Buzual beantwortete sie auch jetzt nicht. »Nachher, Alessandro. Ibai wird dir alles erklären. Die Dunkle hier war auf unserem Schiff. Portugiesin. Teresa Carvalho. War das alles, Ibai?«
Der Angesprochene nickte nur und schaute Di Melo misstrauisch und feindselig an.
»Ich muss kurz telefonieren«, sagte der Senior und erhob sich. »Ich bin gleich zurück.«
Di Melo blieb nichts übrig, als zu warten. Er hatte angenommen, es ginge nur um irgendeinen Zwischenfall an Bord eines von Buzuals Schiffen. So hatte es sich jedenfalls angehört, als die Sekretärin des spanischen Reeders ihn vor fünf Tagen angerufen und gebeten hatte, so rasch wie möglich nach Vigo zu kommen. Er war gerade in London und hatte noch unaufschiebbare Termine vor sich. Zwei Tage Moskau. Dann Frankfurt. Aber dann fiel Ragnas Name, und er war so schnell wie möglich hergekommen.
Er erinnerte sich kaum noch an Buzual. Oder vielleicht sollte er besser sagen: Er hatte, so gut er konnte, verdrängt, was ihn mit diesem Menschen verband. Er hatte vorsorglich die alten Akten heraussuchen und auf den Büroserver laden lassen, um sie in Charles de Gaulle beim Warten auf den Anschlussflug nach Vigo zu studieren. Es war über zehn Jahre her, dass er für Ignacio Buzual gearbeitet hatte. Damals war es ein gutes Geschäft gewesen. Eines von Buzuals Schiffen hatte in einem Schutzgebiet in der Antarktis illegal Arktisdorsch gefischt und war von der australischen Küstenwache erwischt worden. Die Australier hatten den Trawler über viertausend Seemeilen hinweg verfolgt und schließlich unter Einsatz von südafrikanischen Söldnern gekapert und nach Perth abgeschleppt, wo man der Crew den Prozess machen wollte. Di Melo und sein Team hatten keine großen Schwierigkeiten, die Crew wieder freizubekommen. Die Anklage war juristisch nicht haltbar. Das internationale Seerecht war noch schwammiger als das internationale Recht. Die Besatzung wurde freigesprochen, da nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass der an Bord gefundene Fisch aus der geschützten Zone stammte. Die Australier behielten allerdings das Schiff und zerstörten es später sogar. Auch das war illegal und beschäftigte bis heute die Gerichte. Im Großen und Ganzen war Buzual jedoch glimpflich davongekommen, der materielle Verlust erträglich. Seine Leute waren längst wieder im Einsatz und hatten vermutlich andere Wege gefunden, an den begehrten Fisch heranzukommen. Nur Di Melo selbst hatte für diesen verfluchten Job einen hohen Preis gezahlt: seine Tochter! Sie war auf dem Verfolgerschiff mitgefahren und hatte dem Prozess beigewohnt – und seither kein Wort mehr mit ihm gesprochen.
Schon deshalb dachte Di Melo äußerst ungern an die Zeit zurück, als er mit Leuten wie Buzual Geschäfte gemacht hatte. Es war auf allen Ebenen eine üble Phase in seinem Leben gewesen, beruflich wie privat. Wie ein Idiot war er ausgerechnet kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende in die Selbständigkeit gestartet und hatte sich dabei fast ruiniert. Nicht mit Aktien. So dumm war er nun auch wieder nicht. Aber nach dem Crash ging ja vorübergehend überhaupt nichts mehr. Das Beratergeschäft war komplett eingebrochen. Jeder abgehalfterte Geschäftsführer trieb sich als Consultant auf dem Markt herum und verdarb die Preise und das Geschäft. Und sie lebten auch noch ausgerechnet in Frankfurt, in einem der Zentren dieses Fiaskos. Wie hatte ihn sein Instinkt nur derart im Stich lassen können? Mit Müh und Not hielt er sich und die Familie über Wasser, was aber bedeutete, dass er alles annehmen musste, was sich bot, und aus dem Flieger kaum noch herauskam.
Seine Frau hasste Frankfurt von Anfang an. Ylva mochte Deutschland nicht und nahm ihm übel, dass sie mit Ragna dort festsaß, während er so gut wie nie zu Hause war. Dabei hatte er gedacht, eine Rückkehr nach Europa würde ihr entgegenkommen. Frankfurt lag strategisch günstig. Sie wäre näher an ihrer norwegischen Heimat. Ragna könnte endlich einmal richtig Deutsch lernen, woran ihm viel lag. Er selbst kam aus dem Tessin, aber das Studium in St. Gallen und später in Zürich hatten ihm Wege eröffnet, die er sonst niemals hätte einschlagen können. Dabei war es nicht die Sprache von Kant und Goethe, die ihn interessierte. Da zog er Machiavelli und Dante vor. Ihn faszinierte der Exportweltmeister. Er wollte das Denken der Leute verstehen, die eine der leistungsstärksten Volkswirtschaften des Planeten hervorgebracht hatten.
Doch alles kam anders. Ragnas Wechsel von einer Internationalen Schule an ein deutsches Gymnasium versetzte sie in eine Art Schockzustand. Und Ylva begann zu trinken. Im gleichen Jahr platzte die Dotcom-Blase. Ein Jahr später, nach den Anschlägen auf New York, brach die US-Börse ein. Schließlich folgte auch noch das Enron-Debakel, und Arthur Andersen kollabierte. Ein Schlachtfeld. Geschäftsfreunde, die sich erschossen. Ruinierte Partner. Telefonanrufe von verzweifelten ehemaligen Kollegen, denen das Wasser bis zum Hals stand und die ihn um Hilfe anflehten. Und er damit beschäftigt, zwischen diesen Trümmern seine eigene Firma aufzubauen.
Im Nachhinein stellte es sich als der Coup seines Lebens heraus. Kaufen, wenn das Blut in den Straßen schwimmt. Investieren, wenn der Rauch aus den Ruinen aufsteigt. Das waren alte Börsenweisheiten, die jeder im Mund führte. Aber wer hatte schon wirklich den Mut dazu? Und er hätte ihn auch nicht aufgebracht, wenn er damals irgendeine Alternative gesehen hätte. Aber er hatte keine Wahl gehabt, und so waren Leute wie Buzual in sein Portfolio gerutscht. Und über einen dieser schmutzigen Aufträge war es ihm endlich gelungen, Kontakte zu SVG-Consulting zu knüpfen, einer renommierten internationalen Beratergesellschaft. Bald darauf wurde das Büro in Genf vergrößert, und er bekam die Chance einzusteigen. Inzwischen war er Partner, und SVG-Consulting hatte zwei große Konkurrenz-Agenturen geschluckt. Leuten wie Buzual würde er heutzutage auf eine Anfrage nicht einmal antworten. Aber jetzt saß er hier und hatte gar keine Wahl. Ragna war also in Rangoon, hatte vermutlich eine Beziehung zu einem von Interpol gesuchten Umweltterroristen und war zu allem Überfluss ins Visier dieser spanischen Fischpiraten geraten. Ein schöner Schlamassel.
Er blickte verstohlen zu Ibai, aber der beachtete ihn gar nicht, sondern wischte auf seinem Smartphone herum. Buzuals Telefongespräch dauerte offenbar länger. Di Melo stand auf und trat ans Fenster. Es begann dunkel zu werden. Unter dem düsteren Himmel lag tiefschwarz der Atlantik, und ungefähr auf halber Strecke zwischen ihm und den dunklen Wassermassen markierten Lichtpunkte den Saum der galizischen Küste. Buzuals Villa lag an einem Hang, und bei schönem Wetter konnte man von hier aus wahrscheinlich die der Bucht von Vigo vorgelagerten Inseln sehen. Immerhin eine schöne Gegend für eine üble Nachricht. Er musterte sein Gesicht, das sich im Fensterglas spiegelte und ihm zu sagen schien: Lass es einfach gut sein. Du kannst nichts für sie tun. Sie hat sich vor langer Zeit entschieden. Nichts zu machen. Ihr ist nicht zu helfen.
Die Welt war nun mal, wie sie war. Niemand konnte sie ändern. Auch nicht seine Tochter und ihr Seewolf. Die einzige Frage war, wo und wie man sich darin positionierte. Nur Verrückte trieben sich auch noch freiwillig dort herum, wo sich die tektonischen Platten großer globaler Interessensphären aneinanderrieben.
Buzual kam zurück und nahm wieder am Tisch Platz. Di Melo setzte sich ebenfalls. Ibai legte sein Smartphone weg und verschränkte die Arme. Sein Vater trank einen Schluck Wasser. Di Melo sah, wie Buzuals Schläfen pochten. Die Haut war über seinen Schädel gespannt wie Leder über eine Kugel, gegerbt von vielen Jahren auf See. Auch seine Hände sahen schlimm aus, von Leberflecken übersät und von weißen Flächen durchzogen, wo die Pigmente verschwunden waren und rosige Haut durchschimmerte. Säuglingshaut, dachte Di Melo überflüssigerweise. Als häute sich der Greis in der Hoffnung, die Zeit zurückdrehen zu können.
»Was kann ein Vater schon tun«, sagte Buzual mit einem Seitenblick auf seinen Sohn, »wenn die Kinder nicht gehorchen wollen, nicht wahr, Alessandro? Ibai, erzähle uns jetzt bitte einmal, was am Sonntag auf der Valladolid passiert ist. Damit Alessandro ein klares Bild von der Geschichte bekommt.«
Ibai räusperte sich, was an seiner rauhen, kratzigen Stimme jedoch nicht viel änderte.
»Brüssel schickt uns ja immer diese verfluchten Beobachter. Diesmal war es eine Portugiesin. Ganz hübsch, aber extrem neugierig. War ein schlechter Zeitpunkt. Wir kreuzten. Zulieferschiff war schon in der Nähe. Wegen der Lady konnten wir also nicht umladen.«
»Was hat man euch geliefert?«, unterbrach Di Melo.
»Fisch natürlich.«
»Was für Fisch? Immer noch Arktisdorsch? Oder habt ihr etwas Neues gefunden?«
»Spielt das eine Rolle?«, mischte sich Buzual senior in das Gespräch ein. »Guter, nahrhafter Fisch für Europa eben, den es hier nicht mehr gibt und der in jedem Fall von irgendjemand gefangen wird.«
»Wer beliefert euch?«
»Alessandro, das ist nicht unser Thema. Ibai. Weiter.«
Di Melo verstummte widerstrebend. Ibai fuhr fort.
»Sie war anders als die üblichen Beobachter. Merkte gleich, dass wir zu wenig Fisch im Eis hatten. Mit unserer Ausrüstung so wenig zu fangen hat bei ihr gleich Warnlampen angehen lassen. Entsprechend hat sie herumgeschnüffelt. Wollte Fangbücher sehen und so. Hatte auch ihren Computer die ganze Zeit bei sich. Und immer eine Gürteltasche mit irgendwelchen Analyseinstrumenten. Trug das alles ständig mit sich herum. Sogar beim Essen.«
Di Melo sagte nichts, sondern zog nur skeptisch die Mundwinkel nach unten und zuckte mit den Achseln.
»Ich habe einen Riecher für so was«, fuhr Ibai fort, »blieb ihr also die ganze Zeit über auf den Fersen. In den Kühlräumen habe ich sie dann erwischt. Sie dachte, sie wäre allein, hantierte mit irgendetwas herum, injizierte eine Flüssigkeit in die Fische, und manche besprühte sie auch.«
»Proben«, wandte Di Melo ein, »sie wird Proben gezogen haben. Was denn sonst? Fischereibeobachter ziehen ständig Proben.«
»Nein«, blaffte Ibai ihn an. »Meinst du vielleicht, ich weiß nicht, wie die normalerweise arbeiten?«
»Okay, okay«, ging Buzual Senior dazwischen. Ibai murmelte einen unhörbaren Fluch in sich hinein. Di Melo verkniff sich eine weitere Bemerkung.
»Weiter«, befahl Buzual.
»Habe sie mir natürlich gleich vorgeknöpft. Sie ließ ihre Spritzen und Fläschchen sofort verschwinden, faselte etwas von Hygienetests und wollte den Kühlraum verlassen. Ich stelle mich ihr in den Weg, sie stößt mich zur Seite, und wie eine Katze war sie die Treppe hinauf. Ich hinterher. Aber sie war ziemlich schnell. Sie warf etwas über Bord, dann verschwand sie unter Deck und verbarrikadierte sich in ihrer Kabine. Schrie dann herum, durch die geschlossene Tür, ich solle sie in Ruhe lassen, sonst würde sie mich augenblicklich bei den Behörden melden. Hatte wohl auf einmal Angst. Na ja, wird schon wieder herauskommen, dachte ich.«
Ibai machte eine kurze Pause, bevor er hinzufügte: »Tja, und so kam es dann eben zu diesem Unfall.«
Di Melo blinzelte. »Unfall?«, sagte er leise.
Ibai schaute seinen Vater an, aber der hob nur kurz die Hand zum Zeichen, dass er weiterreden sollte.
»Sie verlangte plötzlich, sofort zum nächsten Hafen gebracht zu werden, und die Hafenpolizei sollte sie vom Schiff eskortieren. Das kam natürlich gar nicht in Frage. Dann schrie sie herum, sie wollte auf die Ariana zurück, wir sollten einen Funkspruch an die Ariana absetzen, damit die sie abholen. Die Sache wurde allmählich richtig unangenehm. Mateo schnauzte mich ständig an, er könne nicht länger warten mit dem Umladen. Die Thais waren schon mächtig nervös und wollten wissen, warum wir nicht zum Treffpunkt kamen.«
»Wer ist Mateo?«
»Der Kapitän«, erklärte der alte Buzual.
»Wir mussten unbedingt erst umladen«, fuhr Ibai fort. »Wir konnten nicht ewig warten. Aber wir hatten ja jetzt keine Gelegenheit mehr, ihr etwas ins Essen zu mischen oder so etwas, denn sie verließ ja ihre verdammte Kabine nicht mehr. Was hatte sie außerdem im Kühlraum getrieben? Mateo befahl schließlich, ihre Tür aufzubrechen und sie in die Messe zu bringen. Wir wollten uns erst einmal in aller Ruhe mit ihr unterhalten.«
Di Melo schluckte. Von Ibai Buzual befragt zu werden, auf hoher See, Tausende Kilometer von jeglicher möglichen Hilfe entfernt, war so ziemlich das Letzte, was er sich wünschen würde.
»Aber sie wurde immer hysterischer. Sie machte einfach den Mund nicht auf. In ihrer Kabine fanden wir nichts, nur Proben, die sie gezogen hatte. Ich fragte sie, was sie ins Wasser geworfen hatte, aber sie schrie nur herum. Wir hatten jetzt also ein doppeltes Problem. Sie arbeitete nicht nur für die Arschlöcher in Brüssel, das war sicher. Wir hatten keine Zeit mehr für lange Diskussionen. Wir mussten sie ruhigstellen, damit wir umladen konnten. Es war Mateos Job, denn ich musste hoch, weil die Thais im Anmarsch waren. Mateo sagte, sie sei plötzlich wie eine Wahnsinnige auf ihn losgegangen, und er hätte sie einfach nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Sie entkam auf Deck, und dort muss sie bei dem schweren Seegang wohl ausgerutscht sein. Oder sie hat in der Dunkelheit und bei dem Regen einfach die Richtung verfehlt. Was weiß denn ich? Von uns hat niemand etwas gesehen. Mateo kam jedenfalls plötzlich auf die Brücke und brüllte herum, sie sei weg. Tja. So war das.«
Di Melo schlug vor Empörung mit der flachen Hand auf den Tisch und starrte Ibai hasserfüllt an. Der lehnte sich zurück und verschränkte die Arme, so dass sich sein muskulöser Oberkörper gut unter seinem schwarzen T-Shirt abzeichnete. Di Melo versuchte, seine Empörung im Zaum zu halten. Ibais Geschichte war so glaubwürdig wie das verlogene Bedauern auf seiner Ganovenvisage. Er sollte aufstehen und sofort den Raum verlassen. Das waren skrupellose Mörder! Er spürte, wie Übelkeit in ihm aufstieg. Warum war er hergekommen? Für solche Leute hatte er gearbeitet? Er schaute auf die Leinwand, auf der soeben noch das Bild seiner Tochter zu sehen gewesen war. Seine Übelkeit nahm noch zu. Er riss sich zusammen und fragte: »Was zum Teufel habe ich damit zu tun?«
Ibai schaute zu seinem Vater, und der alte Mann sprach nun an seiner Stelle:
»Ich bekam die Meldung von diesem Unfall Sonntagnacht. Wir haben sofort recherchiert. Die Frau wohnte in Vigo. Also haben wir uns bei ihr umgesehen, und siehe da …« Er deutete mit der Hand auf die leere Leinwand. »Diese Aufnahmen haben wir in ihrer Wohnung gefunden, auf ihrem PC. Auf ihrem Laptop, den wir inzwischen geknackt haben, gibt es außerdem einen interessanten Schriftwechsel mit einer gewissen Ragna Di Melo.«
Er machte eine kurze Pause, um die Information besser wirken zu lassen. »Weißt du eigentlich, was deine Tochter treibt, Alessandro?«
»Ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr«, antwortete Di Melo, so beherrscht er konnte. »Ich weiß weder, wo sie sich aufhält, noch, was sie tut.«
»Wo genau sie ist, wissen wir leider auch noch nicht.« Buzual machte erneut eine Pause, um der unausgesprochenen Drohung Nachdruck zu verleihen. »Dafür kann ich dir sagen, was sie tut. Bis vor ein paar Jahren hat sie wie dieser Kanadier für Sea Shepherd gearbeitet. Du kennst diese Leute ja, Verrückte, die Fischereiboote rammen und auch nicht davor zurückschrecken, Schiffe in die Luft zu sprengen. Auch zwei hier direkt vor Vigo.«
»Ich habe davon gehört«, erwiderte Di Melo. »Aber das waren Walfänger, und es ist eine ganze Weile her, oder?«
»Fanatiker hören nie auf. Sie werden nur immer radikaler, je aussichtsloser ihre Sache wird. Sea Shepherd hat sich von Greenpeace abgespalten, weil sie deren Aktionen als zu lasch empfanden. Inzwischen scheint es Leute zu geben, denen sogar das Rammen und Versenken von Trawlern nicht ausreicht. Und deine Tochter scheint dabei eine ganz wesentliche Rolle zu spielen. Wir kennen ihre Organisation noch nicht sehr gut. Ja, wir wissen nicht einmal, ob es sich nur um ein paar verirrte Einzelne oder eine gut organisierte Gruppe handelt. Aber eins ist sicher: Die junge Dame, die auf unserem Schiff war, wurde allem Anschein nach von deiner Tochter geschickt.«
»Wie kommst du darauf? Allein die Tatsache, dass sie sich kennen, besagt doch überhaupt nichts. Außerdem weiß ich immer noch nicht, was die Frau auf deinem Schiff denn so Schlimmes getan hat, dass du dir auch noch das Recht herausnimmst, ihre Wohnung zu durchsuchen.«
Buzual warf ihm einen finsteren Blick zu, bevor er weitersprach: »Sie hat unsere Ladung vergiftet, Alessandro. In Madrid sind gestern drei Menschen an einer Fischvergiftung fast gestorben. Fisch, den wir geliefert haben.«
Di Melo hob ungläubig die Augenbrauen. »So«, sagte er nur. »Und das kannst du beweisen?«
Buzual griff in seine Tasche und legte etwas auf den Tisch. Es war eine kleine Ampulle von der Größe einer Parfümprobe, wie man sie manchmal als Werbegeschenk bekam. Buzual tippte sie an, und sie rollte langsam über den Tisch auf Di Melo zu. Er stoppte das Glasröhrchen und nahm es vorsichtig in die Hand. Es war eine Parfümprobe. Jedenfalls stand der Name einer bekannten Marke darauf. Die Flüssigkeit darin war leicht gelblich. Di Melo schaute verständnislos von einem zum anderen.
»Eau de Cologne?«, fragte er.
»Du kannst es ja gern mal ausprobieren«, knurrte Ibai.