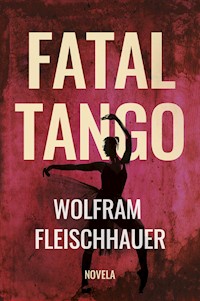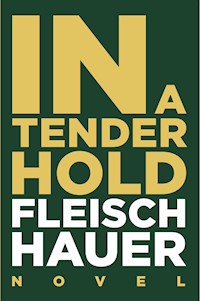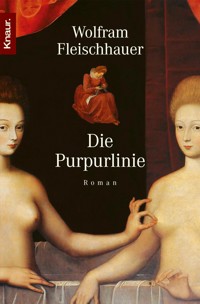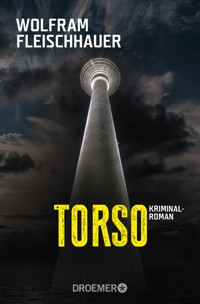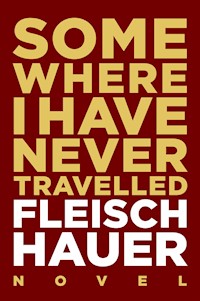6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1780. Revolutionäre Ideen durchziehen das Land. Mystische Zirkel und Geheimbünde bekämpfen sich allerorten.In der fränkischen Grafschaft Alldorf ist es zu merkwürdigen Todesfällen gekommen, und der junge Arzt und Epidemieforscher Nicolai Röschlaub soll bei der Aufklärung helfen. Wenn es ein Gift war, so hinterlässt es keine Spuren. Eine Verschwörung ist denkbar, doch wen hat sie zum Ziel? Begleitet von einer rätselhaften jungen Frau, macht sich Nicolai auf den Weg an die äußersten Grenzen des Reiches - und gleichzeitig ins Innerste seiner Seele. Die Zeit drängt, denn das Geheimnis ist aus dem Stoff, der eine Welt zerstören kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Wolfram Fleischhauer
Das Buch in dem die Welt verschwand
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Deutschland, um 1780. Wenige Jahre vor der Französischen Revolution ist das Deutsche Reich in unzählige Fürstentümer aufgespalten. Aufgeklärte Geister, Sekten und kriminelle Banden liefern sich einen im Verborgenen schwelenden Kampf.
In der fränkischen Grafschaft Alldorf ist es zu merkwürdigen Todesfällen gekommen, und der junge Arzt Nicolai Röschlaub soll bei der Aufklärung helfen. Ist ein bislang unbekanntes Gift im Umlauf? Bahnt sich eine Verschwörung an? Je tiefer Nicolai dringt, desto unheimlicher wird ihm der Fall. Mit der jungen Frau, die er liebt, flieht er an die äußersten Grenzen des Reiches – und macht eine Entdeckung, die seine Vorstellungskraft sprengt …
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
I.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
II.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
III.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Epilog
Vermischte Meldungen aus der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts
Niemand stirbt jetzt an tödlichen Wahrheiten.Es gibt zu viele Gegengifte.
F. Nietzsche
Prolog
Die Geschwindigkeit war atemberaubend!
Nicolai Röschlaub starrte gebannt aus dem Fenster. Häuser und Bäume flogen an ihm vorüber. Der Lärm der Zugmaschine übertönte alle anderen Geräusche. Aber nicht nur die Geräusche, auch die Gerüche, so stellte er fasziniert fest, verschwanden bei dieser neuen Art des Reisens. Mit Ausnahme des Gestanks der im Dampfwagen verbrannten Kohlen.
Verunsichert suchte er einen Punkt, um seine Augen einen Moment lang auszuruhen. Doch das Eisenbahnfahren erforderte offenbar eine Anpassung des Sehapparates. Nur was weit entfernt und fast nur noch in Umrissen erkennbar war, konnte man mit Ruhe betrachten. Versuchte man indessen, die Dinge in nächster Nähe anzuschauen, so war das unmöglich, da sie zu schnell vorüberschossen.
Es ist ungeheuerlich, dachte er. Das Sichtbare war zwar noch da. Aber er konnte es vorübergehend nicht mehr wahrnehmen, denn es raste an ihm vorbei, mit fünfzehn Meilen in der Stunde.
Erschöpft wandte er den Blick von der vorbeirauschenden Welt ab und ließ ihn durch das Passagierabteil schweifen. Er schien der Einzige zu sein, dem die Geschwindigkeit zu schaffen machte. Auch seine Enkelin Theresa, die ihm gegenübersaß, schaute unbeirrt nach draußen und genoss die Aussicht offensichtlich. Ihr Anblick tat ihm wohl. Was für eine Erholung! Er verstand jetzt, warum man ihm geraten hatte, nicht aus dem Fenster zu schauen. Sein Gesicht entspannte sich. Er brauchte nun diese Pause von der schnellen Bewegung.
Nach einer Weile schien Theresa seinen Blick zu spüren. Sie drehte sich zu ihm hin und sagte mit verzücktem Gesichtsausdruck:
»Ist es nicht großartig?«
»Durchaus«, antwortete er, »großartig.«
Dabei krallte er sich unwillkürlich an die Armlehnen der gepolsterten Sitzbank.
Nürnberg verschwand hinter ihnen. In wenigen Minuten würden sie in Fürth ankommen. Seit der Jungfernfahrt der Ludwigsbahn am 7. Dezember 1835 hatte sich die erste Aufregung um die Dampfwagen zwar gelegt, aber auch jetzt, ein drei viertel Jahr später, war es noch immer etwas Besonderes, mit der ersten deutschen Eisenbahn fahren zu dürfen. Die Wagen waren bis auf den letzten Platz gefüllt.
Als man Nicolai Röschlaub für seine Verdienste bei der Bekämpfung der letzten Choleraepidemie eine Reise zur Eisenbahnfahrt von Nürnberg nach Fürth anbot, hatte er zunächst abgelehnt. War er für solch ein Abenteuer nicht zu alt? Und Nürnberg? Es war über fünfzig Jahre her, dass er dort als junger Arzt einige unglückliche Monate verbracht hatte. Aber die Stadt war für ihn auch mit einer Erinnerung verbunden, auf die er heute mit Recht stolz sein konnte: Er hatte dort seine ersten Epidemiekarten gezeichnet. Damals war er belächelt und manchmal sogar angefeindet worden. Heute ehrte man ihn für Ideen, die ihm damals nur Hohn und Spott eingetragen hatten. Doch sollte er wirklich mit seinen fünfundsiebzig Jahren für eine Eisenbahnfahrt von wenigen Meilen durch halb Deutschland reisen?
Die glänzenden Augen seiner Enkelin hatten ihn am Ende bewogen, das Angebot anzunehmen. Das siebzehnjährige Mädchen war ganz aus dem Häuschen gewesen, als sie von der Einladung erfuhr. Wie aufregend! Ihre Begeisterung war auf ihn übergesprungen. Ihretwegen würde er diese Fahrt machen. Und sie sollte ihn begleiten. Ja, er war stolz darauf, dass sie durch ihn das Abenteuer des Fortschritts kennen lernen würde. Die Eisenbahn! Alle sprachen davon. Stand sie nicht für jene Zukunft, für die er sein ganzes Leben gekämpft hatte: die Herrschaft des Menschen über die Kräfte der Natur, den Siegeszug der Vernunft und der Wissenschaft?
Theresa schaute wieder aus dem Fenster und konnte von dem Schauspiel gar nicht genug bekommen. »Sieh nur«, rief sie belustigt, »auf der Chaussee scheuen die Pferde.«
Nicolai zögerte, aber dann blickte er doch wieder nach draußen. Nicht nur die Pferde scheuten. Auch die kleinen Kinder weinten vor Schreck angesichts des vorbeirauschenden Dampfwagens, während die Mütter und Väter den Reisenden zuwinkten.
»Warum weinen sie denn?«, fragte Theresa mit vor Aufregung geröteten Wangen.
»Das Getöse der Lokomotive erschreckt sie«, rief Nicolai. »Sie haben Angst.«
Theresa winkte den Schaulustigen zu. Dann legte sie die Hände an den Mund, formte einen Trichter und rief laut: »Habt keine Angst. Alles wird gut. Wir fahren in eine neue Welt!«
Die Passanten konnten sie natürlich durch den Lärm der Zugmaschine hindurch nicht hören, aber einige junge Männer warfen trotzdem wie zur Bestätigung ihre Hüte hoch. Die kleinen Kinder weinten unbeirrt weiter.
Theresa strahlte ihren Großvater an. Doch dessen Gesichtsausdruck hatte sich plötzlich verändert.
»Was ist mit dir?«, fragte sie besorgt. »Ist dir nicht gut?«
»Nein, nein. Alles in Ordnung«, beruhigte er sie. »Ich muss mich nur an diese Geschwindigkeit gewöhnen.«
Er erhob sich kurz und setzte sich wieder.
Wir fahren in eine neue Welt.
Der Satz hatte ein unheimliches Echo in ihm ausgelöst. Er hörte eine Stimme. Wie lange war es her, dass er diese Stimme nicht mehr vernommen hatte? Und jetzt war sie wieder da, als wäre das alles erst gestern gewesen.
Nicolai, es ist zu mächtig für uns. Du musst nein sagen.
Er schloss die Augen, aber es half nichts. Die Worte klangen noch immer in ihm nach.
Es verspiegelt den Himmel und führt uns in den Wahnsinn.
Unwillkürlich öffnete er die Augen wieder und schaute in den Himmel hinauf. Auch diese Perspektive hatte sich verändert. Ja, recht besehen hatte sie sich erübrigt; die Reisestrecke war ja festgelegt, und das Wetter konnte einem Dampfwagen, der auf Eisenschienen dahinrollte, nichts anhaben. Aber der Anblick des blauen Himmels, in dem einige weiße Wolken schwebten, war ihm immerhin noch vertraut. Es war das Panorama vor dem Fenster, das ihm nicht so ganz geheuer war.
Er mochte diesen Blick nicht. Aus einer Postkutsche heraus konnte man sowohl den Horizont als auch einzelne Gräser und sogar die Steine direkt vor sich auf dem Boden erkennen. Die Welt stand still, während man sich durch sie fortbewegte. Hier war es jedoch umgekehrt. Obwohl er es besser wusste, hatte er das Gefühl, als stehe in dieser Maschine er selbst still, als sei er ein Teil von ihr geworden und nicht mehr ein Teil der Welt, die an ihm vorbeiraste. Es gab nur noch Nürnberg und Fürth, Abfahrt und Ankunft. Doch was war mit dem Raum dazwischen geschehen? Er war noch da, er konnte ihn ja sehen. Aber zugleich war er anders geworden. Es war kein Raum mehr, sondern ein Zwischenraum. Man befand sich … im Nirgendwo.
Nicolai, bitte komm mit mir. Es ist die einzige Möglichkeit für uns beide, in der gleichen Welt zu bleiben.
Theresa plauderte aufgeregt los. Was sie nach der Rückfahrt in Nürnberg noch alles unternehmen könnten. Es sei unglaublich. An einem Tag konnte man von Nürnberg nach Fürth und wieder zurück fahren.
»Weißt du, dass man sagt, es werde schon bald eine Bahn nach München geben?«, fuhr sie fort. »Die Strecke, die jetzt achtundvierzig Stunden dauert, ist dann in nur sechs Stunden zu schaffen. Sechs Stunden! Wenn man die Strecke zweimal fährt, so hat man sechs Tage des Lebens gewonnen.«
Nicolai nickte, aber er hörte nur unaufmerksam zu. Er hätte doch nicht in diese Gegend zurückkehren sollen, dachte er. Zu viele Erinnerungen waren damit verbunden.
Aber nach einer Weile wurde ihm klar, dass sein Stimmungswandel nicht allein mit der Gegend zusammenhing. Und es war auch nicht nur Theresas Reaktion auf diese Eisenbahnfahrt, die ihn verstörte. Er griff in seine Jackentasche und befühlte das Buch, das er vor einigen Wochen zu lesen begonnen hatte. Das Buch dieses verfemten jungen deutschen Dichters, der in Paris lebte. Die Lektüre hatte ihn auf gespenstische Weise berührt. Ja, war es am Ende vielleicht sogar dieses Buch gewesen, das ihn bewogen hatte, die weite Reise zu unternehmen, um ihre Welt noch einmal zu sehen?
Hörte er nicht seit Wochen ihre geliebte Stimme? Magdalenas Stimme.
Ich habe dich nicht belogen, Nicolai. Und ich habe dich nicht getäuscht. Aber konnte ich dir vertrauen?
Warum nicht?, flüsterte er lautlos. Warum?
Ich wollte es ja, aber hättest du mich verstanden? Ich habe dir meinen Körper geschenkt …
Sein Herz zog sich zusammen. Nein, er ertrug diese Erinnerung nicht. Nicht hier. Nicht so. Aber eine Tür hatte sich geöffnet. Lautlos. Still. Unweigerlich. Nach so vielen Jahren.
»Wir fahren morgen noch nicht zurück nach Hamburg«, sagte er Theresa am Abend.
»Bleiben wir noch einen Tag in Nürnberg?«, erwiderte sie aufgeregt.
»Nein. Wir fahren aufs Land. Ich möchte jemanden besuchen.«
»Hast du hier Freunde?«, fragte sie verwundert.
»Nein. Aber hier in der Nähe lebt jemand, den ich lange nicht gesehen habe. Und ich denke, dass ich so bald nicht wieder in diese Gegend kommen werde. Kannst du reiten?«
»Reiten?«
Theresa, so stellte sich bald heraus, konnte es nicht. Ein Versuch am nächsten Morgen, das Mädchen auf ein Pferd zu setzen, scheiterte. Sie hatte zu große Angst, und das Tier schien das zu spüren.
Sie setzt sich in einen Dampfwagen, dachte Nicolai irritiert, in eine Maschine, von der sie nichts begreift und die hundertmal mehr Kraft hat als dieses Pferd. Doch ein Pferd macht ihr Angst?
»Sie können auch bis Wolkersdorf den Postwagen nehmen und dann die restliche Strecke zu Fuß gehen«, schlug der Stallmeister vor.
Nicolai warf einen unsicheren Seitenblick auf seine Enkelin, die von diesem unvorhergesehenen Ausflug sichtlich nichts hielt.
»Müssen wir denn aufs Land fahren?«, rief Theresa enttäuscht aus. »Und auch noch im Postwagen? Wie langweilig und mühsam. Wir haben doch noch den ganzen Rückweg nach Hamburg vor uns.«
»Die Gegend hier ist sehr hübsch, gnädiges Fräulein«, versuchte der Stallmeister sie zu trösten. »Vor allem jetzt im Herbst.«
»Wir nehmen Extrapost«, schloss Nicolai.
»Aber wohin fahren wir denn überhaupt?«, fragte Theresa unwillig.
»Lass dich überraschen.«
Nicolai hätte nicht geglaubt, dass die Fahrt nach Wolkersdorf ihn in einen derartigen inneren Aufruhr versetzen würde. Je näher sie dem Städtchen kamen, desto lebhafter stiegen die Erinnerungen an die seltsamen Vorfälle und Erlebnisse des Jahres 1780 in ihm auf. Wie konnte es sein, dass er so lange nicht mehr daran gedacht hatte? Er musterte neugierig die Umgebung und erkannte bald, dass sie gleich an Schloss Alldorf vorbeikommen mussten. Doch als er das zerfallene Gemäuer des nun seit vielen Jahren verlassenen Schlosses in der Ferne erblickte, war es ein Schock für ihn. Seine Augen wurden starr, sein Herzschlag stockte, und seine Hand griff unwillkürlich nach dem von der Herbstsonne gewärmten Klingelseil. Das Schloss lag wie zerborsten auf dem Hügel. Hatten französische Revolutionstruppen es geschleift? Oder war es einfach jahrzehntelang als Steinbruch genutzt worden? Am liebsten wäre er sogleich auf den Hügel hinaufspaziert, doch im letzten Moment hielt er inne und gab kein Signal zum Anhalten. Nein. Es hatte keinen Sinn, an diesen Ort zurückzukehren. Einen Menschen wollte er noch einmal sehen. Das schon. Aber nicht die Ruinen einer verschwundenen Welt. Was vergangen war, war vergangen. Aber war es dann überhaupt eine gute Idee gewesen, diese Fahrt zu machen?
»Warum starrst du diese Ruine so an?«, fragte Theresa.
»Wie bitte?«, erwiderte er gereizt. »Ich starre gar nichts an.«
Was Theresa über die unerwartete Änderung der Reisepläne dachte, stand ihr ins Gesicht geschrieben. Sie langweilte sich sichtlich. Das unregelmäßige Geruckel der Kutsche gestattete es nicht, zu lesen, und was draußen vor dem Fenster zu sehen war, nahm sie nicht lange gefangen. Auch als sie von Wolkersdorf zu Fuß weitergingen, hob sich ihre Stimmung nicht merklich.
Sie brauchten etwas mehr als eine Stunde, bis sie das Kloster erreicht hatten. Eine Ringmauer, an der Weinranken emporwuchsen, umschloss das Anwesen.
»Wohin gehen wird denn nur?«, fragte Theresa jetzt hartnäckig.
»Wir besuchen jemanden«, erwiderte Nicolai kurz.
»In einem Kloster?«
Er nickte. Sie schritten durch eine geöffnete Pforte und gelangten über einen Kiesweg an die Eingangstür. Nicolai klopfte. Nach einer Weile hörten sie Schritte. Die Tür öffnete sich, und eine Schwester erschien.
»Ja bitte?«, fragte sie.
Nicolai nahm seinen Hut ab. Es war zwar schon seit einigen Jahren nicht mehr Mode, eine Perücke zu tragen, aber die Nonne war offenbar dennoch ein wenig unangenehm berührt, ein entblößtes Haupt zu sehen.
»Sie wünschen?«, fragte sie freundlich.
»Mein Name ist Röschlaub. Nicolai Röschlaub. Das ist meine Enkelin. Ihr Name ist Theresa.«
Theresa machte einen Knicks.
»Ich suche eine Bewohnerin Ihres Stifts«, fuhr Nicolai fort. »Ihr Taufname ist Magdalena. Magdalena Lahner.«
»Sie lebt hier, ja«, antwortete die Frau, nun schon etwas weniger freundlich.
»Könnte ich sie sehen?«
»Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird.«
Die Schwester trat jedoch zur Seite und ließ sie eintreten. Dann schloss sie die Tür, verbeugte sich kurz und fügte hinzu: »Bitte warten Sie hier.«
Nicolai nickte. Sein Blick fiel auf einen Kalender neben der Eingangstür. Warten! Was für ein kleines Wort, unpassend für diesen Augenblick. Jetzt, da er hier stand, wusste er plötzlich, dass er eigentlich ein halbes Jahrhundert auf diesen Moment gewartet hatte. Ein halbes Jahrhundert? Fast sein ganzes Leben. Theresa war völlig perplex.
»Was tun wir hier?«, flüsterte sie, offenbar durch die ihr völlig fremde Umgebung verunsichert. »Wer ist diese Frau?«
Aber Nicolai antwortete nicht. Seine Kehle war auf einmal wie zugeschnürt. Sie war am Leben! Hier, irgendwo hinter diesen Mauern. Warum nur war er nicht früher gekommen? Er hatte doch schon vor vielen Jahren erfahren, dass sie sich hierher zurückgezogen hatte. Warum hatte er bist jetzt gewartet? Er hatte so oft an sie gedacht. Und nun durfte er möglicherweise nicht einmal zu ihr. Aber warum? War sie krank?
Er wollte nicht, dass Theresa seine Ergriffenheit bemerkte und ging daher ein paar Schritte in die Empfangshalle hinein bis zu einem Fenster. Von hier aus hatte man einen schönen Blick auf den Klostergarten. Eine Kastanie stand dort in der Abendsonne, das Herbstlaub in ihrer Krone gelbrot entflammt. Ein kleiner Brunnen in der Mitte des Gartens plätscherte vor sich hin. Sonst war nichts zu hören.
Ihr Gesicht. Ihre Lippen. Die Art und Weise, wie sie damals den Kopf gesenkt, ihre Hände betrachtet hatte. Das hatte er nie vergessen. Die riesenhafte Stille. Das verschwommene Bild einer schmutzigen Gasse zwischen krummen, eng stehenden Häusern unter einem grauen Himmel.
Als er sich wieder umdrehte, sah er eine andere Ordensfrau auf sich zukommen. Ihr Ornat war ebenso einfach wie das der Schwester, die ihnen geöffnet hatte. Die Art und Weise jedoch, wie sie auf ihn zuschritt, sowie ihr Gesichtsausdruck kündeten von einer Autorität und Würde, die auch ein prächtigeres Gewand nicht besser hätte zum Ausdruck bringen können.
Sie kam vor ihm zum Stehen, verbeugte sich leicht und sagte: »Herr Röschlaub?«
Nicolai nickte und winkte zugleich Theresa herbei, die noch immer misstrauisch am Eingang stand. »Das ist meine Enkelin.«
Die Schwester begrüßte das Mädchen. »Ich bin Schwester Rachel. Was kann ich für Sie tun?«
Nicolai spielte nervös mit seinem Hut. »In Ihrem Kloster wohnt jemand, der mir sehr viel bedeutet«, begann er unsicher. »Ihr Name ist Magdalena. Magdalena Lahner.«
Die Frau schaute ihn erstaunt an.
»Sie lebt doch hier, nicht wahr?«, fügte er hinzu.
»Ja. Und?«
Sonst sagte sie nichts, als erübrige sich jeder weitere Kommentar.
»Geht es ihr gut?«, fragte Nicolai. Er war jetzt selbst ein wenig verwundert über seine Frage. Aber es war das Erste, was ihm in den Sinn kam.
»Ja. Es geht ihr gut. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ein Familienangehöriger?«
»Nein, nein«, erwiderte er. »Nein. Das nicht. Ich bin ein Freund. Nichts weiter. Ein Freund.«
Er spürte Theresas Hand auf seinem Arm. Die Geste war gut gemeint, aber sie störte ihn dennoch. Er schaute sie kurz an, und sie zog ihre Hand wieder zurück.
Nach einer kurzen, peinlichen Pause sagte er: »Ich möchte fragen, ob ich sie sprechen kann?«
»Sprechen?«, fragte die Frau und schaute ihn an, als habe er den Verstand verloren. Dann schüttelte sie kurz den Kopf.
»Ich fürchte, das geht nicht, mein Herr. Schwester Magdalena spricht nicht. Mit niemandem.«
Nicolai schaute verlegen zu Boden.
»Ah ja«, sagte er dann. »Das … das wusste ich nicht. Darf ich fragen, wie lange sie schon bei Ihnen ist?«
Die Frau runzelte die Stirn. Dann antwortete sie: »Sie sollten lieber fragen, wie lange ich schon bei ihr bin. Aber ich darf Ihnen leider keine Auskunft geben. Wir empfangen hier nur Familienangehörige. Daher muss ich Sie bitten, zu gehen.«
»Natürlich«, sagte Nicolai enttäuscht. »Ich weiß, dass ich eigentlich kein Recht habe, hier zu sein. Es ist nur … ich habe nur diesen einen Wunsch gehabt, verstehen Sie.«
Die Art und Weise, wie er das gesagt hatte, musste einen gewissen Eindruck auf die Ordensschwester gemacht haben. Sie schaute ihn an. Auf ihrem Gesicht wechselten Skepsis und Verwunderung einander ab. Theresa wusste überhaupt nicht, wohin sie schauen sollte. Wie peinlich war diese Situation. Was taten sie denn bloß hier? Was war mit ihrem Großvater los?
»Woher kommen Sie?«, fragte die Schwester jetzt.
»Aus Hamburg.«
»Das sind viele Tagesreisen von hier. Hatten Sie in der Nähe zu tun?«
Er schaute zu Boden. Die Enttäuschung war nun doch größer, als er sich eingestanden hätte.
»Schwester Rachel, Sie werden das wahrscheinlich nicht begreifen, aber ich suche Magdalena seit vielen Jahren. Doch ich habe … ich habe nie den Mut aufgebracht, herzukommen.«
Die Frau musste lächeln. Doch dann wurde sie wieder ernst und sagte: »Sie können nicht zu ihr. Niemand kann es. Sie lebt wie alle Silentisten in völliger Stille. Selbst wenn Sie ihr gegenübertreten würden, so würde es Ihnen nichts nützen.«
»Ich suche keinen Nutzen«, erwiderte er nach einer Pause. Seine Stimme war belegt. »Ich habe nur den Wunsch, sie noch einmal zu sehen.«
»Das ist nicht möglich.«
Nicolai nickte resigniert. Er stand unschlüssig da. Sein Kopf war leer, und er wusste nicht, was er noch sagen sollte. Aber er konnte doch nicht einfach weggehen.
Theresa griff ihn erneut am Arm, und diesmal ließ er es geschehen. Doch bevor er sich zum Gehen wandte, fragte er: »Wird sie … erfahren, dass ich hier war und nach ihr gefragt habe?«
Die Schwester sagte erst nichts. Dann nickte sie kurz.
»Und falls sie mich sehen wollte, könnte sie das dann verlangen?«
Eine noch längere Pause trat ein. Dann nickte die Schwester erneut. »Ja. Aber das ist sehr unwahrscheinlich.«
Nicolai spielte nervös mit seinem Hut. Schließlich reichte er der Schwester die Hand. »Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.«
»Ich begleite Sie hinaus.«
Sie gingen den Kiesweg hinab auf das Tor zu. Eine milde Herbstsonne beschien die ockerfarbenen Steine der umlaufenden Mauern.
»Wohin werden Sie jetzt gehen?«, fragte die Schwester, als sie das Tor erreicht hatten.
Theresa kam ihm zuvor. »Nach Wolkersdorf«, antwortete sie schnell. »Wir müssen heute noch zurück nach Nürnberg.«
Nicolai warf ihr einen gereizten Blick zu und erwiderte: »Wir werden in Wolkersdorf übernachten und morgen noch einmal vorsprechen. Das werden Sie mir doch nicht abschlagen, oder?«
Eine lange, unangenehme Pause entstand. Theresa schaute schamrot zu Boden. Nicolai ärgerte sich über sie. Aber dann besann er sich. Das Mädchen wusste ja von nichts. Sie hatte sich auf eine aufregende Zugfahrt und die eleganten Geschäfte von Nürnberg gefreut. Sie spürte nicht, was geschehen war. Und er, wie hätte er es ihr sagen sollen?
»Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Dinge morgen anders liegen werden als heute«, erwiderte die Schwester schließlich. »Sie können gerne noch einmal wiederkommen, bevor Sie die Rückreise antreten. Versprechen Sie sich aber nichts davon.«
»Ich danke Ihnen«, sagte er. »Sie sind sehr freundlich.«
Bald war das Kloster wieder hinter einer dichten Baumreihe verschwunden. Sie spazierten den Feldweg nach Wolkersdorf entlang. Theresa war zugleich enttäuscht und bedrückt. So kannte sie ihren liebevollen Großvater überhaupt nicht. Was war nur in ihn gefahren? Er wollte hier übernachten und morgen noch einmal in dieses Kloster gehen? Aber nach dem Vorfall von eben wusste sie nicht mehr, wie sie ihn ansprechen sollte.
Nicolai wurde immer schweigsamer. Auch am Abend, als sie in ihrer Herberge das Abendessen zu sich nahmen, sprach er nur das Notwendigste und war froh, als Theresa sich schon bald zur Nachtruhe in ihr Zimmer begab.
Er hatte ein unstillbares Bedürfnis, allein zu sein.
Würde sie ihn morgen empfangen? Wie sollte er ihr gegenübertreten? Und warum, warum nur hatte er so lange gewartet?
Er blieb den ganzen Abend in der Stube sitzen. Die Wirtsleute hatten nichts dagegen, dass er es sich am Feuer bequem machte. Er könne gerne die ganze Nacht dort sitzen und lesen, scherzte der Wirt. Holz sei jedenfalls genug da.
Eine Weile lang hörte er noch ihre Schritte auf der Treppe. Dann war alles still. Das Feuer knackte.
Das Buch des verfemten Dichters lag auf seinem Schoß. Er schlug es auf und überflog die ersten Zeilen des Absatzes, den er zuletzt gelesen hatte. Ein eigentümliches Grauen, eine geheimnisvolle Pietät erlaubt uns heute nicht, weiterzuschreiben. Unsere Brust ist voll von entsetzlichem Mitleid – …
Nicolai starrte in die Flammen.
Mitleid.
Das Licht der Vernunft.
Das Licht der Gnade.
Theresas Stimme war in seinem Kopf.
Habt keine Angst.
Habt keine Angst …
I.
1.
Das große Katzensterben des Jahres 1780 versöhnte ihn ein wenig mit seinem Schicksal. Nicolai Röschlaub hatte die frühen Morgenstunden vor seinem langen Arbeitstag genutzt. Auf seinem Tisch lagen Dutzende von wirren Skizzen, große Pergamentblätter mit Strichen, Kreisen und Ellipsen, über die eine Vielzahl von winzigen Punkten gestreut war, die er geduldig mit Tinte und Federkiel verzeichnet hatte. Manchmal hob er den Kopf. Dabei fiel sein Blick auf eine Staffelei, auf der eine große Landkarte des fränkischen Kreises auf einen Rahmen gespannt war. Daneben, hinter dem grünlichen Glas des Dachstubenfensters, konnte man in der Ferne, über verschneiten Dächern, die Spitze der Kirche Sankt Sebaldi aufragen sehen. Aber Nicolai nahm von Nürnbergs ältestem Gotteshaus keine Notiz. Und auch die Stadt war ihm völlig gleichgültig. Es war die Wahrheit vor ihm auf dem Papier, die sein Herz schneller schlagen ließ, nicht der Klang der Morgenglocken, die ihm meldeten, dass er bald aufbrechen musste. Eine sonderbare Wahrheit, die sich in unerklärlichen und doch geheimnisvoll sich wiederholenden Mustern offenbarte. Er würde sich hüten, seine Erkenntnisse noch einmal öffentlich zu verbreiten. Aber diesen heimlichen Triumph konnte ihm niemand streitig machen. Kein Pfaffe, kein Fürst, und erst recht kein neidischer Hofphysikus.
Das Katzensterben! Selbst die betagtesten Bauern hatten dergleichen noch nicht erlebt. Seit April waren die Tiere in großer Zahl verendet. Im Sommer war die Sache plötzlich vorüber. Niemand hatte eine Erklärung dafür gehabt. Elektrizität, meinten manche unter Verweis auf ein jüngst entdecktes physikalisches Phänomen, von dem keiner so recht wusste, was sich eigentlich dahinter verbarg. Katzen seien empfindlicher als Menschen, hieß es, und daher unsichtbaren Energieladungen stärker ausgesetzt. Doch wenn dem so war, warum waren dann nicht schon früher Katzen gestorben?
Die Beschäftigung mit dieser unbekannten Krankheit hatte Nicolai allmählich aus seiner monatelangen Melancholie gerissen. Er hatte aufgehört, darüber nachzugrübeln, was an seinen Beobachtungen für die Welt so gefährlich sein sollte, und sich stattdessen wieder seinen Studien gewidmet. Etwas mehr als ein Jahr war es jetzt her, dass er das erste Mal öffentlich dargelegt hatte, wie sich ihm die Phänomene der Natur so ganz anders ordneten, als es in den Büchern stand. Das war ihm übel bekommen. Jetzt saß er hier in diesem finsteren Winkel Deutschlands, abgeschnitten von jeglichem Verkehr mit gebildeten Menschen, und konnte froh sein, als Adjutant von Stadtphysikus Müller ein kümmerliches Auskommen zu fristen. Hier wusste niemand etwas von den Ideen des Lizenziaten Nicolai Röschlaub, die ihn vor gut einem Jahr im Fuldischen die Existenz gekostet hatten, und er verspürte gegenwärtig wenig Neigung, in irgendeiner Weise aufzufallen.
Doch dieses Katzensterben hatte ihn nicht ruhen lassen. Das ganze Frühjahr und einen Gutteil des Sommers über hatte er, sobald die Zeit es zuließ, die Fälle beobachtet und verzeichnet. Er konnte einfach nicht anders. Er spürte regelrecht, dass die Natur ihm etwas mitzuteilen hatte und dafür eben eine Sprache wählte, die er erst noch lernen musste. Jede Meldung, deren er habhaft werden konnte, verzeichnete er. Manche der verendeten Tiere zergliederte er auch, aber er fand stets das gleiche unschlüssige Bild: eine Anfüllung des Leibes mit einer faulen, schwarzen, übel riechenden Flüssigkeit, durchsetzt von einer dunklen Materie. »Wie Fahrwegskot«, notierte er in seinem Arbeitsjournal.
Die Arbeit tröstete ihn über die Erniedrigung des Vorjahres hinweg, die er noch immer nicht ganz verdaut hatte.
Er war damals gerade erst von der Universität Würzburg examiniert worden und nun Lizenziat der Medizin. Zur Promotion, die im Wesentlichen darin bestanden hätte, die gesamte Fakultät drei Tage lang auf seine Kosten zechen zu lassen, hatte ihm das Geld gefehlt. So war er ohne einen richtigen Titel und auch auf Drängen seines Vaters, der seine Hilfe in der Apotheke brauchte, nach Fulda zurückgekehrt.
Als er zu Hause eintraf, hatte das Fieber schon einige Wochen gewütet. Panik machte sich breit. Keiner wusste, wie man der Krankheit begegnen sollte. Wenn man die Toten aufschnitt, fand man faules, stinkendes Wasser und einige Pfund Eiter. Die noch lebendigen Opfer erbrachen eine schwarze Masse. Als kein Mittel half, griff Panik um sich. Aus Angst vor einem giftigen Miasma, das offenbar durch den Kreis zog und sie alle hinwegraffen würde, weigerten sich die Bauern ausgerechnet zur Erntezeit, ihre Häuser zu verlassen. Der Fürst hatte schon Soldaten aufgestellt, um die Bauern aus den Häusern auf die Felder treiben zu lassen. Aber selbst die Soldaten hatten Angst. Schließlich hatte der Fürst einige Vertreter der Stadt und des Ärztestandes geladen, um über die Situation zu beraten. Nicolai bat darum, an der Besprechung teilnehmen zu dürfen. Zu seinem Unglück wurde ihm das gewährt.
Er hielt inne und betrachtete versonnen die Punkte vor sich auf dem Papier. Diese Muster übten eine ungeheure Faszination auf ihn aus. War es ein Zufall, dass sie sich manchmal so ähnelten und manchmal nicht? Hatte jede Krankheit ein Eigenleben? Auch wenn ihm schleierhaft war, wodurch sie alle ausgelöst wurden, so hinterließ doch die Art der Verbreitung der Fälle ein untrügliches Zeichen, dass diese Krankheiten, die er über die Jahre erfasst hatte, unterschiedlicher Natur sein mussten. Das hatte er damals auch in Fulda beobachtet. Aber hätte er doch nur den Mund gehalten.
Der Stadtphysikus hatte berichtet, wie das Fieber bisher verlaufen war, und erläutert, was man dagegen unternommen hatte. Die nachfolgende Diskussion hatte Nicolai an die Vorlesungen in Würzburg erinnert, an das endlose Aufzählen von unterschiedlichen inneren Flüssen und Stockungen, von Blitzschlag, Gewitter und Winden, von Sünde und moralischem Verfall, welche ebenfalls für das Fieber verantwortlich sein könnten. Vorsichtshalber hatte man einige Kanonenschüsse in die Luft abgegeben, um atmosphärische Gifte zu zerstreuen. Doch am Ende setzte sich die Kaffeetheorie durch. Da die meisten Opfer kaffeesatzartigen schwarzen Schleim erbrochen hatten, war man schon vor einigen Wochen zu der Überzeugung gelangt, dass Kaffeegenuss das Fieber ausgelöst haben musste. Daher waren alle Lieferungen vernichtet und die Kaffeehäuser geschlossen worden. Die Ursache sei also längst beseitigt und es gebe keinen Grund, nicht aufs Feld zu gehen.
Es folgten Auseinandersetzungen über die beste Behandlung der bereits Erkrankten. Manche plädierten für Tee, weil Tee das natürliche Antidot zu Kaffee sei. Andere widersprachen. Einigkeit bestand indessen über fortgesetztes Aderlassen und Schröpfen. Die Vertreter der Kirche gaben zu bedenken, dass, da es sich um eine üble Seuche handelte, die gottlosen Juden verantwortlich sein müssten. Der Beweis dafür sei, dass sie schließlich den Kaffeehandel betrieben. Man empfehle daher, einige ihrer Güter zu kassieren und zusätzliche Messen zu lesen. Das sei gottgefällig und außerdem geeignet, die Ernteverluste auszugleichen, die diese verkommene Rasse verschuldet hatte. Der Fürst lauschte missmutig und wandte ein, man habe jetzt genügend Messen gelesen. Die Kaffeehäuser seien seit zwei Monaten geschlossen. Man purgiere und schröpfe seit Wochen ohne Erfolg. Er wolle wissen, wie man die Bauern wieder aufs Feld bekommen könne, denn da verfaule die Ernte.
Und irgendwann war ihm der junge Mann aufgefallen, der da unter den anderen saß, eine billige Perücke trug, die ihn zu jucken schien, aufmerksam lauschte, sich an keinem Disput beteiligte und doch zugleich in seiner ganzen Attitüde einen gewissen Hochmut an den Tag legte, der den Fürsten reizte.
»Und er dort«, fuhr er ihn an, »was hat er uns zu diesem Übel zu sagen?«
Nicolai erstarrte und schaute schamrot zu Boden.
»Das ist nur Lizenziat Röschlaub«, rief jemand dazwischen, »der Sohn von Apotheker Röschlaub.«
»Na und?«, donnerte der Fürst. »Ein Lizenziat hat auch etwas gelernt, oder? Trete er vor und rede er!«
Und dann hatte ihn der leibhaftige Teufel geritten. Wie hatte er es nur wagen können, das gesamte Kollegium so herauszufordern?
»Die Bauern sollten nur in der Mittagshitze aufs Feld gehen«, sagte er schnell. »Und ich würde nicht schröpfen oder zur Ader lassen.«
Es wurde still im Saal.
»So?«, sagte der Fürst interessiert. »Was schlägt er also vor?«
»Die Bauern sollen im Haus bleiben, alles verschließen und ein wenig Schwefel verbrennen. Ernten sollen sie nur von Mittag bis vier Uhr. Ich glaube, die Miasma-Tierchen, die das Fieber bringen, reisen mit den Stechfliegen.«
Jetzt brach Gelächter los. Der Hofphysikus schüttelte amüsiert den Kopf und sagte: »Exzellenz, Lizenziat Röschlaub hat offenbar in Würzburg Theorien der Kontagionisten gelesen, die behaupten, Krankheiten würden durch so genannte animaculi, die leider noch niemand gesehen hat, übertragen. Niemand glaubt daran, außer ihren Erfindern, die sich damit originell machen wollen.«
»Was sind Miasma-Tierchen?«, fragte der Fürst unwirsch.
»Es sind kleine Lebewesen, die den Menschen angreifen und krank machen können«, antwortete Nicolai.
Der Hofphysikus verbeugte sich und fügte hinzu: »Exzellenz, Lizenziat Röschlaub will damit sagen, dass ein niedriger, schmutziger kleiner Wurm von Gott die Gabe erhalten haben soll, Euch in Eurer Macht und Großartigkeit verwunden und dadurch krank machen zu können.«
»Wie dies auch jede giftige Schlange vermag, sofern Euer hochwohlgeborener Fuß auf ihren niedrigen Schwanz treten sollte«, widersprach Nicolai.
Ein Raunen ging durch die Versammlung. Der junge Arzt war gefährlich vorlaut.
»Schlangen können wir jedoch mit unseren Augen sehen«, widersprach der Hofphysikus lächelnd, »was bei den Miasma-Tierchen nicht der Fall ist, nicht wahr, lieber Kollege? Außerdem ist die Schlange ein biblisches Geschöpf.«
Der Fürst schaute missmutig vor sich hin. Nicolai verbeugte sich unsicher und setzte sich wieder. Was fiel ihm eigentlich ein, sich mit dem Hofphysikus anzulegen?
»Wer hat ihm erlaubt, sich wieder zu setzen«, fuhr der Fürst ihn jetzt an. Nicolai erhob sich augenblicklich wieder und spürte jetzt alle Blicke auf sich.
»Wo leben diese Miasma-Tierchen?«, fragte der Landesherr.
»Sie leben … sie leben überall«, sagte Nicolai stotternd.
»Und warum sollen sie jetzt ausgerechnet hier sein?«
»Weil … ich weiß es nicht. Sie kommen … unter bestimmten Bedingungen.«
»Was für Bedingungen?«
»Es hängt wohl ab von der Wärme und Feuchtigkeit … und … man weiß es nicht genau.«
»Er weiß es nicht genau! Aber er erdreistet sich, mir zu sagen, meine Bauern sollen sich vor Miasma-Tierchen verstecken und die Ernte verfaulen lassen. Was für ein Arzt ist er denn?«
Jetzt stieg eine brennende Wut in Nicolai hoch. Er spürte die hämischen Blicke der anderen Ärzte. Hätte er doch nur geschwiegen und die Niederlage eingesteckt. Warum hatte er nicht einfach den Mund gehalten? Aber als Dummkopf wollte er hier auch nicht hinausgehen.
»Wenn Euer Hochwohlgeboren gestatten«, begann er, »würde ich meine Behauptung gerne durch eine Beobachtung begründen, die man den Bauern zu deren Beruhigung auch leicht erklären könnte.«
Erstauntes Schweigen erfüllte jetzt den Raum. Woher nahm dieser junge Bursche das Selbstbewusstsein, so zu sprechen? Aber der Fürst betrachtete den jungen Arzt neugierig, und niemand wagte es, ohne Aufforderung durch den Landesherrn das Wort zu ergreifen. Selbst der Hofphysikus schwieg zerknirscht. Sollte der Junge sich doch sein eigenes Grab schaufeln, schien er zu denken. Der Fürst nickte kurz, zog jedoch dabei seine Stirn in tiefe Falten.
»Er rede!«
Nicolai sprach langsam und versuchte, so harmlos wie möglich zu klingen.
»Ich habe beobachtet, dass sich das Fieber ausgerechnet dort hartnäckig hält und zum Tode führt, wo zur Ader gelassen und geschröpft wird. In entlegeneren Kreisen, die gleichfalls stark vom Fieber betroffen sind, hat es weniger Todesfälle gegeben, und dort ist das Fieber bereits stärker zurückgegangen als in der Stadt und den angrenzenden Gebieten, wo viel geschröpft wurde.«
Jetzt ging ein Raunen durch den Saal. Solch eine Ungeheuerlichkeit! Aus dem Mund eines solchen Grünschnabels!
»Weiter!«, sagte der Fürst. »Mich interessiert nicht, was er vom Schröpfen hält. Was ist mit diesen Miasma-Tierchen? Das will ich wissen.«
»Dieses Fieber ist nicht von hier. Es ist eingeschleppt worden. Seine Verbreitung ist ganz anders als die Verbreitung der hier bekannten Fieber. Ich habe mir erlaubt, die Krankheitsfälle zu erfassen und auf einer Karte zu verzeichnen. Vergleicht man nun diese Aufzeichnungen mit den Beobachtungen früherer Fieber, so zeigt sich ein eigentümlicher Unterschied.«
Sehr weit war er nicht gekommen mit seinen Erklärungen. Er hatte ausgeführt, dass es Krankheiten zu geben schien, die an einem Ort begannen, wohingegen andere an mehreren Orten gleichzeitig ihren Ausgang nehmen konnten. Ein englischer Arzt, der diesen Umstand studiert und dessen Schriften er gelesen hatte, sprach von lokalen und eingeschleppten Miasmen, die sich ganz unterschiedlich entwickelten. Nicolai hatte anbieten wollen, seine Karten zu holen und zu zeigen, dass es im Umland mindestens fünf anfänglich voneinander isolierte Gebiete gab, wo die Krankheit sich zuerst gezeigt hatte. Er habe das auf seiner Karte in Form von vielen eng aneinander liegenden Punkten, von denen jeder für einen Erkrankten stand, dokumentiert. Daraus könne man ablesen, dass die Krankheit eingeschleppt worden sei. Eigenartig dabei sei übrigens, dass die Krankheit erst dann in der Stadt ausgebrochen war, als die auf dem Land herumreisenden Ärzte überall begonnen hatten, die Opfer zur Ader zu lassen. Ein Aderlass nütze seiner Auffassung nach jedoch wenig, da die Krankheitstierchen ja offensichtlich von außen kamen und nicht aus dem Körper.
»Genug!«, platzte der Hofphysikus mit hochrotem Kopf heraus, und sogleich entstand ein regelrechter Tumult.
»Was hat er dazu zu sagen?«, raunzte der Fürst jetzt den Hofphysikus an. Der Mann warf Nicolai einen bitterbösen Blick zu.
»Lizenziat Röschlaubs Ausführungen sind skandalös. Es ist erwiesen, dass Krankheiten durch Reize im Körper entstehen, welche die prästabilierte Harmonie der Säfte stören. Dies kann zur Bildung von Krankheitstierchen führen. Aber sie kommen aus dem Körper. Woher denn sonst?«
Nicolai schüttelte den Kopf. »Francesco Redi hat nachgewiesen, dass Krankheitskeime eingeschleust werden. Omne vivum ex ovo. Alles Leben kommt aus dem Ei. Und das Ei, so klein es auch sein mag, muss gelegt werden.«
»Kann er das beweisen?«, fragte der Fürst.
»Setzt zwei Stücke Fleisch der Luft aus. Legt das eine in ein offenes Gefäß, das andere in ein Gefäß, das Ihr mit einer dünnen Gaze verschließt. Ihr werdet sehen, dass aus dem offen daliegenden Fleisch bald Maden hervordringen, weil die von der Fäulnis angelockten Fliegen dort ihre Eier ablegen. Das andere Gefäß wird die Fliegen gleichsam anlocken, und sie werden ihre Eier in die Gaze legen, von wo die Maden versuchen werden, das Fleisch zu erreichen. Doch das Fleisch selbst bringt keine Maden hervor.«
»Was sagt Ihr dazu?«, meinte der Fürst zum Hofphysikus gewandt.
»Wie erklärt Ihr Euch dann das Auftreten von Würmern an Toten, die nicht nur durch Gaze, sondern durch drei Zoll dickes Eichenholz vor Fliegen geschützt sind?«
»Das sind keine Fliegenwürmer«, erwiderte Nicolai gegen losbrandendes Gelächter.
»Und warum«, führte der Hofphysikus triumphierend aus, »warum sollten die Miasma-Tierchen ausgerechnet unseren Kreis aufgesucht haben? Stinken wir vielleicht wie ein verrottetes Stück Fleisch? Will Lizenziat Röschlaub dies mit seiner Theorie beweisen?«
Das Gelächter ergriff jetzt auch den Fürsten. Er winkte amüsiert ab und entließ Nicolai mit einer wegwerfenden Handbewegung.
Die darauf folgenden Wochen waren verheerend gewesen. Sein Vater machte ihm heftigste Vorwürfe. Dann hieß es, der junge Röschlaub habe in Würzburg keine Medizin, sondern Spekulieren gelernt. Er sei ein Quacksalber, der die Alten verachte. Eine Aussicht auf ein Physikat war rasch dahin. Als auch die Apotheke seines Vaters mehr und mehr gemieden wurde, weil der rechtschaffene Mann solch einen missratenen Sohn beschäftigte, der zudem als hochmütig und verschlossen galt, wurde es auch dem Vater zu viel. Er solle zusehen, wie er sich andernorts durchschlug. Hier sei kein Platz für ihn, und er dulde nicht, dass die ganze Familie unter seinen Grillen zu leiden habe. Nicolai verließ Fulda noch vor dem Weihnachtsfest 1779.
Er brauchte fast vier Monate, bis er, halb verhungert, in Nürnberg eine kärglich besoldete Stelle fand.
2.
Seitdem suchte er alles zu vermeiden, das ihn irgendwie mit der Obrigkeit in Konflikt bringen konnte. Dieses Amt, so kümmerlich es auch war, wollte er auf keinen Fall so schnell wieder verlieren, und daher verhielt er sich bei allen Dingen, die ihm angetragen wurden, so umsichtig und vorsichtig wie möglich. Vielleicht reagierte er deshalb etwas abweisend, als am nächsten Abend eine Magd aus Alldorf vor seinem Haus auftauchte. Sie trat aus dem Schatten der Hofeinfahrt, als der junge Arzt sich soeben an der Haustür zu schaffen machte.
»Physikus Röschlaub?«, fragte sie schüchtern.
Er drehte sich zu ihr herum und hob seine Laterne hoch. Die Nacht war klar und hell durch den Neuschnee, aber die Gestalt, die wenige Meter von ihm entfernt neben der Einfahrt stand, zeichnete sich nur als dunkler Schatten ab. Sie kam zwei Schritte näher und trat in den Lichtschein der Laterne. Nicolai musterte das Mädchen. Es sah sehr jung aus, hatte ein rundes Gesicht mit den für die Gegend typischen Merkmalen. Flache Stirn, eher eng stehende Augen, gut ausgebildete Wangen und volle Lippen. Ein Gesicht, bei dem man jetzt schon erahnen konnte, wie es im Alter aussehen würde.
»Ich komme von Alldorf«, sagte sie jetzt, ohne eine Antwort abzuwarten. »Graf Alldorf … er ist krank und bedarf eines Arztes. Physikus Müller hat mich an Euch verwiesen.«
Das war nicht verwunderlich, dachte Nicolai, während er weiterhin das Mädchen musterte. Stadtphysikus Müller wand sich seit zwei Tagen in Krämpfen, von denen man nicht wusste, ob eine Verstopfung daran schuld war oder die Mittel dagegen, welche sein Patron sich hartnäckig verabreichte. In jedem Fall war Müller unpässlich, und Nicolai hatte seit Tagen das doppelte Pensum zu erledigen.
»Es ist spät«, entgegnete er müde.
Das Mädchen kam noch einen Schritt auf ihn zu. Wie lange sie wohl schon hier in der Kälte auf ihn gewartet hatte?
»Morgen wird es vielleicht zu spät sein.«
Woher sie das so genau wisse, wollte er spöttisch erwidern. Aber etwas in ihrem Gesichtsausdruck ließ ihn unsicher werden. Er schloss die Haustür auf, trat beiseite und bedeutete dem Mädchen, einzutreten. Doch sie bewegte sich nicht von der Stelle und blickte ihn unverwandt an.
»Bitte kommen Sie nach Alldorf«, sagte sie.
»Willst du dich nicht erst einmal aufwärmen?«, fragte er.
Sie schüttelte schüchtern den Kopf. Erst als er sie nachdrücklich aufforderte, folgte sie ihm zögernd ins Haus.
Nicolai ließ das Mädchen vorgehen, betrat dann die Wohnstube und schloss die Tür. Die angenehme Wärme der beheizten Stube ließ die Aussicht, bei Einbruch der Nacht zu dem entfernt liegenden Schloss aufzubrechen, noch unangenehmer erscheinen. Das Lohensteiner Gebiet, zu dem Alldorf gehörte, begann zwar kurz vor Nürnberg, aber Alldorf selbst lag abseits, gut eine Stunde Fußweg bei gutem Wetter. Bei diesem Schnee konnten es zwei werden.
Er wies das Mädchen an, am Tisch Platz zu nehmen.
»Seit wann ist der Graf denn krank?«, fragte er dann.
»Seit acht Monaten«, erwiderte sie.
Nicolai zog die Augenbrauen hoch. Er wog die Antwort einen Augenblick lang unschlüssig ab und sagte schließlich: »Acht Monate. Und warum ist es dann so wichtig, dass ich heute Abend noch zu ihm komme?«
»Man hat mir gesagt, Sie dürfen keine Zeit verlieren … Bitte, kommen Sie schnell.«
Er zog seinen Mantel aus, und als er sich wieder zu ihr umdrehte, schaute sie ihn immer noch an. Die Wärme der Stube hatte ihre Wangen gerötet. Unter ihrem Umhang, den sie jetzt geöffnet hatte, sah Nicolai das in diesem Landstrich übliche über der Brust geschnürte Mieder, unter dem sich, von einem gespannten Brusttuch verdeckt, abzeichnete, wofür die Frauen in dieser Gegend zu Recht gerühmt wurden.
»Hat der Graf dich geschickt?«, fragte er.
Sie schwieg, dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, Kammerherr Selling.«
Nicolai wusste über Graf Alldorf nur, dass er hier in der Gegend ein mächtiger Mann war. Nicht zu ihm zu gehen könnte ihm übel ausgelegt werden.
Die Apothekertasche war noch von seinen heutigen Krankenbesuchen gepackt. Er füllte lediglich Brechweinstein und Essig nach, griff nach dem Tabaksklistier und einem Glas mit Blutsaugern und legte beides behutsam in einen dafür vorgesehenen gepolsterten Koffer. Was auch immer den Grafen plagte, so schlimm konnte es nicht sein, wenn er schon acht Monate damit lebte.
Sie saßen erst auf, als sie das Stadttor hinter sich gelassen hatten. Vor zehn Uhr würden sie nicht im Schloss eintreffen, und als Nicolai jetzt bewusst wurde, dass er wohl auch die Nacht dort würde verbringen müssen, sank seine Stimmung noch tiefer. Es verging ohnehin kein Tag, an dem er sich nicht bittere Vorwürfe über sein gegenwärtiges Los machte. Wäre er in Fulda nur nicht so vorlaut gewesen und hätte sich stattdessen bemüht, das Apothekergewerbe zu lernen, so säße er jetzt behaglich und wohl versorgt in der väterlichen Stube vor dem Kamin, anstatt nachts bei Schnee und Eis mit einer abergläubischen Magd durch einen fränkischen Wald zu reiten, um einem Grafen ein Klistier zu setzen.
Er hing seinen Gedanken nach. Die Erinnerung an eine Bäuerin, die er vor einigen Tagen behandelt hatte, ging ihm nicht aus dem Sinn. War nicht alles nutzlos, was er auf der Universität gelernt hatte? Wann immer er an ein Krankenbett trat, musste er feststellen, dass die Mittel, die er anzuwenden hatte, zwar in den gelehrten Büchern, jedoch nur selten bei seinen Patienten ihre Wirkung zeigten. Wurde einer wieder gesund, so hätte er beim Himmel nicht angeben können, wie es damit zugegangen war, hatte doch eine Woche zuvor ein anderer die gleiche Behandlung damit quittiert, sogleich aus dem Leben zu scheiden. War er denn mit seinen Pulvern und Klistieren weniger närrisch als die herumziehenden Bader und Quacksalber?
Jetzt sprach alle Welt vom Magnetisieren. Er hatte dem berühmten Vorkämpfer dieser Methode, Herrn Diakonus Lavater, geschrieben und ihn im Falle einer von Krämpfen geplagten Bäuerin um Rat gebeten. Der Mann hatte geantwortet und ihm die Behandlung sorgfältig erklärt. Morgens und abends solle er die Frau jeweils eine halbe Stunde lang magnetisieren. Am dritten Tag seien ihr vier bis fünf Blutsauger hinter die Ohren zu setzen, zwei Tage später sollte er ihr ein Klistier geben und am darauf folgenden Tag einen Kräutertee verabreichen. Vierzehn Tage nach ihrer monatlichen Reinigung sei sie zur Ader zu lassen und dann jede Woche noch zweimal, dienstags und freitags, erneut zu magnetisieren. Sei das Übel dann noch nicht besiegt, so wären kalte Bäder bis zum Hals hinauf zu empfehlen; hierbei müsste allerdings das Kopfhaar abgeschnitten werden. Vor dem Schlafengehen seien der Kopf, der Rücken und der Bauch mit kaltem Wasser zu waschen. Ab dem zehnten Behandlungstage müsse die Patientin täglich vier Gläser Schwalbacher Wasser mit Milch trinken, wenig Fleisch und mehr Gemüse essen. Das Wasser sei gleichfalls zu magnetisieren.
Er hatte eine Weile gezögert, bevor er beschloss, die Methode wenigstens einmal auszuprobieren. Aber vor allem fehlten ihm hierzu die Magneten, die im ganzen Kreis nicht so leicht aufzutreiben waren. Und dann hatten seine Überlegungen plötzlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Das leidende Frauenzimmer war Anfang dreißig, von einem hitzigen Temperament und hatte aus Überlegung den ehelosen Stand gewählt, was bereits auf eine starke Gemütsstörung schließen ließ. Und hatte er nicht bei Marcard gelesen, dass all diese neumodischen Heilmethoden bloße Wirkung der Einbildungskraft waren? Allerorten wurden derzeit Geister zitiert, Gold gemacht, Universaltinkturen gebraut, der Stein der Weisen gesucht und der Mond auf die Erde herabgezaubert. Das kranke Frauenzimmer war so abergläubisch wie noch der finsterste Jesuit. Sollte er es auf einen Versuch ankommen lassen, einen ganz neuen Behandlungsweg zu gehen?
Er ließ bei einem Schmied zwei Eisenplatten anfertigen. Als man ihm wieder einen heftigen Anfall meldete, erschien er mit wichtiger Miene im Zimmer der Geplagten, gefolgt von einem Gehilfen, der die schweren Platten trug. Sogleich wurde es still im Raum, und man beobachtete mit furchtsamer Hochachtung, wie er die Frau nach allen Regeln der Kunst, die er sich freilich kurz zuvor erst ausgedacht hatte, magnetisierte. Er legte ihr eine der Platten auf den Magen und hielt die andere an ihren rechten Fuß, denn die Krämpfe machten sich besonders an der rechten Seite bemerkbar. Er murmelte auch noch ein paar lateinische Sprüche, denn das machte stets Eindruck und konnte in jedem Fall nicht schaden. Im gleichen Augenblick fühlte die Patientin den magnetischen Strom. Sie erstarrte, gab seltsame Laute von sich, wurde jedoch bald ruhiger, und eine Viertelstunde später war der Krampf verschwunden. Den folgenden Tag wurde die Anlegung der Magnete mit dem nämlichen Erfolg wiederholt, und von dieser Zeit an war von krampfhaften Anfällen nichts mehr zu spüren.
Die Erfahrung hatte ihn in eine tagelange Niedergeschlagenheit gestürzt. Hätte er nun gleich eine Schrift aufsetzen sollen über die therapeutische Wirkung von Eisenplatten? War er nicht auf dem besten Weg, ein großer Scharlatan zu werden, wie Tausende andere, die das Land durchstreiften und jedes Leiden mit Kot und Urin zu heilen vorgaben? Kam zu all der Unwissenheit, die er ohnehin schmerzlich in sich verspürte, auch noch der Umstand hinzu, dass die heilige Natur mit der Vernunft Schabernack spielte? Welche rätselhafte Krankheit hatte er denn bloß in dieser Frau geheilt? Offenbar gab es eingebildete Krankheiten, die wahre Symptome hervorrufen konnten! Wie sollte es also möglich sein, den wahrhaft erkrankten vom eingebildet erkrankten Körper zu unterscheiden? Und schlimmer noch – es hatte sich das eingebildete Mittel als das einzig wahre erwiesen! Hier war offenbar ein Fehler in der Schöpfung, an dem sein Verstand sich unablässig rieb.
Das Mädchen hinter ihm auf dem Pferd murmelte Geistersprüche. Nicolai spürte, dass seine ohnehin schwelende Gereiztheit dadurch noch zunahm. Er hätte nicht übel Lust gehabt, sie einfach abzusetzen und umzukehren. Doch er riss sich zusammen und konzentrierte sich auf den Weg, während hinter ihm Baumgeister und Waldtrolle mit beschwörenden Sprüchen bedacht wurden. Eine Weile gelang es ihm, diese Beschwörungsreden zu ignorieren. Aber als sie plötzlich auch noch zu singen begann, riss ihm der Geduldsfaden. Ob sie ihm bis Alldorf die Ohren vollplärren wolle mit diesem närrischen Singsang?
Sie verstummte augenblicklich, glitt vom Pferd, bekreuzigte sich dreimal in rascher Folge und ging zu Fuß weiter. Nicolai fluchte leise, stieg gleichfalls ab und folgte ihr in einigen Metern Entfernung. Ihr Gemurmel war noch immer hörbar, aber durch die Entfernung nun wenigstens stark gedämpft.
Er wusste selbst nicht, was ihn daran so störte. Aber offenbar sollte es sein Schicksal sein, in einem dunklen Wald dem Aberglauben hinterherlaufen zu müssen, dachte er grimmig. Dabei wusste er doch, dass es völlig sinnlos war, sich dagegen aufzulehnen. In Deutschland regierten noch immer die verfluchten Mönchskutten. Selbst die aufgeklärten Fürsten hatten vor ihnen resigniert. Einige seiner Kollegen hatten in den letzten Jahren den Kampf gegen Aderlassmännchen, Aderlasstafeln, hundertjährige Kalender, Sterndeuterei und Muttermalprophezeiungen aufgenommen. Sie hatten geschrieben, dass blaustichiges Blut nichts über die Gesundheit der Milz aussage und grünstichiges weder Herzweh noch Gallenkrankheit bedeute und dass die Blut- und Urinbeschauer allesamt Farbseher und Scharlatane seien. Sie hatten den Irrglauben widerlegt, dass rote Striemen auf Neugeborenen Kirschen oder Erdbeeren darstellten, nach welchen die Schwangere Sehnsucht gehabt habe. Weikard, der alte Spötter, hatte sogar dargelegt, dass es doch seltsam sei, dass noch nie ein Muttermal in Form eines Dukaten, eines Laubtalers oder eines schönen Kleides gesehen worden sei, wonach Frauen sich doch wohl öfter sehnen als nach frischem Obst. Aber das war alles vergeblich gewesen. Im Gegenteil. Sein Spott war ihm übel vergolten worden. Die Bauern waren scharenweise zusammengezogen und verbrannten seine Reformkalender öffentlich. Sie wollten nichts von Fruchtwechsel und Dünger hören, sondern Horoskope haben.
Und ihm war es jetzt genauso ergangen. Seit dem Zwischenfall während der Fieberseuche hatte sich der ganze Stand gegen ihn verschworen. Lizenziat Röschlaub müsse verschwinden, so hieß es. Hexen und Teufelsgeschichten wurden über den »Spekulierer« verbreitet. Niemand in seiner Heimatstadt würde ihn je als Arzt akzeptieren. Nun gut, er war gegangen, und die Bürger von Fulda hatten ihre Ruhe wieder. Doch jetzt war er schon wieder von Gespenstern umgeben.
Irgendwann war das Mädchen still geworden und stapfte einfach schweigend vor ihm her. Sie kannte den Weg offenbar gut, hatte mehrmals die Richtung gewechselt, ohne dass Nicolai einen Wegweiser hätte ausmachen können. Alldorf lag isoliert auf einer kleinen Anhöhe über der Pegnitz. Es führte auch eine Landstraße dorthin, aber die machte einen großen Bogen und hätte die Wegzeit noch um ein Drittel verlängert.
Die Bäume standen jetzt dichter, und die Zweige hingen so tief, dass an Aufsitzen nicht zu denken war. Nicolai tat es fast ein wenig Leid, die Magd so barsch angefahren zu haben. Er schloss zu ihr auf und fragte sie mit versöhnlicher Stimme, ob sie schon lange auf Schloss Alldorf wohne.
»Seit drei Jahren«, gab sie wortkarg zurück, ohne zu ihm aufzusehen oder ihren Schritt zu verlangsamen.
»Und deine Eltern? Wohnen sie auch dort?«
»Nein. Die wohnen an der Weilermühle.«
»Aha«, sagte Nicolai und fügte nach einer Pause hinzu: »Ich dachte, die Weilermühle läge nicht auf Alldorfer Gebiet? Dann gehörst du eigentlich nach Wartensteig, oder?«
Sie schaute ihn kurz von der Seite an und sagte dann: »Ich gehöre dem Grafen, wie alles hier.«
Die Art und Weise, wie sie das sagte, ließ Nicolai verstummen. Was stellte er auch für dumme Fragen.
3.
Schon bevor sie das Schloss betraten, hatte er das Gefühl, dass etwas an diesem Krankenbesuch seltsam war. Das Mädchen führte ihn zu einem Seiteneingang. Das Mondlicht beschien einige Abfallhaufen, die den Weg säumten und trotz der kalten Witterung gehörig stanken. Es dauerte einige Minuten, bis endlich jemand die Tür öffnete und sie hereinließ. Ein Stallknecht nahm Nicolai die Zügel aus der Hand und führte sein Pferd weg. Sonst war niemand zu sehen. Der Innenhof war völlig verlassen, die Fassaden dunkel bis auf zwei Fenster im dritten Stock, hinter denen Licht brannte.
Wohin das Mädchen ihn am Ende brachte, wusste er nicht. Nach soundso vielen Gängen und Treppen waren sie in einem kleinen Vorzimmer angekommen. Nicolai musste sich auf eine Holzbank setzen. Das Mädchen verschwand. Nicolai wartete. Im Nebenzimmer hörte er gedämpfte Stimmen, verstand aber nicht, was gesagt wurde. Außerdem fror er. Nach einer Weile öffnete sich die Tür, und ein älterer Mann kam auf ihn zu.
»Lizenziat Röschlaub? Ich bin Kammerherr Selling. Danke, dass Sie gekommen sind. Bitte folgen Sie mir.«
Im nächsten Raum brannte glücklicherweise ein Feuer. Selling schloss die Tür und wies Nicolai einen Stuhl zu, auf den er sich setzen sollte.
»Stadtphysikus Müller ist verhindert?«
Nicolai nickte.
»Sie müssen neu sein in Nürnberg. Ich kenne Sie nicht.«
»Ich bin erst seit April in der Stadt«, antwortete Nicolai.
Selling musterte ihn, was Nicolai Gelegenheit gab, den Mann seinerseits ein wenig in Augenschein zu nehmen. Er musste die vierzig schon überschritten haben, war also sicher doppelt so alt wie er selbst. Seine Perücke saß tadellos, und trotz der späten Stunde war der Mann frisch gepudert. Aber seine Gesichtszüge wirkten dadurch noch hagerer, als sie es ohnehin waren. Die leichte Röte seiner Wangen war wohl entweder krankhaft oder künstlich, und die großporige Haut sprach Bände über seinen Zustand. Unter anderen Umständen hätte Nicolai ihn sogleich ausgefragt, was für Speisen er normalerweise zu sich nahm. Doch er verwarf den Gedanken sogleich. Schließlich sollte er einen Grafen untersuchen, und nicht seinen Kammerdiener.
»Ich hoffe, es gefällt Ihnen in Nürnberg«, sagte Selling jetzt.
»Ja. Sehr gut, danke«, log Nicolai.
Was hätte er denn schon sagen sollen? Er hatte nichts von dem, was man Gastfreiheit oder Unterhaltung oder auch nur anständige Höflichkeit nennt, unter den Leuten in Nürnberg gefunden. In den Kaffeehäusern staunte man ihn an, als käme er aus einer anderen Welt. Man steckte die Köpfe zusammen, und wenn er den einen oder anderen anredete, so fertigte man ihn unter tiefen Bücklingen entweder mit einem kurzen Ja oder Nein ab, oder man pflegte bei seinem Erscheinen ganz in ein geheimes Stillschweigen zu verfallen. Er hatte sich zu Beginn durchaus vorgenommen, der Stadt etwas Angenehmes abzugewinnen, aber seine ersten Eindrücke von den Straßen und Gassen war genauso gewesen wie alle nachfolgenden: Sie schlangen und wanden sich ungeordnet durcheinander, und wo sie das nicht taten, gingen sie steil auf- oder abwärts. Gab es an sich schon wenig Grund, in den düsteren, zugebauten Gassen zu verweilen, kam indessen noch ein weiterer hinzu: die Gassenjungen, die unbehelligt von Polizei und Stadtaufsicht jeden Fremden unter dem unanständigsten Geschrei anbettelten, so dass er sich anfänglich gezwungen sah, in Mietkutschen von einem Haus zum anderen zu fahren. Erst nachdem er einige Male in Begleitung von Stadtphysikus Müller gesehen worden war, verschonte ihn diese Horde allmählich oder begnügte sich damit, ihm völlig unverständliche Vokabeln aus ihrem fränkischen Gossenwortschatz nachzurufen. Doch wie bedrückend er all dies fand, konnte Selling schwerlich interessieren. Schließlich war er hier, um einen Kranken zu besuchen.
Aber warum führte man ihn dann nicht zu ihm?
»Das freut mich«, sagte der Kammerdiener. »Die Stadt braucht tüchtige Männer. Wo haben Sie studiert?«
»In Würzburg«, antwortete er.
»Bei Papius?«
Nicolai nickte verwundert.
»Ein recht fauler Mensch, nicht wahr?«
Jetzt wusste er überhaupt nicht mehr, was er sagen sollte.
»Nun, er las nicht viele Kollegien, das stimmt«, antwortete er unsicher.
Selling lächelte. »Sie brauchen vor mir kein Blatt vor den Mund zu nehmen«, sagte er lächelnd. »Ich kenne den Schlendrian in Würzburg, habe dort selbst ein Jahr verbracht. Papius liebt die Jagd und das Kaffeehaus. Das war schon zu meiner Zeit so. Ist Ehlen noch dort?«
»Ja. Er liest über die Lebenskräfte.«
»Und tut dies mit völlig totem Vortrag. Narkotisch für die Seele, nicht wahr?«
Nicolai musste lächeln. Die vertrauliche Art des Mannes gefiel ihm.
»Herr Selling«, sagte er dann, »warum bin ich hier?«
»Wir warten noch auf jemanden«, erwiderte der Mann.
»Aber der Graf … ist er denn nicht … ich meine, ist keine Eile geboten?«
Statt einer Antwort erhob sich der Kammerdiener, trat ans Fenster und schaute kurz hinaus. Nicolai hatte völlig die Orientierung verloren, aber er vermutete, dass er sich in einem der beiden erleuchteten Zimmer befand, die er vom Hof aus gesehen hatte.
Selling wandte sich wieder ihm zu.
»Lizenziat Röschlaub, die Sache ist ein wenig kompliziert: Graf Alldorf hat seit zwei Tagen und Nächten seine Bibliothek nicht mehr verlassen. Bei seinem Gesundheitszustand ist das beunruhigend.«
»Hat der Graf keinen Leibarzt?«
»Nein. Es gibt hier keinen Arzt, nur einen Apotheker, Herrn Zinnlechner, den Sie gleich kennen lernen werden. Aber auf diesen hört Graf Alldorf ebenso wenig wie auf alle anderen. Er hat seine eigenen Vorstellungen von der Arzneikunst.«
Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Es ist seit Menschengedenken jedem Schlossbewohner bis zum Kastellan hinauf strengstens verboten, diese Bibliothek zu betreten, da der Graf dort geheime Studien betreibt. Ich bin der Meinung, die Situation gebietet es, dieses Verbot jetzt zu übergehen. Aber Herr Kalkbrenner, der Gutsverwalter und mein Vorgesetzter, ist anderer Meinung. Er weigert sich, gegen das Verbot des Grafen zu verstoßen. Ich möchte, dass Sie mir helfen, Herrn Kalkbrenner zu überzeugen, dass wir durch weiteres Zuwarten möglicherweise eine noch viel größere Schuld auf uns laden. Der Graf ist krank. Seit zwei Tagen und Nächten hat er seine Bibliothek nicht verlassen. Er hat schon oft mehrere Tage und Nächte darin zugebracht, aber nicht in solch einem Zustand.«
»Wird er denn irgendwie versorgt?«, fragte Nicolai.
»Ja. Natürlich. Es gibt einen Schacht, der die Bibliothek mit der Küche im Kellergeschoss verbindet. Aber seit zwei Tagen ist jeder Verpflegungskorb wieder so heruntergekommen, wie er hinaufgeschickt worden ist: völlig unangetastet.«
Nicolai brauchte einen Moment, bis er begriff, was Selling von ihm wollte: Er sollte offenbar eine Diagnose stellen, ohne den Patienten überhaupt gesehen zu haben.
Selling begann jetzt, ihm ein Bild vom Gesundheitszustand des Grafen zu entwerfen. Der Mann wusste offenbar, wovon er sprach, auch wenn er nur ein Jahr lang medizinische Kollegien gehört hatte. Nicolai stellte einige Rückfragen, und die Antworten waren ebenso präzise wie alarmierend. Wenn zutraf, was der Kammerherr beschrieb, dann war die Situation wirklich ernst.
Selling unterbrach seine Ausführungen, als sich die Tür öffnete.
»Ah, Herr Kalkbrenner«, sagte er.
Der Mann, der jetzt das Zimmer betrat, erwiderte nichts, reichte Nicolai aber immerhin die Hand. Dann nickte er kurz Selling zu und ließ sich schwer schnaufend auf einem Fauteuil nieder, der unter seinem Gewicht laut knarrte. Kalkbrenner hatte Selling nicht nur an Jahren, sondern auch an Körpergröße und Leibesfülle einiges voraus. Nicolai hatte sofort den Eindruck, dass die beiden sich nicht besonders mochten. In jedem Fall konnten sie unterschiedlicher nicht sein. Kammerdiener Selling hatte eine feine, etwas zurückhaltende Art. Er vermied direkten Augenkontakt, erweckte bei seinem Gesprächspartner aber dennoch das Gefühl, Gegenstand seiner gesammelten Aufmerksamkeit zu sein. Zugleich lag in seinem ganzen Gebaren etwas Delikat-Unauffälliges, als könnte er sich auf Verlangen sogleich in Luft auflösen. Kalkbrenner dagegen strahlte eine bedrohliche Energie aus, die geeignet schien, die Luft um ihn herum in Brand zu setzen. Er blickte sein Gegenüber forschend und prüfend aus kleinen, tief gesetzten Äuglein an und schnaufte dabei schwer. Sein Amt des allerhöchstgräflichen Eintreibers, denn nichts anderes war ja ein Gutsverwalter, mochte ihm bei seiner Statur und der nicht gerade menschenfreundlichen Physiognomie, mit der die Natur ihn ausgestattet hatte, recht leicht fallen.
»Wo ist Zinnlechner?«, brummte er Selling an.
»Ich habe ihn rufen lassen«, gab der zurück. »Er müsste gleich hier sein. Ich habe Herrn Lizenziat Röschlaub die Situation erklärt und …«
»Es gibt keine Situation«, fuhr ihm der Mann über den Mund.
Selling wurde steif, beherrschte sich jedoch und setzte nach einer kurzen Pause erneut an. »Lizenziat Röschlaub ist der gleichen Auffassung wie ich. Graf Alldorf schwebt in Lebensgefahr, nicht wahr?«
Kalkbrenners streitbarer Blick traf jetzt Nicolai. Er wusste nicht, wie er reagieren sollte.
»Was ich über den Gesundheitszustand des Grafen gehört habe«, korrigierte er Selling vorsichtig, »ist bedenklich. Aber ob Lebensgefahr besteht, kann ich so natürlich nicht sagen …«
»Sehen Sie«, bellte der Mann los. »Und ich soll meinen Kopf hinhalten. Sie kennen das Hausgesetz so gut wie ich. Niemand darf dort hinein, wenn der Graf es nicht ausdrücklich befiehlt. Unter keinen Umständen. Niemals!«
Selling blieb ruhig und wandte sich wieder an Nicolai.
»Lizenziat, sagen Sie, wie lange vermag ein fiebriger, kranker Mensch ohne Wasser und Speise auszuharren?«
Kalkbrenner verschränkte die Arme und schnaubte, sagte aber nichts, sondern musterte missmutig den Arzt.
Nicolai fühlte sich zunehmend unwohl. Er begriff überhaupt nicht, was hier vor sich ging. Warum hatte man ihn geholt? Der Fürst hatte sich krank in seine Bibliothek zurückgezogen, die niemand betreten durfte. Graf Alldorf hatte sich durch sein Verbot möglicherweise in eine bedenkliche Lage gebracht. Das Ganze erinnerte an die mittelalterliche Sitte, vom Pferd gestürzte Könige liegen zu lassen, solange kein Untertan von angemessenem Rang zur Stelle war, um dem Verunglückten aufzuhelfen. Das hatte schon so manchen Monarchen das Leben gekostet.
Doch was sollte Nicolai in dieser Sache nun bewirken? Zwei Tage und Nächte ohne Wasser und Speise. Das sah nicht gut aus. Überhaupt nicht gut.
»Ohne Wasser nicht viel länger als …«
»Er hat Wasser«, fuhr Kalkbrenner wieder dazwischen. »So viel er will.«
»Nun«, erwiderte Selling, »wenn er welches hat, warum bleibt dann das Nachtgeschirr leer?«
Nicolai war versucht, an diese zwingende Beobachtung sofort anzuknüpfen. Kein Mensch, schon gar kein fiebriger, konnte so lange verharren, ohne Wasser zu lassen. Doch in diesem Augenblick ging erneut die Tür auf, und ein weiterer Mann betrat den Raum.
Selling sprach ihn sofort an. »Herr Zinnlechner, wann haben Sie das letzte Mal ein Nachtgeschirr des Grafen erhalten?«