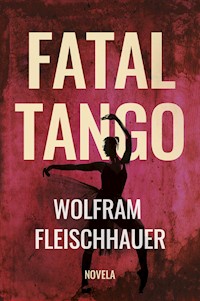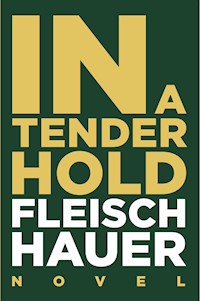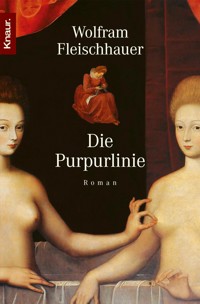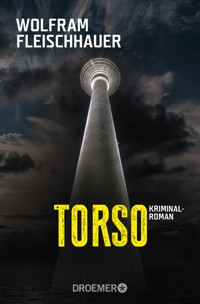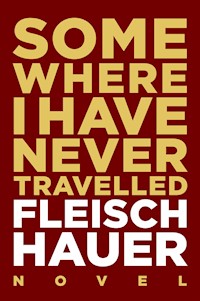Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Täuschung, Verführung und die Suche nach der Wahrheit - der Erfolgsroman von Wolfram Fleischhauer jetzt in einer Neuausgabe anlässlich der geplanten Serien-Verfilmung. Berlin im Jahre 1926. Es ist keine Seltenheit, dass der junge Student Edgar von Rabov seine Abende in der Eldorado-Bar zubringt. Doch diese kühle Februarnacht ist anders, mit ihr beginnt für Edgar etwas Neues: Eine bemerkenswert schöne junge Inderin erregt sein Interesse, immer wieder scheint auch sie Edgars Blick zu suchen. Als sie die Bar in Begleitung eines älteren Herrn verlässt, steckt sie Edgar eine Notiz zu: "Übermorgen hier. Ich erwarte Sie!" Edgar, Fabrikerbe und Spross einer norddeutschen Adelsfamilie, kann sich dem exotischen Zauber der jungen Frau nicht entziehen und begibt sich auf eine verstörende Reise, die ihn bis nach Indien und ins esoterische Herz des aufkeimenden Nationalsozialismus führt. Bestsellerautor Wolfram Fleischhauer erzählt in "Schule der Lügen" eine packende, politische und hochaktuelle Familien- und Liebesgeschichte im Dunstkreis der ersten großen Esoterikwelle der 20er Jahre und des Entstehens der nationalsozialistischen Ideologie. In den "Roaring Twenties" - einer der faszinierendsten Epochen der jüngeren Geschichte genau 100 Jahre vor unserer Zeit - erleben wir, wie die Verhexung von Politik durch Religion und esoterisches Denken eine unfassbare Katastrophe heraufbeschwört: ein unheimlicher und alarmierender Vorgang von aktueller Brisanz angesichts von Querdenkern und alternativen Wahrheiten. "Schule der Lügen ist ein erstklassiger Roman und ein Leseabenteuer, das berührt und fasziniert. Spannend, unterhaltsam und lehrreich zugleich. Ein originelles und zugleich anspruchsvolles Vergnügen mit Nachklang." LovelyBooks.de
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfram Fleischhauer
Schuleder Lügen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin im Jahre 1926. Es ist keine Seltenheit, dass der junge Student Edgar von Rabov seine Abende in der Eldorado-Bar zubringt. Doch diese kühle Februarnacht ist anders, mit ihr beginnt für Edgar etwas Neues: Eine bemerkenswert schöne junge Inderin erregt sein Interesse, immer wieder scheint auch sie Edgars Blick zu suchen. Als sie die Bar in Begleitung eines älteren Herrn verlässt, steckt sie Edgar eine Notiz zu: »Übermorgen hier. Ich erwarte Sie!«
Edgar, Fabrikerbe und Spross einer norddeutschen Adelsfamilie, kann sich dem exotischen Zauber der jungen Frau nicht entziehen und begibt sich auf eine verstörende Reise, die ihn bis nach Indien und ins esoterische Herz des aufkeimenden Nationalsozialismus führt.
Inhaltsübersicht
Prolog
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Epilog
Textnachweise
Ich danke
Die Literatur ist eine Lüge, die die Wahrheit sagt.
Juan Rulfo
Prolog
Der Weg kam ihm erheblich kürzer vor, als er ihn in Erinnerung hatte.
Soeben hatte er noch einen Blick auf den still daliegenden See zu seiner Linken geworfen und sich vorzustellen versucht, wie diese Ansicht damals auf ihn gewirkt hatte. Und jetzt, nur wenige Wegminuten später, konnte er bereits die ersten Gebäude dort oben am Hang erkennen.
Vielleicht lag darin das Missverhältnis? Die Zeit, die vergangen war, seit er diesen Hügel das letzte Mal gesehen hatte – und die fast brüskierende Selbstverständlichkeit, mit der er jetzt plötzlich vor seinen Augen lag. Natürlich konnte es gar nicht anders sein. Aber es kam ihm dennoch unwirklich vor, dass dieser Ort hinter einer Wegbiegung einfach so aus dem Nichts auftauchte.
Phil Manings blieb stehen, rückte seinen Strohhut ein wenig ins Genick und betrachtete das Panorama. Der Lago Maggiore schimmerte in der Nachmittagssonne. Er war vom gleichen unwirklichen Blau wie der Himmel darüber, in dem ein Raubvogel seine Kreise zog. Für die Jahreszeit, immerhin Oktober, war es viel zu warm. Phil trocknete sich die Stirn mit einem feinen Stofftaschentuch und betrachtete danach für einen Augenblick die Bügelfalten darin: Bügelfalten, die noch aus London stammten, wo das Hausmädchen vor zwei Tagen den Koffer gepackt hatte, der dann direkt ins Hotel nach Locarno geschickt worden war.
Er blieb stehen und versuchte, sich daran zu erinnern, wie es im Sommer 1902 hier ausgesehen hatte, als er das letzte Mal hier gewesen war. Der Hügel war damals karg und unbewachsen gewesen, kaum mehr als eine Geröllhalde. Jetzt, fast ein Vierteljahrhundert später, war die Vegetation sehr dicht. Die Bäume standen nah am Wegesrand, und ihre Kronen berührten sich. Ein schmaler, steiniger Pfad führte durch Reben hindurch auf den Berg hinauf. Wie hängende Gärten waren hier die Rebterrassen übereinandergebaut worden, und wo der Rebberg endete, betrat man Kastanienwald. Etwas weiter oben begann Heidegrund, gesäumt von gelbem Ginster und hellgrünen Wacholderbüschen. Kleine, schlanke, silberweiße Birkenstämmchen wuchsen hier. Und dann sah er das Hotel.
In Locarno hatte man ihm bereits erzählt, dass ein paar Berliner Abenteurer das Anwesen vor ein paar Jahren gekauft hatten und nun ernsthaft versuchten, es mit Profit zu betreiben. Zwei der drei Partner waren bereits wieder ausgeschieden, was wohl darauf hindeutete, dass das Vorhaben gescheitert war. Es gab Gerüchte, dass der Berg demnächst wieder auf den Markt kommen würde. Aber für diese Saison waren das Hotel und die verschiedenen Chalets, die sich darum gruppierten, wohl noch gut ausgelastet. Die Konferenz zog zusätzlich Publikum in die Gegend. Die Regierungschefs und Außenminister waren eine Sensation. Sogar Mussolini war gekommen.
»Filippo?«, sagte plötzlich eine Stimme.
Phil schaute auf. Er hatte den Mann, der ein Stück entfernt auf einer Aussichtsbank saß, überhaupt nicht bemerkt. Der Unbekannte erhob sich und kam auf ihn zu.
»Dio mio, non e possibile! Filippo!«
»Bernardo?«
Aber da stand der Mann schon vor ihm und umarmte ihn.
»Filippo!« rief er erfreut aus, nachdem er ihn wieder losgelassen hatte. »Mein Gott … mein Gott …«
Phil schaute überrascht und zugleich ein wenig verlegen auf den Italiener hinab. Er war gut einen Kopf kleiner als er selbst. War auch er so alt geworden wie jener? Nein, es lag an der ärmlichen Kleidung und dem Vollbart, dass Bernardo beinahe großväterlich aussah. Wenn Phil sich recht erinnerte, dann waren sie gleich alt gewesen, als sich ihre Wege hier gekreuzt hatten.
»Die Zeitungen haben recht. Diese Konferenz ist wirklich ein Wunder«, rief Bernardo erfreut. »Sie bringt das verlorene Europa wieder zurück. Dio mio, Filippo, was für eine Überraschung. Wo bist du gewesen? Wie kommst du hierher? Wie lange bleibst du?«
Phil hatte sich allmählich von seiner Überraschung erholt, fasste Bernardo am Arm und wies auf die Sitzbank vor ihnen in der Nachmittagssonne. »Ich bin nur für ein paar Tage hier«, antwortete er auf Italienisch. »Und du? Du bist immer noch hier. Ich dachte, hier leben nur noch Gespenster.«
Bernardos Augen strahlten. Bei näherem Hinsehen sah er nun doch nicht so alt aus. Seine Haut war gebräunt. Er wirkte ungeheuer gesund.
»Gespenster, ja«, rief er lachend. Er knuffte ihn freundschaftlich in die Seite. »Filippo, du glaubst gar nicht, wie ich mich freue. Und wie gut du aussiehst. Ein richtiger feiner Herr. Sag bloß, du bist Politiker geworden?«
»Nein. Wie kommst du denn darauf. Ich arbeite für die Engländer, das schon. Aber ich gehöre nicht dazu.«
»Ich hätte dich fast nicht erkannt«, erwiderte Bernardo. »Aber die Augen. Diese Augen. Die hatten es ja auch der unvergleichlichen Contessa angetan, nicht wahr? Madonna, che bellezza! Wie geht es ihr? Ist sie auch hier?«
Phil wusste gar nicht, wie ihm geschah. Jedes Wort aus Bernardos Mund jagte ihm jetzt Schauer über den Rücken. Er wollte, dass er aufhörte, doch zugleich war es ein köstliches Gefühl, diesem Rufer in einem Schattenreich zu lauschen. Die Contessa? Er schüttelte den Kopf.
»Non lo so«, erwiderte er. »Ich habe keine Ahnung.«
»Aber ihr seid doch damals zusammen weggegangen?«
»Ja, schon, aber du weisst, wie es manchmal ist. Die Wege trennen sich, und man verliert sich aus den Augen.«
»Peccato. Veramente peccato.«
Sie schwiegen einen Augenblick lang und schauten auf den See hinab. Die Brissagoinseln lagen vor dem Hafen von Ronco wie zwei grüne Tupfen im Wasser. Was für ein unvergleichliches Panorama! Wenigstens daran hatte sich nichts geändert.
»Und du?«, fragte Phil nach einer Weile. »Hast du Lotte geheiratet?«
Mein Gott, dachte er, kaum dass er die Frage gestellt hatte. Lotte Hattmer! Er hätte niemals geglaubt, dass er diesen Namen jemals wieder in den Mund nehmen würde.
Bernardos Lächeln verschwand augenblicklich. Dann sagte er bekümmert: »Nein, Filippo. Weißt du denn nicht? Lotte ist schon lange tot.«
Phil schwieg betreten. Bernardo fügte hinzu: »Sie hat sich umgebracht.«
Was für ein Jammer, dachte Phil stumm. Die bildhübsche Bürgermeistertochter.
»Sie lebte am Ende nur noch vom Geld ihrer Eltern. Ich bin manchmal zu ihr gegangen, um nach ihr zu sehen, aber es war ihr nicht mehr zu helfen.«
»Inwiefern?«
»Sie war verrückt geworden.«
»Verrückt? Hier waren doch alle verrückt, meinst du nicht? Wir auch, oder?«
»Wie man es nimmt. Vielleicht schon. Aber Lotte war zu schwach für diese Art von Verrücktheit. Außerdem litt sie sehr darunter, als die ursprüngliche Gemeinschaft zerfiel. Sie lebte mutterseelenallein in ihrer Hütte und siebte Asche. In meiner Erinnerung höre ich sie manchmal noch rufen: Mein Gott, es ist noch nicht fein genug. Irgendwann hat sie Gift genommen. Ich war nicht hier, als es geschah. Man erzählt, sie habe etwas genommen, das normalerweise in einigen Augenblicken wirkt, aber bei ihr dauerte es zweieinhalb Tage, bis sie starb.«
»Entsetzlich«, murmelte Phil.
Bernardo war über seinem Bericht ein wenig in sich zusammengesunken. Jetzt richtete er sich wieder auf und sagte: »Filippo, wie lange bleibst du? Du musst uns auf jeden Fall besuchen, du musst zu uns nach Cannobio kommen …«
»Ich fürchte, das wird nicht so ganz einfach sein«, erwiderte Phil skeptisch.
»No! Keine Widerrede. Diesen Gefallen musst du mir tun. Außerdem habe ich etwas für dich.«
»Siehst du das Schiff dort hinten?«, entgegnete er.
Bernardo folgte seinem Blick. Die Orangenblüte war am Horizont aufgetaucht. In wenigen Stunden würden die Staatschefs in Ascona wieder an Land gehen. Er musste zurück. »Ich habe nur heute Nachmittag frei. Heute Abend gibt es eine Besprechung, und dann wird wieder getagt. Ich fürchte, ich werde keine Zeit haben.«
»Aber du musst zu uns kommen«, insistierte der Italiener. »Du wirst gar nicht anders können, wenn ich dir sage, was ich für dich habe.«
Phil nahm einen Schluck Wasser aus seiner Flasche und leckte sich die Lippen. Bernardos Augen blitzten, als er weitersprach.
»Ich habe Briefe von ihr«, sagte er. »Briefe für dich. Ich sollte sie dir schicken, aber ich hatte ja keine Adresse.«
»Briefe? Für mich? Von Lotte?«
»Nein. Nicht von Lotte. Von der Contessa. Sie hat sie zurückgelassen, als sie das letzte Mal hier durchgekommen ist. Ida hat sie jahrelang aufbewahrt. Dann, als Ida und Henri weggingen, gab sie sie mir. Sie meinte, fast jeder käme früher oder später noch einmal zurück, und vielleicht auch du. Jedenfalls wollte sie die Briefe nicht mit nach Spanien nehmen, und so habe ich sie verwahrt.«
»Nach Spanien?«, wiederholte Phil tonlos.
»Ja. Henri und Ida sind nach dem Krieg nach Spanien gegangen, und von dort nach Brasilien. Sie haben eine neue Kolonie gegründet.«
Briefe von ihr? Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Wann, sagst du, ist die Contessa hier gewesen?«
Die Contessa! Wie fremd das klang. Er hatte sie nie so genannt.
»Im Februar 1903«, antwortete Bernardo. »Aber sie blieb nicht lange. Ida hat mit ihr gesprochen, und ein paar Tage später war sie auch schon wieder verschwunden. Aber die Briefe sind noch hier. Du musst sie bekommen. Schließlich sind sie für dich.«
Phil griff in die Innentasche seiner Jacke, holte ein Päckchen Zigaretten heraus und hielt es Bernardo hin. Aber der lehnte ab. Phil nahm eine Zigarette aus der Schachtel, zündete sie an und inhalierte den Rauch mit großer Konzentration. Briefe von ihr. Von 1903? Seit zweiundzwanzig Jahren lagen sie hier. Was für eine verrückte Idee, überhaupt hierher zurückgekommen zu sein. Was sich hier abgespielt hatte, war naiv und töricht gewesen. Heute argwöhnte er, dass es vielleicht sogar gefährlich gewesen war, auf beklemmende Weise närrisch. Auf dieser Wiese dort hatten sie getanzt, nackt und berauscht von abstrusen Ideen. Aber ein Blick in Bernardos sympathisches Gesicht stimmte ihn um. Warum nicht?, dachte er.
»Wie finde ich euer Haus in Cannobio?«
Der kleine Passagierdampfer, den er drei Tage später bestieg, um über Porto Ronco nach Cannobio zu fahren, war gut besetzt. Tessiner Landvolk tummelte sich darauf und etwa ebenso viele Touristen. Ein lang gezogener Sirenenton erklang, und das Schiff legte ab. Phil machte es sich auf dem Vorderdeck bequem. Der Geruch des Wassers, das leichte Schaukeln des Bootes und die italienischen Gesprächsfetzen, dazu die malerische Kulisse der Berge, all dies tat bald seine magische Wirkung. Der See schien gen Süden hin überhaupt kein Ufer zu haben, als sei die Welt dort zu Ende.
Bernardo erwartete ihn an der Anlegestelle von Cannobio. Sie spazierten die Uferpromenade entlang und bogen dann in die verwinkelten Gassen des Ortes ab. Wie überall in dieser Gegend ging es steil aufwärts, sobald man sich vom See entfernte. Doch mit jedem Schritt wurde die Aussicht prächtiger. Bernardo erzählte die ganze Zeit von früher. Recht besehen war das Ganze ja bereits Legende, und einige Monate dieser Legende hatte Phil miterlebt. Allerdings war er damals nicht barfuß von München ins Tessin gewandert, wie die Gründer der Vegetariersiedlung. Kein Wunder, dass es eine kleine Sensation gewesen war, als sie hier auftauchten: ohne Schuhe, die Männer mit kniefreien Hosen und die Frauen sogar ohne Korsett.
Mittlerweile hatten die beiden Männer einen Höhenweg erreicht und spazierten nun in südlicher Richtung parallel zur Böschung. Hier und da duckte sich ein Haus an den steilen Abhang. Auch Bernardos Haus kauerte in solch einer abschüssigen Lage. Vom Weg aus sah man nur das Dach. Eine schmale Treppe aus krumm liegenden Schieferplatten führte steil abwärts zu einem aus dem Hang herausgegrabenen kleinen Grundstück. Das Haus selbst war winzig, nicht viel größer als eine Gartenlaube. Vor der Haustür gab es noch zwei mal zwei Meter ebenen Grund, der zum See hin umzäunt war. Ansonsten umgab nur abschüssiges Gelände die Behausung.
Bernardos Frau öffnete. Ihr Aufzug ähnelte dem ihres Mannes. Sie trug weite dunkelrote Pluderhosen und ein buntes gewebtes Hemd. Ihre langen, grauen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Um ihren Kopf trug sie ein ledernes Stirnband. Sie hatte angenehme, gleichmäßige Züge, und man konnte erkennen, dass sie einmal eine hübsche Frau gewesen sein musste.
Sie bat ihn einzutreten, und schon bald saßen sie in der kleinen Wohnstube auf dem Boden um einen niedrigen Tisch herum, tranken Tee und plauderten. Henri Oedenkovens Vegetarierkolonie und das Schicksal der Nackten vom Monte Verità waren das Gesprächsthema. Phil erfuhr, dass Bernardo und Antonella die Kolonie noch vor Kriegsausbruch verlassen hatten. Sie hatten sich neuerdings der Philosophie eines österreichischen Theosophen angeschlossen, der allerdings mittlerweile der Theosophie den Rücken gekehrt und eine neue pädagogische Bewegung ins Leben gerufen hatte. Die Grundsätze waren in vielen Dingen noch immer die gleichen wie damals. Phil lauschte, teils amüsiert, teils wehmütig, doch zunehmend distanziert. Wie lange war das alles her? Und wie sinnlos erschien es ihm heute. Als gäbe es am Menschsein irgendetwas Natürliches. Antonellas handgewebte Kleidung deprimierte ihn. Die wenigen Möbel, fast ausschließlich aus Wurzeln und Astgabeln gefertigt, irritierten ihn nicht minder. Alles war krumm und schief.
Wie die Natur.
Bernardo erkundigte sich, was Phil die ganzen Jahre über gemacht hatte. Antonella fragte immer wieder nach der Contessa. Bernardo musste viel von ihr erzählt haben. Doch Phil wollte darüber nicht sprechen. Wie hätte er das alles erklären sollen? Die Flucht. Die weite Reise. Und dann die Trennung, die nicht geplant gewesen war. Das alles konnte und wollte er jetzt unmöglich ausbreiten. Es gelang ihm, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Ich bin nach England zurückgegangen«, kürzte er die Geschichte ab. »Als der Krieg begann, brauchte man Leute, die Deutsch konnten. So kam ich erst ins Foreign Office und später zur militärischen Aufklärung. Das klingt wichtig, ist aber nur ein anderes Wort für langweilige Büroarbeit. Für Felddienst war ich glücklicherweise schon zu alt.«
»Und die Contessa ist nicht mit dir gegangen?«, insistierte Antonella, offenbar auf der Suche nach einem befriedigenden Abschluss der Liebesgeschichte, die Bernardo ihr erzählt hatte.
Phil sagte nichts und schüttelte nur leicht den Kopf. Bernardo warf Antonella einen vorwurfsvollen Blick zu. »Sei doch nicht so indiskret. Du merkst doch, dass Filippo nicht darüber reden will.«
Antonella errötete leicht. Ein peinliches Schweigen entstand, das Bernardo durch eine erneute Frage unterbrach.
»Und heute lebst du in London?«
»Ja.«
Sie aßen zu Abend, und kurz darauf war es auch schon Zeit aufzubrechen, da Phil darauf bestand, den letzten Dampfer zurück noch zu erreichen. Auf keinen Fall wollte er über Nacht bleiben und auf diese Weise noch länger den neugierigen Fragen Antonellas ausgesetzt sein. Ein unangenehmes Gefühl hatte ihn beschlichen. Die Vergangenheit drohte ihn einzuholen. Auf dem Rückweg zum Hafen von Cannobio ließ er Bernardo keine Gelegenheit mehr, auf alte Tage zu sprechen zu kommen. Stattdessen malte er ihm ein lebendiges Bild der neuen Situation, in der Europa sich nun befand. Locarno sei in diesen Tagen ein Name geworden, der in den Geschichtsbüchern eine helle Spur hinterlassen würde. Noch vor einem Jahr wäre undenkbar gewesen, was gestern Abend im Bürgersaal des Rathauses zwischen den Kernstaaten Europas vereinbart worden war. Die Garantie für die Rheingrenze, der Abzug der französischen Truppen aus dem Rheinland, die schwierige Frage bezüglich des Artikels 16 des Völkerbundabkommens. Phil spürte, dass der Italiener nicht alles verstand, aber er hörte aufmerksam zu, und das genügte ihm. Erst als sie die Promenade von Cannobio erreicht hatten, unterbrach ihn Bernardo.
»Dies ist eben ein besonderer Ort, nicht wahr, Filippo?« Dabei schaute er ihn auf eine Art und Weise von der Seite an, die ihm signalisierte, dass Bernardo genau gespürt hatte, warum er die ganze Zeit geredet hatte. Phil blieb stehen und steckte die Hände in die Taschen.
»Ja, Bernardo«, sagte er dann und schaute auf den See hinaus. »Es ist so wunderschön hier. Fast unwirklich schön, findest du nicht?«
»Antonella war schrecklich indiskret«, entschuldigte sich der Italiener bekümmert. »Es ist meine Schuld. Ich habe ihr so viel von dir … von euch erzählt. Das muss ihre Fantasie beflügelt haben. Bitte verzeih mir. Ich fürchte, ich habe eine kleine Legende aus euch gemacht.«
Eine Legende? Phil lächelte. Doch bevor er etwas erwidern konnte, hatte Bernardo ein Päckchen aus der Tasche gezogen und hielt es ihm hin.
»Hier«, sagte er. »Das gehört dir. Bitte, nimm es an dich.«
Phil nahm das Päckchen in die Hand: ein verschnürtes Bündel, kaum größer als eine mehrfach gefaltete Zeitung.
»Wann fährst du nach Hause?«, fragte Bernardo, offenbar bemüht, das Thema zu wechseln.
Phil zögerte einen Augenblick, dann steckte er das Bündel ein. »Morgen«, antwortete er. »Morgen Nacht.«
Sie umarmten sich kurz. Phil schaute Bernardo hinterher, bis er den Marktplatz überquert hatte und in einer der Seitengassen verschwunden war. Der Dampfer lag bereits am Ufer. Aber Phil war nicht imstande, sich zu bewegen. Er befühlte das Päckchen in seiner Hand. Er atmete tief durch, ging ein paar Schritte die Promenade hinauf und setzte sich dann auf eine der Steinbänke, welche in die Hafenmauer eingelassen waren. Nein, er konnte jetzt nicht zurückfahren. Er würde hier übernachten. Er wusste, dass er diese Briefe lesen würde. Aber keinesfalls an jenem verwünschten Ort, an dem sich das alles abgespielt hatte.
Er erhob sich wieder, ließ seinen Blick die Promenade hinabwandern und entdeckte, was er suchte: ein kleines Hotel, das durch einen üppigen Garten vom See getrennt war. Er überquerte rasch den Marktplatz und betrat die Lobby. Er nahm ein Zimmer im obersten Stock mit Blick auf den See. Er trat auf den Balkon hinaus, nahm auf einem der beiden Korbstühle Platz und öffnete das Päckchen. Hatte Bernardo nicht gesagt, es seien Briefe? Offenbar hatte er den Inhalt des Päckchens noch nie gesehen. Phil betrachtete das Moleskine-Notizbuch, aus dem einige gefaltete Bögen Crown-Mill-Papier herausragten. Er zog die Bögen hervor und faltete den ersten auseinander. P&O Liners, London, stand in bordeauxrotem Tiefdruck auf dem Briefkopf der eng beschriebenen Blätter.
Sie hatte das alles während der Rückreise geschrieben, im Februar 1903, auf dem Weg nach Triest? Er faltete jetzt Bogen für Bogen auf und musterte die Handschrift, ohne sich zunächst um den Sinn der Worte zu kümmern. Das würde er nachher tun. Er würde ohnehin alles lesen, was sie geschrieben hatte. Eine unbestimmte Scheu hielt ihn noch zurück. Wie eng sie die Buchstaben setzte! Die gedrängt stehenden, schrägen Zeichen zeugten von Eile und Entschlossenheit. Er schichtete die Bögen übereinander. Sie waren nummeriert, aber nicht datiert. Doch der Name des Schiffes, der im Briefkopf mitabgedruckt war, kam für ihn einem Datum gleich. Die Route hatte ja festgestanden. Jetzt wusste er zwar, dass sie noch bis Ascona gekommen war. Aber danach? Was war wohl danach aus ihr geworden?
Der letzte Bogen des P&O-Briefpapiers war nur halb beschrieben, der untere Teil der Seite abgerissen. Der abgerissene Teil fand sich im Notizbuch, zwischen dem Deckel und dem Deckblatt. Ein Name stand darauf. Mahendra! Sein Mund wurde trocken. Der Name starrte ihn an. Mahendra! Nur diese halbe Seite war also für ihn bestimmt, die Nachricht darauf direkt an ihn gerichtet.
Er las nur den ersten Absatz. Weiter kam er nicht. In der Ferne hörte er das Signal des auslaufenden Dampfers. Die Sonne war untergegangen, und ein kühler Wind kam auf. Er fröstelte, aber er konnte den Blick nicht von dem Stück Papier nehmen, das vor ihm auf dem ovalen Steintisch lag. Er öffnete das Notizbuch und blätterte darin. Alle Seiten waren vollständig beschrieben. Die P&O-Bögen enthielten vermutlich den Schluss der Aufzeichnungen, da das Notizbuch nicht ausgereicht hatte.
Auf dem letzten Blatt sprang ihm ein Vers in die Augen. Und als er ihn las, hörte er ihre Stimme:
Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär,
und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer.
Komm, wir wollen uns näher verbergen …
Das Leben liegt in allen Herzen wie in Särgen.
Du, wir wollen uns tief küssen …
Es pocht eine Sehnsucht an die Welt
an der wir sterben müssen …
Phil legte die Bögen und das Notizbuch wieder hin und nahm erneut den kurzen Brief zur Hand. Immer wieder überflog er den ersten Absatz. Dann blieb sein Blick an einem Wort hängen. Er las es, wiederholte es leise und spürte dem Schauer hinterher, den es in ihm auslöste. Die uralte Kraft war ungebrochen. Er wollte sich dagegen wehren, doch er sah sogleich ein, dass es sinnlos war. Vipàssana, flüsterte er und versuchte, die Gefühle und Gedanken zu verstehen, die das Wort in ihm auslösten.
Innerhalb von wenigen Tagen war dies jetzt schon das zweite Gespenst, dem er begegnete. Erst Bernardo und jetzt das. Aber warum auch nicht? Was, außer Gespenster, sollte man in Europa erwarten? Nach solch einem Krieg. Er tastete seine Jacke nach Zigaretten ab, fand die Schachtel jedoch leer. Ohne Hast sammelte er die Papiere vor sich zusammen, erhob sich, ging ins Zimmer und legte sie auf dem Bett ab. Es würde eine lange Nacht werden. Oder begann hier das Ende einer langen Nacht? Er griff nach seinem Mantel und verließ das Zimmer, das rätselhafte Wort wie ein Gebet in seinem Kopf.
Vipàssana. Vipàssana.
Erster Teil
1.
Sie war ihm sofort aufgefallen.
Sie sah aus wie eine Filmschönheit. Vielleicht eines der vielen ausländischen Tanzmädchen, die in Babelsberg in monumentalen Streifen die exotischen Kulissen zu füllen hatten.
»Hübsch, die Kleine«, bemerkte Daniel, der neben ihm stand und seinem Blick gefolgt war.
Edgar zog die Augenbrauen hoch. Hübsch? Nein. Bildschön war sie. »Was meinst du, wo sie herkommt?«, fragte er.
Daniel zuckte mit den Schultern, drehte sich der Bar zu und machte dem Kellner ein Zeichen, dass er die Rechnung wünschte.
»Möglichkeiten gibt’s genug«, bemerkte er dann auf seine typische leicht spöttische Art. »Kommt darauf an, wer der Glatzkopf ist, den sie dabeihat.«
Edgar schaute aus dem Augenwinkel zum Tisch der beiden hinüber. Die Frau hatte sich ihrem Begleiter zugewandt, der mindestens doppelt so alt war wie sie. Er war sehr gut gekleidet, wahrscheinlich ein wohlhabender Ausländer mit Devisen.
»Sicher ein Diplomat«, riet Daniel. »Die haben immer so hübsche junge Dinger im Schlepptau.«
Edgar spürte, dass die Frau ihn schon wieder anschaute. Schwierige Sache. War sie die Frau von diesem Glatzkopf? Oder seine Geliebte? Vielleicht war sie überhaupt keine Frau, wie einige der Anwesenden hier. Schließlich war das Eldorado ein Treffpunkt für Angehörige des sogenannten dritten Geschlechts. Aber üblicherweise begann der Zirkus mit den Transvestiten erst gegen Mitternacht.
Daniel legte einige Münzen auf den Tisch.
»Du willst wirklich schon los?«, fragte Edgar mit bekümmerter Miene. »Was gibt’s denn heute?«
»Irgendwas von diesem Toller. Ich schreibe den Verriss nachher im Café Braun. Willst du später noch vorbeikommen?«
Daniel und seine Verrisse. Dabei war er viel gnädiger als die meisten anderen Kritiker. Immerhin blieb er stets bis zum Schluss.
»Aber ich sehe ja, du bist beschäftigt«, sagte Daniel grinsend. »Der Alte sieht kräftig aus, also sei lieber vorsichtig.«
»Ich muss auch gleich weg«, erwiderte Edgar, ohne auf den Spott einzugehen. »Robert holt mich ab.«
»Dein Vetter? Dieser Widerling. Gehst du immer noch mit ihm aus?«
»Familie, Daniel. Familie. Was soll ich denn machen. Außerdem ist er nicht so schlimm, wie er sich gibt. Harte Schale, weicher Kern.«
»Ein brauner Kern.«
»Ach, das ist jetzt Mode. Robert hat es schwer.«
Daniels Gesichtsausdruck hatte sich merklich verfinstert.
»Nun, ich will ihm lieber nicht begegnen. Ich muss los. Sehen wir uns morgen?«
»Sicher. Spaziergang am See. Wie wär’s?«
»Mal sehen. Rufst du an?«
Sie umarmten sich kurz. Während Daniel aufbrach, nutzte Edgar die Gelegenheit und erhaschte wieder einen Blick auf die unbekannte Schöne. Es war wirklich erstaunlich. Sie sprach zwar mit dem Glatzkopf, schaute aber schon wieder zu ihm herüber. Edgar beobachtete die anderen Gäste. Natürlich war er nicht der einzige Mann, der sie verstohlen musterte. Aber immerhin war er es, dem sie bisweilen einen Blick zuwarf. Nun ja, das musste nichts bedeuten. Wahrscheinlich hatte sie ihn für ihr gelegentliches Aufblicken ausgewählt, um sich nicht jedes Mal einem halben Dutzend interessierter Männeraugen aussetzen zu müssen. Sie schaute nicht ihn an, sondern durch ihn hindurch an allen anderen Männern vorbei.
Edgar sah auf die Uhr und dann zur Tür. Früher hatte sich Robert überhaupt nicht für ihn interessiert. Das hatte sich erst geändert, als Edgar ihm vor ein paar Monaten bei einem langweiligen Frühstück in einer Grunewalder Bankiersvilla von seinen nächtlichen Streifzügen durch das verruchte Berlin erzählt hatte. »Abartig«, hatte Robert nur erwidert, jedoch ein paar Tage später darum gebeten, einmal durch diese entartete Welt geführt zu werden. Seither waren sie ein paarmal zusammen unterwegs gewesen. Heute sollte es wieder passieren. Dass Robert zu spät kam, war jedoch ungewöhnlich. Er hasste Unpünktlichkeit. Slawen und Juden seien unpünktlich, pflegte er zu sagen. Aber kein Deutscher. Edgar kommentierte derartigen Blödsinn nicht.
Er überlegte, was er mit dem angebrochenen Abend anfangen sollte, falls Robert nicht mehr erscheinen sollte. Nach Hause gehen, sich ein Bad einlassen und den englischen Kriminalroman zu Ende lesen? Die Auflösung ahnte er bereits. Doch die Hauptfigur war ihm sympathisch. Er würde ihr die letzten Seiten auch noch folgen, vorausgesetzt, sie führten nicht zum Traualtar. Aber so plump waren englische Krimiautoren üblicherweise nicht, dass sie einen spannenden Mordfall in eine langweilige Ehe münden lassen würden.
»… erschien völlig rückenfrei«, sagte jemand neben ihm. »Ich meine, ein Ausschnitt vom Nacken bis zur Pospalte.«
»Die Frau des Ministers?«
»Ja doch, und dann sagt er zu ihr: Gnädige Frau, ich wünschte, Ihr Mann würde so viel Rückgrat zeigen wie Sie …«
Edgar versuchte den Übermittler dieser Pikanterie ins Auge zu fassen, aber der Mann hatte ihm den Rücken zugekehrt. Sein Gegenüber drehte sich soeben zum Barkeeper um und schnippte mit den Fingern. Hätte er vielleicht doch mit Daniel ins Theater gehen sollen? Aber Robert hatte ihn unbedingt an diesem Samstag sehen wollen. Edgars Theaterpläne hatten ihn nicht beeindruckt.
»Welchen verblasenen Quark willst du dir denn antun?«, hatte er gefragt.
Edgar hatte nicht die Wahrheit gesagt. Wozu seinen Vetter damit provozieren, dass er vorgehabt hatte, sich das neue Stück von diesem Erzkommunisten anzuschauen? Wenn er ehrlich war, hatte es ihn auch nicht weiter gestört, von diesem Theaterbesuch entbunden zu sein. Er ging ja meist nur Daniel zuliebe mit, der sich dieses Zeug anschauen musste, um sein Studentenleben zu alimentieren. Edgar hatte das glücklicherweise nicht nötig. Im Gegenteil. Von seinem üppigen monatlichen Wechsel aus Hamburg hätte Daniel leicht auch noch leben können. In gewisser Hinsicht war das auch der Fall. Edgar lud ihn regelmäßig zu Horcher ein und hatte ihm zum Nikolaustag sogar eine halbe Tonne Kohlen spendiert. Aber ins Theater gehen? Nein, so weit ging die Freundschaft dann doch nicht immer.
Im Grunde war das zeitgenössische Sprechtheater eine Zumutung. Es stimmte ja dort überhaupt nichts mehr. Einfach alles wurde republikanisiert, gerade so, als habe die Menschheitsgeschichte erst im November 1918 begonnen. Die meisten Klassikeraufführungen sahen derzeit so aus wie das Kaiserdenkmal in Bonn: verstümmelt (von fremden Besatzungstruppen) und rot angestrichen (von deutschen Kommunisten): ein unförmiger Klumpen.
Als die Frau ihn das nächste Mal anschaute, bekam er eine leichte Gänsehaut. Robert hin oder her, er würde in jedem Fall so lange bleiben, bis diese bildschöne Frau und ihr glücklicher Begleiter ihre Vorstellung hier beendet haben würden. Mein Gott, wie zwei Pfauen saßen sie da. Der Mann sah ebenfalls interessant aus. Sein großer, kahl geschorener breiter Schädel saß auf einem starken Nacken. Er trug einen eleganten Anzug, nach Edgars Geschmack allerdings etwas zu hell für die Jahreszeit. Schließlich war Winter. Aber vermutlich waren die beiden Ausländer. Vor einigen Stunden am Flughafen Tempelhof gelandet, hatten sie wohl im Adlon ein wenig ausgeruht und dann beschlossen, vor Beginn der Dreharbeiten morgen früh noch auf einen Sprung ins Berliner Nachtleben zu gehen. Vielleicht war er ihr Filmpartner oder ihr Produzent. Edgar schüttelte den Kopf über diese Abendblatt-Fantasien. Ebenso gut konnte es sich um einen Kaffeebaron handeln, der zur Grünen Woche eine seiner Pflückerinnen mitgebracht hatte. Aber die Grüne Woche begann erst am 20. Februar, also in zwei Wochen, und die Frau sah einfach zu elegant aus, um als Kaffeepflückerin durchzugehen. Ihre dunkle Haut, die tiefschwarzen Haare, die schlanken Oberarme, von den anderen Reizen, die sich unter einer ziemlich eng geschnittenen knallroten Bluse deutlich abzeichneten, gar nicht zu sprechen. Aus Berlin waren die beiden gewiss nicht. Solche Köpfe, wie dieser Mann einen besaß, wurden hier nicht gemacht. Ein hellhäutiger Othello, dachte Edgar. Kräftig und elegant, mit dunklen, nicht gerade vertraueneinflößenden Augen. Edgar hätte dem schätzungsweise Fünfzigjährigen sofort eine erfolgreich beendete Box- oder Ringkampfkarriere zugetraut. Allerdings fehlten ihm hierzu die Blessuren. Sein Gesicht sah durchaus ein wenig verlebt aus, aber nicht gezeichnet. Narben und eine gebrochene Nase hatte er jedenfalls nicht, und wie ein Kriegsveteran sah er auch nicht aus.
»Im Esplanade, beim Gesellschaftsabend vom baltischen Roten Kreuz«, vernahm er wieder vom Gespräch, das neben ihm in Gang war. »Söhne des Kaiserhauses sind da immer dabei. Aber eigentlich nur verarmte Gesellschaft. Das Komtesschen, mit dem ich getanzt habe, war Säuglingspflegerin …«
Edgar nahm etwas Abstand. Das geistige Niveau dieser Konversation war nun doch stark abgefallen. Man war beim Kaiserhaus angekommen. Als Nächstes würden die beiden vermutlich über den Kronprinzen reden und dann die Fürstenenteignung diskutieren. Die Volksabstimmung stand ja bevor. Jetzt wurde es hier doch wie im Theater. Man sah die Pointen kommen. Er schaute wieder zur Eingangstür, aber Roberts hochgewachsene Erscheinung war nirgends zu entdecken.
Dafür zupfte ihn jetzt der Barkeeper am Jackett und beugte sich über den Tresen: »Herr von Rabov?«
Er zog verwundert die Augenbrauen hinauf, denn er kam zwar seit geraumer Zeit regelmäßig hierher, aber diesen Barkeeper kannte er nicht.
»Ja?«, antwortete er.
»Telefonanruf für Sie.« Und damit schob er ihm einen Zettel hin. Edgar faltete ihn auseinander und las: »Kommen mit Kraftwagen. Bitte warten.«
Als er wieder aufschaute, saß sie alleine am Tisch. Nein, dieser Blick galt offenbar doch ihm, so merkwürdig das auch sein mochte. Ihre Augen schauten ihn ruhig an, fast zu ruhig für seinen Geschmack. War das eine Aufforderung? Unter normalen Umständen hätte ihm dieser Blick genügt. Unter Berliner Umständen, sozusagen, nach den Spielregeln der neuen Umgänglichkeit, die er seit seiner Ankunft hier vor zwei Jahren in vollen Zügen genoss. Aber da war etwas, das ihn zögern ließ. Und im nächsten Augenblick tauchte auch ihr Begleiter schon wieder auf. Othello, dachte er erneut, ohne recht zu wissen, warum. Irgendetwas an ihm erinnerte ihn an die Shakespeare-Figur. Die junge Frau wandte sich wieder ihrem Begleiter zu, und die beiden begannen zu plaudern.
Edgar schaute auf den Zettel in seiner Hand. Im Kraftwagen! Das konnte nur eines bedeuten: Roberts Vater, der Reichstagsabgeordnete Arthur von Rabov, wäre mit von der Partie. Edgar bestellte sofort eine Limonade und spülte sich den Mund aus. Schon Robert gegenüber fühlte er sich stets ein wenig unsicher. Doch Arthur von Rabov war die graue Eminenz seiner Familie! Wenn es jemanden gab, vor dem Edgar äußersten Respekt hatte, dann war er es. Edgars Vater hatte ihm zwar angedeutet, dass sein wichtiger und vielbeschäftigter Onkel in Berlin sich bald einmal mit ihm in Verbindung setzen würde, aber diese Ankündigung lag Monate zurück. Und jetzt kam er womöglich gleich hier vorgefahren, um ihn zu treffen? Ausgerechnet im Eldorado, in dieser Transvestitenbar! Mit Robert konnte man sich hier ja noch verabreden. Aber mit Arthur von Rabov? Warum hatte Robert ihm nicht gesagt, dass sein Onkel mitkommen würde? Die einzige Erklärung war, dass er es selbst nicht gewusst hatte, denn sonst hätte er Edgar bei ihrer Verabredung vor einigen Tagen ja schwerlich gebeten, sich eine neue »abartige« Vergnügung zu überlegen.
Soeben drehte sie den Kopf etwas zur Seite, und er sah sie jetzt zum ersten Mal im Profil. Wäre sie alleine oder mit einer Freundin da gewesen, wäre er spätestens jetzt zu ihr gegangen. Schon ihr Profil war umwerfend. Vor allem setzte die Seitwärtsbewegung des Kopfes ihre schöne dunkelbraune Haut von ihrer Wange über den Hals zu ihrem Nacken hinab unter eine köstliche Spannung. Aber ihr Begleiter irritierte ihn. Bei solch einer Frau half nur völlige Direktheit. Jegliche Strategie wäre hier fehl am Platz. Er würde sich nur lächerlich machen, sich in irgendwelchen Posen und Andeutungen verheddern. Aber in Anwesenheit dieses Mannes konnte er schwerlich so vorgehen. Ob die beiden ein Paar waren? Kaum vorstellbar, dass dieser Mann nicht wusste, was für eine Frau neben ihm am Tisch saß. Jetzt lächelte sie Othello an und legte ihm zärtlich die Hand auf den Unterarm. Und im gleichen Augenblick schaute der Mann auf, und sein Blick traf Edgar. Er erschrak und errötete. Doch das würde in der gedämpften Beleuchtung dieser Bar niemandem auffallen. Edgar sah zur Seite, spürte jedoch, dass jetzt sowohl Othello als auch die unbekannte Schöne zu ihm herüberschauten. Nach einigen Augenblicken hatte er seine kurze Verunsicherung wieder überwunden und blickte erneut in ihre Richtung. Doch der Tisch war jetzt leer. Und im nächsten Moment sah er sie auf sich zukommen. Sie trugen ihre Mäntel über dem Arm. Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, strichen sie an ihm vorüber auf den Ausgang zu. Zuerst sie, ein Wesen wie aus einem orientalischen Märchen. Danach ihr Begleiter. Edgar konnte ihr Parfüm riechen, so dicht ging sie an ihm vorbei. Doch was war das? Aber da waren die beiden bereits hinausgegangen. Edgar stand wie angewurzelt da. Der feste Druck ihrer Hand in seiner, ihr kaum merkliches Innehalten, die rasche und zugleich völlig unauffällige Bewegung! Träumte er? Er schaute auf seine Hand hinab.
Dann faltete er das kleine Stück Papier auf, das sie ihm zugesteckt hatte, und las mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und geheimer Freude die auf Englisch geschriebene Notiz: »Übermorgen hier. Gleiche Zeit. Ich erwarte Sie.«
2.
Edgar presste sein Gesicht gegen die Fensterscheibe und schaute ihnen nach. Sie hatte sich bei Othello untergehakt. Ohne jede Eile überquerten sie die Lutherstraße und steuerten auf das Scala-Varietétheater gegenüber zu. Edgar hoffte, dass sie sich noch einmal umdrehen würde, aber das geschah nicht. Die beiden verschmolzen einfach mit der Menge der wartenden Besucher, die sich vor dem Theater drängelten. Im nächsten Moment verdeckte ihm eine direkt vor dem Fenster zum Stehen kommende Maybach-Kraftdroschke die Sicht. Robert!
Edgar trat rasch vom Fenster zurück, ging zum Tresen, bezahlte und holte seinen Hut und Mantel. Warum trug Robert denn einen Frack? Er sah aus, als käme er von einem Empfang. Und warum presste er die Lippen derart zusammen und schaute um sich wie eine Dogge, die gleich beißen würde?
»Mein Vater wollte dich unbedingt heute Abend sehen«, fuhr er Edgar nervös an ohne ein Wort der Entschuldigung für die Verspätung. »Ich hatte keine Ahnung, und jetzt das hier.«
Edgar zuckte mit den Schultern und schob sich an seinem Vetter vorbei ins Freie. Natürlich war es ein wenig peinlich, von Arthur von Rabov aus einem Transvestitenlokal abgeholt zu werden. Aber da es nun schon mal nicht zu ändern war, hatte es wenig Sinn, sich irgendwelche Ausflüchte zu überlegen. Was Robert von ihm erwartete, war klar, und Edgar würde ihm natürlich gefällig sein.
»Was hast du ihm gesagt?«, fragte er kurz.
»Ich bin hier noch nie gewesen, verstehst du? Es war deine Idee!«
Edgar nickte nur und ging auf den geöffneten Wagenschlag zu. Nieselregen fiel ihm in den Nacken, als er sich herunterbeugte und den Hut abnahm. Der Geruch von Leder und Zigarrenrauch war das Erste, was er von seinem Onkel wahrnahm. Der Graf, in Frack und weißem Seidenschal, den Zylinder auf dem Schoß, saß rauchend auf dem Rücksitz. Er nickte Edgar zu, als der sich neben ihm niederließ. Robert schloss die Tür, ging um den Wagen herum und nahm vorne neben dem Fahrer Platz.
»Guten Abend, Edgar«, sagte von Rabov.
»Guten Abend, Graf. Welch eine Überraschung, dass Sie mich so unerwartet gesucht und in der Tat gefunden haben. Robert muss meinen ganzen Bekanntenkreis durchtelefoniert haben.«
»Habe ich auch«, ließ Robert sich vernehmen.
Arthur von Rabov erwiderte nichts, machte dem Fahrer ein Zeichen und sagte: »Hans, bitte fahren Sie.«
Der Maybach setzte sich in Bewegung und rollte mit surrenden Reifen über die regennasse Lutherstraße. Noch einmal geriet das hell erleuchtete Scala-Theater in Edgars Blickfeld. Dann verschwand es hinter ihm in der Nacht.
»Ich hoffe, wir haben keine wichtigen Wochenendpläne durchkreuzt«, sagte von Rabov.
»Nein, überhaupt nicht«, wiegelte Edgar ab. »Meine Zeit kostet ja noch nichts. Darüber können Sie gerne verfügen. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Nur …«, und er blickte auf Arthur von Rabovs Zylinder, »meine Garderobe ist nicht gerade comme il faut. Sollte ich mich vielleicht umziehen?«
»Nein. Das ist nicht notwendig. Robert und ich waren auf einem Empfang in der Italienischen Botschaft. Daher unser Aufzug. Wir werden nur eine Kleinigkeit zusammen essen, das ist alles.«
Er zog an seiner Zigarre und blies den Rauch durch das einen Spalt geöffnete Fenster in die Berliner Nacht hinaus. Es war kalt im Wagen. Edgar fröstelte. Er zog seinen Mantel fester um sich und bekam dabei den Zettel zu fassen, den das Mädchen ihm zugesteckt hatte. Die Erinnerung daran erschien ihm augenblicklich in einem anderen Licht. Wie naiv er doch war! Er kannte doch die mannigfaltigen Erscheinungsformen des Berliner Nuttengewerbes: die Kontrollmädchen, Fohsen, Dominas, Medizinmädchen, Münzis, Tischmädchen, Demi-Castoren, Mannequins, Chonten, Grashüpfer, und wie sie alle hießen, je nachdem, ob man drinnen oder draußen, teuer oder preiswert, sehr jung oder alt, hochschwanger oder flachbrüstig, allein oder in der Gruppe bedient werden wollte. Aber welche davon steckten ihren Freiern Briefchen zu? Das fiel durchaus aus dem Rahmen. Othello indessen passte gut ins Raster: irgendein Geldsack, der sich die bildhübsche Dollarnymphe für den Abend gemietet hatte. Und die geschäftstüchtige kleine Fohse hatte nebenher etwas Kundenwerbung für den lauen Wochenanfang betrieben, wenn das Geschäft schleppender ging. Oder warum wollte sie ihn sonst am Montag wieder treffen?
Die nächste Frage seines Onkels holte Edgar wieder in die Gegenwart zurück.
»Du siehst gut aus, Edgar. Was machen die Studien?«
Edgar warf Robert einen Blick zu, aber der hatte sich mittlerweile von ihnen weggedreht und schaute auf die Straße hinaus.
»Gut, gut«, log er. Er hatte seit Monaten keinen Hörsaal mehr betreten und die üppigen Wechsel aus Hamburg für alles Mögliche ausgegeben, aber nicht für das Studium von Syntheseverfahren oder Spektralanalysen. Chemie ödete ihn an. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass sein Vater in Hamburg eine Kunstfarbenfabrik besaß, die er irgendwann erben und leiten würde. Es gab genügend Leute, die sich mit diesen Dingen auskannten und die er dafür bezahlen könnte, schnell trocknende Schiffslacke oder dergleichen zusammenzurühren. Wozu sollte er sich mit solchem Zeug beschäftigen? Die einzigen Vorlesungen, die er noch besuchte, betrafen Nationalökonomie und Philosophie, Ersteres wegen der weiblichen Studenten, die dort merkwürdigerweise stark vertreten waren, Letzteres aus Gründen, die ihm selber unerklärlich waren. Es musste ein Reflex von früher sein. Eine Philosophiestunde glich ja einem Gottesdienst. Man ging hin und schluckte sich an enttäuschten Erwartungen hungrig.
»Das freut mich zu hören, Edgar. Es ist wirklich schlimm. Wie lange bist du jetzt schon hier? Zwei Jahre. Fast drei. Und wir haben uns kaum gesehen. Ich meine, durch Robert war ich ja wenigstens immer ein bisschen auf dem Laufenden. Aber es ist ein Jammer, dass wir uns so selten begegnen. Das wird sich aber ändern, mein Junge. Und um das Ganze auf ein neues Gleis zu stellen, erst einmal weg mit diesen Formalien. Herrgott, wir sind ein Fleisch und Blut, nicht wahr? Also: Ich bin Arthur.«
Damit zog der Graf den dunkelbraunen Handschuh seiner rechten Hand aus und hielt diese Edgar hin. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah, ergriff jedoch die Hand seines Onkels, die sich warm und weich um die seine schloss.
»Ich … ich freue mich sehr«, sagte er unsicher.
»Wir müssen zusammenhalten, Edgar«, fuhr Arthur mit eindringlicher Stimme fort. »Wir haben unsere Familienbande viel zu lange brachliegen lassen. Die heutige Zeit gestattet weiß Gott keine Nachlässigkeit in diesem Bereich. Feinde, wo man hinschaut, und anstatt zusammenzurücken, geht ein jeder seiner eigenen Wege und weiß nichts vom anderen. Das ist unsere große Schwäche, findest du nicht auch?«
»Durchaus«, erwiderte Edgar verwundert. Er musterte seinen Onkel verstohlen. Arthur von Rabov war eine denkwürdige Erscheinung. Selbst der exquisite Frack und der glänzende Zylinder, die er mit weltmännischer Selbstsicherheit trug, konnten den Eindruck nicht zerstreuen, dass er eigentlich verkleidet war. Auf kaum beschreibbare Weise sprach aus all seinen Reden und Gesten immer jene untergegangene Welt, aus der er stammte: die Welt des Adels, des Kaisers. Stattlich, wie er war, schien er eigentlich für die Paradeuniform eines Grenadiers gemacht. Es fiel Edgar fast leichter, sich ihn als Flügeladjutant eines Landesherrn vorzustellen, mit Silberschärpe, Adjutantenschnüren und mit aufgestecktem Helmbusch, als ihn in Rock und Zylinder vor sich zu sehen. Alles an dem Mann atmete alten Adel, nicht zuletzt das Monokel, mit dem er das in diesen Kreisen unverzeihliche Gebrechen einer leichten Sehschwäche standesgemäß ausglich. Brillen galten als unvereinbar mit körperlicher Gewandtheit und militärischer Schneidigkeit und waren daher verpönt. Kneifer gingen gerade noch so durch, aber wirklich standesgemäß war eben nur das Monokel, welches selbstverständlich frei und ohne schwarzseidene Notleine im Auge zu tragen war.
»Vor allem jetzt, wo es deinem Vater so schlecht geht«, fügte der Graf hinzu. »Hast du von Edith gehört?«
»Ja. Großmutter hat gestern angerufen. Es klang aber so, als sei Vaters Zustand stabil.«
»Ja. Schon. Aber wie lange noch?«
Edgar erwiderte nichts. Er wollte nicht an Hamburg denken, das Unternehmen, die Verantwortung, die auf ihn wartete. Aber er ahnte bereits, dass dies der Grund war, warum Arthur ihn heute sprechen wollte. Edgar schaute ihn von der Seite an. Das Gesicht des Grafen fügte sich in seinen wesentlichen Merkmalen nahtlos in die Reihe aller anderen von Rabovs ein. Sein Kopf war eher oval als rund und ein wenig in die Länge gezogen, was aber durch eine abgeflachte Kinnpartie wettgemacht wurde. Wie alle von Rabovs hatte er ein wenig müde wirkende Augen, aus denen ein oberflächlicher Betrachter irrtümlich einen Zug von Resignation herauslesen konnte. Indessen sprach die Mundpartie eine ganz andere Sprache, bildete gewissermaßen in dieser Familie den Ort, an dem die Leidenschaften sich zu zeigen pflegten. Arthur von Rabov verfügte nicht über die sinnlichen Lippen seiner Schwester Agnes oder seiner Mutter Edith, aber die insgesamt fast feminin geschwungene Mundpartie gab diesem ansonsten hochmütig und distanziert wirkenden Gesicht einen Anflug von Wärme und Anteilnahme, die Robert merkwürdigerweise völlig fehlte. Robert hatte überhaupt wenig Rabovsches an sich, ausgenommen vielleicht die dünkelhafte Attitüde, die bei ihm jedoch leicht einen Zug ins Derbe annehmen konnte.
Der Wagen bog nach links ab, was Edgar erstaunte. Er hatte erwartet, in eines der großen Hotels ausgeführt zu werden, ins Adlon oder ins Esplanade, denn es war ja neuerdings üblich, dass die Berliner Gesellschaft ihre Gäste in Hotelrestaurants empfing. Außerhalb der großen Hotels war selbst für viel Geld nur mit Glück etwas Genießbares zu finden. Lediglich eine Handvoll Restaurants führte französische Küche, in der mit Butter gebraten wurde. Da sie jedoch Richtung Westen fuhren, konnte es weder zu Peltzer noch zu Borchardt oder Löffler gehen. Am Horcher, das wie das Eldorado in der Lutherstraße lag, waren sie zu Edgars großem Bedauern soeben vorbeigefahren. Das Tournedos Rossini, das der Chefkoch Poncini dort servierte, gehörte zu Edgars festen Stationen während des ersten Monatsdrittels, wenn der Wechsel aus Hamburg eingetroffen war. Der Oberkellner Martius war der einzige Berliner Kellner, der ein eigenes Auto besaß, woran sich die Zufriedenheit der Stammgäste am besten ablesen ließ. Nach dieser enttäuschenden Linkskurve zum Wittenbergplatz hin blieb eigentlich nur noch Schwannecke in der Rankestraße, ein, wie Edgar sofort befand, unwahrscheinlicher Ort für seine beiden Verwandten, die er sich zwischen Schauspielern und Kabarettgrößen nicht so recht vorstellen konnte. Tatsächlich rollte der Wagen auch an der Rankestraße vorbei und schlug eine Richtung ein, die auf Edgars gastronomischem Stadtplan überhaupt nicht existierte.
Sie hielten schließlich im Spreebogen, auf der etwas unbestimmbaren Grenze zwischen Charlottenburg und Moabit, einem noch unentschiedenen Stadtbezirk zwischen aufstrebender Kleinbürgerlichkeit und drohendem Abstieg in die Proletarierklasse. Edgar betrachtete entgeistert die Fenster des Restaurants, vor dem sie ausstiegen. Eine dumpfe Butzenscheibengemütlichkeit schimmerte daraus hervor. Hier wollte Arthur von Rabov mit ihm essen gehen? Es handelte sich unzweifelhaft um ein Etablissement, das mit dem Begriff »gutbürgerlich« in seiner ganzen Schauderhaftigkeit erschöpfend umrissen war. Man würde dort Sauerbraten vorgesetzt bekommen, mit einer Generalsoße von unbestimmter Farbe übergossen, ferner Flammerie, ein zittriges Etwas, das hier als Dessert galt. Dazu das obligate Bier mit Limonade als Gipfel der Gaumenfolter.
Arthur von Rabov schien die Gedanken seines Neffen lesen zu können, denn er legte beruhigend den Arm um ihn und sagte: »Es muss sein. Wir treffen hier jemanden.«
Hier? Warum hier? Es konnte für die Wahl dieses merkwürdigen Ortes nur eine Erklärung geben: Der Graf wollte nicht gesehen werden.
Edgar warf Robert einen fragenden Blick zu, aber der beachtete ihn gar nicht, sondern marschierte auf die Eingangstür zu. Der Art nach zu schließen, wie er sie aufriss, war ihm dieser Ort vertraut. Edgar hatte das Gefühl, den Innenraum einer Kuckucksuhr zu betreten. Überall Holzvertäfelung und Hirschgeweihe. Auf massiven Eichenbänken saßen Männer um schwere Holztische herum und unterhielten sich. An diesem Ort trank jeder Bier, welches in schweren Krügen serviert wurde. Indessen durchquerte Robert, ohne nach links oder rechts zu schauen, den Schankraum und öffnete an dessen Ende eine mit Bleiverglasung durchsetzte Holztür, die in einen Hinterraum führte. Edgar folgte ihm verwundert. Arthur betrat hinter ihm den Raum und schloss die Tür hinter sich wieder. Der einzige Gast war ein Mann, der sich jetzt erhob und Robert die Hand schüttelte.
Arthur schob Edgar sanft vor sich her und sagte dann: »Freiherr, guten Abend. Darf ich vorstellen: mein Neffe, Edgar Falkenbeck-von Rabov.« Und dann, zu Edgar gewandt: »Freiherr von Gall möchte deine Bekanntschaft machen.«
»Graf, es ist mir eine Freude«, sagte der Mann und reichte Edgar die Hand. »Bitte, nehmen Sie Platz.«
Edgar war sprachlos. Er musterte den Tisch, an dem bis vor Kurzem noch eine andere Person gesessen haben musste; jemand, der Juno-Zigaretten geraucht, zwei Bier getrunken und aus Nervosität, Erregung oder Langeweile mehrere Bierfilze zerbröselt hatte. Eine Ausgabe der Berliner Arbeiter-Zeitung, schwerlich die Lektüre eines Freiherrn, lag außerdem da. Offenbar hatte von Gall hier zuvor jemanden getroffen, mit dem zusammen er nicht unbedingt gesehen werden wollte. Das war also der Grund für dieses Treffen im Hinterzimmer dieser Kaschemme.
»Ihr Onkel hat Ihnen vermutlich schon gesagt, worum es geht?«, fragte von Gall.
»Nein«, warf Arthur von Rabov ein. »Mein Neffe ist noch nicht im Bilde.« Dann wandte Arthur sich Edgar zu und erklärte: »Freiherr von Gall ist wie ich Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei.«
Edgars Blick ging von einem zum anderen. Eine dunkle Ahnung beschlich ihn. Er fixierte seinen Vetter Robert, der seinem Blick nicht auswich, sondern ihn ernst und durchdringend anschaute, bevor er kurz angebunden sagte: »Es wird Zeit, dass du etwas für dein Land tust, Edgar.«
»Das weiß Edgar schon selbst«, warf Arthur vermittelnd ein. »Er hatte bisher mit seinem Studium zu tun und sollte sich ja auch ein wenig austoben, nicht wahr, Edgar? Aber allmählich ist der Zeitpunkt gekommen, da du dich dafür interessieren solltest, wie unser aller Schicksal sich gestaltet. Als Freiherr von Gall vor einigen Tagen erfuhr, dass du noch nicht einmal Mitglied bei uns bist, bat er mich darum, dich kennenlernen zu dürfen.«
Edgar war viel zu perplex, um etwas erwidern zu können. Freiherr von Gall ging augenblicklich dazu über, ihm auseinanderzusetzen, dass jeder aufrechte Deutsche gefordert sei, nach dem Verrat von Locarno den Kampf gegen die Erfüllungspolitik aufzunehmen. Insbesondere Edgar, als zukünftiger Erbe eines deutschen Unternehmens und als Angehöriger des einzig zur Führung befähigten Standes, sei geradezu verpflichtet, den Kampf gegen die rote Gefahr und den parlamentarischen Brei aufzunehmen. Nach dem Dawes-Plan und Locarno sei die anstehende Volksabstimmung zur Fürstenenteignung nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur endgültigen Bolschewisierung des Landes. Man habe Deutschland entwaffnet und versklavt. Jetzt gehe es darum, ihm auch noch sein Herz, seine Seele, sein Wesen zu rauben, um es in einen bewusstlosen Ameisenstaat zu verwandeln, den man nach Belieben ausbeuten könnte.
Edgar lauschte, sah zu, wie volle Bierkrüge auf dem Tisch erschienen, und begann alsbald zu überlegen, wie er aus dieser unangenehmen Situation so rasch wie möglich wieder herauskommen könnte.
»Es ist doch selbstverständlich, dass ich dagegen stimmen werde«, erklärte Edgar, um sich weitere Ausführungen zu ersparen. »Aber die ganze Sache ist doch ohnehin albern. Die Abstimmung wird niemals Erfolg haben. Die Leute durchschauen doch, was dahintersteckt.«
Aber da war sein Onkel ganz anderer Ansicht.
»Edgar«, sagte er, »noch nicht die Hälfte der Leute, die jetzt von den Roten zum Volksbegehren geschleppt werden, weiß überhaupt, worum es sich handelt. Die Leute glauben, dass das Volk drei Milliarden an die Herrscherhäuser zahlen soll. Dabei geht es ja nur darum, den Hohenzollern und den Übrigen einen Teil ihres Eigentums aus der durch die Revolution beschlagnahmten Masse zurückzugeben. Die ganze Agitation soll das Volk vergessen machen, dass während der ›Revolution‹ fünf Milliarden Goldmark rechnungslos veruntreut worden sind. Zwei Milliarden haben die Arbeiter- und Soldatenräte den Behörden und Privatleuten abgepresst. Die Entente hat zweiundfünfzig Milliarden Goldmark aus dem Land geraubt. Laut Dawes-Plan müssen jährlich fast drei Milliarden abgeliefert werden. Und die Roten sagen, die Fürsten saugten das Land aus. Dabei sind sie es selber, die Novemberlinge, die dem Landesfeind in die Hände spielen.«
»Man lässt die einfältigen Leute sogar in dem Glauben, das Geld würde ihnen zufließen«, meldete sich Freiherr von Gall wieder zu Wort. »Im Wedding gibt es bereits Listen, auf denen die Leute sich mit Namen und Adressen eintragen, mit dem Stockwerk sogar, damit das Fürstengeld auch ja bei ihnen eintrifft. Heute Abend habe ich erfahren, dass im schwäbischen Oberland Dorfschultheiße die Leute aufstacheln, für die Enteignung zu stimmen, um sich Waldstücke von kleinen Landadeligen, die mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, unter den Nagel zu reißen. Die wo net unnerschreibe«, äffte er voller Verachtung den schwäbischen Tonfall nach, »kriege nix vom Fürschtewäldle. Bolschewismus, schwäbischer Bolschewismus.«
Edgar wusste nicht, was er erwidern sollte, und zuckte hilflos mit den Schultern.
»Die Sache ist«, ließ sich jetzt Robert vernehmen, »dass wir etwas tun müssen. Du musst etwas tun.«
Edgar antwortete nicht. Irgendwann hatte es ja so kommen müssen. Er war aus Hamburg weggegangen, um dem Drängen seines Vaters zu entgehen, den ewigen Vorhaltungen und Vorwürfen, er solle endlich damit beginnen, sich um das Familienunternehmen zu kümmern. Mit viel Geschick und Überredungsgabe war es ihm gelungen, das Studium in Berlin durchzusetzen. Doch jetzt griff auch noch der andere Familienzweig nach ihm und versuchte, ihn in eine Welt zu ziehen, die ihm noch mehr zuwider war als das Universum von Kaufleuten: die Politik. Was hatte er damit zu schaffen? Er schaute seinen Onkel an und sagte: »Ihr sitzt im Reichstag und beschäftigt euch mit diesen Dingen. Ich bin Student. Was sollte ich schon tun können?«
Arthur machte eine wegwerfende Handbewegung, und Edgar erinnerte sich, dass sein Onkel ihm ja vor einer halben Stunde erst das Du angeboten hatte. Aber es wollte ihm so leicht nicht über die Lippen kommen.
»Der Reichstag ist eine Schmierenkomödie«, seufzte von Rabov. »Er wurde in Weimar in einem Theater erfunden, und dort gehört er auch hin. In die Requisitenkammer einer Provinzbühne. Stattdessen lässt ein ganzes Volk sich von der Posse dieser Ausschüsse und Unterausschüsse blenden, während England, Frankreich und die USA genüsslich die Welt unter sich aufteilen. Und wenn die Aufteilung vollzogen ist und die Entente sich satt gefressen hat, dann werden wir den Russen als Nachspeise gereicht …«
»Die Nachspeise des jüdischen Industriekapitalismus«, warf Robert mit hasserfüllten Augen ein und nahm einen großen Schluck aus seinem Bierkrug. Arthur von Rabov warf seinem Sohn einen Blick zu, den Edgar nicht zu deuten wusste. Dann fuhr er fort: »Du wirst bald kein Student mehr sein, Edgar, sondern nach Hamburg zurückkehren. Dann ist es zu spät, hier in der Hauptstadt die notwendigen Kontakte zu knüpfen, die du brauchst, um der Bewegung dienlich sein zu können. Heute Abend ist erst der Anfang, Edgar. Freiherr von Gall und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir die notwendigen Kontakte und Bekanntschaften zu vermitteln, die für das politische und wirtschaftliche Überleben unserer Familie notwendig sind. Du musst eingeführt sein. Wir zählen auf dich. Diese Republik ist über dem offenen Grabe geboren. Sie kann nur untergehen. Allein zum Zweck der Lähmung des deutschen Volkes ist sie geschaffen worden. Aber das Volk wird sich nicht dauerhaft von demokratischen Formen und Floskeln ersticken lassen. Die Frage ist, wie wir uns frei machen von diesem System der Ausschüsse, der Kommissionen, der Verzehrung aller Kräfte in Rede und Gegenrede. Die Massenherrschaft ist ein monströser Widersinn. Deshalb müssen wir alles tun, diesen Widersinn bis zu dem Punkt zu treiben, wo er so augenfällig wird, dass der Ruf nach dem einzig vorstellbaren Retter sich wie von selbst einstellt.«
Der einzig vorstellbare Retter. Der Satz ging Edgar noch lange im Kopf herum. Am Ende hatte er dem Gespräch nur noch schweigend gelauscht. Freiherr von Gall hatte über ein Treffen mit einem wichtigen Kontaktmann aus der Nazipartei berichtet, der ihm versichert hatte, Hitler werde den linken Flügel der Partei in der Frage der Fürstenenteignung aufs Schärfste zurückpfeifen. Außerdem werde demnächst ein neuer Gauleiter nach Berlin geschickt. Der Mann heiße Goebbels. Er werde dort aufräumen und die Bewegung auf Spur bringen. Es seien aber auch andere Aktionen geplant. Die Berliner Arbeiter-Zeitung der Brüder Strasser sei Hitler zu sozialistisch und nicht national genug. Es müsse eine andere Zeitung her. Das alles sei schon abgesprochen. Edgar traute seinen Ohren kaum. Sein Onkel und dessen Parteikollegen wollten das neue Berliner Kampfblatt der Nationalsozialisten mit aufbauen? Und er sollte mithelfen, Geld dafür zu beschaffen?
Edgar saß im Wagen und starrte in die Nacht hinaus. Sein Onkel richtete manchmal das Wort an ihn, doch er antwortete nur einsilbig. Was hatte er mit Politik zu schaffen? Er erklärte, er werde über alles nachdenken und sich in den nächsten Tagen melden.
»Das hoffe ich«, sagte Arthur von Rabov, als er an der Charlottenstraße ausstieg. »Robert, du fährst doch auch nach Steglitz, oder? Da kannst du Edgar ja begleiten. Sie, Hans, können danach für heute Schluss machen. Morgen brauche ich Sie erst gegen Mittag. Gute Nacht.«
Edgar hätte liebend gern darauf verzichtet, nach Hause gefahren zu werden, aber es war wohl nicht zu verhindern. Robert nahm nun hinten neben ihm Platz.
»Von Gall fand dich sympathisch, das habe ich gleich gemerkt. Morgen ist Sonntag. Da ist Jour fixe bei ihm in seinem Haus in Lichterfelde. Willst du nicht mitkommen? Es werden wichtige Leute da sein.«
»Nein, morgen geht es nicht. Ich bin verabredet.«
»Na gut, dann vielleicht am Montag? Da treffen wir uns bei mir, um eine kleine Sache im Wedding vorzubereiten. Jede Hand kommt uns recht. Mensch, Edgar, es wird wirklich Zeit, dass du uns hilfst!«
Edgar erwiderte nichts. Er kam sich plötzlich wie in einem Gefängniswagen vor. Robert ging ihm auf die Nerven, doch er kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass es wenig Sinn hatte, ihm zu widersprechen. Außerdem war er jetzt zu müde. Er würde morgen in Ruhe über diesen merkwürdigen Abend nachdenken und sich dann überlegen, wie er sich herauswinden könnte. Doch im nächsten Augenblick nahm der Abend eine völlig unvorhergesehene Wendung.
»Hans!«, schrie Robert plötzlich. »Hans! Halten Sie an!«
Edgar schrak auf. Was war los? Sie waren kurz zuvor von der Französischen Straße abgebogen. Rechter Hand säumte ein Bretterzaun die Fahrbahn. Offenbar wurden dahinter Bauarbeiten durchgeführt. Es regnete noch immer leicht.
Die straßenseitige Tür war aufgerissen und schwang soeben leicht zurück. Alles lag still und verlassen da. Nur Roberts eilige Schritte auf dem Asphalt klangen durch die Nacht. Und dann ein schneidender Ruf: »Heda!«
Edgar drehte sich um und versuchte aus dem ovalen kleinen Fenster hinauszuschauen. Doch er konnte nichts erkennen. Roberts Stimme erklang erneut, noch um einen Grad schärfer. »He!« Dann erklang ein schepperndes Geräusch, als sei ein Eimer umgefallen. Edgars Herz begann zu klopfen. Was war denn da nur los? Er öffnete nun seine Tür und stieg aus. Plötzlich hörte er einen kurzen, hellen Schrei und dann kurz hintereinander zwei dumpfe Schläge. Ein Überfall!, schoss es Edgar durch den Kopf. Robert hatte einen Überfall beobachtet und helfen wollen. Edgar stürmte los. Die Knie zitterten ihm, aber er konnte doch nicht einfach nichts tun. Nach einigen Schritten versperrte ihm eine umgestürzte Holzleiter den Weg. Daneben lag ein umgefallener Blecheimer. Irgendeine Flüssigkeit quoll daraus hervor. Und dann sah er Robert. Etwa zehn Meter weiter kniete er auf dem Gehsteig über etwas Dunklem. Edgar kam näher. Dann hörte er ihn fluchen. »Verdammtes Pack. Da, du dreckiges rotes Aas.« Ein erstickter Schrei, gefolgt von einem Würgen, war jetzt zu hören. Ein Plakatkleber, durchfuhr es Edgar. Robert verprügelte einen Plakatkleber! Jetzt hatte er den Schauplatz der Szene erreicht. Im gleichen Augenblick stand Robert auf, riss den Menschen, den er bis eben mit Faustschlägen traktiert hatte, mit sich hoch und hielt ihn Edgar direkt vors Gesicht. »Sieh sie dir an«, schnaubte er zornbebend, »diesen Abschaum.« Der Plakatkleber war ein Junge. Er mochte vielleicht fünfzehn oder sechzehn sein. Sein Mund war blutig, seine Lippen waren aufgerissen, und aus einer große Platzwunde auf seiner Stirn quoll Blut hervor und floss ihm in die Augen. Edgar wich zurück. Aber Robert folgte ihm einfach. Den halb bewusstlosen Jungen schleifte er mit sich wie eine Puppe. Dann, auf halber Strecke zum noch immer wartenden Wagen, schien er es sich anders zu überlegen. Er schleuderte sein Opfer einfach gegen den Bretterzaun, von dem die halb aufgeklebten »Spartakus«-Plakate herabhingen. Voller Wut ergriff er dann den Eimer mit Leim und schleuderte ihn mit aller Kraft in Richtung des reglosen Körpers. Er krachte nur knapp neben dem Kopf des Jungen gegen das Holz.
Edgar wich weiter zurück und stützte sich kurz mit einem Arm auf den Kotflügel des wartenden Wagens. Dann begann er zu laufen. Ihm war speiübel. Er lief, so schnell er konnte. Er hatte keine Ahnung, wie viele Abzweigungen und Straßenbiegungen er im Laufschritt hinter sich gebracht hatte, bevor er langsamer wurde. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war der Gesichtsausdruck des Fahrers gewesen. Er hatte Edgar völlig verständnislos angeschaut, als dieser an ihm vorbeihastete, als verstehe er die Aufregung gar nicht. Das Bild verfolgte ihn auf dem ganzen Heimweg: der Maybach mit laufendem Motor, die Lichtkegel und in der Dunkelheit dahinter sein Vetter, der einem kleinen Arbeiterjungen, der kommunistische Plakate klebte, die Zähne einschlug.
Sogar in der Leere und Stille der nächtlichen Straßen von Steglitz klopfte sein Herz noch vor Aufregung. Die Kälte kroch ihm in die Knochen. Es hatte ein wenig geschneit. Schneepfützen zogen sich über den Gehsteig. Ein Bad, dachte Edgar. Ein Bad und einen Whiskey. Das war der einzig denkbare Abschluss dieses furchtbaren Abends.
Ohne den Mantel auszuziehen, ging er zuerst zum Kachelofen und legte Briketts nach. Eine Weile lang lauschte er dem pochenden Geräusch des hochfeuernden Ofens. Dann verschloss er ihn, regelte die Kaminklappen und setzte sich, noch immer in seinen Mantel gehüllt, in das dunkle Wohnzimmer und wartete.
Der Whiskey tat seine Wirkung. Er fühlte sich allmählich entspannter. Er wollte rauchen. Er durchsuchte seine Taschen nach Zigaretten, bekam dabei aber stattdessen den Zettel zu fassen, den ihm das Flittchen im Eldorado zugesteckt hatte. Dann fand er endlich sein Päckchen Juno und das Feuerzeug. Während er die ersten Züge machte, überflog er die mit Bleistift geschriebene Zeile. »Übermorgen hier. Gleiche Zeit. Ich erwarte Sie.«
Er trank einen weiteren Schluck, inhalierte genussvoll den Rauch und betrachtete den Zettel. Und wenn sie doch kein Flittchen war? Oder doch? Und wenn schon.