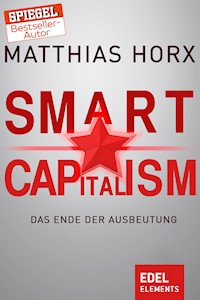11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Was unsere Welt bewegt
Megatrends markieren die großen Veränderungen der Gesellschaft, sie wirken global, langfristig, tiefgreifend: die Globalisierung etwa, die Verschiebung der Altersstruktur, Individualisierung oder die immer wichtigere Rolle der Frauen. Matthias Horx beschreibt die innere Dynamik dieser Treiber des Wandels und erläutert ihre Rolle für den Fortschritt in den komplexen Zusammenhängen der modernen Welt. Vielen erscheint diese unübersichtlich, chaotisch, auf dem Weg in den Abgrund. Dabei sind heutige Gesellschaften aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und Vernetzung robuster und viel eher in der Lage, neue Wege einzuschlagen. Wie immer ideensprühend und unterhaltsam verknüpft Matthias Horx die Analyse der Wandlungskräfte mit einem Blick auf die wichtigsten Megatrends.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Seit ich denken kann, versuche ich herauszufinden, was die Welt vorantreibt und wie die Zukunft funktioniert. Ist alles nur ein bizarrer Zufall, der uns Homo sapiens auf einen »unbedeutenden Planeten am Rande einer mittelmäßigen Galaxie« (der Astrophysiker Stephen Hawking) abgesetzt hat? Gibt es in der Entwicklung der menschlichen Zivilisation einen Großen Plan, eine Blaupause, einen Sinn, den wir dechiffrieren können?
Oder lassen sich wenigstens beschreibbare Kräfte ausmachen, die die Welt vorantreiben und in eine bestimmte Richtung verändern?
Was wird passieren, in der langen, langen Zeit, in der wir tot sind?
Ist es die Technik, die vorgibt, was morgen geschieht? Dann müssten wir, getreu den Träumen unserer Jugend in den sechziger und siebziger Jahren, eigentlich längst in Raumstationen leben und fröhlich mit Atomautos durch eine ewige Freizeit düsen. Oder uns in virtuelle, unsterbliche Wesen verwandelt haben. Oder demnächst verwandeln.
Vielen Menschen erscheinen andere Varianten des Morgen inzwischen viel plausibler: der Untergang zum Beispiel, das Scheitern der Zivilisation. Sie sind überzeugt, dass alles in einer Art Superkrise enden muss. Sieht man nicht überall die Zeichen an der Wand? Das beliebteste Doppelwort in den Medien lautet heute »Noch nie!«. Noch nie lebten Menschen in einer Zeit so durchgreifender Veränderungen, alarmierender Verunsicherungen, unaufhaltsam beschleunigten Fortschritts. Noch nie war die Menschheit so bedroht durch Naturkatastrophen, Atomunfälle, Terrorismus, Tsunamis, Klimaextreme, Bürgerkriege, Finanzkrisen, Euro-Krisen, Rohstoffverknappungen und so fort …
In der Formel vom »Noch nie« findet sich das, was wir in der Zukunftspsychologie (ja, eine solche Disziplin gibt es) »Gegenwartseitelkeit« nennen. Wer möchte nicht in einer exklusiven Schlüsselzeit leben? »Wohl dem, der in bewegten Zeiten lebt«, sagen sogar die harmonieverbundenen Chinesen. Aber im Vergleich zur sozialen und materiellen Welt, in der unsere Vorfahren lebten, ist unsere Epoche wahrscheinlich gar nicht so prekär und gefährlich, wie die Alarmismus-Gurus und Apokalypse-Propheten es uns weismachen wollen. Untergangsglaube, Angstmachen, Zuspitzung um jeden Preis sind zu einem Riesengeschäft geworden. Kein Wunder, angesichts einer Medienlandschaft, in der Tausende von Funk- und Fernsehkanälen um die rare Ressource Aufmerksamkeit konkurrieren. Womit könnte man besser Aufmerksamkeit generieren als mit Übertreibung, Untergangsgeraune, nie dagewesenen Gefahren?
Dieses Buch ist für all jene geschrieben, die sich nicht ins apokalyptische Bockshorn jagen lassen wollen. Es spürt vielmehr den Kontinuitäten nach, die uns in die Zukunft begleiten, und handelt von der Robustheit und Verlässlichkeit der menschlichen Entwicklung. Von jener (dynamischen) Stabilität, die ausgerechnet durch Wandel entsteht.
Diesem Aspekt können wir uns am besten durch Megatrends nähern. Jene massiven, lang andauernden Triebkräfte des Wandels, die gesellschaftliche, soziale, ökonomische Systeme transformieren. Von der Verstädterung über die Individualisierung bis zur Verschiebung der Altersstrukturen. Von der Globalisierung über die Bildung bis zur » Vernetzwerkung« unserer Welt durch das Internet.
Wer den Begriff »Megatrend« hört, denkt zunächst an gewaltige Kräfte, die wie Tsunamis über uns hinweg rollen, alte Gewohnheiten zertrümmern und keinen Stein auf dem anderen lassen. Aber nichts ist falscher als das. Megatrends wirken langsam und graduell. Sie verändern unsere Welt von innen heraus, als Entwicklungsagenten des Morgen, das zugleich ein komplexeres Gestern ist. Sie sind »konservativ« und »progressiv« zugleich. Ihre rekursive Dynamik gilt es zu entschlüsseln, um Zukunft zu verstehen.
Doch Megatrends ergeben keinen »Sinn«, wenn wir nicht verstehen, worauf sie einwirken und woraus sie entstehen. Die ökonomischen, politischen, kommunikativen Systeme, die sich zu dem verdichten, was wir »Gesellschaft« nennen. Aber auch die Systeme der Natur, der Evolution selbst. In der klassischen Ordnung der Wissenschaften gibt es hierfür jeweils eine eigene, separate Disziplin: Ökonomie kümmert sich um Wirtschaft, Soziologie um das Gesellschaftliche, Biologie um Naturprozesse. Human- und Naturwissenschaften bleiben in aller Regel getrennt. Aber genau hier liegt das Problem, da partikulares Denken von dem, was vor uns liegt, nur »Bahnhof versteht«. »Die Welt ist ein reichhaltiges, vielgestaltiges, verwobenes Gefüge aus vielen Erklärungen und Erklärungsebenen, die integriert werden müssen, um zur Grundlage für effiziente Voraussagen und Handlungen zu werden.« So formuliert es die Systemforscherin und Biologin Sandra Mitchell in ihrem wunderbaren Buch »Komplexitäten«.1 Es sind vor allem drei neue »Schnittstellen-Wissenschaften« die uns bei diesem Integrationsversuch helfen können:
Die soziale System- und Spieltheorie. Mitten im Kalten Krieg entwickelten Supernerds wie John von Neumann, Thomas Schelling und John Nash die Grundlagen einer Disziplin, die die Interaktionen von Menschen als »fortlaufende Spiele« begreift. Zunächst nur in militärischen Planspielen angewandt, hat die Spieltheorie seitdem gewaltige Fortschritte gemacht. Heute lassen sich ganze soziale Systeme im Rahmen von computergestützten Modellen simulieren. Wie große Gruppen von Einzelwesen in bestimmten Kontexten agieren, wie sich Krisen und Kooperationen entwickeln, ist inzwischen kein Buch mit sieben Siegeln mehr.
Die Kognitionspsychologie, neuerdings im Verbund mit der Hirnforschung, handelt von der Frage, wie Menschen ihre Umwelt »codieren« – und welche Entscheidungen und Handlungen daraus folgen. Die Pioniere Daniel Kahneman und Amos Tversky zeigten schon vor zwanzig Jahren, wie unhaltbar die Vorstellung eines ausschließlich rational handelnden Menschen ist. In unserem Hirn läuft eine ständige Musterbildung ab, indem Meme (kulturelle Informationseinheiten, analog zu Genen) und Ängste, Erwartung und Vermeidung gegeneinander abgewogen werden. Die Muster »produzieren« Zukunft, indem sie durch Erwartungshaltungen selbsterfüllende Prophezeiungen erzeugen.
Die erweiterte Evolutionswissenschaft. Seit Charles Darwin vor zweieinhalb Jahrhunderten die Grundprinzipien der Evolution beschrieb, hat dieser Begriff eine schwierige Karriere hinter sich. »Darwinismus« bedeutet auch heute noch in den Köpfen vieler Menschen einen Kampf auf Leben und Tod, bei dem immer nur eine Seite gewinnen kann. Aber die Welt basiert auf Co-Evolution, nicht auf Überlegenheit und Unterwerfung. Mit ihren zwei Hauptzweigen, der evolutionären Psychologie und der evolutionären Systemwissenschaft hilft, uns die neue Evolutionswissenschaft, Menschen als »kooperierende Überlebenswesen« zu begreifen. Warum und auf welche Weise wir Schönheit präferieren, Reichtum und Status anstreben, aber auch Empathie empfinden, wie ökonomische Krisen eskalieren, Firmen prosperieren oder sich eine schreckliche Krankheit wie Krebs entwickelt, unterliegt letztlich evolutionären Prozessen.
An den Schnittstellen dieser drei Metadisziplinen entsteht heute eine ganzheitliche Weltwissenschaft des Wandels. Ich nenne sie auch evolutionäre Prognostik, eine Disziplin, die sich aus den Teildisziplinen der Trend- und Zukunftsforschung zusammensetzt und diese mit den drei genannten Systemwissenschaften kombiniert.
Nach einem Bonmot von Malcolm Gladwell gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen einem Geheimnis und einem Rätsel. Ein Rätsel können wir durch simple Information lösen. Ein Geheimnis hingegen ist keine Frage der Information, sondern des Kontextes, des Bewusstseins. Um ein Geheimnis zu verstehen, müssen wir uns selbst und unsere Wahrnehmungsmuster verändern.
Das Geheimnis der Zukunft können wir nur lösen, wenn wir die richtigen Fragen stellen: Worauf können wir bauen? Worauf vertrauen? Wo liegen nicht nur die Brüche, sondern die Kontinuitäten der Geschichte? In diesem Buch möchte ich die Melodie hörbar machen, die Vergangenheit und Zukunft verbindet.
Wien, Sommer 2011
ERSTER TEIL
Das Geheimnis des Fortschritts
Fortschritt ist das Werk der Unzufriedenheit.
JEAN-PAUL SARTRE
Fortschritt wird von faulen Menschen vorangetrieben, die nach bequemeren Wegen suchen, etwas zu erledigen.
ROBERT A. HEINLEIN
Man muss sich nämlich darüber im Klaren sein, dass es kein schwierigeres Wagnis, keinen zweifelhafteren Erfolg und keinen gefährlicheren Versuch gibt … als eine neue Ordnung einzuführen.
NICCOLÒ MACHIAVELLI
1 Im Orbit
Das Fenster mit der besten Aussicht auf die Welt befindet sich auf einer Umlaufbahn in einer Höhe zwischen 350 und 460 Kilometern über der Erde. Es besteht aus sechs in konischem Winkel um ein rundes 80-cm-Bullauge angeordneten Glasflächen aus supergehärtetem Borosilikatglas, massive acht Zentimeter dick, versehen mit schließbaren Kevlar-Stahlblenden gegen Mikrometeoriten. Die Cupola genannte Konstruktion, mit einem Durchmesser von rund zwei Metern, ist seit 2009 die Aussichtskuppel der internationalen Raumstation ISS. Gebaut wurde sie zumindest zum Teil auf Initiative und hartnäckiges Drängen der Astronauten – als einziger »Luxus« in einer ansonsten kargen, funktionalen Umgebung.
Die ISS zieht mit rund 25 000 Kilometern pro Stunde auf ihrer leicht elliptischen Bahn um die Erde, also etwa 21-mal so schnell wie der Schall. Im Orbit merkt man allerdings wenig von diesem Tempo. Die Erdoberfläche zieht in beinahe derselben gemächlichen Weise vorbei, wie man es in einem Flugzeug auf Reiseflughöhe erlebt. Nur dass man keine Autobahnen sehen kann. Und dass die Tiefdruckwirbel wie zarte Pinselstriche oder mächtige Spiralen tief unter einem liegen.
Sechzehnmal innerhalb von 24 Stunden erlebt die ISS-Besatzung einen Tag- und Nachtwechsel – einen rasend schnellen Sonnenauf-oder -untergang. Die Erde erscheint aus der niedrigen Umlaufbahn schon als echte Kugel. Dabei entspricht die Distanz zur Oberfläche gerade einmal der Strecke, die wir bei einem Ausflug in die Berge zurücklegen.
Die Astronauten sehen die Welt aus einer radikal anderen Perspektive, wie sie nur wenigen Menschen vergönnt ist. Dieses Erlebnis hinterlässt einen tiefen Eindruck, für den jemand den Begriff »Overview-Effekt« fand. Es ist ein schönes Bild für den fundamentalen Wandel der Wahrnehmung, der immer dann stattfindet, wenn man ein System als Ganzes aus der Ferne betrachtet.
Rund 60 Prozent der Zeit fliegt die ISS über dem Meer, einer blauen, grauen, manchmal spiegelnden Oberfläche mit eingebetteten Grüntönen, ornamentiert von Wolkenwirbeln und Wetterfronten. In diesem Gemisch aus H2O, organischen Substanzen, Salzen und Mineralien, begann vermutlich vor zwei, drei Milliarden Jahren unter damals noch völlig anderen Umweltbedingungen Leben.
Weitere 20 bis 30 Prozent, also ein volles Viertel der Umlaufzeit befindet sich die Raumstation über nahezu unbewohntem Gebiet. Wüsten und Halbwüsten. Eisflächen und Tundra. Die endlosen Waldgebiete Nordkanadas und Sibiriens. Die Geröll- und Grasländer des zentralasiatischen Kontinents. Die Savannen und Dschungel Afrikas. Die Wüsten und Gebirge und ausgedehnten Tropenwälder Südamerikas und Südostasiens.
In diesen Landschaften hat sich, trotz der planetaren Dominanz des Menschen, trotz einer erdumspannenden technischen Zivilisation, in den letzten zehntausend Jahren kaum etwas verändert. Diese Landschaften in den klimatischen Grenzbereichen des Planeten – den Übergängen von Wasser zu absoluter Trockenkeit, von Wärme zu andauernder Kälte – waren immer schon dünn besiedelt. In der Nacht wird man auf den großen schwarzen Flächen nur vereinzelt kleine Lichtflecken glimmen sehen.
Dörfer im Regenwald, kleine Hütten in Tälern, Lager aus Reisig an Flussläufen, Nomadenzelte in kargen Landschaften. Rund 5000 indigene Völker und Stammesgesellschaften gibt es heute weltweit, mit rund 300 Millionen Menschen in 76 Staaten. Nur ein kleiner Teil lebt noch in einer echten nomadischen Lebensweise. Dort, wo die Natur kaum etwas hergibt, keine fruchtbaren Böden existieren, die Biodiversität nicht sehr hoch ist, auf abgelegenen Inseln oder Hochebenen, wo keine Rohstoffe gefunden wurden oder wo der Dschungel undurchlässig und lebensfeindlich ist, hat sich erstaunlich zäh eine Lebensweise erhalten, die höchst effektiv nutzt, was die Umwelt an Kalorien hergibt. Das Stammeswesen der Jäger und Sammler.
»Nur Stämme werden überleben«, hieß ein Bestseller in meiner Jugend, der Ära der großen Zivilisationskritik, in der sich die Probleme eines industriell erschlossenen Planeten deutlich am Horizont abzeichneten. Die Poster, auf denen Indianer vor Sonnenuntergängen von der Sünde des Weißen Mannes sprechen, der die Natur verdirbt und die Seele der Welt schändet, hängen bis heute in den Zimmern Jugendlicher. In vielen Gesprächen, im Fernsehen, selbst in den Kommentaren kluger Menschen hört man einen »Ton des Abschieds«. Gibt es nicht seit uralter Zeit eine Prophezeiung, dass die »Zivilisation« – oder das, was wir dafür halten – an sich selbst zugrundegehen muss? Und mehren sich nicht die Zeichen dafür, dass sie sich im 21. Jahrhundert erfüllen wird?
Zeichen der Zivilisation
Nur zwischen zehn und 20 Prozent ihrer Umlaufzeit überquert die ISS Landschaften, die sichtbare Spuren der menschlichen Bemühungen aufweisen, Natur zu nutzen. Plantagen, geforstete Wälder, riesige Getreidelandschaften, die Reisterrassen und Teeplantagen des Fernen Ostens. Geordnete, gezähmte, dirigierte Natur. Das sind die Spuren der nächsten Stufe der menschlichen Entwicklung: der agrarischen Zivilisation. Westeuropa etwa besteht zu 40 Prozent aus landwirtschaftlich genutzter Fläche, die sich bis tief nach Russland erstreckt. Im mittleren Westen des nordamerikanischen Kontinents reichen die Weizen-, Soja- und Maisfelder fast über das gesamte Sichtfeld der Raumstation, im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso haben sich Viehweiden und Sojaplantagen zu Kontinentgröße ausgeweitet. Selbst an einigen Stellen der Sahara sieht man riesige, kreisrunde Flächen im Sand: Felder, auf denen mit Grundwasser Kulturpflanzen angebaut werden.
Agrarische Kulturtechniken haben im Lauf der Geschichte die unterschiedlichsten Sozialformen hervorgebracht, angefangen von den frühen Hochkulturen im Nahen Osten bis zu den vorindustriellen Gesellschaften auf allen Kontinenten. Das Leben spielt sich, wie bei den Jägern und Sammlern, im Rhythmus der Natur ab, nur dass es nicht mehr der Zug der Tiere ist, sondern Niederschlag und Temperatur, die den Jahresrhythmus vorgeben. Agrarische Gesellschaften sind noch empfindlicher gegenüber den Naturkräften als Jäger und Sammler. Ihre Bevölkerungszahl ist höher – fleißige Hände werden auf dem Feld gebraucht und müssen sich um die Alten kümmern. Jede Fehl- und Missernte kann zu ernsthafter Not führen. Anders als die Nomaden können Bauern nicht einfach fortziehen, wenn die Natur – oder menschliche Konkurrenten – sie bedrängen.
Innerhalb nur eines Jahrhunderts – des zwanzigsten – hat sich jedoch eine Form der Landbearbeitung ausgebreitet, die nicht mehr viel mit dem Bauerntum zu tun hat. Riesige Mengen von Proteinen werden immer effektiver auf immer größeren Flächen erzeugt. Der industrielle Landbau war es, gestützt auf die Segnungen der fossilen Energieträger, der in vielen Regionen der Erde die Menschen einerseits vom Land vertrieb, ihnen andererseits in den Städten eine verlässlichere Ernährungsgrundlage lieferte.
Die bäuerliche Lebenskultur, die jahrtausendelang die kulturellen Muster der Menschheit mehr und mehr dominierte, hinterließ viele Spuren in unseren Gewohnheiten, in unseren Memen, den kulturellen Zeichensystemen, mit denen sich Menschen verständigen und synchronisieren. »Wo kommst Du her?«, ist die erste Frage, die wir einem Unbekannten stellen – obwohl diese Auskunft in einer hypermobilen, digitalen Kultur eigentlich völlig belanglos sein müsste. Unsere Ideen von Identität, von Wurzeln und Natur, sind in der agrarischen Welt unserer Vorfahren geformt worden. All das ist nur scheinbar unwesentlich geworden. Neuerdings scheint sich die Frage des Ortes sogar zu verstärken. Im »Bio-Zeitalter«, legen wir wieder Wert darauf, wo eine Pflanze, ein Tier gewachsen ist. Welche Hände einen Gegenstand geformt haben. Wir interessieren uns wieder für Stammbäume. Der Mensch ist und bleibt ein territoriales, ein erdgebundenes Wesen.
Das glitzernde Band
Zwischen fünf und 15 Prozent der Erdoberfläche sind bedeckt von dem, was Außerirdische bei ihrem ersten Besuch ohne aufwendige Analysen als Tätigkeit einer technoiden Spezies ausmachen könnten: Städte. Bald 60 Prozent der rund 7 Milliarden Menschen ballen sich auf nur drei Prozent der festen Erdoberfläche, in immer größeren urbanen Konglomeraten. Wie Muster geschmolzenen Bleis erstrecken sich die Stadtgebiete über Küstenregionen und entlang von Flussläufen, bilden Flecken in den Kontinentalmassen, überwuchern ganze Halbkontinente. Wie filigrane, fraktale, organische, zellulare Strukturen strecken sie ihre Fühler aus in alle Richtungen.
Ihre wahre Pracht entfalten diese Gebilde jedoch erst, wenn die Sonne hinter dem Planeten verschwindet und die kalten Sterne des Weltraums sichtbar werden. Unter der Cupola entfaltet sich dann ein beeindruckendes Schauspiel, das selbst die kühl technisch ausgebildeten Astronauten zu andächtigem Schweigen bringen kann. Die Städte glitzern wie Diamanten und erhellen in Dunst und Wolken selbst die höheren Atmosphärenschichten. Und diese Organogramme des menschlichen Lebens wachsen schnell, sie wuchern förmlich: In China entstanden allein in den letzten zehn Jahren Dutzende Riesenstädte mit über zehn Millionen Einwohnern, wo bis vor Kurzem nur Reisfelder lagen. Städte, deren Namen Europäer womöglich noch nie gehört haben: Tianjin, Shenyang, Hefei, Chengdu, Chongqing, Harbin, Nanjing, Taiyuan …
Welche Kräfte bewegen die Menschen dazu, seit rund 200 Jahren die Welt der natürlichen Zyklen, Ernten, Jahreszeiten, Traditionen zu verlassen? Aus den Hütten in Häuser, aus Dörfern in Siedlungen, aus Städten in gewaltige Siedlungskonglomerate zu ziehen, bisweilen regelrecht zu flüchten? In eine Lebensform, in der auf die meisten Neuankömmlinge zunächst einmal sozialer Abstieg, Entwurzelung, Konkurrenz mit vielen anderen wartet? Welche tieferen Wirkkräfte zeigen sich in diesem Leuchten, mit dem der Planet sein »Anthropozän« signalisiert, das Zeitalter, in dem die menschliche Spezies ein für alle Mal den Planeten umformt?
Löcher im Gewebe
Überfliegt die ISS Nordkorea, erlöschen die Lichter plötzlich. Nur noch einzelne verschwommene Kleckse und ein gelber Schein, die Hauptstadt Pjöngjang, erhellen die planetare Nacht. Nordkorea ist eine Insel der Finsternis in einem Meer elektrischer Zivilisation.
Einen ähnlichen Blackout-Effekt kann man über Somalia beobachten. Die Stadt Mogadischu ist nur ein matter Fleck, mit einigen schwach glimmenden Sprenkeln darin. Hier herrscht die atavistische Nacht. Hier töten und hungern Menschen, sie vegetieren eher, als dass sie ihrem Alltag nachgehen. Sie kämpfen jeden Tag bitter ums Überleben.
Afghanistan. Somalia. Nordkorea. Haiti. Der Kongo. »Failing States« entstehen nicht über Nacht. Die Parameter ihres Scheiterns sind multidimensional, langfristig, kumulativ. Eines kommt zum anderen. Ein gesellschaftliches« System versagt. Ein anderes wird gewaltsam von außen zerstört. Menschen reagieren mit Verzweiflung, die neue Gewalt gebiert. Demütigungen aus der Vergangenheit lagern sich im Kultursystem ab und führen zu immer neuen Runden von angstgetriebener Aggression. Kultursystem, politisches System, ökologisches System scheitern immer aufs Neue. Übergänge misslingen. Stämme werden zerstört, aber das Bauerntum kann sich nicht richtig entwickeln. Staaten zerfallen, weil ihre Existenz von oben verordnet, durch Marionetten erzwungen ist. Die soziale Synthese, aus der sich Fortschritt und Wohlstand entwickeln, das Funktionieren von Institutionen, Gewaltenteilungen, Arbeitsteilungen, versagt auf allen Ebenen.
Was unsere Astronauten sehen, ist ein Panorama der verschiedenen Stadien und Evolutionsmöglichkeiten der Menschheit, von zwei, womöglich drei Transformationen, die in Wellen über den Planeten laufen – ungleichzeitig und doch mit erstaunlicher Kontinuität. Ist die technische Turbo-Zivilisation, das große Leuchten, nur eine Zuckung, ein temporäres Aufschäumen, wie es der Astrophysiker Stephen Hawking trocken formulierte? »Menschen sind einfach ein chemisch-biologischer Schaum auf der Oberfläche eines typischen Planeten, der einen typischen Stern in den Randbezirken einer typischen Galaxie umkreist.«
Woran erinnert uns dieses leuchtende Schauspiel, das unsere Sendboten in der Umlaufbahn überschauen? An organische Strukturen, das Wachsen von Zellen, die Entwicklung von Nervenfasern, die den Planeten umfassen. Ist das der Anfang von etwas, das weitergehen wird, Tausende, womöglich Millionen Jahre in die Zukunft? Oder sind komplexe technische Zivilisationen zwangsläufig zum Scheitern verurteilt? Und alles wird wieder in der Nacht der Lagerfeuer enden?
2 Wege des Wohlstands
Mitten in den endlosen Wasserwüsten des Pazifik, 3000 Kilometer nordöstlich von Australien, liegt die Insel Nauru. Auf dem Satellitenbild sieht das Eiland, das gerade einmal 21 Quadratkilometer umfasst, wie ein leicht eingedrückter Pfannkuchen aus.
Nauru war bis vor Kurzem das reichste Land der Welt.
Dabei hat die Insel durchaus schwere Zeiten durchgemacht. Sie wurde im Laufe ihrer Geschichte von Fremdmächten regelrecht »durchgereicht«. Zuerst besaßen die Engländer die Hoheit, von 1888 an die Deutschen. Seit 1914 verwalteten die Australier die Insel. Von 1942 bis 1945 war sie von Japan besetzt. Bis zur endgültigen Unabhängigkeit 1968 verwalteten erneut die Australier dieses »Paradies des Vogelkots«.
Vogelkot war es nämlich, der den erstaunlichen Reichtum der Nauruer begründete. Vogelkot, der sich in Tausenden von Jahren in ein wertvolles Mineral verwandelte: Phosphat. 15 Meter dick war die Schicht, die bis vor einigen Jahrzehnten fast die ganze Insel bedeckte. Auf Nauru kam es in nie gekannter Reinheit vor. Phosphat spielt eine wesentliche Rolle beim menschlichen Energiestoffwechsel und für den Knochenaufbau. In der Landwirtschaft dient es als Grundlage für Dünger. Und Sprengstoffe kann man mit seiner Hilfe ebenfalls produzieren. Jedes Jahr wurden auf Nauru rund eine Million Tonnen abgebaut. Das war nicht schwer. Man konnte den Stoff einfach mit Baggern auf Mulden laden. Oder mit der Schaufel in Eimer füllen.
Der Reichtum, der im Laufe der sechziger und siebziger Jahre über die Nauruer hereinbrach, war ungeheuerlich. »Paradiese, gibt’s die?«, fragte 1973 die »Bild«-Zeitung – und gab mit leicht neidischem Unterton selbst die Antwort: »Eines bestimmt. Auf dieser Insel braucht man keinen Finger zu rühren.« Die Steuern wurden komplett abgeschafft, und die rund 10 000 Insulaner lebten von Transaktionen des (verstaatlichten) Phosphats.
Fünf, sechs Autos besaß nun jeder Nauruer. Die Straßen waren perfekt geteert, allerdings ständig zugeparkt. Denn die Bewohner ließen, wenn einer der Straßenkreuzer oder Riesenjeeps einen Defekt hatte, das Auto einfach stehen. Und kauften sich ein neues. Und fuhren aus lauter Langeweile Karussell rund um die Insel.
Irgendwann reinigte der Staat auch noch auf seine Kosten die privaten Toiletten seiner Bürger. Der Besuch in den vier Kinos der Insel wurde kostenlos. Die Regierung schuf eine gutbezahlte Stelle nach der anderen, stellte Hunderte Polizisten ein, obwohl es kaum Kriminalität gab. Die Nauruer gründeten eine eigene Fluglinie, die den pazifischen Luftraum erobern sollte, Air Nauru, deren Maschinen allerdings kaum besetzt waren. Die Mini-Großmacht kaufte in Australien Luxushotels und ganze Stadtviertel auf, baute 1977 in Melbourne den höchsten Büroturm und investierte weltweit Milliarden in dubiose Finanzgeschäfte.
Als das Phosphat in den neunziger Jahren zur Neige ging, war die Insel mit protzigen Villen im amerikanischen Stil übersät, in denen die Nauruer vor riesigen Fernsehern saßen. Achtzig Prozent waren übergewichtig, und jeder Dritte hatte Diabetes. Die Nauruische Regierung musste sich etwas einfallen lassen. Aber eine Regierung gab es eigentlich nicht, nur eine nepotistische Struktur aus miteinander befreundeten »Verwaltern«. Allein zwischen 1998 und 2002 erlebte die Insel 17 Regierungswechsel. Ein kompliziertes Verwaltungssystem, eine hybride Mischung aus polynesischer Basisdemokratie, englischem Verwaltungswesen und repräsentativer Bananenrepublik, blockierte alle ernsthaften Maßnahmen.
So wurde Nauru ein Paradies für Geldwäscher und Steuerflüchtlinge. Kasinos eröffneten, Bordelle sprossen aus dem Strand. Erst auf internationalen Druck widerrief die Regierung im Jahr 2003 rund 450 Lizenzen für dubiose Banken, die als Geldwaschanlagen funktionierten. Das Land verkaufte Pässe für 15 000 Dollar, unter anderem an zwei weltweit gesuchte Terroristen. Für 30 Millionen Dollar baute die Insel schließlich eine Art Gefängnis für afghanische Flüchtlinge, die in Australien gestrandet waren. Asylantenknast gegen Bezahlung.
»Nauru ist eine Insel aus Scheiße«, wird im »Spiegel« ein australischer Anwalt zitiert. »Sie sieht aus wie Scheiße, und sie riecht wie Scheiße, aber wenn Sie Geschäftssinn haben, können Sie in diesem Land ganz schnell eine ganze Menge Schotter verdienen.«1
Wohlstand kommt und geht auf seltsamen Wegen. Nur eines ist sicher: Der Grundrohstoff besteht nicht aus Atomen. Schätze im Boden allein machen nicht unglücklich oder übergewichtig. Allerdings: Sich allein auf Schätze im Boden zu verlassen, führt oft geradewegs in den Ruin.
Der planetare Reichtum
Seit dem Jahr 1800, dem Beginn der industriellen Revolution in Europa, hat sich die Bevölkerung der Welt versechsfacht, von 1,2 auf fast sieben Milliarden Menschen. In dieser Zeit hat sich das mittlere Pro-Kopf-Einkommen (angepasst an die Kaufkraft) verneunfacht. Der »Gesamtreichtum« hat sich also um den Faktor 54 erhöht.2
Nehmen wir eine etwas kürzere Spanne. 1955, das Jahr meiner Geburt. Vergleichen wir eine statistische »Durchschnittsfrau« damals und heute, im vollen Bewusstsein der Beschränktheit dieses Unterfangens. Eine Welt-Frau verfügt seit dieser Zeit über dreimal mehr Einkommen (zweieinhalbmal mehr eigenes Einkommen, der Rest ist Familieneinkommen), hat dreimal mehr Kalorien zur Verfügung und lebt rund ein Drittel länger, als vor einem guten halben Jahrhundert. So gut wie alle Lebensumstände haben sich verbessert: Ihr Risiko, an Mord, Kindbettfieber, Unfällen, Naturkatastrophen, Fluten, Hunger, Kriegen, Malaria, Masern oder anderen Krankheiten zu sterben, hat sich deutlich verringert. In jedem ihrer Lebensabschnitte besteht zudem eine verminderte Wahrscheinlichkeit, Krebs, Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Die Chance, dass sie einen höheren Schulabschluss hat als 1955, liegt bei 90 Prozent. Ihre Chance, Zugang zu Telefonen, Fernreisen, einer Spültoilette und einem Fahrrad zu besitzen, hat sich immerhin vervierfacht.
Der erste berechtigte Einwand lautet, dass dies ja nicht für alle Frauen auf der Welt gilt. Es ignoriert die Tragödien. Er vernachlässigt die Verlierer. Aber auch, wenn man die armen Länder auf dem Planeten seit 1955 verfolgt, ist es schwer, wirkliche Verschlechterungen zu finden. Nur in sechs Ländern (von knapp 200, die es heute auf der Welt gibt) sank das mittlere Einkommen – in Afghanistan, Haiti, Kongo, Sierra Leone, Liberia und Somalia. Die Lebenserwartung ging in drei zurück (Zimbabwe, Swaziland, Birma), in einigen, wie Russland und Turkmenistan, ging sie bis vor einigen Jahren zurück, steigt aber derzeit wieder an.
Wenn wir den so genannten HDI als Grundlage nehmen, den Human Development Index, der nicht nur das Einkommen misst, sondern auch Bildungszugang, Frauenemanzipation, Gesundheit und Demokratiestatus eines Landes, finden wir dort etwa zehn Länder, die ihren Status seit einem halben Jahrhundert kaum nennenswert verbessert haben oder sogar ein Stück nach unten abrutschten. Etwa 20 Länder durchlaufen einen »Entwicklungsknick«, aus dem sie sich derzeit wieder erholen – meist Peripherie-Länder der ehemaligen Sowjetunion und einige ehemals sozialistische Länder in Afrika und Asien.
Erstaunlich, wie anders unsere Wahrnehmung des Wohlstands heute ist. Im Jahre 1955 hieß es in deutschen, englischen und amerikanischen Zeitungen immer wieder hymnisch, dass »die Menschen es noch nie so gut hatten wie in der modernen Welt«. Man stelle sich eine solche Zeile in einer heutigen (westlichen) Zeitung vor!
Ein (westlicher) Durchschnittverdiener in der Zeit meiner Geburt, überwiegend ein Mann, hatte einen geringeren Lebensstandard als heute ein Hartz-IV-Empfänger. Fließend warmes Wasser, eine Toilette in der Wohnung, ein Telefon, ein Fernseher, ein Kühlschrank – all dies war im Jahrzehnt meiner Geburt in einem Mittelschichthaushalt noch keine Selbstverständlichkeit. Rund 20 Prozent der europäischen Haushalte auf dem Land hatten damals keine Elektrizität.
Im städtischen China, das 1955 in bescheidenen Ansätzen existierte, verfügen heute 90 Prozent der Menschen über den »Luxus« von Kommunikations- und Mediengeräten wie Handy und Fernseher. Vor einem halben Jahrhundert besaßen selbst Parteifunktionäre kaum private Kommunikationsmittel.
Patrick Caron, Forschungsleiter des Zentrums für Internationale Zusammenarbeit in der Agrarforschung (CIRAD) in Paris, bezeichnet es als große Überraschung, dass sich in Afrika die Getreideerträge von 1961 bis 2003 verdoppelt haben. Mitte der 1960er Jahre mussten in Entwicklungsländern noch 57 Prozent der Menschen mit weniger als 2200 Kalorien pro Tag auskommen, Ende der 1990er waren es nur noch zehn Prozent.3
Es ließen sich noch zahlreiche weitere Beispiele anführen. Die Meldungen über stille oder graduelle, bescheidene oder drastische Wohlstandsgewinne sind robust und vielfältig. Auch wenn es immer noch Inseln von Hunger und Elend geben mag – die Riesenwelle der Entwicklung, die die Welt erfasst hat, verbessert Schritt um Schritt, Schicht für Schicht, Region für Region die Lebensverhältnisse. Das kann uns Hoffnung geben und macht uns doch gleichzeitig schon wieder Angst. Aber wie kommt es eigentlich dazu?
Die Pfade des Wohlstands
Schauen wir uns also die Entwicklung von Wohlstand genauer an. Um sie linear darzustellen, benutzen wir Hans Roslings Weltdatenmodell Gapminder.4 »Wohlstand« erscheint hier als Ergebnis aus dem Zusammenspiel zweier Größen: des kaufkraftbereinigten Einkommens pro Person, also des rein materiellen Wohlstands, und der mittleren Lebenserwartung, die Schlüssel ist für die allgemeine Qualität des Lebens. Auf welchen Wegen haben die einzelnen Länder und Regionen des Planeten sich in diesem Koordinatensystem bewegt?
Schweden, der Inbegriff des Wohlfahrtsstaates und heute eines der wohlhabendsten, zivilisiertesten, »fortschrittlichsten« Länder der Erde, wurde keineswegs in einer geraden Linie zu jenem modernen Volksheim, das nur wenig Armut und Elend kennt (auch wenn die grausamsten Verbrechen gern in schwedischen Krimis begangen werden).
Praktisch das gesamte 19. Jahrhundert hindurch, als England und die Niederlande bereits stabile Zuwächse an Lebenszeit und Einkommen verzeichneten, kam es in Schweden zu drastischen Einbrüchen der Lebenserwartung, zu Hungersnöten und tödlichen Epidemien. Solche Desaster hat es immer wieder gegeben. Nach einer Legende aus dem 16. Jahrhundert kamen Könige und Räte nach der großen Hungersnot um 1540 zu dem Schluss, dass jeder zehnte Bürger das schwedische Heimatland verlassen und auswandern müsse, da zu wenig Nahrung für alle vorhanden sei. Die Hungersnot von 1866 bis 1868 in Nordschweden und Finnland, verursacht durch Ernteausfälle und lange Winter, forderte etwa 270 000 Tote. Die Linie der schwedischen Wohlstandsentwicklung verläuft bis ins 20. Jahrhundert hinein chaotisch. Erst von 1900 an verstetigt sich der Wohlstandsfortschritt, mit einem Einbruch um 1918. Seitdem strebt Schweden enorm schnell nach oben – weit vor anderen Nationen erreichte es einen Massenwohlstand, aus dem kaum jemand ausgeschlossen war. Besonders auffällig ist die Diagonalität der schwedischen Wohlstandskurve in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Lebenserwartung und mittleres Einkommen entwickeln sich parallel (eine kleine »Wohlstandsdelle« entsteht in der Wirtschaftkrise zu Beginn der neunziger Jahre).
Die Schweden lebten immer schon in einer herausfordernden Natur mit kurzen Ernteperioden. Das kalte, raue Land bot in der vortechnischen Agrargesellschaft nur unsichere Nahrungsgrundlagen für die Bevölkerung. Aber gerade weil die Umgebung so harsch war, entwickelten sich in den skandinavischen Gesellschaften schnell Inseln der Kooperation, die sich auf die Gesellschaft als Ganzes ausbreiteten. Eine wichtige Rolle spielen dabei kulturelle Faktoren. Das Einzelgängertum ist in der skandinavischen Kultur zwar ausgeprägt (viele lebten ja tatsächlich alleine auf versprengten Höfen oder Hütten), aber es ist durch gegenseitige Hilfsbereitschaft abgesichert. Allein kann man die harten Winter nicht überleben. Zusammenhalt und Solidarität der schwedischen Gesellschaft, ihr starker Familiensinn, geprägt und verstärkt durch den religiösen Pietismus, bot Schweden zu Beginn der Industriellen Revolution einen enormen Vorteil.5 Die Technisierung kam vergleichsweise schnell voran, und es gab weniger soziale Auseinandersetzungen und politische Krisen als in anderen Ländern. Das Sozialstaatsmodell ist unmittelbarer Ausdruck einer Solidarkultur, in der kirchliche Institutionen ursprünglich eine wichtige Rolle spielten.
Anders verläuft die Wohlstandsentwicklung in Deutschland. Hier ist die Geschichte von wiederkehrenden Krisenereignissen geprägt, die die ganze Gesellschaft erschütterten. Die beiden Weltkriege führen zu »Elendsschleifen« in der Wohlstandsentwicklung – Einkommen und Lebenserwartung sinken über ein, zwei Jahrzehnte, der Wohlstandsprozess dreht sich zeitweise um. Eine ähnliche Schleifenentwicklung findet sich nur noch in einigen afrikanischen Ländern wie etwa Zimbabwe und in China wieder, wo die Kulturrevolution das Land um Jahrzehnte zurückwarf.
Die deutsche Kultur ist von einem starken Schwanken zwischen Individualismus und Kollektivismus geprägt. Die Ursache findet sich in der enormen kulturellen Spannung dieser Gesellschaft. Deutschland war immer eine vielgestaltige »Multikultur«, geprägt von Einwanderungswellen und Identitätskrisen. Der deutsche Nationalstaat wurde viel später gegründet als der britische, französische oder russische. Die Exzesse des Nationalsozialismus lassen sich auch als Versuch einer »gewaltsamen Homogenisierung« lesen, ausgetragen mithilfe mörderischer Ideologien und Feindbilder.
Die ewige »German Angst« hat in dieser kollektiven Brucherfahrung sicherlich auch ihren Ursprung. Das Vertrauen in die Kraft der Zivilgesellschaft war lange Zeit keine Spezialität der Deutschen. Das ambivalente Verhältnis zum Staat lässt diesen gleichzeitig als große Mutter, von der man alles verlangen kann und muss, und als Moloch, der den »kleinen Mann« unentwegt bedroht, erscheinen. Überhaupt ist die Konstruktion des »kleinen Mannes« eine deutsche Spezialität; kein Engländer, Franzose, Amerikaner, Japaner würde sich diese Selbstdefinition zu eigen machen.
Im Vergleich dazu muss das Beispiel Vietnam verblüffen. Auch dies ist ein durch lange Kriege mit gewaltigen Zerstörungen geprägtes Land. Aber der Vietnamkrieg hinterlässt auf dem Wohlstandspfad noch nicht einmal eine Delle in der Lebenserwartung – er war, trotz aller Grausamkeiten, eher ein Guerillakrieg, der die Nahrungsmittelversorgung weitgehend intakt ließ. Vietnam tätigte außerdem während der Kriegszeit massive Investitionen in die Volksgesundheit – und kompensierte so statistisch die Kriegstoten.
Bemerkenswert ist die Geradlinigkeit, mit der hier eine bitterarme, über Jahrhunderte kolonialisierte Gesellschaft ihren Gesamtwohlstand vor allem in der jüngsten Zeit erhöht. Ein wichtiger Faktor könnte dabei die gerade durch Kriegs- und Kolonialerfahrung gestärkte innere Einheit sein. Unabhängig vom politischen Modell, egal ob Kommunismus oder Kapitalismus, ist das Land von der Erfahrung des gemeinsamen Widerstands geprägt.
Im 19. Jahrhundert war Russland ein Elendsland, mit zyklischen Hungerkatastrophen, die große Teile der Bevölkerung dahinrafften. Die Zarenherrschaft verschlimmerte das Problem durch brutalste Formen der Leibeigenschaft. Russland ist dank seiner schieren Größe ein Land großer Gegensätze. Es verfügt einerseits über enorme Rohstoffmengen, aber die für die Landwirtschaft nutzbaren Wachstumsperioden sind in weiten Teilen des Landes kurz, die Winter lang, und die Flüsse eignen sich nicht für Mühlenbau. Regionale Autonomie ist unter diesen Bedingungen nur sehr schwer herstellbar. Alle Infrastrukturen in Russland müssen gigantisch sein, und deshalb spielt ein oligarchischer Zentralstaat immer eine (fatal) dominierende Rolle.
Ähnlich wie in Nauru führten die natürlichen Ressourcen eher zu Korruption und Spaltung der Gesellschaft. Die Eliten bedienten sich im zentralistischen Zugriff, der Mangel an Zivilgesellschaft führte zu einer gewaltbereiten Misstrauenskultur. Der Kommunismus verschlimmerte diese Situation, erst nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer langsamen Stabilisierung. Die Kurve des Wohlstands zeigt hier die charakteristische Steilheit einer ökonomischen Stagnation bei Verlängerung der Lebenszeit. Nach dem Ende der Diktatur geht das Land durch eine Krisenschleife, scheint sich in den letzten Jahren aber wieder auf dem Pfad des Wohlstandsgewinns zu begeben.
Ein interessantes Beispiel bieten Haiti und die Dominikanische Republik, Nachbarländer auf der Antilleninsel Hispaniola, deren Wohlstandskurven doch ganz unterschiedliche Entwicklungen zeigen. Beide Länder haben eine gemeinsame Wurzel in der Kolonialisierung der Insel durch die Spanier. Die Geschichte Haitis, das die westliche Hälfte Hispaniolas umfasst und sich als erstes Land in Lateinamerika selbsttätig vom Kolonialismus befreite, ist geprägt von Ausbeutung, Korruption und Sklaventum. Nachhaltig belastet bis ins 20. Jahrhundert hinein durch hohe Reparationszahlungen an die einstige Kolonialmacht Frankreich, schaffte es Haiti nie zu einer halbwegs stabilen wirtschaftlichen und politischen Verfassung. Hinzu kommen Erdbeben und Wirbelstürme, die die spärliche Infrastruktur immer wieder zerstören.
In seinem »Law of Evolutionary Potential« analysiert der Historiker Elman Service 1960 die kollektiv-psychologischen Auswirkungen langer Unterdrückungsphasen. Besatzungen und Repressionen wirken wie eine kollektive Traumatisierung, die die Hoffnungs-und Vertrauenspotenziale beschädigen.6 Haitianer haben nicht viele positive Erfahrungen mit sich selbst und ihren Mitmenschen machen können. Ihr Glaube an die Zukunft ist brüchig geworden. Diese Einstellung wirkt auf die alltäglichen Handlungen zurück: Man kümmert sich eher um die eigene Gruppe, ums unmittelbare Überleben.
Die Dominikanische Republik liegt auf derselben Insel in derselben Klimazone, teilt eine ähnliche Kolonialgeschichte und erlebte ebenfalls zahlreiche politische Wirren und Interventionen von außen, wurde aber nach der Unabhängigkeit nicht durch Reparationszahlungen gelähmt und nimmt in der Neuzeit einen anderen Wohlstandskurs. 1967 macht die Kurve der Dominikanischen Republik einen deutlichen Sprung nach rechts oben – Richtung Wohlstand. Nach einem Bürgerkrieg beginnt 1965 eine Phase der Demokratisierung, aus der im Lauf der vergangenen Jahrzehnte eine funktionierende Ökonomie entsteht – ohne die massive Korruption, wie sie in Haiti herrscht. Nur ein Faktor der Bedingungen, unter denen Menschen leben – die politische Verfasstheit –, kann den Wohlstandsprozess entscheidend beeinflussen.
Der holprige Weg
Die Entwicklung des Wohlstands, das haben wir gesehen, verläuft nur selten auf geraden Pfaden. Der holprigste Weg – Schwedens Auf und Ab zu Beginn der Industrieära – führt am weitesten hinauf in den verstetigten Wohlstand. Scheinbar fragile Gesellschaften erweisen sich manchmal als robuster, als wir denken. Und scheinbar starke, mächtige Länder vollziehen in bestimmten historischen Turbulenzen eine »Rolle rückwärts«, was an ihrem langfristigen Wohlstandserfolg aber wenig ändert.
Obwohl wir auf einem Planeten enormer Ungleichzeitigkeit leben, scheint es doch so etwas wie eine Ur-Kraft zu geben, die in eine ganz bestimmte Richtung drängt. Wie unterschiedlich die Kulturen sein mögen – fast überall entwickeln sich irgendwann Geldwirtschaft, Handel, ein Bankensystem. So gut wie in allen Kulturkreisen setzen sich Menschen vor Fernseher, wenn welche laufen. Viele Grunderfindungen – der Speer, das Heu, das Pulver, der Pflug – wurden unabhängig voneinander in verschiedenen Zeiten und Regionen gemacht. In jedem einzelnen Land konfigurieren sich die Kräfte des Fortschritts auf andere Weise. Einige haben gute Voraussetzungen, andere schlechte. Einige machen aus schwierigen Voraussetzungen einen stetigen Prozess. Andere, siehe Nauru, verspielen ihre Vorteile. Die Karten sind zwar ungleich verteilt. Aber das heißt nicht, dass das Ergebnis vorbestimmt ist.
Die gute Nachricht: Es gibt keinen statischen »Teufelskreis der Armut«. Jedes Land, jede Region verfügt über einen Kern der Kooperation, eine Kraft, die in Richtung Fortschritt, Komplexität und Wohlstand führen kann. Auch und gerade unter schwierigen Bedingungen können sich Vertrauenskulturen entwickeln. Auch ohne Rohstoffe kann man der Armutsfalle entkommen. Aus schrecklichen Krisen kann Stärke erwachsen. Es gibt kein Land, das »strukturell zum Elend verdammt« ist.
»Nachholende« Wohlstandsprozesse können bisweilen sogar dynamischer sein als die Pfade der Wohlstandspioniere. Die Linien der asiatischen Staaten zeigen einen gradlinigeren Verlauf, was darauf hinweist, dass kohärente, kooperative Gesellschaftsformen über einen »Platzvorteil« verfügen und dass das Kopieren (von Sozialsystemen und Produkten) manchmal eine probate Erfolgsstrategie sein kann.
Radikal sozialistische Gesellschaften können Wohlstand nur auf unterstem Niveau stabilisieren. Sie können durch gute medizinische Versorgung die Lebenserwartung steigern, aber die Wirtschaft stagniert ab einem gewissen Punkt. Über diese Schwelle hinaus helfen nur Elemente des freien Marktes.
Unterdrückung, Kolonialisierung, Besatzung, andauernde Naturkatastrophen sind die schwierigsten Kontraindikatoren für die Wohlstandsentwicklung. Sie haben lange Folgewirkungen, und manchmal zerstören sie die »Seele« einer Gesellschaft so gründlich, dass es keine Zukunft zu geben scheint. Überwundene und zumindest teilweise bewältigte Katastrophen hingegen stärken die Robustheit einer Gesellschaft.
Kann Wohlstand wieder verlorengehen? In den Trümmern von Mogadischu zeigt sich die Antwort. Aber Elend hat, wie der Wohlstand, eine lange Geschichte. Somalia war nie ein wohlhabendes Land. Somalia war ein tribales, dann kolonialisiertes, dann ein armes und ist nun ein zerfallenes Land. Keiner der Transformationsprozesse, die aus der Jäger- und Sammlerkultur in die agrarische und schließlich die industrielle Kultur führen, konnte bislang dort gelingen. Weil es an einer für die Zukunft jeder Gesellschaft existenziellen Ressource fehlt.
Das Vertrauensprinzip
Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama hat in seinem Werk »Trust« von 1995 die Bedeutung emotional-sozialer Bindungssysteme für die Ökonomien untersucht. Er spricht von »High-Trust Societies« (Gesellschaften, in denen ein hoher Grad von Vertrauen herrscht) und betrachtet die verschiedenen Konstellationen, die zu sozialem Kapital führen, das heißt zu Ressourcen, die aus sozialen Beziehungen und auf der Grundlage von Vertrauen entstehen – auf allen Ebenen und in allen Gruppierungen von der Familie bis zum Staat. Für Fukuyama ist soziales Kapital entscheidend für das Wohlergehen einer Wirtschaftsstruktur.7
Vertrauen senkt die »Transaktionskosten« von Gesellschaft und Ökonomie, es macht sie von innen her produktiv. Man braucht nicht jedes Mal einen Schlägertrupp, wenn man ein Geschäft abschließen möchte. Man muss nicht immer einen Anwalt mitbringen, wenn man sich mit einem Fremden unterhält. Man muss nicht an jeder Ecke Bakschisch zahlen. Misstrauensgesellschaften müssen eine Unmenge Grenz- und Transferkosten aufbringen: Rechtsanwälte. Vermittlungsverfahren. Schmiergelder. Kosten für Straflager und Geheimdienste und Spitzel und deren Kontrolleure. Exzessives Controlling ruiniert über kurz oder lang jedoch jede Bilanz. Das gilt für Firmen, für Beziehungen zwischen Individuen wie für ganze Kulturen.
Vertrauen verhindert eine allzu starke Zersplitterung der Gesellschaft in autonome Kulturen. Verhalten wird vorhersagbarer. Vertrauen führt zu spontaner Sozialisation. Ob dies in der freiwilligen Feuerwehr oder in der Genossenschaftsbank, beim gemeinsamen Betreiben eines Tempels oder der Pflege des Trachtenbrauchtums geschieht, ist zweitrangig.
Nach Norbert Elias ist der Zivilisationsprozess ein Prozess der Zentralisierung und Internalisierung. Der Einzelne wird vom Chaos des Lebens, den Wirrungen des gewaltsamen Schicksals entlastet, indem er Verantwortungen nach »oben« abgibt – an Institutionen wie den Staat. Gleichzeitig verinnerlicht er kulturelle Normen und kooperative Verhaltensmuster. Wenn dieser Doppelprozess gelingt, erhöht sich die gesellschaftliche Komplexität – eine Transformation in höhere Arbeitsteilungen entsteht, und damit wächst Wohlstand.
Wohlstand lässt sich als sicherer Zugriff auf existenzielle Lebensgüter definieren. In einer weiteren Drehung auch auf immaterielle Güter wie Gesundheit, Sicherheit, Selbstbestimmung. Und in der nächsten Steigerungsstufe wird Wohlstand ein Synonym für Wohlergehen oder zumindest für die Chance darauf: als Zugang zu Sinnstiftung, Selbstausdruck, Kultur. In den neuen Wohlstandsmodellen wird nicht umsonst der »Glücksfaktor« als neuer Indikator erforscht. Glück im Sinne von Lebensgestaltung, nicht als »Fun und Genuss«. Das ist die Zukunft des Wohlstands. Ein noch unbeschriebenes Blatt, das wir in diesem Jahrhundert füllen werden, wenn der Wohlstand eine Perspektive haben soll.
Der Superzyklus
Wie stabil ist Wohlstand, wenn er einmal »ausgebrochen« ist? In einer Zeit, in der wir von Verlustängsten geschüttelt werden, scheint dies die Frage aller Fragen zu werden.
Weniger als zehn der heute 190 Länder auf dieser Erde haben in den letzten Jahrzehnten Wohlstandsverluste erlitten. In diesen Ländern ist nicht nur ein Bankensystem zusammengebrochen, sondern in einem langen historischen Prozess so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Wir alle kennen das Resultat: Hungersnöte, Flüchtlingslager, zerfallende Regierungen, Städte und Hoffnungen.
Doch im Gesamtbild sind das eher Strudel, Turbulenzen in einem mächtigen Strom. Die mächtigen Kräfte der Globalisierung treiben den Wohlstandsprozess immer weiter in jeden Winkel der Erde. Die Prophezeiung, die man im Krisenjahr 2009 in jeder Zeitung lesen konnte – die Finanzkrise sei das endgültige Ende der Globalisierung, nun würden vor allem die Schwellenländer durch den Kollaps der Industrienationen auf den Stand von Armutsgesellschaften zurückgeworfen –, erfüllte sich nicht im Geringsten. Im Gegenteil. China, Indien, Brasilien und andere Länder setzten zu einem beispiellosen Aufstieg an.
Allen Befürchtungen zum Trotz leben wir im größten globalen Prosperitäts-Boom aller Zeiten. In den letzten 200 Jahren gab es drei Phasen hoher wirtschaftlicher Aktivität, mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten, für die manche, die in zyklischen Bewegungen denken, den Begriff »Superzyklen« verwenden. Phasen, die viele Millionen Menschen aus der Armut in den Wohlstand katapultierten. 8
1870 bis 1913 – In der »Gründerzeit« wurde Europa zur ersten dynamischen industriellen Wirtschaftsregion, damit entstand die Grundlage des europäischen Wohlstands.
1946 bis 1973 – Das Wirtschaftswunder brachte Massenproduktion und Massenwohlstand zu allen Schichten in der westlichen Welt, vor allem Amerika erlebte einen ungeheuren Aufschwung, unser heutiges Mittelschicht-Gesellschaftsmodell entstand.
2000 bis 2030 – Die Turbo-Industrialisierung erschließt den Massenwohlstand für die Schwellenländer und schafft echte – nicht mehr nur westlich dominierte – Global-Märkte. Die Urbanisierung und Technisierung großer Volkswirtschaften in Asien und Südamerika erzeugen einen gewaltigen Investitionsboom, der durch steigende Konsumausgaben in diesen Ländern finanziert wird.
Wenn das System der gegenseitigen ökonomischen Kooperation einmal gezündet hat, ist Wohlstand ein sich selbst verstärkender Prozess. Denn es ist eben nicht nur der abstrakte Markt, der den Fortschritt schafft, sondern eine Koproduktion verschiedener menschlicher Systeme, die alle etwas in den Korb der dynamischen Kohärenz zu legen haben. Unternehmenskultur, Familie, Verein, Vereinigung, Kooperationen, marktnahe und marktferne Verbindungen zwischen Menschen. Im Internetzeitalter kommen vielfältige Formen von Netzwerken hinzu. Diese Superkooperation der menschlichen Kultur erzeugt eine zivilisatorische Resilienz, die wir in diesem Buch ergründen wollen. Doch zunächst müssen wir uns kurz mit einem hartnäckigen Mythos auseinandersetzen, der uns den nüchternen Blick auf die Zukunft verstellt: dem Untergangsmythos.
3 Der Untergangsmythos
Der junge Oswald Spengler war ein ängstliches Kind mit großer Phantasie und starkem Geltungsdrang. 1880 als Sohn eines Postsekretärs im Harz geboren, erinnerte er sich an seine Jugend als eine »durch Kopfschmerzen und Lebensangst geprägte Zeit«. Von 1899 an studierte er in Halle Naturwissenschaften und Pädagogik. Als er 1908 eine Gymnasiallehrerstelle in Hamburg angeboten bekam, erlitt er schon beim Anblick des Schulgebäudes einen Nervenzusammenbruch. So wechselte er in einen der ältesten und lukrativsten Berufe der Menschheitsgeschichte. Er wurde Apokalypseprophet. 1 Oswald Spengler sollte später über sich selbst schreiben:
»Wenn ich mein Leben betrachte, ist es ein Gefühl, das alles, alles beherrscht hat: Angst. Angst vor der Zukunft, Angst vor Verwandten, Angst vor Menschen, vorm Schlaf, vor Behörden, vor Gewitter, vor Krieg. … Angst vor Bindung, vor Weibern (sobald sie sich ausziehen). Ich habe nie den Mut gefunden, das anderen zu zeigen. «2
Wie für einen Großteil seiner Generation bedeutete der Erste Weltkrieg für Spengler einen euphorischen Ausbruch von Gefühlen – dem eine tiefe Traumatisierung folgen sollte. In einer Denkschrift an Kaiser Wilhelm bezeichnete er den Kriegseintritt als »größten Tag der Weltgeschichte«. Umso mehr traf er mit dem Werk, für das er berühmt werden sollte – »Der Untergang des Abendlandes« –, die Zeitstimmung des Jahres 1918. Er gab der traumatischen Niederlage des Deutschen Reiches, dem Grauen des Krieges einen höheren Sinn. Er machte das Trauma erträglicher, indem er es in einen »höheren Geschichtszusammenhang« einordnete.
»Wir Deutschen«, so Spenglers Diskurs, »sind Opfer eines gewaltigen Dramas, das sich über alle Geschlechter und Äonen in der Weltgeschichte stets wiederholt.« Die Weltgeschichte wird beherrscht von zyklisch auf- und absteigenden »Hochkulturen«. Diese Kulturen beginnen in einem Zustand erleuchteter, erhabener Reinheit, dem Ideal des Mythos. Dieser Mythos wird durch die profanen Kräfte der Rationalität, der Ökonomie, der »inneren Korruption« zur Zivilisation. Und damit ist der Untergang unausweichlich. Denn »Zivilisation« war für Spengler, ebenso wie »Politik«, ein Negativbegriff, eine morbide Gegenkraft zu allem »Heiligen« und »Heroischen« und »Erhabenen« und »Archaischen«.
Acht Hochkulturen zog der Prophet Spengler zum Beleg seiner heroischen Zyklentheorie heran:
die ägyptische Pyramiden-Kultur unter Einschluss der kretischminoischen Kulturdie babylonische Kultur, seit ca. 3000 v. Chr.die indische Kultur, seit 1500 v. Chr.die chinesische Kultur, seit 1400 v. Chr.die Antike, also die griechisch-römische Kulturdie arabische, auch frühchristliche und byzantinische Kultur, seit Christi Geburt am östlichen Mittelmeerranddie mexikanische Kultur, seit ca. 200 n. Chr.die abendländische Kultur, seit 900 n. Chr. in Westeuropa, später auch Nordamerika.Die Dauer dieser »Hochnationen« setzte Spengler mit einem Jahrtausend an – das Diktum des »Tausendjährigen Reiches« stammt aus dieser Quelle. Doch obwohl sich die Nationalsozialisten kräftig aus seinem Fundus bedienten, hielt sich Spengler von Hitler fern. Er starb vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, 1936, im Alter von nur 56 Jahren den Tod der Übersensiblen: plötzliches Herzversagen. Mit dem aktuellen Populismus teilt er die Ansicht, dass die Moderne ein »Zerfalls- und Verschmutzungsprozess« ist.
Spenglers Zyklendenken war keine Ausnahme – und blieb auch nicht auf den deutschen Kulturraum mit seinem Hang zum wagnerianischen Pathos beschränkt. Der Historiker Arnold Toynbee nahm den Niedergang des englischen Imperiums zum Anlass, in seinem Monumentalwerk »A Study of History« (1934 bis 1954; die deutsche Fassung erschien unter dem Titel »Der Gang der Weltgeschichte«) ähnlich deterministische Geschichtsbilder zu verbreiten. Und erst in jüngerer Zeit gab Paul Kennedy mit »The Rise and Fall of Great Powers« (1987, deutsch »Aufstieg und Fall der großen Mächte«) einem vergleichbaren Zukunftsbild Nahrung.
Heute trifft man an jeder Ecke, an jedem Stammtisch, in jeder Talkshow auf waschechte Spenglerianer – obwohl kaum jemand diesen Traktat im Original gelesen haben dürfte. Verschwörungstheorien wuchern, und bisweilen führen sie zu bizarren Taten wie zuletzt der des norwegischen Killers Anders Breivik, der von einem »europäischen Imperium« träumte, das sich gegen »den Islam« behaupten müsse. China wächst? Der Westen ist auf dem Weg in den Untergang, man sieht’s ja in Europa! Die deutsche Bevölkerung schrumpft? Die Kopftücher werden uns überschwemmen! Die Jugend spielt zu viele Videospiele? Der Anfang vom Ende! Irgendetwas lässt uns fest daran glauben, dass jedem Aufstieg zwangsläufig ein Abstieg folgt. Und dass »Zivilisation« ein völlig unhaltbarer, prekärer, eigentlich unmöglicher Zustand ist.
Der Sog der Ruinen
Wer jemals die Maya-Pyramiden besichtigt hat oder durch Angkor Wat, die Hauptstadt der untergegangenen Khmer-Kultur, gelaufen ist, kann sich dem Untergangspathos nur schwer entziehen. Gewaltige Tempelanlagen, durch deren mit erotischen Friesen bedeckte Mauern lastwagengroße Wurzeln wuchern. Riesige Bewässerungssysteme, von denen nur noch die Grundmauern stehen. »Die Möglichkeit, dass eine ganze Zivilisation sterben könnte, verdoppelt unsere eigene Sterblichkeit«, formulierte einst Santo Mazzarino.3 Wenn wir Ruinen besichtigen, spüren wir nicht nur der Vergangenheit nach. Wir betrachten unsere Zukunft. Wir vergleichen die Ruinen von damals mit den Hochhäusern von heute.
Zunächst sollten wir wissen, dass wir die Überreste einer ganz bestimmten Zivilisationsart inspizieren – der Pyramidalkulturen. Bei den meisten zerbröckelnden Großbauten handelt es sich um die Überreste zentralistischer Sklavenwirtschaften, die ihre inneren Konflikte nur durch ständige Gewaltherrschaft und dauerhafte Expansion lösen konnten. Wenn es einen Grund des Scheiterns gab, dann war es gerade der »Urmythos« – der zu immer größeren und teureren Kult- und Monumentalbauten führte und schließlich den Ruin besiegelte.
Auch mit den berühmten 1000 Jahren ist es so eine Sache. Das ägyptische Reich dauerte in mehreren Phasen über 3000 Jahre, das assyrische existierte hingegen nur 130 Jahre. Die Blütezeit von Byzanz umfasst eine Kernzeit von 240 Jahren. Die arabisch-islamische Kultur dominierte Europa 246 Jahre. Das Osmanische Reich war immerhin 330 Jahre dominant. England »ruled the waves« rund 250 Jahre (mit einer kleinen Unterbrechung, als Napoleon den Engländern die Stirn bot). Das amerikanische »Imperium«, das sich derzeit angeblich im unweigerlichen Niedergang befindet, ist dagegen mit einer Lebensdauer von einem guten halben Jahrhundert eher ein Säugling.
Die Geschichte, wie Mark Twain anmerkte, wiederholt sich nicht, aber sie neigt dazu, sich zu reimen. Aus diesem Reimen ein »ehernes Gesetz« zu machen ist typisch menschlich, aber falsch. In der sechstausendjährigen Geschichte Chinas oder Japans, in der wechselhaften Historie Europas wimmelt es von Auf- und Untergängen, von Umzügen vom Hauptplatz in den Hinterhof, von Metamorphosen von Stadt- zu Zentral- zu dezentralen Staaten und wieder zurück. Das alte Griechenland ähnelte in vieler Hinsicht eher der konfusen EU von heute – es war ein loser Vielstaatenverbund, der sich immer wieder im Kampf gegen die Perser verbündete und zerstritt. Die Han-Dynastie, die China um Christi Geburt regierte, war vergleichbar mächtig wie die Tang-Dynastie (um 700) und die Ming-Dynastie (Chinas »Nahezu-Moderne« um 1400) – eine Kultur, drei zeitlich voneinander weit getrennte Blütezeiten. Geschichte ist eben kein homogener, auch kein kurvilinearer Prozess, in dem das Auf und Ab in sauberen Phasen vorgesehen ist. Wie sagte Winston Churchill so schön? »Die Zukunft ist ein verfluchtes Ärgernis nach dem anderen!«
Wenn wir auf Ruinen herumklettern, übersehen (oder vergessen) wir gerne, dass wir oft in unserem Leben durch äußerst lebendige »Ruinen« gehen. Viele großartige Städte sind auf den Trümmern ihrer selbst errichtet. Warum bauten die Londoner nach der großen Feuersbrunst im Jahre 1666 ihre Stadt wieder auf, obwohl dieser Brand wie viele Stadtbrände des Mittelalters praktisch keinen Balken auf dem anderen gelassen hatte? Warum kann man heute in Lissabon und San Francisco Straßenbahn fahren, obwohl beide Städte durch verheerende Erdbeben untergingen, oder in Dresden die Frauenkirche besichtigen und im Zwinger Kaffee trinken? Warum in Hiroshima auf einen lebendigen Markt gehen, anstatt nur die Gerippe der im Feuersturm zerstörten Bauten zu besichtigen? Weil die Geschichte weitergeht. Weil Menschen zäh sind, hartnäckig und erfindungsreich. Weil Verlust zur Kontinuität der Geschichte gehört.
Schweden war im 17. Jahrhundert eine kontinentale Seemacht. Belgien und Holland und Portugal, nicht zuletzt Spanien bildeten im Spätmittelalter Weltmächte. England war im 18. Jahrhundert, neben Holland, das reichste Land der Welt, ein Pionier der Industriellen Revolution. Sind Schweden, Belgien, Niederlande, Portugal, England »untergegangen«? England mag heute nicht mehr als imperiale Macht existieren – wie Toynbee es voraussagte. Aber das »Englische« blüht umso mehr – Teetrinken bei Regen, Angelsport und Gartenkunst schätzt man nicht nur in England. Kulturen gehen nicht »unter«, wenn die staatlichen Organisationsformen sich verändern. Die griechische Kultur wurde von der römischen absorbiert. Die lateinische Sprache brachte eine ganze kontinentale Sprachevolution in Gang. Das Weiße Haus in Washington ist das Abbild einer römischen Villa, das Capitol heißt nicht umsonst so. Die jüdische Kultur wurde im Laufe der Jahrtausende viele Male an den Rand des physischen Untergangs gedrängt – was ihr womöglich gerade jene Vitalität und Universalität verlieh, die wir an ihr so bewundern.
Der Vorteil der Rückständigkeit
»Das Problem ist nicht, dass Staatsgebilde zusammenbrechen (das tun sie dauernd), sondern dass sie so lang andauern«, meint der Historiker David Phillips.4 Der »Untergang« (West-)Roms, quasi das Urmeter Spenglerianischer Logik und aller Untergangsgesänge, brachte das »dunkle« Mittelalter mit sich, die Herrschaft der Barbarei und der Hexenverfolgung. So die offizielle Geschichtsschreibung. Doch das Mittelalter war eine erfindungsreiche, vitale, vielfältige Epoche. Im europäischen Mittelalter wurden die Grundlagen für die Moderne gelegt – mit dem Buchdruck, der Mühlenwirtschaft, dem Manufakturwesen und vielen anderen Erfindungen. Die zahlreichen autonomen Klöster entwickelten innovative Wirtschaftsmodelle. Die Soziostrukturen der »Freien Stadt« konnten nur entstehen, weil kein imperiales, kaiserliches Reich mehr jede Stadt zur Garnisonsstadt degradierte. Wäre das Imperium der Römer ein »ewiges Reich« geblieben, hätte die Entwicklung gesellschaftlicher Komplexität, die schließlich zur Renaissance führte, nie stattgefunden.
Auch die »Barbarei der Barbaren« entstammt zu erheblichen Teilen einer verzerrten Geschichtsdarstellung. Als die Vandalen ins Römische Reich einfielen, bewahrten Reitervölker aus dem Norden vieles, durchmischten manches und adaptierten eine Menge.5 Die Mongolen errichteten im Steppengürtel, der den eurasischen Kontinent zwischen Jenissei in Sibirien und dem österreichischen Burgenland durchzieht, ein ganzes »Imperium«. Sie eroberten das imperiale China und (fast) das Japan der Shogune und gründeten sogar eine multikulturelle Großstadt, Karakorum. Ihre Kulturform war grausam im Krieg, aber tolerant im Frieden. Sie hatten keine Vision imperialer Herrschaft, und sie zerstörten weniger Kulturen, als dass sie – wie der Wind die Blütenpollen – diese in alle Welt trugen. Die Mongolen waren womöglich die ersten echten Globalisierer Eurasiens.
Der Historiker Ian Morris brachte diese »kreative Zerstörung« so auf den Punkt:
»Soziale Entwicklung erzeugt Gewinner und Verlierer, neue aufsteigende Klassen, neue Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Alt und Jung. Neue Kerne des Fortschritts entstehen, wenn diejenigen, die zu einer bestimmten Zeit unterlegen waren, durch den ›Vorteil der Rückständigkeit‹ das Heft in die Hand nehmen können. Wenn Gesellschaften größer, komplizierter und schwerer zu verwalten werden, entwickeln sie eine immer größere Bedrohung auch für sich selbst. Hier liegt das Paradox: Soziale Entwicklung erzeugt dieselben Kräfte, die sie unterminieren.«6
Hätte man die von Rom unterjochten Völker im Jahre 350 n. Chr. abstimmen lassen, ob sie das Römische Reich behalten oder abschaffen wollten – was wäre das Ergebnis gewesen? Die vielen »primitiven« Stämme und Kulturen des eurasischen Kontinents hätten den Büttel der Legionen mit Sicherheit gerne gegen jene Rückständigkeit getauscht, aus der sich später das Europa der Vielfalt entwickeln sollte …