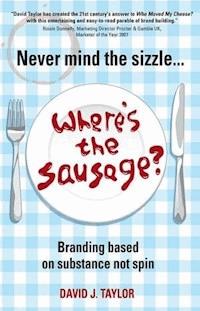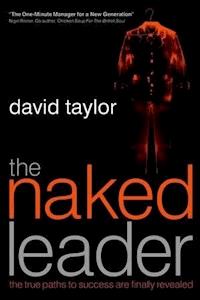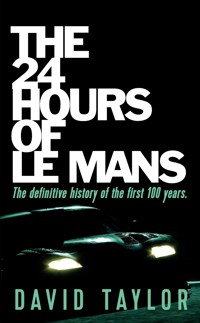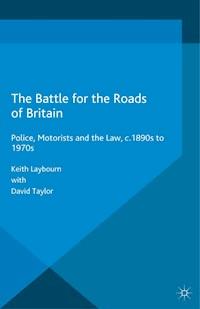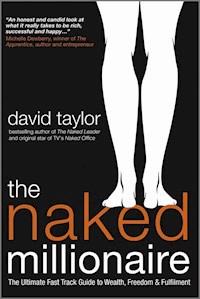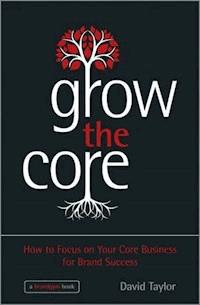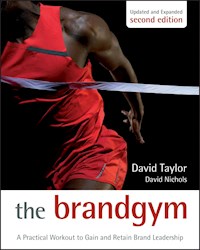3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Von rührenden und haarsträubenden Erlebnissen mit den ungezähmten Patienten im Zoo und in freier Wildbahn erzählen David Taylors Geschichten. Sie sind mit jenem staubtrockenen Humor geschrieben, den es in britischen Breiten offenbar rezeptfrei gibt. Ein Buch für alle, die gern ein Nilpferd in der Badewanne und drei Giraffen auf dem Balkon hätten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Ähnliche
David Taylor
Das Nilpferd muß ins Bett
Aus dem Englischen von Ursula von Wiese
FISCHER Digital
Inhalt
1. Die Dwoniker
Fünfzig Meter von mir entfernt ertönte aus meinem Auto das hohe Piepsen, das mir sagte, daß ich gesucht wurde. Ich ging hin, schaltete den Apparat ab und rief die funktelefonische Vermittlung an.
»Ein Anruf für Sie aus Holland, Herr Doktor Taylor«, sagte die Telefonistin. »In der Nähe von Utrecht ist einem Tierhändler ein Dwoniker entwichen. Sie sollen sofort mit Ihrer Pistole hinkommen und ihn betäuben. Ende.«
»Wird gemacht«, antwortete ich, aber während ich nach Hause fuhr, rätselte ich darüber, was dieses sonderbare Wort, Dwoniker, bedeuten könnte.
»Shelagh«, rief ich von der Haustür aus meiner Frau zu, »hast du eine Ahnung, was ein Dwoniker ist?«
Shelagh wußte es ebensowenig wie ich. Ich rief die Telefonistin nochmals an, um nachzuprüfen, ob ich den Namen richtig verstanden hatte. Ja, sie war ganz sicher. Ein Dwoniker lief im Lande der Windmühlen frei herum. Auf dem Weg zum Flughafen von Manchester erwogen Shelagh und ich, was das rätselhafte Tier sein könnte. Jedes Jahr werden neue Tierarten entdeckt, und es ist noch gar nicht so lange her, als zum erstenmal ein so großes und auffallendes Geschöpf wie das Okapi im dunklen Kongowald gesichtet wurde – genauer gesagt, das war im Jahre 1901 –, aber ich hielt es für unwahrscheinlich, daß der Händler an eine ganz neue Spezies geraten war. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder war der Dwoniker ein Tier, von dem ich noch nie gehört hatte, oder der Name war bei dem Ferngespräch von Holland mit England verstümmelt worden und war die holländische Bezeichnung für etwas weltbekanntes wie Hirsch oder Lama. Ich entschied mich für diese Möglichkeit und erklärte zuversichtlich: »Es ist ein typisch holländisches Wort. Ich wette, es ist ein wildgewordenes Rhinozeros.«
Dwoniker klang zwar holländisch, wie ich fand, doch meine Kenntnisse der holländischen Sprache beschränkten sich auf »Ja«, »Nein« und einen unaussprechlichen Teil der Anatomie.
Nach Shelaghs Überzeugung war der Name von den Telefonistinnen verstümmelt worden. »Überleg einmal, was ähnlich wie ›Dwoniker‹ klingt«, riet sie mir, »dann kommst du darauf.«
Wir versuchten es, aber wir fanden nichts Besseres als den Ducker, eine kleine Antilope, die in vielen Arten in ganz Afrika südlich der Sahara vorkommt.
Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr leuchtete mir Ducker ein. Aber wenn eines dieser schnellfüßigen kleinen Geschöpfe entwichen war, dann mußte es sehr, sehr schwierig sein, es zu verfolgen und aufzuspüren, um ihm im Freien einen Betäubungspfeil aufzubrummen. Ich hatte schon zehnmal größere Hirsche gejagt und von Glück sagen können, wenn ich nach stundenlanger Suche einen Blick auf sie erhaschte. Außerdem wußte ich nicht viel von den Duckern. Ich hatte sie im Londoner Zoo gesehen, aber die meisten britischen Tiergärten hatten keine. Es sollte also meine erste persönliche Begegnung sein. Ich hoffte, daß diese zierlichen, wahrscheinlich sehr kostbaren Geschöpfe mein Betäubungsmittel vertrugen, wenn es mir überhaupt gelang, auf Schußweite an sie heranzukommen. Gott behüte, daß es eine jener unseligen Antilopen war, bei denen gewisse betäubende Chemikalien das Kontrollzentrum der Körpertemperatur lähmen, so daß das ahnungslose Geschöpf einen jähen Temperaturanstieg erleidet, der das ganze Nervensystem zerkochen kann.
In Schiphol, dem Flughafen von Amsterdam, holte mich der Tierhändler, Herr van den Baars, ab. Als wir zu seinem Wagen gingen, vergaß ich, daß der ›Dwoniker‹ ja noch gar nicht identifiziert war, und fragte: »Wo ist der Ducker eigentlich?«
»Der Ducker, was für ein Ducker? Oh, Sie meinen wohl unsere Grachten?« gab van den Baars leicht verwirrt zurück.
»Ich meine den Ducker, der entwichen ist.«
Er lachte. »Ich weiß wirklich nicht, woher Sie das haben. Mein Ducker ist in sicherem Gewahrsam. Nein, es handelt sich um zwei Onager, die aus meinem Quarantänegehege ausgerissen sind.«
Onager! Zwei Onager. ›Dwoniker.‹ Als ich das englische Gehaspel des Holländers hörte, wurde mir klar, wieso die Telefonistin ein märchenhaftes Tier erschaffen hatte. Endlich war das Rätsel gelöst, und ich kannte meine Beute: zwei Onager, seltene und wertvolle persische Wildesel, deren letzte kleine Herden heute die nordöstlichen Grassteppen Persiens bewohnen.
»Sie wurden auf einer Riesenwiese ungefähr anderthalb Kilometer von meinem Tiergarten entfernt gesichtet«, sagte mein Gefährte. »Die Landschaft ist dort offen, und sie sollen ganz friedlich geweidet haben.«
Wir fuhren auf der Autobahn an den sauberen, braven Vorstädten von Amsterdam vorbei; die Abendsonne strahlte von dem schwarzen Wasser der überall fließenden Kanäle zurück. Auch Onager waren für mich etwas Neues, aber ich wußte wenigstens, daß sie zu den kleinen Vertretern der Pferdefamilie gehören. Ich hatte schon eine ganze Menge Pferde und Zebras betäubt, sogar das Przewalski-Urwildpferd. Ich hatte Betäubungsmittel bei mir, die ich gefahrlos bei allen Pferden anwenden konnte.
Herr van den Baars hielt auf einem schmalen Feldweg und wies über eine niedrige Hecke. Zuerst sah ich bloß eine grüne Riesenwiese. Dann erspähte ich die Onager. Sie befanden sich genau in der Mitte, sahen, von unserem Standort aus betrachtet, wie zwei cremefarbene Mäuse aus und taten sich im goldenen Licht der Abendsonne am üppigen Gras gütlich.
»Da sind sie«, sagte van den Baars, »und hier kommen Piet und Kees mit Kisten auf dem Traktor. Was haben Sie nun vor?«
Ich blinzelte in die Ferne. Nirgends gab es in der Nähe der Onager Deckung. Ich mußte es mit der lässigen, scheinbar unbekümmerten Annäherung versuchen. »Ich gehe allein hin, um zu sehen, ob ich die beiden mit dem Pfeil treffen kann«, antwortete ich. »Halten Sie Ihre Leute zurück, bis ich winke. Dann schicken Sie sie zu mir. Sollte nicht weiter schwierig sein, wenn ich auf fünfzehn Meter herankommen kann. Aber wenn sie wegrennen …« Ich schüttelte den Kopf. Da es bald Nacht wurde und so viel Raum zum Manövrieren zur Verfügung stand, konnten die flüchtenden Onager außer Schußweite bleiben, bis ich’s aufgeben mußte. Ich wünschte, ich hätte ein Gewehr bei mir gehabt, denn auf der weiträumigen Wiese vermochte meine Pistole nicht viel mehr als ein Blasrohr.
Nachdem ich Ampullen in zwei Pfeile eingesetzt hatte, kletterte ich über ein Heckengatter und lief eine Böschung hinunter zu der tischflachen Wiese. Während ich auf meine Beute zuging, spannte ich den Pistolenhahn, schraubte den Druck aufs Höchstmaß und hielt einen Finger aufs Sicherheitsventil. Die Sonne war ein orangefarbener Halbkreis über dem Horizont. Als ich den weidenden Onagern näherkam, blickte der eine kauend auf, spitzte die Ohren und warnte den anderen. Aus 250 Metern Entfernung starrten sie mich an. Jetzt mußte ich eine einfache List anwenden, die sich von zehn Malen dreimal als wirksam und siebenmal als blödsinnig erwiesen hatte. Alles hing von meiner Fähigkeit ab, einen harmlosen Spaziergänger mit lauter unschuldigen Gedanken im Kopf zu mimen. Der Tölpel schlendert dahin und schenkt dem Flußpferd oder dem Erdferkel – oder dem Wildeselchen –, das seinen Weg kreuzen mag, nicht die geringste Beachtung. Ein so dummer Hans-guck-in-die-Luft, der vor sich hinsummt, ist das genaue Gegenteil des menschlichen Raubtiers, das auf der Pirsch ist. Wesentlich ist dabei, daß man sich den Tieren nicht direkt nähert. Man muß einen kleinen Umweg machen, so daß man breitseits und nicht zu nahe herankommt.
So ging ich also vor. Die Narkosepistole war verborgen unter meinen lässig verschränkten Armen. Ich schien, wie ich hoffte, tief in Gedanken versunken zu sein, in Gedanken, die von einer Onagerjagd weit entfernt waren. Ab und zu trat ich mit einer Schuhspitze nach einem Grasbüschel, schaute vorbeifliegenden Vögeln nach und sang leise ein Liedchen. Nach einem verstohlenen Blick auf die Stellung der Onager betrachtete ich alles andere, nur nicht die Esel. Ich war zufrieden mit meiner Vorstellung. »Dumdidelidum«, trällerte ich. Der Abstand verringerte sich langsam, aber stetig. Mit gewaltigem Planschen war ich plötzlich bis zu den Knien im Wasser und sank noch tiefer, als meine Schuhe auf Schlamm trafen. Ich war in einen schmalen, schnurgeraden Wassergraben gefallen, der die Wiese berieselte und aus zwanzig Meter Entfernung unmöglich zu sehen war, weil die Ränder fast ineinander übergingen. Tropfend arbeitete ich mich hinaus und schaute mich um. Die Onager standen immer noch friedlich am selben Fleck, fraßen und behielten mich im Auge, als ich meine Hosenbeine mit einer Hand auszuwringen versuchte. Ja, sie hielten mich offenbar für den Dorftrottel. Sie schüttelten den Kopf und kauten weiter.
Ich setzte meinen Schlendergang fort, achtete aber von nun an scharfen Auges auf Wassergräben. Es ging mir auf, daß die ganze Wiese sauber unterteilt war von Wasserkanälen statt von Zäunen oder Hecken, und jedesmal war ich jeweils beinah schon hineingetreten, wenn ich einen entdeckte. Der harmlose Dörfler mußte einige Sprünge vollführen, rückte aber allmählich auf Schußweite vor. Schließlich konnte ich es meines Erachtens wagen und stillstehen, um die beiden Esel aus dem Augenwinkel zu beobachten. Sie beobachteten mich ebenfalls, anscheinend ohne sich zu fürchten. Ich schätzte die Entfernung auf zwölf Meter. Nahe genug. Ich entsicherte die Pistole, folgte mit dem Blick einem Reiher, der sich vom Himmel abhob, bis mein Gesicht den Onagern zugewandt war und nahm die Arme auseinander. Liebenswürdig summend zielte ich und drückte ab. Plupp! Ein Pfeil bohrte sich in die pralle Keule des einen Tieres. Schwanzwedelnd machte es ein paar Schritte und schaute sich nach seiner Flanke um. Inzwischen hatte ich den Onagern den Rücken zugekehrt, scheinbar unbekümmert, in Wirklichkeit, um den zweiten Pfeil einzusetzen. Gemächlich drehte ich mich um. Der zweite Onager starrte mich unsicher an, fluchtbereit, sollte er das geringste Anzeichen wahrnehmen, daß ich eine Gemeinheit im Schilde führte. Er sah, daß ich die Pistole zückte, witterte Gefahr, fuhr aber zu spät zur Flucht herum. Ein Pfeil mit roter Quaste grub sich in seinen Schultermuskel ein.
Beide Tiere waren injiziert und mußten in fünf Minuten bewußtlos sein. Ich fuchtelte wild mit den Armen zu dem Feldweg hin, wo Herr van den Baars und seine Gehilfen warteten. Bis sie kamen, sollten die Onager für die Verladung in die Kisten reif sein. Danach hatte ich nichts anderes mehr zu tun, als die Wirkung des Betäubungsmittels durch ein Antidot aufzuheben, und meine Arbeit war getan.
Die Onager torkelten und trotteten mit den besonders hohen Schritten herum, die Pferde zeigen, wenn ein Betäubungsmittel die Umwelt vor ihren Augen verschwimmen läßt. Dann taten sie etwas, das viele halbbetäubte Tiere tun – sie streben dem nächstbesten Hindernis zu. Sei es ein Zebra, ein Hirsch, eine Antilope oder ein gezähmtes Pferd, wenn ein Stacheldrahtzaun, ein Felsloch, ein Sumpf oder ein Weiher in der Nähe ist, sie alle fühlen sich oft auf unheimliche Weise von dem Hindernis angezogen.
Die beiden Onager tänzelten hochtrabend dem nächsten Kanal zu. Mit einem verzweifelten Sprung gelang es mir, den einen am Schwanz zu packen, um ihn zu bremsen. Vergeblich. Der Onager zog mich blindlings hinter sich her. Ich wollte ihn am Schwanz seitwärts steuern, aber der Wildesel war zu stark für mich. Unter einer mächtigen grünen Fontäne plumpste mein Onager in den Kanal. Sekunden später tat sein Gefährte zwanzig Meter entfernt das gleiche. Nun mußte ich damit rechnen, zwei kostbare, seltene Geschöpfe bewußtlos in anderthalb Meter tiefem Wasser ertrinken zu sehen.
Außer mir sah ich zum Feldweg hinüber. Van den Baars’ Leute lenkten den Traktor mit den Kisten gerade durchs Gatter auf die schmale Grasbrücke des ersten Wassergrabens zu. »Kommt schnell her! Schnell!« schrie ich, in der Hoffnung, daß sie mich auch auf diese Entfernung trotz Motorengeknatter hören konnten.
Der Kopf des einen Onagers ruhte mit glasigen Augen auf dem Schlammrand des Kanals. Bei dem anderen tauchte das Maul mehrmals unter. Er war fast gänzlich bewußtlos. Mir blieb keine Wahl. Ich sprang neben ihm in den Wassergraben und packte den schweren Kopf. Ich bewahrte mühsam das Gleichgewicht, während ich, auf dem Schlammboden ausrutschend, die Nasenlöcher des Tieres über Wasser zu halten suchte und von seinem Gewicht schier erdrückt wurde. Unter Anspannung aller Kräfte zog und zerrte ich, bis die Nase knapp auf dem Kanalrand ruhte. Jetzt ging der andere Onager unter. Wie ein nasses Handtuch schleppte ich mich aus dem Wasser, latschte über das Gras und sprang abermals in den Kanal, um den Kopf des zweiten Tieres zu ergreifen. »Schnell! Schnell!« schrie ich immerzu.
Nach endloser Zeit kamen die Männer an, sprangen vom Traktor und rannten zu mir herüber. »Holt die Kisten vom Traktor herunter, schnell!« stieß ich hervor. »Ich kann den Kopf nicht mehr lange halten.« Ich mußte das Gegenmittel injizieren, während die Tiere noch im Wasser waren. Wir drei vermochten die schweren bewußtlosen Onager nicht über den abschüssigen Kanalrand zu schleifen; aber vielleicht konnte ich sie so weit zu sich bringen, daß sie selbst hinausstrebten. Nur mußten wir sie dann in die Kisten schaffen, bevor sie genügend wach waren, um Reißaus zu nehmen. Unter Wasser kramte ich aus meinen Taschen Plastikspritze, Nadel und Antidot hervor. An Sterilisieren oder Desinfizieren war nicht zu denken. Die beiden Esel und ich waren von oben bis unten schlammbedeckt.
Ich zwängte meinen Kopf unter den Unterkiefer des einen Onagers und stützte seinen Kopf unter Qualen mit dem meinen, so daß ich beide Hände zum Füllen der Spritze frei hatte. Dann drückte ich eine Faust in die Basis seines Halses – irgendwo unter der Wasseroberfläche –, so daß die Drosselader über dem Wasser hervortrat. Eine Minute nachdem ich die Nadel eingestochen und das Gegenmittel injiziert hatte, fühlte ich, daß sich die Muskeln des Onagers strafften. Ohne Unterstützung hob ich seinen Kopf in die Höhe. Mit einem raschen Blick überzeugte ich mich, daß sein Gefährte immer noch über Wasser atmete. Ich teilte den Männern mit, wie es weitergehen sollte: »Ich tauche jetzt, packe ein Vorderbein nach dem andern und schiebe sie aufs Ufer. Dann stellt ihr die Vorderhufe auf und zieht den Esel am Hals. Wenn ich dann hinten schiebe und das Tier die Hinterbeine selbst gebraucht, sollte es hinauszuschaffen sein.«
Die Männer nickten. Ich tauchte und merkte erst jetzt, wie kalt das Wasser war. Blindlings tappte ich unter dem prallen Leib des Wildesels herum, bis ich ein Vorderbein fand. Die Männer griffen von oben zu. Als beide Vorderbeine oben waren, watete ich zum Hinterteil des Onagers. Mit Püffen ermunterte ich ihn, sich zu bewegen. Die Wirkung des Betäubungsmittels war jetzt so gut wie vergangen. Mit einem schwerfälligen Sprung hievte sich das Tier über den Kanalrand, die Männer klammerten sich an seinen Hals, und ehe es alle seine Sinne wieder beisammen hatte, wurde es in die eine Kiste verfrachtet.
Ich füllte meine Spritze von neuem, und zum viertenmal an diesem Tage entfaltete ich meine Kunst als Olympia-Anwärter, indem ich neben dem anderen Onager ins Wasser sprang. Wir wiederholten unsere Taktik; das wiederbelebte Tier kletterte hinaus und wurde zur Kiste gezerrt. Doch während es manipuliert wurde, trat es mit dem einen Hinterbein aus. Der unbeschlagene, aber feste Huf traf mich mitten in die Brust, da ich Steuermann am Schwanz spielte. Ich klatschte rückwärts ins Wasser. Während ich mich aus dem Schlamm aufraffte, fragte ich mich, was mich eigentlich dazu bewogen hatte, einen Beruf zu wählen, bei dem ich in der Tiefe eines holländischen Kanals herumschwimmen und mir von Schlamm Augen und Nasenlöcher verkleben lassen mußte.
Als beide Onager im Quarantänegehege eingesperrt waren, bekamen sie von mir noch eine Injektion, diesmal mit langfristig wirkendem Penicillin, weil zu befürchten war, daß meine unhygienischen Maßnahmen im Kanal ihnen Krankheitserreger eingeimpft hatten.
»Nun ja, Herr Doktor«, sagte Herr van den Baars, als ich schlotternd in Unterhosen stand und mich umzog, »jetzt möchten Sie sich vielleicht mit unserem guten holländischen Gin aufwärmen. Verdient haben Sie es wirklich. Ich muß mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, im Namen der Dwoniker.«
2. Wie alles anfing
Die ersten Schritte auf dem langen Weg zu dem schlammigen holländischen Wassergraben wurden von einem Schuljungen unternommen, der sich glühend für alles interessierte, was fleuchte und kreuchte, schwamm und kroch. Beim Umherstreifen auf den Torfmooren und in den Heidetälern der Penninischen Kette rings um meine Heimat Rochdale (in der Nähe von Manchester) fand ich immerzu Geschöpfe, die offensichtlich in Not waren, vor allem Schafe. Bewegungsunfähig, oft mit entzündeter und geschwollener Scheide, halb zerfressen von Schmeißfliegenmaden, lagen diese bedauernswerten Tiere allein auf windumbrausten Hügelhängen, in Steinbrüchen oder zappelten in Moorlandbächen. Es hätte keinen Zweck gehabt, die Eigentümer der Schafe zu suchen. Die Torfmoore dehnten sich weit, und die Herden wanderten nach Lust und Laune in ferne Gegenden. Nur ein- bis zweimal im Jahr wurden sie von Schäfern zusammengetrieben, die rätselhafterweise immer wußten, wo sie sich gerade aufhielten. »Da kann man nichts mehr machen, Junge«, sagten sie, kehrten dem leidenden Tier den Rücken und schoben ab.
Das Moor war jedermanns Eigentum, das Gras kostenloses Futter. Ein paar Schafe durch Krankheit, Füchse oder Diebe zu verlieren, das gehörte zum Leben. Man verdiente trotzdem seinen Unterhalt.
Die Hausaufgaben waren vergessen, wenn ich im Regen neben einem durchnäßten Wollbündel hockte oder in dem Buch »Kranke Tiere« las. Dieses Buch war eigentlich für Tierhändler gedacht, die ihre Kunden in Erster Hilfe beraten sollten. Es war illustriert mit Radierungen, auf denen bärtige, befrackte Herren unwahrscheinliche Katzen, deren Kopf verhüllt war, über dampfende Schüsseln hielten und kunstvoll frisierte Damen anscheinend Panzerhandschuhe benutzten, um Hunden Tabletten in den Schlund zu stopfen. Was mich betraf, so war es das Evangelium der Tierheilkunde. Ich wußte nicht, daß die Schafe, die ich sah, nach schwieriger Lammung an feuchtem Brand starben oder durch Schmarotzer, die ihre Leber zerfraßen, oder infolge Kalziummangels; denn nichts davon war in meinem Buch erwähnt. Ich bedeckte die Tiere halt mit meiner Joppe, um sie zu wärmen, behandelte ihre entzündeten Körperteile mit desinfizierender Salbe, las die Maden ab und flößte den Ärmsten zwangsweise den Brandy meines Vaters ein.
Ich glaube nicht, daß auch nur eines meiner erkrankten Schafe genas. Zweimal, manchmal sogar dreimal am Tage ging ich zu meinen Patienten hinaus, und früher oder später fand ich sie tot vor. An einem schwarzen Tag traf ich auf einen Widder, der in einen Steinbruch gestürzt war, aber noch lebte. Die zersplitterten Enden des gebrochenen Oberschenkelknochens staken zehn Zentimeter aus der Haut hervor und wimmelten von Schmeißfliegenmaden. Zitternd und elend vor Grauen beging ich meinen ersten Mord an einem Patienten; ich erstickte ihn, indem ich meine Joppe fest um seine Nase und sein Maul wickelte. Er brauchte lange Zeit zum Sterben. Benommen ging ich nach Hause. Zwei Nächte fand ich überhaupt keinen Schlaf.
Neben der desinfizierenden Salbe und dem Brandy enthielt meine Medikamententasche ein Vitamintonikum und Arnikatinktur, ein scharfes braunes Gebräu, das Allheilmittel meiner Großmutter. Großmutter kam selten mit mir aufs Moor, war aber meine Verbündete, Mentor, Mitverschworene und Assistentin bei all meinen tierärztlichen Maßnahmen zu Hause. Sie war sehr lebhaft, immer beschäftigt. Sie war kräftig und untersetzt, hatte glänzende graue Augen in einem runden Gesicht und aß fast immer ein Kuttelgericht, das ihr anscheinend nie verleidete. Nur montags wechselte die eintönige Ernährung mit fettem Hammelfleisch und Pfefferminzsauce ab. Die Buben in der Nachbarschaft hegten große Hochachtung vor ihr, weil sie, wenn sie Lust hatte, mit ihren genagelten Holzschuhen auf dem Kopfsteinpflaster unserer Gasse einen Funkenregen erzeugen konnte. Viele von uns, auch ich, waren imstande, Funken aus den Steinen zu schlagen, aber keiner verfügte über die pyrotechnische Fertigkeit, mit der die alte Dame auf dem Wege zum Metzger ein Feuerwerk hervorbrachte.
Es gab noch einen Grund für die Ehrfurcht der Buben. Abgesehen davon, daß wir unsere jahreszeitbedingten Liebhabereien hatten – wir zündeten das vergilbte Gras am Rande des Moores an, duellierten uns mit Roßkastanien, spielten Kricket und schlugen Kreisel über Steinfliesen –, abgesehen davon hielten wir alle Mäuse. In den Kriegsjahren war es fast unmöglich, zahme Mäuse zu bekommen, und in den Käfigen, Taschen und Privatverstecken der Buben herrschte arger Mangel an den kleinen Nagetieren, bis Großmutter das Problem löste. Irgendwie fand sie heraus, daß im Gaswerk von Rochdale Mäuse gehalten wurden, sowohl weiße als auch schokoladenfarbene, wahrscheinlich zur Warnung vor ausströmendem Gas, so wie man in den Kohlengruben Kanarienvögel benutzte. An einem Samstagmorgen führte sie eine Bubenschar zum Gaswerk. Jeder von uns hatte einen Behälter, eine Dose oder eine Schachtel. Begeistert kamen wir mit Mäusen heim, denn Großmutter kannte den Mann, der den Schlüssel zu dem Raum hatte, wo die Mäuse gehalten wurden. Gewöhnlich war er recht sauertöpfisch, aber in Großmutters Gegenwart taute er auf, und er schmunzelte vergnügt, als er in jeden Behälter, der ihm unter die Nase gehalten wurde, ein paar samtige Tierchen legte. Nach diesem Durchbruch ließen wir es uns angelegen sein, allein zum Gaswerk zu gehen, aber ohne Großmutter klappte es nie. Es gäbe keine überflüssigen Mäuse, hieß es dann immer, Mäuse würden überhaupt nicht gehalten, der Mann hätte keine Zeit. Aber für Großmutter, die von einer Bande Sechs- und Siebenjähriger beschworen wurde, auf ihrem Samstagsgang zum Markt einen Umweg zu machen, waren stets Mäuse zu haben.
So arbeitsam und praktisch sie auch war, gleichzeitig war sie sehr gefühlsbetont. Sie wendete jede Woche drei Pence für uns auf, damit am Sonntagabend für sie eine schmalzige Ballade »Ich will an deiner Seite gehen« gesungen wurde, wobei Mutter uns auf dem Klavier begleitete. Dieses schauerliche Ritual trieb ihr jedesmal die Tränen in die Augen (die gleiche Wirkung hatte es auf alle anderen Familienmitglieder, wenn auch aus anderen Gründen), und zum Glück fand es ein Ende, als bei mir der Stimmbruch begann.
In ihrer Jugend war Großmutter Näherin gewesen, und sie bestand darauf, daß ich Nähen und Stricken lernte, mit der Begründung, daß die Kunst der Chirurgie, an die ich mein Herz gehängt hatte, nur aus Schneiden und Nähen bestehe, und daß man das saubere Gefädel an lebendigem Fleisch am besten an Flanell-, Seiden- und Kammgarnfetzen erlernen könne. Viele Stunden verbrachte ich damit, unter Großmutters falkenscharfen grauen Augen Stoffstückchen zusammenzunähen, und immer wenn ich nachlässig wurde, gab sie mir mit ihren dicken Metallstricknadeln schmerzhafte Schläge auf die Fingerknöchel. Ihre Weisheit fand später Bestätigung, als der Chirurgie-Professor an der Universität den Studenten bei ihren ungeschickten Versuchen, tote, unblutige Tiere zu operieren, zusah und ihnen riet, bei jeder Gelegenheit Strümpfe zu stopfen und Knöpfe anzunähen. »Weniger Bier und Weiber, aber mehr Nadelarbeit, meine Herren«, brüllte er, wenn wir an den Kadavern herumfummelten.
Großmutter und ich bildeten ein gutes Gespann. Sie verstand sich auf das einzige Betäubungsmittel, das wir hatten: Äthylchlorid, das die Haut vereist und durch Kälteeinwirkung örtlich betäubt. Mit der einen Hand hielt sie vorsichtig eine zappelnde Drossel fest, die ich im Gebüsch gefunden hatte, und mit der anderen sprühte sie die betäubende Flüssigkeit auf den gebrochenen Flügelknochen des Vogels. Nachdem sich auf den blutenden Flugfedern Reif gebildet hatte, hieß sie mich den Knochen mit Streichhölzern schienen, die ich mit Heftpflaster zusammenhalten mußte. Durch ihre goldgeränderte Brille verfolgte sie die Bewegungen meiner Finger.
Meine Eltern duldeten anfangs die genesenden Kröten im Badezimmerschrank, die gelähmte Eule, die auf der Standuhr in der Diele saß, und die Kaninchen, Opfer von Verkehrsunfällen, die entweder gesund wurden oder in der Notfallstation, die ich in leeren Zinkwaschzubern eingerichtet hatte, unrettbar dahinsiechten. Doch mit der Zahl der Patienten nahmen auch die Schwierigkeiten zu. Die Eule brachte die antike Uhr zum Stehen, als ich einmal vergaß, das Zeitungspapier, auf dem sie hockte, zu wechseln. Da fielen ihre Exkremente durch ein Loch im Gehäuse und verklebten das Messinguhrwerk. Mit großer Mühe reinigte mein Vater es, aber die Uhr ging nie mehr richtig. Wenn jedoch irgendein Familienmitglied die Sache mit der unseligen Uhr zur Sprache brachte, verschränkte Großmutter die Arme, ließ ihre Brust schwellen und erinnerte in spitzem Ton alle Anwesenden daran, daß die Uhr ihr gehöre, und daß sie nie richtig gegangen sei; eine ungeheuerliche Behauptung, wie wir alle wußten, aber keiner wagte zu sagen, das entspreche gar nicht der Wahrheit. In dem grollenden Schweigen zwinkerte mir Großmutter dann mit ernstem Gesicht zu.
Als der Krieg ausbrach, wurde unser alter Keller in den Luftschutzraum der Familie verwandelt. Man verstärkte die Decke mit Stützbalken und Pfeilern; Pritschen und Gestelle für Konservenvorräte wurden eingebaut. Tatsächlich blieb Rochdale von Bombenangriffen verschont, und bei den seltenen Fliegeralarmen machte die Familie nie Gebrauch von ihrem Luftschutzraum. Ich erkannte bald, welche Vorteile ich daraus schlagen konnte, denn es war wegen meiner tierärztlichen Tätigkeit zu Zusammenstößen mit meinen Eltern gekommen. Bei der Besichtigung der Treibbeete, wo mein Vater unter Glasglocken Radieschen und Salat zog, stellte er nicht nur fest, daß sein reifer, knuspriger Salat als lebenswichtiges Nahrungsmittel für die verwundeten Kaninchen in den Zinkbütten verwendet worden war, sondern daß sogar zwei alte Igel ihr Krankenlager in der Reihe der Glasglocken hatten. Wieder kam mir Großmutter zu Hilfe. Sie pflanzte sich zwischen meinem gereizten Vater und mir auf und verteidigte ihren geliebten siebenjährigen Enkel. »Genug davon, Frank«, sagte sie mit drohend erhobenem Zeigefinger zu meinem Vater. »Wir sind im Krieg.«
Mehr sagte sie nicht. Ihre Macht lag in der Art, wie sie es sagte. Ich erinnere mich deutlich an die schiere Kraft ihrer Worte, während sie, ohne mit der Wimper zu zucken, aufgereckt dastand. Nichts hätte weniger unvernünftig oder einleuchtender klingen können. Da wir im Krieg waren, mußten alle Engländer und Engländerinnen, alle Kaninchen, Eulen und Igel Schulter an Schulter für die gemeinsame Sache kämpfen.
Nachdem Großmutter am folgenden Tag Vater mit neuen Salatsamen beglückt hatte, zog ich sie ins Vertrauen und weihte sie in meinen Plan ein, die streitsüchtigeren Exemplare meiner Vögel und Säugetiere in den offenbar unbenutzten Luftschutzkeller zu verlegen. »Deine Mutter wird dagegen sein«, murmelte sie, als wir die Möglichkeiten erörterten. »Ich weiß, der Luftschutzraum wird fast nie benutzt, aber angenommen, es ist irgendwann einmal notwendig?«
Ich hielt das für ganz und gar unwahrscheinlich, und abgesehen von der alten Waschküche im Hof blieb mir keine Wahl. Großmutter willigte schließlich ein und riet mir, meine Patienten durch den Schacht, über den früher die Kohlen in den Keller gerutscht waren, in den Luftschutzraum zu befördern. Dann brauchte ich nicht durch die Türen zu gehen, womit ich bei den andern Aufmerksamkeit erregt hätte. Das war ein guter Ratschlag. Meine Komplizin wachte in dem großen Raum neben dem Kohlenkeller, wo Früchte eingemacht, Wäsche gemangelt und einzelne Kleidungsstücke gewaschen wurden. Ich hob das schwere Eisengitter vor dem in Straßenhöhe angebrachten Schacht heraus und rutschte mit einem Patienten nach dem andern in den neuen Krankensaal. Hier hatte ich auf den Pritschen die Schachteln, Dosen, Krüge und Käfige für die Kranken aufgestellt. Als die Küste klar war, schlüpfte Großmutter zu mir herein, und wir machten uns gemeinsam an die Arbeit.
Das Krankenhaus überstand die erste Entdeckung durch meine kleine Schwester Vivienne, die eines Tages hereinplatzte, aber von Großmutter gekauft wurde: Vivienne bekam für ihr Stillschweigen ein kleines Medaillon. Aber kurz darauf führte ein Luftangriff auf Manchester dazu, daß in Rochdale ein langer Alarm ertönte. In jener Nacht hörten wir in unserem Hause deutlich die Bomben, und meine Eltern beschlossen, wir sollten alle im Luftschutzraum schlafen. Beim Betreten stellten die Pyjamagestalten fest, daß ihr Zufluchtsort bereits von pelzigen, geschuppten und gefiederten Geschöpfen besetzt war. Was noch schlimmer war, mein Vater entdeckte, daß ich den ganzen Vorrat an Cornedbeef den Igeln verfüttert hatte, und meine kleine Schwester wurde, als sie sich verschlafen auf die unterste Pritsche setzte, von dem verwaisten Fuchswelpen gebissen, der diese Pritsche als seinen Bau betrachtete.
Wunderbarerweise beschwichtigte Großmutter jedermanns zerrissene Nerven und gab furchtlos zu, sie habe die Cornedbeef-Büchsen für mich geöffnet; aber mein vielgeplagter Vater beschloß an Ort und Stelle, die Waschküche auf dem Hof in ein anerkanntes Tierspital umzuwandeln. Bei dem Tierspital ergab sich allerdings das Problem, daß für mich und Großmutter kein Platz zum Arbeiten blieb. Das mußte woanders besorgt werden. Am liebsten arbeiteten wir in der Küche. Das Licht war gut – sehr wichtig, besonders für unsere regelmäßige Behandlung der Igel, die von Zecken heimgesucht wurden. Zusammen bestrichen wir die blutgeschwellten Zecken mit Chloroform, und nachdem wir kurze Zeit gewartet hatten, bis die Zecken ihren Halt am Bauch unserer stachligen Patienten verloren, trat Großmutter zurück, während ich als Oberarzt die Zecken mit einer Pinzette ablas. Ein Ärgernis ist es, daß Igel, insbesondere kranke, oft auch noch eine erkleckliche Ladung von Flöhen mit sich herumtragen. Die Warme in der Küche schien diese Springer zu ermuntern, ihre Wirte zu verlassen, und eines schlechten Tages fand meine Mutter Dutzende von energiegeladenen Pünktchen auf einem Teig herumhüpfen, den sie ausrollen wollte. Großmutter ergriff einen Floh, zerknackte ihn zwischen Zeigefinger- und Daumennagel und erklärte, es sei ein Mückchen. Da es Ende Januar war, mußte sie hinzufügen, es sei eine unzeitgemäße junge Mücke. Danach bestäubten wir die Igel mit DDT, bevor wir sie ins Spital brachten. Großmutter vergewisserte sich stets, daß Mutter ausgegangen oder woanders im Hause beschäftigt war, wenn wir Igel zu behandeln hatten. Wir benutzten den Küchentisch und sprachen im Flüsterton.
Wenn alles gut ging, summte Großmutter vergnügt vor sich hin und umarmte mich zum Schluß. Sie hatte ihre helle Freude daran, mich für sich zu haben. Zweifellos liebte sie die Tiere, mit denen wir uns befaßten, aber in erster Linie sah sie ihre Belohnung wohl darin, daß sie mir beistand, einen kleinen Grundstein für meine Zukunft zu legen; denn wir wünschten beide, daß ich dereinst Tierarzt würde. Wir kamen gar nicht auf den Gedanken, daß ich einen anderen Beruf ergreifen oder mich für das Studium nicht qualifizieren könnte. »O ja«, sagte sie zu ihren Freundinnen, »eines Tages wird David Tiger behandeln.«
Sie behielt recht.
Als wir mit Goldfischen, Wassermolchen und Fröschen, die Hautkrankheiten hatten, zu tun bekamen, ging es zuerst nicht gut. Ich rieb ihre Geschwüre mit Salben und antiseptischen Extrakten ein, aber das Wasser spülte alles sehr bald wieder weg. Immer wieder mußte ich meine Mißerfolge im Garten begraben.
»Mir ist etwas eingefallen«, sagte Großmutter eines Tages, als sie zusah, wie ich mein neuestes Opfer, einen Goldfisch, der Erde übergab. »Hol mir die Paste, die ich für mein Gebiß benutze, David!«
Ich ging die Paste holen, die sie im verschlossenen Badezimmer beim geheimnisvollen Ritual ihrer Morgentoilette zu benutzen pflegte.
»So«, sagte sie, als ich ihr die Dose mit der zähen grauen Substanz gab, »wenn wir das nächstemal einen Goldfisch mit einem häßlichen Geschwür haben, reiben wir ihn wie gewöhnlich mit Arnika ein, aber bevor wir ihn ins Wasser zurücksetzen, schmieren wir ihm dieses Klebemittel auf. Es ist ein sonderbares Zeug, sowie es naß wird, sitzt es fest wie Wachs. Dadurch behalte ich meine Zähne im Mund, junger Mann. Hier, versuch es einmal.«
Ich nahm ein bißchen von dem Zeug und tat es auf meine Zunge. Es schmeckte nach nichts, aber ich fühlte, daß sich die Konsistenz veränderte und daß es festklebte. Ich fuhr mit der Zunge über das Gaumensegel, aber die Paste ging nicht ab, und sie klebte immer noch, als ich mir am Abend die Zähne putzte. Auch am Morgen saß das Zeug noch fest, und da wurden mir die Möglichkeiten des Mittels klar.
Jetzt brauchten wir nur noch einen geeigneten Krankheitsfall.
Einige Wochen später brachte mir ein Freund einen entzückenden großen Frosch. Er war grün, glänzte und saß unangefochten auf meiner Handfläche, wobei seine Kehle zu schlucken schien. Ein Vorderzeh war geschwollen und sah entzündet aus. Durch die Haut quoll Körperflüssigkeit. Ich zeigte ihn meiner Großmutter.
»Das Zeug für dein Gebiß«, erinnerte ich sie. »Jetzt haben wir eine Gelegenheit, es zu erproben.«
Sie war begeistert. »Hol schnell die Paste aus meinem Zimmer«, rief sie. »Wir streichen sie auf Beinwohlsalbe.«
Beinwohlsalbe gehörte zu den Kräuterheilmitteln, deren vorzügliche Eigenschaften Großmutter predigte. Sie lehrte mich nicht nur den Gebrauch von Arnikatinktur, sondern auch von Chinin, Senneskraut und Brechwurzabkochung. Ich wurde überwacht, wenn ich Jod, Gentianaviolett und klebrige Kaolinumschläge anwendete. Wenn wir Tiere hatten, die an Atembeschwerden litten, gingen wir zu den Arbeitern, die Straßen teerten. Großmutter gab den Männern, die große Augen machten, einen Shilling Trinkgeld, wenn sie unsere schnüffelnden Igel eine Viertelstunde lang an den qualmenden Teerkesseln riechen ließen. »Was für Kinder mit Keuchhusten gut ist, wird wohl auch gut für Igel sein«, sagte sie zuversichtlich.
Großmutter hielt den Frosch behutsam fest, während ich den entzündeten Zeh mit lindernder dunkelgrüner Beinwohlsalbe einrieb. Dann bedeckte ich den ganzen Fuß mit dem Gebißklebemittel und setzte den Frosch in eine große Karaffe, die fünf Zentimeter hohes Wasser und einen Kletterstein enthielt. Tags darauf war die Beinwohlsalbe immer noch da. Großmutter freute sich sehr und tätschelte mir den Kopf.
Drei Tage später entfernten wir die Klebepaste und die Salbe und sahen uns den Zeh an. Kein Zweifel, die Schwellung war zurückgegangen, und der Zeh war nicht mehr so stark entzündet. Ich wiederholte die Behandlung, setzte den Frosch wieder in sein Krankenzimmer und schenkte ihm ein halbes Dutzend dicke Schmeißfliegen, die ich für ihn gefangen hatte. Der Frosch und Großmutter machten tierheilkundliche Geschichte, denn der Zeh war in einer Woche vollständig geheilt, ein Rekord für Frösche in meiner Klinik. Wir ließen ihn im Teich eines nahe gelegenen Parkes frei. Ich benutze die Gebißpaste meiner Großmutter noch heute, wenn ich bei Delphinen oder Seelöwen Wunden zu behandeln habe.
Großmutter erfand auch ein neues Heilverfahren für Schildkröten, die abgestürzt waren oder so harte Schläge erhalten hatten, daß ihr Panzer Sprünge bekommen hatte und das weiche Gewebe darunter bloßlag. Heute schneide ich große Fenster in den Schildkrötenpanzer, wenn ich operieren muß; das Loch im Panzer wird mit Epoxydharzen und Glasfasern repariert und ist in ein paar Monaten geheilt. Als Großmutter und ich praktizierten, gab es Epoxydharze und Plastik noch nicht, aber sie war auf der richtigen Spur. Ich muß etwa zwölf Jahre alt gewesen sein, als sie ihren Gedankenblitz hatte.
»Weißt du was«, sagte sie eines Tages, als wir das septische, ausgezackte Loch im Panzer einer Schildkröte betrachteten, das der Biß einer Katze verursacht hatte, »wenn du die Wunde desinfiziert hast, sollten wir das Fleisch schützen, indem wir das Loch richtig versiegeln. Geh und hol deinen Mechanikerkasten.«
Mein Mechanikerkasten enthielt nur das Werkzeug, das ich brauchte, um Löcher in den Reifen meines Fahrrads zu flicken, Schmirgelpapier, Klebstoff, Talkum und Gummischeiben für Schläuche. Ich holte ihn. Für Schläuche gut und schön, dachte ich, als ich mit dem Kasten zurückkehrte, aber für Schildkröten?
Doch mit meiner Großmutter war nicht zu streiten. »Nun, mein Junge, mach die Wunde sauber.« Sie sprühte Äthylchlorid auf die Stelle. »Tu die Arnikasalbe darauf.« Ich tat wie geheißen. »Und jetzt mach weiter, als ob die Verletzung bloß ein gewöhnliches Reifenloch wäre.«
Die Schildkröte zog leise zischend den Kopf ein, anscheinend ergeben in ihr Schicksal, ein Fahrrad darzustellen. Ich rieb die Lochränder des Panzers mit Schmirgelpapier ab, bestäubte sie leicht mit Talkum, bestrich sie mit Klebstoff und drückte einen Gummiflicken von passender Größe darauf. Tadellose Arbeit.
Großmutter strahlte. »So«, sagte sie, »nach der Größe des Lochs zu urteilen, und wenn man bedenkt, wie lange es dauert, bis ein Fingernagel um zwei Zentimeter gewachsen ist und auch in Rechnung stellt, daß Schildkröten kaltblütig sind und wahrscheinlich längere Zeit zum Heilen brauchen als wir Säugetiere, meine ich, du solltest dir die Sache in ungefähr einem Monat begucken können.« Die durchlöcherte Schildkröte, deren schwarzer Flick auf dem Panzer wie eine Falltür aussah, hinter der sich ihre Maschinerie verbarg, streckte Kopf und Beine wieder hervor, als sie sicher war, wieder in ihrem Aquarium zu sein und nicht etwa mitten in der Tour de France zu stecken. Sie sah unbekümmert aus und begann an einer kleinen Wasserschnecke zu knabbern.
Der Flicken hielt unter Wasser. Jeden Tag schaute ich nach, ob die Ränder in Ordnung waren. Als die Tage vergingen, schien »Schwarzfleck« viel glücklicher zu sein, als es dem Namen, den ich der Schildkröte gegeben hatte, entsprochen hätte. Auf den Tag genau nach einem Monat brachte ich sie in die Küche. Sogar Großmutter hielt den Atem an, als ich den Gummiflicken mit ihrer Nagelschere aufschnitt. Ich schälte den Gummi ab, und wir stießen mit den Köpfen zusammen, als wir uns gleichzeitig vorbeugten, um die Wunde näher zu betrachten. Ich jauchzte. Der Panzer war vollständig geheilt, kein Loch war mehr da. »Schwarzfleck« regte sich nicht weiter auf, als wir uns umarmten und vor Freude lachten – wir nahmen unsere Arbeit sehr ernst und freuten uns über unsere gelegentlichen Erfolge ebenso gemeinsam, wie wir den Kummer über unsere häufigen Fehlschläge teilten.
»Großmama«, sagte ich, »eines Tages werde ich dir den Nobelpreis für Medizin geben.«
Ich hegte unbegrenztes Vertrauen zum Wissen meiner Großmutter, und nur allmählich änderte sich diese Sachlage. Als ich zur Universität ging, litt sie an einer chronischen Herzkrankheit und nahm kein einziges Medikament ein, mochte es auch der hervorragendste Facharzt verschrieben haben, solange ihr Enkelsohn und ehemalige Mitarbeiter nicht seine Zustimmung gegeben hatte. Sie war riesig stolz, als ich mein Veterinärexamen machte. Sie hängte das Diplom über ihr Bett und lebte nur dafür, mit mir über die alten Zeiten zu sprechen und meine Ansicht über die neueste Verordnung ihres Arztes zu hören.
Einige Jahre später bekam ich es mit meiner ersten Riesenschildkröte zu tun, einer der mächtigen und seltenen, 300 Pfund schweren Galapagos-Schildkröten im Bellevue-Zoo von Manchester. Daich keine Ahnung von der ungeheuren Zusammenziehungskraft ihrer Hinterbeinmuskeln hatte, konnte mir das Biest die Hand im Panzer einklemmen, wo ich an der Seite eine Injektion in die weiche Haut gegeben hatte. Ich dachte gerade, was Großmutter wohl dazu sagen würde, da zogen die Wärter schnell an dem verschwindenden Bein, das mich festhielt. Ich wollte sie am Abend besuchen und es ihr schildern. Sie war zwar bettlägrig, aber geistig rege wie eh und je. Ich konnte mir vorstellen, wie ihr verrunzeltes Gesicht von einem Lächeln erhellt wurde, wenn ich sie an »Schwarzfleck« erinnerte und ihn mit seinem Riesenverwandten von den Galapagos-Inseln verglich.
Das Telefon klingelte. Der Hauptwärter im Reptilienhaus nahm den Anruf entgegen und kam dann zu mir herüber.
»Herr Doktor«, sagte er, »leider eine traurige Nachricht. Ihr Vater hat angerufen, um Ihnen mitzuteilen, daß Ihre Großmutter soeben gestorben ist.«
3. Ein denkwürdiger Mittwoch
Dank der Ermutigung von seiten meiner Großmutter bewahrte ich mir meine Leidenschaft für Tierpflege während der ganzen Schulzeit, und beim Universitätsstudium fühlte ich mich immer mehr zu den exotischen Tierarten hingezogen, zu den sogenannten wilden, mancherorts recht seltenen Tieren. Es schien mir, daß die tierärztliche Arbeit auf diesem Gebiet am interessantesten sein mußte, gerade weil es ein neues Feld war, das zu beackern sich lohnen würde. Nachdem ich Ende der fünfziger Jahre meinen Doktor gemacht hatte, praktizierte ich bei einem älteren Kollegen in meiner Heimatstadt Rochdale in der Grafschaft Lancashire. Rochdale, eine trübgraue Stadt mit rund 100000 Einwohnern, liegt unter den feuchten Westhängen der verlassenen, felsigen Penninischen Kette, achtzehn Kilometer von der großen Industriestadt Manchester entfernt. Manchester, westlich von uns auf dem Flachland, ist umgeben von kleinen Ortschaften, die alle durch die industrielle Umwälzung ihre große Zeit erlebt haben, unter der Herrschaft des Königs Baumwolle, als das feuchte Klima von Lancashire ideal war fürs Garnspinnen, bevor man etwas von Klimaanlagen und Luftbefeuchtern ahnte. Über die Kopfsteinpflaster von Rochdale ragte ein Wald von hohen Fabrikschornsteinen auf, aber was für Tiere konnte man in diesen nassen Straßen, auf den schäbigen kleinen Bauernhöfen im düsteren, windigen Moorland finden? Gewiß keines der aufregenden wilden Geschöpfe, von denen ich träumte: Tiger, Büffel und Gürteltiere.