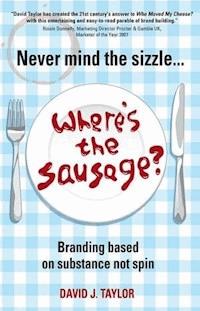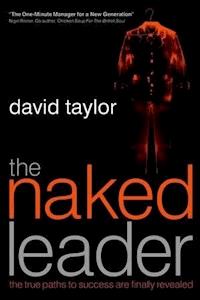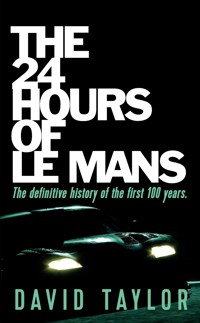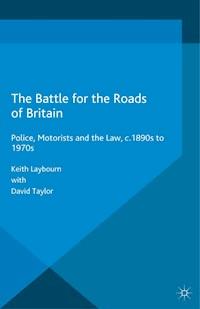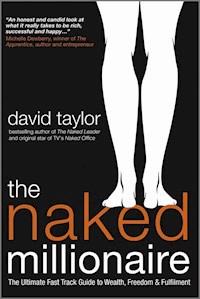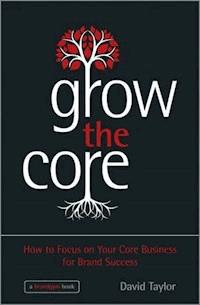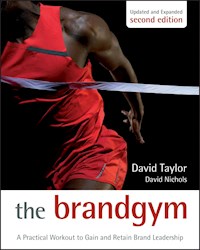3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Pandabären vertragen keinen Bambus, die Schwertwale aus der Arktis leiden an Frostbeulen und ein Gürteltier verirrt sich in London: Der Veterinärpapst David Taylor stellt uns seine Patienten vor. Wieder beeindruckt er durch brillante Sachkenntnis und amüsiert durch seine humoristischen Schilderungen. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Ähnliche
David Taylor
Der nächste Panda bitte …
Aus dem Englischen von Ursula von Wiese
FISCHER Digital
Inhalt
1
»Mögen Sie Warzenschweine?« fragte meine Gastgeberin so beiläufig, wie man sich erkundigt, welche Musik der andere bevorzugt oder wieviel Zucker er im Tee wünscht.
Bisher hatte ich noch nie darüber nachgedacht, ob ich Warzenschweine grundsätzlich mag oder nicht. Einmal hatte ich in Nordkenia ein Auto zu Bruch gefahren, als ich in ein Loch geraten war. Warzenschweine pflegen nämlich solche Fallen zu bauen. Andererseits sind Warzenschweine im Zoo sehr beliebt, sie sind sanftmütige Geschöpfe, die sich gut anpassen. Ihr ulkiges Gesicht zieht die Besucher an, und sie machen wenig Mühe, da sie widerstandsfähig, leicht zu füttern und langlebig sind. In den wenigen Fällen, in denen ich ein Warzenschwein ärztlich betreuen mußte, handelte es sich um arthritische Gelenke, eine Alterserscheinung. Eine liebe alte Seele hatte im Zoo Bellevue in Manchester 16 ½ Jahre lang gelebt, ohne auch nur einen Tag krank zu sein. Ja, wenn ich es mir recht überlege, mag ich Warzenschweine ganz entschieden gern. Wie alle Schweinearten sind sie meiner Erfahrung nach sauber, intelligent und charaktervoll.
»Ja«, beantwortete ich die Frage, »ich mag Warzenschweine. Warum?«
»Nicht weit von hier haust im Gebüsch ein entzückender Warzeneber. Er heißt Walter und ist versessen auf Kartoffeln. Ich gehe ein paar holen, und dann rufen wir ihn.«
Meine Gastgeberin war Betty Leslie-Melville, eine interessante Dame, die auf ihrem Besitz in Kenia eine junge Giraffe, Daisy Rothschild genannt, großgezogen und dann in die Freiheit entlassen hatte. Zahme Giraffen – und nun Kartoffeln für ein freilebendes Warzenschwein! Betty Leslie-Melville hatte wirklich einen ganz besonderen Zugang zum Leben in der Wildnis.
Nachdem sie mit einem Sack Kartoffeln zurückgekehrt war, wies sie mich an, ganz still auf dem Gras am Rande der Terrasse zu sitzen, und häufte Kartoffeln neben mich. Ich durfte mich nicht rühren und kein Wort sagen. »Walter ist ein bißchen nervös«, erklärte sie. Dann rief sie zum Wald hinüber: »Wal-ter! Wa-a-a-a-alter!«
Es war spannend, im Gras zu sitzen und auf ein zentnerschweres Warzenschwein mit gefährlich aussehenden gebogenen Eckzähnen zu warten. Mag es in der Gefangenschaft auch zahm werden, ein wilder Warzeneber ist ein streitsüchtiges, unberechenbares Geschöpf.
»Wa-a-a-alter!« rief Betty abermals. »Vielleicht ist er gerade auf Nahrungssuche.«
Plötzlich tauchte in der Ferne ein Warzenschwein auf. Es kam mit gespitzten Ohren und hochgeringeltem Schwanz aus dem Wald. Es zögerte ein Weilchen, als es außer Deckung war, äugte zu uns herüber und trottete schließlich auf uns zu. Betty rief zum letztenmal seinen Namen und ermahnte mich, ganz still zu bleiben.
Walter kam immer näher. Er war ein prächtiges Tier mit seinem über 60 Zentimeter hohen, tonnenförmigen Leib und den glänzenden Äuglein im wild aussehenden Knubbelgesicht. Der stramm gestreckte Stachelkopf erinnerte mich an einen schnurrbärtigen, reizbaren Feldwebel.
Als er zehn Meter von mir entfernt war, beäugte er mich scharf. Jetzt streckte er den Schwanz gerade in die Luft, und die struppige Rückenmähne war teilweise gesträubt. Er schnupperte, ließ den Blick zu dem Kartoffelhaufen gehen und beschloß, ein Scharmützel mit dem Fremden zu wagen. Ganz langsam rückte er vor, wobei die Äuglein zwischen mir und den Kartoffeln hin und her flitzten. Ich nahm jetzt einen Warzenschweingeruch wahr und konnte die Risse in der Schönheitsmaske aus getrocknetem Lehm, die sein wildes Gesicht bedeckte, deutlich sehen. Ich hielt den Atem an. Es war ein magischer Augenblick. Keine Käfigstangen, kein Beruhigungsmittel, kein trennender Wassergraben. Hier bot sich die seltene Gelegenheit, einem Wildtier ohne die Hilfe derartiger künstlicher Schutzmittel Aug in Aug zu begegnen. Nun ja, Walter war von berechnender Liebenswürdigkeit, wenn es etwas zu fressen gab, er hatte es auf die Kartoffeln abgesehen; dennoch wird der Mensch von seinen Artgenossen als gefährliches, nicht vertrauenswürdiges Geschöpf gescheut.
Walter kam bei meinen Schuhen an. Er war sehr wachsam und gespannt wie eine Sprungfeder. Er machte sich über die Kartoffeln her, wobei seine Vorderfüße ein wippendes Tänzchen vollführten, so versessen waren sie darauf, ihn von dem merkwürdig riechenden Affen wegzutragen, sobald die Mahlzeit beendet war. Walter behielt mich im Auge, fraß aber weiter. Meine Hand war dreißig Zentimeter von seinen riesigen, gebogenen Eckzähnen entfernt, dann fünfzehn, dann zehn. Atemlos schob ich meine Hand näher. Ich berührte das harte Elfenbein. Walter verschlang die letzte Kartoffel, grunzte zufrieden und kehrte sich ab, aber ich hatte tatsächlich ein freilebendes, unbetäubtes Warzenschwein berührt. Als Walter mit schlenkerndem, vollem Bauch und wedelndem Schwanz zum Wald zurücktrottete, wurde mir klar, daß dieses Erlebnis der Höhepunkt meines Aufenthalts in Kenia gewesen war.
Meine Begegnung mit Walter ereignete sich ungefähr zehn Jahre nachdem ich beschlossen hatte, mein Leben als gewöhnlicher Tierarzt aufzugeben und mich nur noch freilebenden und exotischen Tieren zu widmen. In diesem Zeitraum hatte ich fast 400000 Kilometer im Flugzeug zurückgelegt, in 31 verschiedenen Ländern gearbeitet und rund 50000 Pfund für Flugscheine ausgegeben. Aber mein Leben bestand keineswegs nur aus Champagner, Austern und niedlichen Koalabären (Koalabären sind im allgemeinen streitsüchtig, sie beißen und kratzen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit). Das Leben eines vagabundierenden Tierarztes, der stets unterwegs ist und nicht einmal den »Landurlaub« der Seefahrer genießen kann, bringt zahlreiche Schwierigkeiten. Ich gewöhnte mich daran, an Geburtstagen und Festtagen im Ausland zu sein. Ich hatte drei Weihnachts- und zwei Sivesterfeste versäumt, unzählige Einladungen zum Abendessen im letzten Augenblick abgesagt, Theaterkarten verschleudert und die Ferien mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern abgebrochen. Trotzdem – und dabei läßt sich ein Element der Selbstsucht nicht leugnen – bereute ich meinen Entschluß keinen Augenblick. Meine Wanderarbeit saß mir jetzt im Blut, und die Tage der Hunde und Katzen, Schweine und Kühe gehörten in ein vergangenes Leben. Zur allgemeinen Praxis in meiner Heimatstadt Rochdale zurückzukehren, war unvorstellbar. Es ist es noch immer.
Das Schicksal hatte mir auch andere Karten zugeteilt: Während meiner Reisen in England hatte ich Hannelore Lonkwitz kennengelernt, eine reizende Deutsche aus Ostpreußen und Freundin meiner Schwester. Sie lebte in der Nähe von Windsor und begleitete mich zuerst im dortigen Safari-Park, dann zu den Londoner Delphinarien und immer weiter. Hanne und ich wurden dicke Freunde. Bei Jim McNab, dem Oberwärter in Windsor, hatte Hanne den Gebrauch des Narkosegewehrs erlernt. Wir drei verbrachten viele Stunden damit, zu Fuß in dem Löwen- und Tigerreservat herumzuschlendern, ungeschützt vor den Großkatzen, die damals noch jung waren und unerfahren in der Kunst, Menschen zu beschleichen und zu verfolgen. Das alles hörte eines denkwürdigen Tages auf, an dem ein Löwe den inspizierenden Sekretär des Verbandes Zoologischer Gärten angriff und ihn so zurichtete, daß er ins Krankenhaus mußte.
Hanne begleitete mich auch auf meinen Delphin-Beobachtungsreisen. In jenen Jahren war die Südküste Englands voller Delphinarien. Auf dem Höhepunkt, im Jahr 1972, gab es in England und Schottland 22 Delphinarien. Hanne bekam rasch das »Gefühl« für Meeressäugetiere und ließ sich von dem beständigen Lächeln der schnabelmäuligen Delphine, die sich zu Tode fressen und spielen können, nicht mehr täuschen. Alle paar Wochen verbrachten wir einen Abend im Londoner Delphinarium an der Oxford Street, wo wir nach der letzten Vorstellung den Gesundheitszustand der Tiere prüften, die eng zusammengepfercht unter dem Soho Square lebten.
Um einen Delphin zu untersuchen, muß man ihn aus dem Wasser ziehen. Wenige Menschen können einen frei in tiefem Wasser schwimmenden Delphin ohne Zuhilfenahme eines weichen Netzes fangen, das bleibeschwert bis zum Boden reicht. Ich glaube, daß es Delphinen Spaß macht, für eine medizinische Untersuchung gefangen zu werden; dabei bietet sich einem Delphin viel Gelegenheit zu spielen und die Menschen, die sich mit dem Netz abmühen, zum Narren zu halten. Das Fangspiel läßt sich auf herrliche Weise vielfach abwandeln. Da ist zum Beispiel der Sprung über das Netz. Diesem Scherz folgt das Kunststück, das Netz vom Boden zu heben oder sich selbst zwischen den Netzrand und die Wand zu quetschen. Oder man kann – vorausgesetzt, man ist ein Delphin – unter Wasser geradewegs ins Netz schwimmen, sich bewußtlos stellen und dann, wenn sich der erschrockene Homo sapiens bemüht, das Netz herauszuziehen, und – o Superspaß – einem Artgenossen befiehlt, vollbekleidet ins Wasser zu springen, um einem zu Hilfe zu kommen, die Schnauze über das Netz strecken, über den Rand schlüpfen und mit einem einzigen Schwanzschlag alle am Beckenrand stehenden Leute bespritzen.
Wenn ein Homo sapiens, ausgerüstet mit Schnorchel und Maske, ins Wasser steigt, um einen zu packen, bereitet es ein unheimliches Vergnügen, ihm beim Auftauchen die Maske vom Gesicht zu reißen. Menschen sind im Wasser etwa so geschickt wie Treibholz. Am meisten bringt es die Landratten zur Verzweiflung, wenn man ein paar Minuten lang auf dem Boden des Beckens liegt. Sie warten darauf, daß man an die Oberfläche kommt. Während die Zeit vergeht, werden sie ungeduldig und besorgt und vergessen die Tatsache, daß Delphine den Atem siebenmal länger anhalten können als Menschen. Wahrhaftig, schließlich schicken sie ein ungelenkes Exemplar herunter, das nachsehen soll, was los ist; dann schnappt man nach seiner Kniekehle, und man kann entrinnen, während es verwirrt ans Ufer zurückpaddelt. Natürlich streckt man nach jeder geglückten Flucht den Kopf aus dem Wasser, schnattert frech und fordert eine Fischbelohnung.
Derartige Spiele sind für die Delphine meist lustiger als für die beteiligten Menschen, aber einmal retteten sie mir das Leben. Ich hatte vorgehabt, im Delphinarium auf Mallorca Blutproben von einigen Delphinen zu entnehmen und dann schnurstracks zum Flughafen zu fahren, um mit der Frau des Direktors nach London zu fliegen. So munter und gekonnt trieben die Delphine ihre Spiele, daß ich der Dame vorschlug, schon vorauszufahren und die Bordkarten zu besorgen; ich wollte nachkommen, sobald die verflixten Tiere mit ihren Possen aufgehört und ich die paar Teelöffel voll Blut eingesammelt hatte, die ich brauchte. Wir kämpften mit den Hanswursten, aber unermüdlich hielten sie uns in Atem, wobei es schien, als ob ihre großen dunklen Augen vor Vergnügen funkelten. Alle außer den Delphinen wurden bitterböse. Als ich endlich meine Blutproben hatte, stellte ich fest, daß das Flugzeug bereits abgeflogen war. Das nächste ging erst am folgenden Tag, dabei wartete ein kranker Davidshirsch im Zoo von Manchester auf mich. Ich verließ in sehr schlechter Stimmung das Delphinarium, um mich wieder in dem Hotel einzuquartieren, aus dem ich am Morgen ausgezogen war. Unterwegs kam mir der Pressemann des Unternehmens entgegen. Als er mich erblickte, reagierte er sonderbar. Er setzte sich plötzlich auf den staubigen Boden, wurde weiß wie eine Penicillinflasche, deutete auf mich und krächzte: »Sie sind doch tot!«
Etwas Entsetzliches war geschehen. Das Iberia-Flugzeug, mit dem ich hatte fliegen wollen, war mit einer Spantax-Chartermaschine in der Nähe der französischen Grenze zusammengestoßen. Alle an Bord der Iberia-Maschine waren umgekommen, auch die Frau des Direktors, und mein Name war auf der Liste der Passagiere gestanden. Der Pressemann, der nichts von meiner Verspätung durch die neckischen Delphine gewußt hatte, und ich, der dem Tod Entronnene, brauchten mehrere Gläser Carlos Primero Cognac, um uns vom größten Schrecken zu erholen. Seither ist meine Geduld unerschöpflich, wenn ich warten muß, bis meine Delphinpatienten sich einfangen und untersuchen lassen.
Hanne war dabei, als ich eines Abends im Londoner Delphinarium vor dem Problem stand, bei einem alten Delphin eine Vene für eine Blutentnahme zu finden. Terry Nutkins, der Pfleger der Tiere und andere erfahrene Delphinspezialisten kauerten rings um mich, während ich herumfummelte. Nichts war zu sehen von dem dunklen Schatten oder der leichten Furche, die die einzigartigen, wärmeaustauschenden Blutgefäße der Delphine anzeigen. Ratschläge wurden mir gegeben, die Leute ächzten, und der Direktor wurde immer ungeduldiger. Ein peinlicher Mißerfolg. Plötzlich beugte sich Hanne, die meine Ärztetasche im Arm hielt, über die Köpfe der ratlosen Männer, deutete mit dem Zeigefinger auf einen Punkt der grauen Schwanzflosse und sagte laut: »Entschuldigung. Stich da hinein.« Wir schmunzelten alle gönnerhaft. Wer hatte jemals von einem Blutgefäß gehört, das so weit vom Flossenrand entfernt lag? »Da!« wiederholte Hanne. Schaden konnte ein weiterer Mißerfolg nicht. O diese Preußen! dachte ich, während ich die Nadel einstach. Sofort füllte sich der Spritzenkolben mit Blut. Mit einem Schlag geriet Hanne in den Ruf einer Hellseherin in bezug auf schwierige Delphine.
Es war wohl unvermeidlich, daß wir uns ineinander verliebten, als sich meine Bande zum Norden, den Sümpfen und den verregneten Straßen von Lancashire, auch meine Verbindung mit Shelagh, immer mehr lockerten. Ich mußte das bisher Unvorstellbare bedenken: ein neues Leben zu beginnen, fern von dem alten Bauernhaus am Rande der Stadt, wo ich geboren war, fern von der offenherzigen Vitalität des Lebensstils in der Stadt der Baumwollindustrie und dem schneidenden Wind, der von den Hängen der Penninen herunterpfeift und den schmutziggrauen umherziehenden Marschschafen Beine macht.
Nach geraumer Zeit waren wir beide geschieden, und gemeinsam kauften wir ein kleines Haus in Lightwater in der Grafschaft Surrey, das auch Hannes Söhnen Andreas und Martin als neues Heim dienen sollte. Die einst unvorstellbare Trennung von Lancashire war vollzogen; dennoch fuhr ich regelmäßig nach Manchester zum Zoo Bellevue, wo ich nach wie vor für die medizinische Versorgung der Tiere verantwortlich war. Dann benutzte ich auch die Gelegenheit, meinen Partner Andrew Greenwood in der Praxis in Keighley aufzusuchen.
Unser Haus in Lightwater wurde das Büro im Süden, so daß Hanne die Festung halten konnte, wenn ich abwesend war. Ich rief sie regelmäßig an. Auch als ich mich in Kenia bei Betty Leslie-Melville aufhielt, rief ich zu Hause an und bekam von Hanne eine wundervolle Nachricht zu hören. Dr. Marguerita Celma, Leiterin der biologischen Abteilung des Madrider Zoos, hatte angerufen, um uns zu sagen, daß der Zoo ein Paar Große Pandas erhalten werde.
»Beschaffe mir aus der Universitätsbibliothek Fotokopien von allem, was über Pandas veröffentlicht worden ist«, bat ich Hanne, vor Aufregung buchstäblich zitternd. »Kannst du dir vorstellen, was das für mich bedeutet? Nie hätte ich es mir träumen lassen, mit Großen Pandas zu tun zu bekommen!«
»Du hoffst doch nicht etwa, daß sie krank werden«, erwiderte sie vorwurfsvoll.
»Natürlich nicht. Aber ich möchte einen anfassen.«
Als ich 1974 in China gewesen war, hatte ich fast alle dortigen in Gefangenschaft lebenden Pandas gesehen, ich hatte auch die Pandas in London, Washington und Paris gesehen, aber nie war ich mit ihnen in nähere Berührung gekommen, von einer Betreuung oder Behandlung dieser geheimnisvollen Geschöpfe gar nicht zu reden. Die chinesischen Beamten, die mich und meinen Gefährten Gary Smart in Peking, Kanton und Schanghai durch die Pandapavillons geführt hatten, waren streng darauf bedacht gewesen, daß wir von dem Gitter Abstand hielten. Nach der Art, wie sie uns bewachten, uns am Arm packten und sich dazwischen warfen, wenn wir einen kleinen Schritt näher ans Gitter traten, hätte man meinen können, wir wären tolpatschige Dummköpfe oder die Pandas die gemeinsten Vierbeiner seit dem elf Meter langen Tyrannosaurus.
»Ob sie wohl befürchten, wir wollten die Tiere umbringen?« flüsterte mir Gary einmal zu, als wir in Peking versucht hatten, hinter unseren Führern zurückzubleiben, um zu sehen, was geschehen würde, wenn wir uns den anscheinend so gutmütigen, bambusknabbernden Pandas näherten, ohne von einer Mauer blaugekleideter, nervöser Chinesen umgeben zu sein. Es hatte nichts genützt. Die Mauermenschen hatten Augen im Rücken; sie durchschauten unser Vorhaben und machten es zunichte. Sie stürzten sich auf uns, und im Übereifer stolperte unser Dolmetscher und riß mich mit sich zu Boden. Die ganze offizielle Schar landete kunterbunt durcheinandergewirbelt vor den Pandas, die diplomatischerweise so taten, als merkten sie nichts. Gary und ich wurden mit unverständlichen Zurechtweisungen bedacht und am Abend, sicher zur Strafe, ins Theater geführt, wo wir eine revolutionäre Oper durchsitzen mußten, die wir schon am vohergegangenen Abend über uns hatten ergehen lassen müssen.
Allerdings habe ich mir nie vorgemacht, Pandas seien so etwas wie lebendige Teddybären. Der Große Panda oder Bambusbär, der zwar nicht zu den Bären gezählt wird, hat das Gewicht, die Kompaktheit und den kräftigen Biß des schwarzen Himalajabären. Ein solches Tier kann mit Leichtigkeit einen Menschen in die Mangel nehmen, wenn ihm der Sinn danach steht, und auch die bärenhaften Pranken – nicht umsonst wird er unter anderem Prankenbär genannt – können wild zuschlagen. Er hat nämlich besonders stählerne Greifballen an den Vorderpfoten, mit denen er Nahrungsmittel und andere Gegenstände wie mit einer Hand erfaßt. Wenn er gereizt oder mißgelaunt damit einen zarteren Körperteil packt, ist der Schraubstock, der in den James-Bond-Filmen angewendet wird, im Vergleich so schonend wie die Hand einer Geisha. Es ist übrigens nicht verwunderlich, daß die Großen Pandas, die, von Natur aus Einzelgänger, in den Wäldern und im Bambusdickicht der hohen Berghänge von Westsetschuan hausen, rätselhaft und schwer zu verstehen sind. Sie sind launisch und unberechenbar und manchmal, zumal wenn sie älter werden, recht wild.
Nein, ich war nicht so töricht, anzunehmen, ich könnte freudig auf einen Prankenbär zulaufen, der auf dem Rücken liegt und unter Benutzung beider Hände an einem dicken Zuckerrohr knabbert und ihm den runden Bauch kraulen. Ich wünschte mir nur eine Gelegenheit, mich mit ihm zu befassen. Bis jetzt hatte ich meine einzige Chance darin gesehen, daß in einem der Zoologischen Gärten, für die ich arbeitete, Pandas eingeliefert würden, was ein unerfüllbarer Traum zu sein schien. Die wenigen Exemplare, die von den Chinesen freigegeben worden waren, hatten ihr Heim in Zoos befreundeter Staaten gefunden. London hatte zwar ein Paar, aber dort hatte man ein eigenes tierärztliches Institut. Ich hatte mich damit begnügen müssen, ab und zu einen hübschen Kleinen Panda, ein grundsätzlich anderes Tier, zu beobachten und zu behandeln.
Nun war es soweit. Mao war tot, und China suchte Freunde. Franco war tot, und auch Spanien nahm unter König Juan Carlos einen neuen, offenen Stil an. Was diese Veränderungen in globaler und politischer Hinsicht zu bedeuten hatten, war Sache der Staatsmänner. Die kleine Rosine, die aus dem Kuchen für mich persönlich abfiel, war das Geschenk, das die Chinesen dem spanischen König gemacht hatten. Während das russische Staatsoberhaupt Breschnew angeblich eine Garage voller luxuriöser ausländischer Automobile hatte, die ihm geschenkt worden waren, und der französische Präsident Giscard d’Estaing von seinen Staatsbesuchen in Zentralafrika mit funkelnden Steinchen in den Taschen zurückkehrte, hatte König Juan Carlos ein Paar der fabelhaftesten von allen seltenen Säugetieren geschenkt bekommen. Er konnte aber nicht zulassen, daß die Pandas ihr Geschäft auf den dicken blauen Teppichen des Palacio Real erledigten, und so hatte er die beiden kostbaren Geschenke einem neuen Zoo zur Betreuung übergeben, etwa einen Kilometer von seinem Badezimmerfenster entfernt, und zwar einem Zoo, der mich schon seit geraumer Zeit regelmäßig als tierärztlichen Berater beizog.
Der Madrider Zoo gehört zu den schönsten Anlagen in Europa. Er liegt in dem ausgedehnten Waldgelände Casa de Campo außerhalb der Stadt und ist großartig entworfen, so daß er dem Besucher ein reizvolles Naherholungsgebiet und den Tieren gleichzeitig einen guten Lebensraum bietet. Anstatt nach dem Muster alter naturalistischer Vorstellungen kleine Tierbehausungen aufzustellen, hat man hier moderne Gebäude und gute Gartenanlagen erstellt, die den funktionellen und psychischen Bedürfnissen der Tiere Rechnung tragen. Es sind künstliche Gebilde, aber dem Auge des Besuchers wohlgefällig. Die Steinböcke müssen zum Beispiel nicht über Miniberge aus Gunit klettern, sondern haben einen großen »Hochzeitskuchen« aus Beton, den ein führender spanischer Bildhauer geschaffen hat. Er gibt sich nicht den Anschein, ein Berg zu sein, sondern ist die richtige Umgebung für die Steinböcke, die hier umhertollen, übers Land spähen oder friedlich dösen können. Die Sammlung des Zoos umfaßt so wichtige Tiere wie Okapis, Riesenottern vom Amazonas, Kaiseradler und Pumas aus Patagonien. Das sind Namen, die Geister beschwören!
Als ich aus Nairobi zurückkehrte, holte mich Hanne in Heathrow ab – wie stets, auch nach der kürzesten Auslandreise – und reichte mir zwei Fotografien. »Heute früh aus Madrid gekommen«, sagte sie. Es waren Aufnahmen der beiden neuen Großen Pandas, Chang-Chang und Shao-Shao, die im Flughafen Barajas unter den wachsamen Augen meines guten Freundes Antonio-Luis, Kurator und Veterinärassistent im Madrider Zoo Casa de Campo, gerade ausgeladen wurden.
Sowie wir zu Hause angelangt waren, buchte ich zwei Plätze für den nächsten Flug nach Madrid, und dort kamen wir bei bitterkaltem Winterwetter im Zoo an. Ich liebe die Stille des Parks unter dem hellblauen Himmel dieser Jahreszeit. Die Tiere wirken dann entspannter. In der Luft liegt nicht die unterdrückte Erwartung, die sich beim ersten Anzeichen des Frühlings bemerkbar macht. Viele Weibchen sind trächtig. Die Geräusche des Tiergartens, gedämpfte Schreie, Knacken, Schlurfen und kehliges Grunzen, werden klar durch die Frostluft getragen. Büffel und Elefantenrobben blasen weiße Rauchwolken aus, wenn sie den Kopf vorstrecken und schnüffeln, um zu ergründen, was der Wind bringt. Am angenehmsten ist es, daß nur wenige Besucher da sind, keine lärmenden Kinder, kein Geruch von schwitzenden Kinderwagenschiebern und Schokolademilch.
Wir begaben uns vom Taxi aus schnurstracks zum neuen Pandahaus. Hier fanden wir Antonio-Luis und seine Frau Liliana, eine hübsche Argentinierin, die als Obertierärztin des Zoos amtet und mit der wir ebenso befreundet sind wie mit ihrem Mann. Beide überwachten die Zubereitung des Mittagsmahles für die Pandas, die ihre besonderen Betreuer hatten, einen Biologen und zwei ältere Wärter, alle in weißen Kitteln. Ihre einzige Aufgabe bestand darin, sich der Neuankömmlinge anzunehmen. Pandas beanspruchen immer ein ganzes Gefolge, sogar noch mehr als Delphine und Wale, und den Katzenbären, den Kleinen Pandas, stand tatsächlich ein eigener Tierarzt zur Verfügung, der sich einzig und allein um sie kümmerte (kein guter Gedanke, meiner Meinung nach).
Stolz wie frischgebackene Eltern machten Antonio-Luis und Liliana uns mit Chang-Chang und Shao-Shao bekannt. Da waren sie in ihrem neuen Heim, das zwei getrennte bequeme Schlafquartiere und einen grasgepolsterten Auslauf hatte. Daneben waren ein Wärterraum (mit Bett, denn die Tiere wurden rund um die Uhr betreut), eine Küche und ein Käfig. Der Käfig, der sich verengen ließ, war in einen Durchgang eingebaut, den die Pandas täglich benutzten, und enthielt eine automatisch registrierende Waage. Die Pandas waren prächtige Tiere, offensichtlich in glänzender Verfassung, und zeigten herzhaften Appetit. Sie genossen den spanischen Bambus und schmatzten wohlig, während sie den frischgekochten Reis mit geriebenen Mohrrüben und Äpfeln verzehrten. Zu meiner großen Freude durfte ich zu dem Männchen Chang-Chang hineingehen und ihm eine Schale warme Milch geben; dabei berührte ich ihn sachte mit der anderen Hand. Ich fühlte seine Haare – sie waren gröber und fettiger, als ich sie mir vorgestellt hatte – und stupfte den kompakten Leib: Phantastisch! Chang-Chang betrachtete mich freundlich mit Augen, die wie Knöpfe aus schwarzem Öl waren, und gab keinen Ton von sich. Man hielt es nicht für ratsam, sich solche Freiheiten Shao-Shao gegenüber herauszunehmen, die laut Angabe der Chinesen ein »Retortenbaby« war, durch künstliche Befruchtung entstanden, und als viel launischer und reizbarer galt. Hanne schien jedoch durch die Fütterungsklappe in ihrer Tür sehr gut mit ihr auszukommen.
Der Zoo hatte sich mit allen Mitteln bemüht, den beiden Tieren optimale Lebensbedingungen zu bieten. Im Winter wurde ihre Behausung geheizt, im Sommer standen ihnen eine schattige Veranda und eine Dusche zur Verfügung. Ich fragte mich, ob diese Vorrichtungen zur Kühlung in den sengendheißen Juli- und Augusttagen genügen würden. Vielleicht wäre eine Klimaanlage notwendig gewesen, denn Bambusbären vertragen mit ihrem dicken Fell nicht allzuviel Hitze. Sie bevorzugen Höhenlagen von 1500 bis 4000 Meter, in denen oft sogar hoher Schnee liegt.
Wir sprachen über ihre Ernährung. Täglich kamen frische Bambushalme vom Lande, wie man hoffte, aus unverseuchtem Gebiet, die in einem kühlen Raum aufbewahrt wurden. Für den Fall, daß ein nachlässiger Bauer Insektizidspray zu dem Bambus hatte wehen lassen, wurden die Halme vor der Fütterung in sauberem Wasser gründlich gespült.
Damals war noch sehr wenig über Biologie und Pflege der Bambusbären veröffentlicht worden, aber was es gab, das hatte ich gelesen, und mit den wenigen Tierärzten, die weltweit mit ihnen in Berührung gekommen waren, hatte ich gesprochen oder korrespondiert. So wußte ich, daß medizinische Präventivmaßnahmen sofort in Angriff genommen werden mußten. Ich sammelte Kotballen, um sie zu Hause auf Parasiten untersuchen zu lassen, da ich auf keinen Fall mit einem »unbekannten« Tier eine Wurmkur machen wollte, wenn es nicht unbedingt notwendig war. Schutz gegen Viruskrankheiten mußte in erster Linie bedacht werden, aber was für Viren befielen Bambusbären? Noch wichtiger, wie wirkten sich Impfstoffe bei diesen rätselhaften Tieren aus? Ein Impfstoff, den die eine Art gut verträgt, ohne daß sich Nebenwirkungen ergeben, kann bei einer anderen Art zu gefährlichen oder gar tödlichen Erlebnissen führen. Ich hatte selbst erlebt, daß Vakzine für Schafe und Schweine bei Delphinen Böses anrichteten und daß das Vakzin der Hauskatze von Geparden und kleineren exotischen Katzenarten häufig nicht vertragen werden. Natürlich produzierte keine chemische Fabrik einen besonderen Impfstoff für unseren Freund Ailuropoda melanoleuca, den Großen Panda.
Antonio-Luis fragte mich, wann ich die Frage der Impfung entscheiden würde. Nach gründlichem Nachdenken sagte ich ihm, ich fände es vernünftig, Chang-Chang und Shao-Shao gegen Krankheiten zu impfen, denen die nächsten Verwandten der Pandas am meisten ausgesetzt sind. Der Panda wurde früher der Familie der Procynoidae (Kleinbären) zugeteilt, die ausschließlich die Neue Welt bewohnen. Zu ihnen gehören unter anderen Waschbär, Coati, Wickelbär sowie zwei Geschöpfe, von denen die meisten Menschen nicht einmal den Namen kennen: der Schlankbär und der selten ausgestellte Alingo. Die Procnoidae können von dem Virus befallen werden, der die übliche Darmkrankheit der Katzen hervorruft, und wie viele Tiergärten ist der Madrider Zoo ein Magnet für streunende, futtersuchende Katzen. Auch die unzähligen Nagetiere, die sich hier häuslich niederlassen, sind nicht auszumerzen, und sowohl Mäuse wie auch Ratten können Bakterien einschleppen, die Leptospirose hervorrufen. An sich war es unwahrscheinlich, daß meine neuen Schützlinge jemals mit Hunden in Berührung kommen würden, aber bedenken mußte ich doch, daß die Vettern des Pandas für Staupe, Hepatitis und wie alle Säugetiere für Tollwut anfällig sind. Tote Staupe-Erreger wurden nicht mehr hergestellt, und ich hätte lieber tote als lebende Erreger als Impfstoff benutzt, um keine Impfschäden zu riskieren. Zudem wollte ich nur gute britische Produkte benutzen, von Firmen hergestellt, denen ich traute. Das beruht nicht auf Chauvinismus, sondern auf Erfahrung: Mein Partner Andrew Greenwood hatte aus vielen ungeöffneten Flaschen mit angeblich toten Krankheitserregern gefährliche Bakterien kultiviert, und alle hatte er vom Kontinent bezogen.
Die Gefahr einer Tollwutinfektion war minimal, da in der Umgebung von Madrid kein Fall vorgekommen war, nur in fernen Waldgebieten. Ich faßte meinen Entschluß. Die Pandas sollten gegen die Katzen-Enteritis geimpft und auch vor Leptospirose geschützt werden. Ich schlug Liliana und Antonio-Luis vor, die Tiere in den Käfig zu schaffen und die Schutzimpfungen sofort vorzunehmen.
Ich merkte, daß meine Freunde Angst bekamen. Sie machten lange Gesichter, sagten aber kein Wort.
»Keine Sorge«, sagte ich. »Es hat keinen Sinn, damit zu warten. Wenn es geschehen soll, dann je eher, desto besser. Ich verbürge mich dafür, daß keine Nebenwirkungen auftreten werden.« In Anbetracht der Tatsache, daß ich als erster einem Großen Panda eine Injektionsnadel ins Fleisch stoßen würde, mußte das recht überheblich klingen.
»Wenn ein Impfschaden auftreten würde, wie lange würde es nach der Impfung dann dauern?« fragte Hanne schüchtern.
»Oh, lange bevor unser Flugzeug nach London abgeht, mein Herz«, antwortete ich. »Die Guardia Civil hätte genügend Zeit, die Grenzen zu schließen.« Ich lachte ein wenig hohl. Verflixt, noch mehr solche Fragen, und ich würde selbst zu zweifeln beginnen.
Wenigstens wußten Liliana und Antonio über die Wichtigkeit der Schutzimpfung Bescheid. Manchmal finden Laien, daß Präventivmedizin das Schicksal herausfordert und Geldverschwendung ist, obwohl es in unserer aufgeklärten Zeit üblich ist, daß sich Menschen regelmäßig untersuchen und gezwungenermaßen impfen lassen. In einem englischen Safari-Park, wo ich veranlaßt hatte, daß den Giraffen täglich Vitamin E mit der Nahrung eingegeben werden sollte, seit mir viele Jahre früher Giraffen infolge einer Herzmuskelschwäche unter den Händen gestorben waren, wurde ich zu meiner Verwunderung zu einem toten Tier gerufen, das die typischen post-mortem-Anzeichen des Vitamin-E-Mangels zeigte. Sehr bald fand ich heraus, daß der Direktor den Vitaminzusatz als »kostspieligen Luxus« untersagt hatte. »Die Giraffen sind ja kerngesund und vermehren sich«, hatte er sich dem Kurator gegenüber gerechtfertigt. »Wozu also Medizin geben?« Dieser Einstellung war ich schon als ganz junger Veterinär bei den Bauern rings um Rochdale begegnet. Dort hatte ein Schäfer in jedem Frühling große Verluste unter seinen Lämmern erlitten. Als Ursache stellte ich eine infektiöse Nierenerkrankung fest, und ich riet dem Schäfer, seine Herde jedes Jahr mit einem billigen, wirksamen Vakzin zu impfen. Das Ergebnis war, wie erwartet, dramatisch: Kein einziges Lamm ging mehr an der Krankheit ein. Nach drei Jahren aber beklagte sich der Schäfer bei mir, das Unglück habe wieder angefangen, und er war ebenso verwirrt wie ich, als ich bei der Obduktion die Nierenkrankheit als Todesursache fand. Doch eindringliche Befragung förderte die Wahrheit zutage: Er hatte mit dem Impfen aufgehört. »Warum?« fragte ich. »Sie haben die Wirkung doch selbst erlebt.« Seine Entgegnung kam trotzig: »Verstehen Sie denn nicht, Herr Doktor? Die Schafe wurden nicht mehr krank. Da wäre es doch sinnlos gewesen, ihnen das Zeug zu spritzen, wenn ihnen nichts fehlte.«
Soviel ich sehen konnte, fehlte auch den Pandas nichts, als wir sie mit Äpfeln in den Käfig lockten. Sowie das erste Tier darin war, brachte Antonio-Luis es in Stellung und verengte den Käfig so sehr, daß es sich kaum mehr rühren konnte. Da erlebte ich zum erstenmal, wie beweglich diese Tiere sind. Es ist bekannt, daß Pandas viel bessere Baumkletterer als Bären sind, aber was der Panda in einem Raum, der nicht viel größer war als er selbst, an Akrobatik vollführte, das brachte er müheloser als jeder Affe zustande. Bei beiden war es dasselbe: Sie konnten kopfstehen und sich um 360 Grad herumwirbeln, als ob die Stahlstangen aus Gummi bestünden. Für den Kopfstand steckte Chang-Chang einfach den Kopf in seinen federnden Bauch, und mit kräftiger schnellender Bewegung der Handgelenke stand er kopf. Das Verblüffende dabei war die vollständige Geräuschlosigkeit. Affen in gleicher Lage keckem und schimpfen, Bären brummen drohend; aber die Pandas turnten zuerst stumm, boten dann meiner Nadel ein unbewegliches Ziel und murrten nicht, als sie ins Hinterteil gestochen wurden. Kein Zeichen von Furcht oder Erregung, nur kühle, praktische Kaltblütigkeit. Man lasse sich also von der behäbigen Gestalt und dem gemächlichen Bärenpaß nicht irreführen – der Große Panda muß als ungewöhnlichster »Kautschukmann« der Zoowelt angesehen werden.
Als die geimpften Pandas aus dem Quetschkäfig freigelassen wurden, kehrten sie ganz ruhig in ihr Quartier zurück und ergötzten sich am Bambus. Es trat auch keine gestaute Gereiztheit oder sonst eine verzögerte Reaktion auf die Impfung auf, wie ich zu meiner Erleichterung feststellte, so daß wir unbesorgt heimreisen konnten. Als ich im Flugzeug saß, grübelte ich darüber nach, wann ich die Bambusbären wohl wiedersehen würde. Was stand mir bevor, wenn einer von ihnen krank wurde?
Bei meinem nächsten Fall handelte es sich um ein ganz anderes Geschöpf, um ein friedliches gepanzertes Nachttier aus Südamerika. Gürteltiere kommen in Europa nicht vor, am wenigsten in Großbritannien, und was die Londoner Straßen betrifft, so würden sich die Gürteltiere eher den Mond als Tummelplatz aussuchen. Dennoch wurde hier in einer feuchten Samstagnacht auf dem Hinterhof eines Wirtshauses am Notting Hill Gate ein Kugelgürteltier gefunden, das unglücklich zusammengerollt neben Abfalleimern lag. Hier gab es keine gastliche braune Pampaserde, in der es sich schutzsuchend hätte vergraben können.
Gegen neun Uhr stolperten einige Burschen, die auf dem Hof ihr Wasser abschlagen wollten, über eine sonderbare Kugel von Fußballgröße. Sie hielten sie für einen kahlen Igel, da sie als Städter keine Ahnung hatten, wie ein Igel aussieht. Grölend scharten sie sich um das seltsame Ding. Ein vorsichtiger Stoß mit der Schuhspitze bewirkte, daß es sich noch fester zusammenrollte – es lebte!
Die Burschen waren es wie jeder Londoner gewöhnt, auf dem Hinterhof eines Wirtshauses alles mögliche zu finden, aber ein Gürteltier gehörte gewiß nicht dazu. In ihren Augen war es die natürlichste Sache von der Welt, mit allem Gerümpel, leeren Büchsen, Schachteln und sonstigen ausgedienten Behältern, Fußball zu spielen. Das taten sie denn auch mit dem Gürteltier. Einfach war es nicht, es mit dem Fuß in die Luft zu befördern. Da es nicht abheben wollte, begnügten sie sich damit, zu dribbeln, hinaus auf die Straße, wo es vielleicht besser gehen würde.
Die Burschen johlten und lärmten, als sie das richtige Gefühl für den Sport entwickelten und auf die Straße gelangten. Die Füße schmerzten sie, so schwer war es, den Ball in Bewegung zu bringen. Ein Junge bereitete sich kunstgerecht auf den nächsten Schuß vor. Sein nasser Schuh glänzte im Licht einer Laterne, als er vom Boden abstieß. Es war ein guter Schuß nach allen Regeln der Kunst, mit richtigem Einsatz des Spanns und der vollen Kraft der Schenkelmuskeln, und er rief ein hörbares Knurren hervor, als das Gürteltier in die Brust getroffen wurde. Er brach dem Tier auch einen Vorderbeinknochen.
Welcher Inka- oder Aztekengott auch immer über Gürteltieren wachen mag, er griff an diesem Punkt in das grausame Spiel ein, und zwar in Gestalt zweier alter Damen, die unter ihren Schirmen heimeilten. Sie blieben im Eingang eines Ladens stehen, als sich die grölende Schar ihnen näherte. »Sie lassen etwas über die Straße rollen«, sagte die eine und spähte angestrengt durch ihre nassen Brillengläser. Ihre Gefährtin schnalzte mißbilligend und streckte den Hals vor. »Um Himmels willen, es ist eine Katze!«
Eine sekundenlange Pause des Entsetzens entstand, ehe die beiden Damen hervorstürzten, ihre Regenschirme schwangen und die Burschen schrill anschrien. Alte Damen werden von solch mutigen Jugendbanden oft überrannt, aber in diesem Falle ließen die Burschen nur ein paar unanständige Worte vom Stapel, zuckten die Schultern und marschierten in die Nacht hinaus. Der Igel war ohnehin kein geeigneter Fußball gewesen. Mochten die alten Schachteln ihn haben.
»Schlechte, schlechte Menschen gibt es«, schäumte die eine und bückte sich, um die anscheinend leblose Katze aufzuheben. Ihre Gefährtin half ihr dabei.
Die Damen wunderten sich über ihren Fund. »Es ist gar keine Katze, Alice«, sagte die eine. »Es ist …« Sie erkannte das Geschöpf fast sofort. »Es ist ein Gürteltier.«
»Es muß aus dem Regent’s Park entwichen sein«, meinte Alice. »Komm, wir nehmen es mit und rufen den Zoo an.«
Immer noch wutschnaubend trugen sie das Gürteltier nach Hause; es lebte noch, war aber, was sie nicht wußten, im Schockzustand. Während Alice telefonierte, setzte ihre Schwester das fremdartige Tier vor den Gaskamin und überlegte, wie sie es wiedererwecken könnte. Die kleine Schnauze stak fest im Bauch. Vielleicht sollte man ihm Rum und Butter um die Nase schmieren …
In Wirklichkeit war das Gürteltier nicht aus dem Regent’s Park entwichen, und Alice konnte ohnehin zu dieser späten Stunde niemanden im Zoo erreichen. Deshalb rief sie den Tierarzt an, der die zwölf wohlgenährten Katzen der Schwestern zu betreuen pflegte. Er hatte in Cambridge mit Andrew Greenwood zusammen studiert, und als er erfuhr, daß alle Katzen gesund waren, aber ein streunendes Gürteltier dringend der Pflege bedurfte, übergab er mir den Fall. Er kannte die beiden alten Damen gut – ausgeschlossen, daß sie nach der Polizeistunde jemals rosa Elefanten sehen würden. Wenn sie sagten, sie hätten ein Gürteltier gefunden, dann war es ein Gürteltier. Ich fuhr durch den regen Londoner Verkehr und kam Schlag Mitternacht in dem Haus in Arundel Gardens an.
Die alten Damen schenkten heiße Schokolade ein, und die Katzen saßen stumm herum, während ich vor dem Kamin kniete und das Gürteltier untersuchte. Seine Geruchsdrüsen füllten das Zimmer mit dem typisch bitteren Parfüm der Armadillos. Der Schock hatte es entspannt, so daß es teilweise aufgerollt war, und ich konnte die Blutergüsse und den mehrfachen Vorderbeinbruch ertasten. Alice hielt das Tier, während ich ihm ein schmerzstillendes Mittel und ein wenig Cortison injizierte. Es strampelte, jedoch nur schwach, und als ich die Schürfwunden mit einem Antiseptikum einrieb, erbrach es.
»Sieht gar nicht gut aus«, sagte ich zu den beiden Damen. »Wenn es morgen noch lebt, will ich sehen, was sich mit dem Bein machen läßt, aber ich fürchte …« Sie brachten mir einen großen Katzenkorb, in den ich das Gürteltier setzte. Alice rief die Polizei an, um über ihren Fund Bericht zu erstatten, und gerade als ich gehen wollte, rief ein Wachtmeister zurück, der zu wissen glaubte, woher das verletzte Tier stammte. »Schauen Sie nach, ob es im linken Ohr zwei Löcher hat.« Das stimmte. »Dann ist es von einem Tierhändler in Brighton als gestohlen gemeldet worden«, sagte er. Er seufzte vernehmbar. »Was wird wohl als nächstes geklaut?«
Ich konnte mir den Vorgang ungefähr vorstellen. Der Kerl, der meinen neuesten Patienten gestohlen hatte, war sicher auf dem Weg zur Petticoat Lane oder sonst einem der Orte gewesen, wo Tiere, meistens zweifelhaften Ursprungs, am Sonntagvormittag von scheeläugigen, geschwätzigen Individuen feilgeboten werden, die sich als Züchter ausgeben – ja, sogar wenn es sich um Schlangen, Papageien, auch Gürteltiere handelt –, um die Vorschriften des Tierhandels zu umgehen. Vielleicht hatte er kalte Füße bekommen und seine ungewöhnliche Beute auf dem Hinterhof des Wirtshauses abgesetzt. Oder konnte das gutartige Tierchen Reißaus genommen haben? In ihrer Heimat können die Gürteltiere auf ihren Grabkrallen recht schnell durch das dürre Gras laufen, und sie sind vortreffliche Schwimmer. Wie es auch zu erklären war – und bis zum heutigen Tage bin ich nicht dahintergekommen –, das Kugelgürteltier befand sich zwölf Stunden nach dem Diebstahl in Notting Hill.