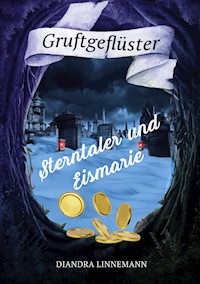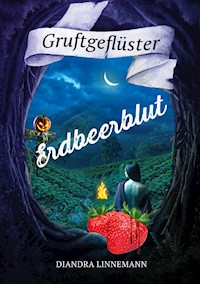Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gruftgeflüster
- Sprache: Deutsch
Mein Name ist Mina. Ich habe mir meine Familie nicht ausgesucht - oder mein Leben. Seit Generationen sammeln wir Geister. Geben ihnen ein Zuhause. Betreuen sie. Bewachen sie. Wir schützen die Menschheit vor Dingen, an die die meisten von ihnen nicht einmal glauben. Es ist ein einsames Leben. Und die Menschen, die mich besuchen kommen, führen nicht immer nur Gutes im Schilde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
Danksagung
EINS
EIN VERTRAUTES KICHERN ertönte aus dem Regal über der Spüle. Dann ertönte die Wanduhr im Flur. Und gleich darauf hörte ich die Glocke am Gartenzaun läuten. In diesem Haus gab es einfach keine Überraschungen.
Ich sah durch die offene Küchentür den Flur entlang. Über die Arbeit musste ich mal wieder das Gefühl für Zeit verloren haben. Oder der Paketbote war heute früher dran als sonst. Ich wusste, dass er das Grundstück nicht freiwillig betreten würde, und ich hatte keine Lust, die Sendungen morgen auf dem Postamt abholen zu müssen. Also legte ich rasch den hölzernen Löffel beiseite und wischte mir die Hände an der altmodischen Schürze ab. Trat ich hinaus auf die hölzerne Plattform vor der Eingangstür, von der aus eine steile Treppe zur Einfahrt hinabführte. Mein Vater hatte ihr vor zwei Jahren ihren letzten Anstrich verpasst. Die Farbe blätterte allmählich ab. Das Wetter setzte ihr zu. Nächstes Jahr würde ich mich darum kümmern müssen. Jetzt, so kurz vor dem Winter, war es sinnlos.
Es war ein schöner Oktobertag. Man konnte den Herbst in der Luft spüren. Raschelndes Laub bedeckte die Einfahrt. Während ich die Eingangstreppe hinunterging, nahm ich die Schürze ab und hängte sie, unten angekommen, über das hölzerne Geländer. „Guten Morgen!“, rief ich dem Paketboten entgegen, auch wenn ich seine Reaktion bereits vorausahnte.
Er hob dann auch nur unwillig den Kopf – ein stämmiger Mann mit schütterem grauem Haar und rotem Kopf, der seit Jahren täglich herkam. Dennoch sah er mich nicht direkt an und erwiderte meinen Gruß auch nicht. Mit einer Sackkarre schob er einen wackligen Stapel Kartons bis gerade eben über die Grundstücksgrenze und setzte sie dicht am Zaun ab.
„Ist das alles?“, fragte ich, obwohl ich mir sicher war, dass er nicht antworten würde.
Und ich hatte Recht. Er brummte nur irgendwas, verstaute die Sackkarre und stieg wieder in seinen Wagen. Nicht einmal eine Unterschrift wollte er von mir haben. Als der Motor röhrend zum Leben erwachte, stieg eine blaugraue Abgaswolke aus dem Auspuff auf und schwebte auf der Brise davon. Ich sah ihm hinterher. Mit jedem Mal, dass er mich belieferte, verschwand er nach getaner Arbeit etwas schneller. Als könne er meine Anwesenheit nicht länger als unbedingt nötig ertragen.
Ob er meinen Eltern gegenüber wohl genauso unfreundlich gewesen war?
Vergeblich versuchte ich, mich zu erinnern.
Nun gut, es änderte sowieso nichts an der Sache. Ich bewegte die Schultern gegen die Verspannung, die sein Besuch immer hinterließ, und hob das erste Päckchen hoch. Es war ziemlich groß, aber nicht sehr schwer.
Kein Absender.
Auch das war nicht ungewöhnlich. Die meisten Leute wollten nicht, dass wir sie noch einmal kontaktieren konnten. Es war schon Glück, wenn sich in den Paketen neben dem eigentlichen Objekt ein Zettel mit einer Erklärung fand. Meist waren wir bei Bewertung und Einordnung dessen, was uns geschickt wurde, komplett auf uns allein gestellt.
Ich sage die ganze Zeit wir, dabei bin ich inzwischen allein. Meine Eltern waren nicht reich gesegnet – nur eine Tochter, und das zu einem Zeitpunkt, als schon niemand mehr damit gerechnet hatte. Sie starben, kaum dass ich volljährig war, als hätten sie insgeheim nur auf diesen Augenblick gewartet. Endlich frei. Zurück blieben einige unbezahlte Rechnungen, ein Haus voller Gespenster – und eine neunzehnjährige Tochter, deren Lebensweg darin bestand, die Tradition hochzuhalten.
Und auch heute war ich auf mich allein gestellt. Es gab zwar nur wenige Passanten hier an der Straße in den Wald, doch wenn ich die Pakete zu lange vorne am Zaun stehen ließ, wuchs das Risiko, dass jemand sich an ihnen zu schaffen machte. Mutproben und so. Wäre nicht das erste Mal. Zum Glück dauerte es nicht lange, alles die Treppe hinauf und in den Flur zu schaffen. Ich setzte die Pakete hinter der Trennwand in der Garderobe ab und lief schnell in die Küche zurück, um das Gas unter dem Kochtopf abzudrehen. Keine Sekunde zu früh – das Apfelmus hatte bereits begonnen, am Topfboden anzusetzen. Ich rührte noch einmal und schob den Topf dann nach hinten, um mehr Platz zu haben. Rasch füllte ich mehrere Einmachgläser mit dem stückigen Mus und stellte sie zum Auskühlen auf den Kopf. Dann begann ich, die Pakete zu öffnen.
In den meisten Fällen war das, was die Leute uns schickten, in Wahrheit harmlos, und das ungute Gefühl, das es bei ihnen auslöste, erwies sich lediglich als ein Bestandteil ihrer eigenen Psyche. Schuldgefühle taten so etwas manchmal. Nicht, dass ich irgendwen verurteilte.
Ich stellte einen kleinen Spielzeugaffen mit Trommel auf die Anrichte und betrachtete ihn gründlich.
Plötzlich schepperte er los.
Ich zuckte zurück.
Seine Ärmchen bewegten sich wie von selbst. Winzige Trommelstöcke klapperten unrhythmisch auf die Plastiktrommel.
So etwas hatte ich schon das eine oder andere Mal miterlebt. Wahrscheinlich nur ein loser Draht in seinem Innern. Ich drehte ihn um und zog den roten Uniformstoff seines Oberteils beiseite. Der Klettverschluss gab ratschend nach. Darunter befand sich ein Batteriefach. Natürlich war es nicht leer.
Was dachten die Leute sich eigentlich dabei?
Vorsichtig hebelte ich die Batterien aus ihrer Halterung und legte sie beiseite. Dann drehte ich den Affen in den Händen und lauschte. Besser erklären konnte ich es nicht. Es war ein Talent – das Familienerbe, sozusagen. Aber diesmal blieb alles ruhig. Ich konnte nichts erspüren.
Eigentlich war der Affe ja ganz niedlich. Wenn man ihn abstaubte, könnte man ihn vielleicht noch spenden. Das tat ich mit den meisten Dingen, von denen keine Gefahr ausging. Ich hatte Kontakte für solche Fälle – Leute, die diese Dinge für mich erledigten. Ich brauchte Vermittler, wenn ich etwas Gutes tun wollte, denn man misstraute unseren Gaben. Nicht einmal Gold und Silber hätten die meisten Menschen von meiner Familie genommen, wenn sie geahnt hätten, woher es stammt.
Eine Weile hatte ich nach dem Tod meiner Eltern versucht, mein Einkommen mit Flohmarktständen aufzubessern. Sie hätten dieses Vorgehen nicht gutgeheißen. Und es lohnte sich auch nicht. Egal, wie weit ich fuhr und unter welchem Namen ich mich anmeldete, die sensationsgierige Meute schien mich immer wieder zu finden. Einige kamen für den Nervenkitzel. Andere wollten mich nur einmal anspucken. Wenn ich etwas verkaufte, blieb stets das ungute Gefühl, ich sei nur eine Touristenattraktion. Nach nur einer Saison hatte ich dieses Experiment aufgegeben.
Ein Hauch von Zimt und Zitronensaft lag in der Luft. Ich stellte den erkalteten Topf in die Spüle und ließ Wasser einlaufen. Der leere Karton, in dem der Affe geliefert worden war, landete in der Ecke hinter dem von Alter und Besteck zerkratzten Küchentisch. Es wurde höchste Zeit, mal wieder den Altpapiercontainer zu besuchen.
Die nächste Lieferung, die ich öffnete, enthielt einen Bilderrahmen aus angelaufenem Messing mit einem ausgeblichenen Schwarzweiß-Bild. Das Glas war gesprungen – möglicherweise während des Transports. Ein Zettel ohne Unterschrift lag dabei: Dies ist ein Bild meines Onkels. Seit seinem Tod kann ich es nicht mehr um mich haben. Es raubt mir den Schlaf – ist ganz bestimmt verhext. Einige der Wörter, mit Kugelschreiber auf liniertes Papier geschrieben, waren ungeduldig ausgebessert worden. Ich ließ die Nachricht zurück in den Karton fallen und betrachtete das Foto eine Weile. Der Mann auf dem Bild schien an einer Art Strand zu sitzen, die Beine im Schneidersitz vor sich gekreuzt. Hinter ihm erkannte ich Dünen aus feinem Sand. Er trug helle Kleidung, die bestimmt irgendwann sehr modern gewesen war. Nichts an dem Motiv wirkte bedrohlich. Trotzdem stellte ich es nach längerer Betrachtung beiseite. Ich würde es eine Weile beobachten.
Der größte Karton war erstaunlich leicht und enthielt einen verbeulten, verbogenen, fleckigen, mit Spinnweben überzogenen Spielzeug-Kinderwagen mit einem Riss im Verdeck. Er knarzte, als ich ihn auf den Küchenboden stellte. Sah aus wie ein Kellerfund. Als ich das schwarzlackierte Gestänge anfasste, schmiegte sich mir eine Gänsehaut in den Nacken. Kurzentschlossen nahm ich das Teil und schaffte es direkt ins Untergeschoss zu den anderen Funden. Es war mühselig, ihn die Treppe hinunterzuschaffen, sie war schmal und steil. Ich sparte mir die Mühe, Licht anzumachen, und sah mich im Halbdunkel suchend um.
Das Untergeschoss bestand aus einem einzigen, großen Raum. Eigentlich aus zwei Räumen, inzwischen, als junger Mann hat mein Vater eine Garage und ein Herrenzimmer angebaut. In der Garage stand mein Wagen, eigentlich immer noch sein Wagen, den ich nur selten benutzte. Es gab kaum Orte, an die ich fahren könnte, denn ich hatte immer Sorge, was mit dem Haus in meiner Abwesenheit passiert. Es war mein Erbe und gleichzeitig mein Fluch.
Der beinahe bis zur Unkenntlichkeit verunstaltete Kinderwagen fand Platz zwischen einem Regal mit Gläsern voller vertrockneter Pflanzenteile, die wir von der Witwe eines Universitätsprofessors bekommen hatten, und einem defekten Kühlschrank. Als ich einige verstaubte Spinnweben vom Regal wischte, erblühte eine der Pflanzen für wenige Augenblicke und fiel dann wieder in sich zusammen. Ich kannte den Anblick, trotzdem hielt ich fasziniert inne.
Wann es angefangen hatte, dass meine Familie Spukphänomene sammelte, konnte ich nicht sagen. Natürlich gab es Aufzeichnungen, doch die hatten mich noch nie interessiert. Staubige, dicke Bücher voller winzig geschriebener Wörter mit altmodischen Schnörkeln. Als Kind hatte ich lieber in meinem Schulatlas geblättert, später in Abenteuerromanen. Inzwischen las ich, wenn ich las, am liebsten billige Liebesromane mit bunten, heiteren Coverbildern und Happy End.
Der Kinderwagen blieb also hier unten, und ich suchte mir wieder meinen Weg zur Treppe zurück. Die Jalousien waren fast immer zur Hälfte geschlossen, und die Geister mochten kein künstliches Licht – weder Kerzenflammen noch Elektrizität. Ich hatte gelernt, mich im Dunkel zurechtzufinden.
Als ich wieder nach oben kam, sah ich durch das schmale Fenster neben der Eingangstür einige Leute vorn am Zaun stehen und die Köpfe zusammenstecken, während sie aus dem Augenwinkel auf das Haus schielten. Ich widerstand der Versuchung, die Tür aufzureißen und sie zu erschrecken. Es war auch so schon nicht leicht, hier zu leben.
Ich sammelte die Kartons zusammen und trat sie, bis auf den größten, flach. In dem verstaute ich das restliche Altpapier und stellte ihn in die Vorratskammer, die neben der Küche lag. Der Container konnte warten. Die Gläser mit Apfelmus fühlten sich noch ein wenig warm an, also ließ ich sie auf der Anrichte.
Wieder kicherte es im Regal.
„Du hast gut lachen“, sagte ich in die Stille. „Du musst schließlich später nicht in die Stadt.“ Kartoffeln und Tee waren aus, und frische Milch könnte auch nicht schaden. Aus irgendeinem Grund verdarb die immer, wenn sie eine Weile in der Vorratskammer stand – sogar die ultrahocherhitzte, umständlich haltbar gemachte. Vielleicht hatte es mit der Belüftung zu tun. Ich gab mir die größte Mühe, möglichst normale Dinge über das Haus zu denken.
Die Oktoberschwestern im ersten Stock starrten stumm aus dem Spiegel, als ich meine Tasche aus der Kleiderkammer holte. Früher war das mein Kinderzimmer gewesen, doch seit ich ins Schlafzimmer meiner Eltern gezogen war, beherbergte es nur noch meine Kleidung und was man so brauchte. Dafür hatte ich den verwunschenen Spiegel hierher verbannt. Ich wollte in Ruhe schlafen.
Die dunklen Augen der Schwestern folgten mir, ohne zu blinzeln, durch den Raum. Ich bewegte mich vorsichtig und leise, um sie nicht zu verschrecken. Auf dem Weg nach unten machte ich einen großen Schritt über die zweitoberste Stufe. Sie war aus besonderem Holz. Mit der Zeit waren mir solche Angewohnheiten zur zweiten Natur geworden. Ich spürte ein kaltes Kribbeln zwischen den Schulterblättern und holte tief Luft. Auf dem Treppenabsatz begrüßte mich ein wärmender Kreis aus Sonnenlicht, der durch das Fenster fiel. Ich sah, wie die Nachbarin vom unteren Ende der Straße sich im Vorbeigehen bekreuzigte, und streckte ihr die Zunge heraus. Dann war ich unten, schlüpfte in meine Straßenschuhe und machte mich auf den Weg zum Laden an der Ecke. Auf die Jacke verzichtete ich. Bestimmt wäre ich nicht lange unterwegs, und die Oktobersonne hatte noch genug Kraft, mir ordentlich einzuheizen.