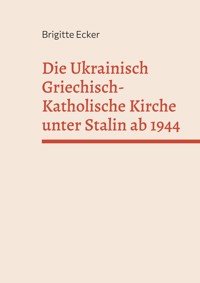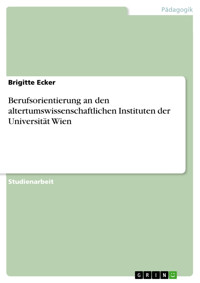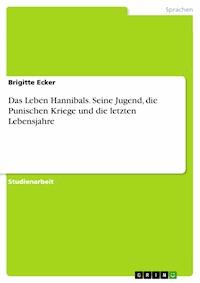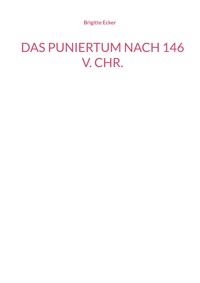
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es handelt sich um einen Essay, der mit 1,0 beurteilt wurde. Viele glauben, dass das Puniertum mit der Zerstörung des punischen Karthago erloschen ist, es war länger lebendig, als selbst WissenschaftlerInnen angenommen haben, zumindestens bis in die Vandalenzeit, wahrscheinlich ging es erst unter der arabischen Herrschaft unter, möglicherweise erlosch es erst im 11. Jahrhundert, das Phönikertum hätte dann ca. 3000 Jahre bestanden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Name:
Brigitte Ecker BA
MNR:
A 8201399
STR:
MA Geschichte
STK:
A 066 803
Zuordnung:
PM1 Einführung in Themenfelder, Räume und Epochen
VO:
Themen und Methoden der Studienrichtung Alte Geschichte
LVLtg.:
Ass. Prof. Dr. Hameter
LVNR:
090084
Semester:
SS 2023
Essay:
1
Thematisiert wird dieser Themenbereich eher am Rande, als letztes Kapitel einer Geschichte Karthagos oder im Rahmen eines Werkes zur Geschichte Nordafrikas. Die Forschung ist sich weitgehend einig, am ehesten gehen die Meinungen zum Zeitpunkt des Sprachentods auseinander. Sicher ist, dass es noch unter den Vandalen gesprochen wurde. Dass es erst unter den Arabern ausgestorben ist, ist nicht gesichert. Laut dem Semitisten und vergleichenden Sprachwissenschaftler R. M. Kerr (Latino-Punic Epigraphy, Tübingen 2010 [= Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe, 42, zugleich Diss. Leiden 2007]) blieb Punisch in Nordafrika länger lebendig als bisher angenommen (T. Toebosch in einem Artikel über die Dissertation von Kerr, NRC Handelsblad 10./11.3.2007, S. 47) bis zum Auftreten des Islam, jedenfalls bis ins 7. Jh. n. Chr.
Auf dieses Thema bin ich gestoßen, da mich nicht nur die Geschichte und Altertumskunde der Punier, sondern auch das römische Nordafrika sehr interessiert. Die Arbeit am Essay hat mir eine Reihe neuer Informationen betreff einer mich sehr interessierenden Frage gebracht.
„Er spricht nur Punisch, zur Not ein paar Worte Griechisch, die er von seiner Mutter hat; Lateinisch will und kann er nicht sprechen.“ schreibt Apuleius, dessen Muttersprache Punisch war, im 2. Jh. nach Christus, also Jahrhunderte nach der Zerstörung des punischen Karthago und dem Ende des karthagischen Staatswesens über einen jungen Zeitgenossen (Apul. Apol. 98/De Magia 98,8, zit. nach W. Röllig, Das Punische im Römischen Reich, in_ G. Neumann, Sprachen im Römischen Reich der Kaiserzeit, Köln/Bonn, 1980, S. 285). Apuleius war ein wohlhabendes Mitglied einer angesehenen Familie. Er schilderte einen Prozess vor dem Statthalter. Zunächst warf Apuleius seinem Gegner, seinem Stiefsohn aus Leptis vor, ein moralisch verworfener, in fragwürdigen Kreisen verkehrender junger Mann zu sein, bevor er ihn wegen seiner fehlenden Latein- und mangelhaften Griechischkenntnisse kritisierte. Der junge Mann war übrigens ebenfalls von respektabler Herkunft. Vielleicht wollte sich Apuleius dem Statthalter durch Betonung seiner eigenen Latein- und Griechischkenntnisse anbiedern (D. Kreikenbom, Punische Kultur unter römischer Herrschaft, in: Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hg.), Hannibal ad portas, Stuttgart 2004, S. 353f., 359, Kerr, S.21).