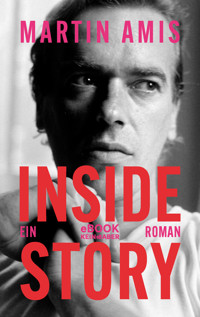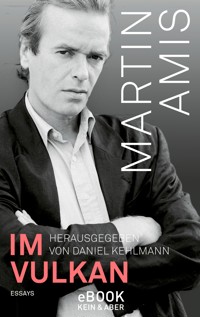11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charles Highway, ein intellektuell präpotenter, vor Energie, besonders sexueller, nur so strotzender Neunzehnjähriger aus der englischen Provinz, kommt ins Swinging London und hat bald nur noch eins im Sinn: die coole Rachel in sein Bett zu kriegen.
Das preisgekrönte Debüt eines unvergleichlichen Autors!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Martin Amis
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Martin Amis, geboren 1949 in Swansea, ist einer der bedeutendsten britischen Gegenwartsautoren. Er ist der Verfasser von vierzehn Romanen, sechs Sachbüchern und zwei Kurzgeschichtensammlungen. Für sein Romandebüt Das Rachel-Tagebuch (1973) erhielt er den Somerset Maugham Award. Zu seinen bekanntesten Werken zählen weiterhin Gierig (1984), London Fields (1989) und Pfeil der Zeit (1991), zuletzt erschien von ihm der Roman Interessengebiet (2015). Martin Amis lebt in New York.
ÜBER DAS BUCH
Ich sah Rachels Profil an. Meine Güte, ich mochte sie wirklich. Eine Wende in unserer Beziehung. Worin hatte diese bis jetzt bestanden? Es schien nicht wie Zuneigung, noch weit weniger Begierde: mehr so eine Art erschöpfender Unvermeidlichkeit, wie ins Büro von neun bis fünf.
Charles Highway, ein intellektuell präpotenter, vor Energie, besonders sexueller, nur so strotzender Neunzehnjähriger aus der englischen Provinz, kommt ins Swinging London und hat bald nur noch eins im Sinn: die coole Rachel ins Bett zu kriegen. Seine strategische Planung läuft auf Hochtouren, doch stellt sich das Leben als unerwartet gemein und gefährlich heraus. Ein zeitloser Geniestreich über die Kunst des Verführens und die Grenzen der Selbstinszenierung.
Für Gully
Sieben Uhr:
OXFORD
Ich heiße Charles Highway, obwohl man’s nicht meinen sollte, wenn man mich so sieht. Das ist so ein hochgewachsener, weit gereister, langpimmliger Name, und ich bin das alles ja nicht, so vom ersten Eindruck her. Zunächst mal habe ich eine Brille, schon immer, seit ich neun war. Und meine mittelgroße Figur, arschlos, hüftlos, mit dem Wellblechbrustkorb und den krummen Beinen, da hat sich alles verschworen, jede Spur von Grandezza zu vertreiben. (Man sollte dieses spezielle Modell übrigens auf keinen Fall mit den elastischen Chassis verwechseln, die bei meinen Altersgenossen so beliebt sind. Die sind ganz anders. Ich weiß noch, ich hab meinen Hosenbund fast doppelt übereinanderfalten müssen und den Hosenboden mit einem massiven Erwachsenenhemd ausgefüllt. Mittlerweile kleide ich mich allerdings mit mehr Überlegung – nicht unbedingt geschmackvoll, aber umsichtig.) Was ich immerhin habe, das ist eine von diesen hell-quäkigen Stimmen, die jetzt schwer en vogue sind, so eine mit der eingebauten Ironie durch die Nase, sehr gut geeignet zur Verunsicherung älterer Herrschaften. Und mein Gesicht dürfte wohl auch etwas Imponierendes haben. Es ist eckig, aber sensibel; dünne lange Nase, breiter dünner Mund – und meine Augen! Üppig bewimpert, dunkles Ocker, eine Spur gebranntes Nussbraun … ach, wie unzureichend diese Worte sind.
Die Hauptsache an mir ist aber, dass ich neunzehn Jahre alt bin und morgen zwanzig werde.
Zwanzig, das ist natürlich der eigentliche Wendepunkt. Sechzehn, achtzehn, einundzwanzig, das sind alles so willkürliche Marksteine – es wird lediglich festgelegt, dass man verhaftet werden darf, wenn man die Raten längere Zeit nicht gezahlt hat, man darf heiraten, gevögelt werden oder hingerichtet: Äußerlichkeiten. – Natürlich muss man unbedingt so törichte Parolen ignorieren wie »Man ist so alt, wie man sich fühlt« – die zweifellos dazu geführt haben, dass unzählige stramme Fünfzigjährige im Jogginganzug umgekippt sind, fahle Hippies mit einer Überdosis dalagen, fragile Schwuchteln ihre Brücken und Kronen von irgendwelchen viehischen Anhaltern zertrampelt bekamen. Zwanzig, das mag nicht der Beginn der Reife sein, aber das Ende der Jugend, so darf man schon sagen.
Um mit einem Schlag dramatische Spannung und inhaltliche Symmetrie herbeizuführen, möchte ich meine Geburt auf die Mitternacht legen. Tatsächlich war der Gebärvorgang bei meiner Mutter eine weitschweifige und insgesamt wenig elegante Angelegenheit; die Wehen begannen etwa um diese Zeit jetzt (das heißt gegen sieben Uhr abends am fünften Dezember vor zwanzig Jahren), und erst nach zwölf Uhr war das Ergebnis da: ein feuchtes Bündel von fünf Pfund, das ins Krankenhaus gebracht und dort vierzehn Tage lang gepäppelt werden musste. Mein Vater hatte – Gott weiß warum – eigentlich vorgehabt, sich alles bis zum Schluss anzusehen, war aber nach ein, zwei Stunden die Sache leid. Ich habe schon lange das sichere Gefühl, dass diese Anekdote eine sehr tiefe Bedeutung hat, komme aber nicht drauf, welche es sein könnte. Vielleicht finde ich die Antwort genau zwanzig Jahre nachdem ich zum ersten Mal in meinem Leben Luft geschnuppert habe.
Ich muss gestehen, dass ich mich seit Monaten auf den heutigen Abend gefreut habe. Als Rachel vor einer halben Stunde plötzlich ankam, dachte ich schon, sie würde mir alles verderben, aber sie ging rechtzeitig wieder. Ich muss diesen Übergang würdig hinter mich bringen, würdig und sozusagen offiziell, und ich muss die Schlussphase meiner Jugend noch einmal nacherleben. Denn irgendetwas ist mit mir passiert, ganz eindeutig, und ich möchte unbedingt wissen, was. Also: Wenn ich nun die letzten, sagen wir, drei Monate noch einmal durchgehe und versuche, von meiner ganzen Altklugheit und Kinderei, meiner Primanergewitztheit und meiner Sekundanergemeinheit, meiner ganzen befangenen Selbstsucht, von Selbstekel, Selbstverliebtheit, Selbst-was-auch-immer, von all dem einen Begriff zu bekommen – vielleicht kann ich dann meine Hamartia herausfinden, wie es die Alten nannten, meinen Wesensfehler, meinen falschen Zug, und erkennen, was für einen Erwachsenen ich abgeben sollte. Oder eben nicht. Jedenfalls dürfte der Versuch Spaß machen.
Jetzt ist es – einen Moment – gerade sieben Uhr. Noch fünf Stunden meines Teenagerdaseins liegen vor mir. Fünf Stunden, dann wandere ich weiter in das grässliche Brobdingnag, welches das Kind als Erwachsenenalter sieht.
Ich lasse mein altes schwarzes Reiseköfferchen aufklacken und stülpe es auf dem Bett um; Aktendeckel, Notizhefte, Ordner, prall geblähte Umschläge, in Bindfadenfesseln geschlagene Zettelbündel, Briefe, Durchschläge, Tagebücher – die Marginalien meiner Jugend übersäen die bunte Steppdecke. Ich dränge all das Papier zu provisorischen Stapeln zusammen. Sollte ich es chronologisch ordnen, nach Personen, nach Themen? Ganz offensichtlich ist heute Abend intensive Arbeit in der Registratur angesagt. Ich fische wahllos ein Tagebuch heraus, gehe ans andere Ende des Zimmers und lehne mich gegen das Bücherregal, das knarrt. Ich nehme ein Schlückchen von meinem Wein und blättere das Buch auf.
Das zweite Wochenende im September. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur noch ein paar Tage daheim durchzustehen, ehe es nach London ging. Am Donnerstag hatte sich mein Vater, der zum ersten Mal seit Jahren ein Glas härteren Alkohol in der Hand hatte, plötzlich laut gefragt, weshalb ich nicht »mal versuchen wollte, ob ich in Oxford landen kann« – und ich hatte ihm bestätigend zugenickt und mich das ebenfalls gefragt. Ja, warum nicht? Bevor ich dann auf die Universität gehen würde, wollte ich ohnehin ein Jahr freinehmen. Mein Englischlehrer hatte mir immer eingehämmert, wie gottverdammt begabt ich war. Und für eine andere Uni hatte ich auch keine Pläne. Es war irgendwie logisch.
Mutter legte dann am nächsten Morgen voll eifriger Betriebsamkeit los (das regeln wir jetzt alles), beim Mittagessen wurde sie aber sehr diffus und hochgeistig und beschloss, gleich ein Schläfchen zu halten. Als ich sie fragte, was noch zu tun war, erging sie sich in freiem Assoziieren, bis klar wurde – wie ein Puzzlebild nach und nach klarer hervortritt –, dass es ihr einzig und allein gelungen war, meiner Schwester mitzuteilen, ich würde dann kommen und bei ihr wohnen. Und ihr ansonsten noch (nehme ich doch an) das übliche halbstündige Bulletin über die Gefahren der späten Wechseljahre durchzugeben und ähnlichen weiblichen Schweinkram.
»Also«, sagte ich, »ruf ich selber bei der Aufnahmestelle in Oxford an und bei der UCCAund bei den Tutoren.«
Mutter verließ die Küche, die eine Hand an die Stirn gepresst und die andere hinter sich in der Luft flatternd. »Ja, Schatz«, rief sie.
Es brauchte etwa eine Stunde, weil ich am Telefon erstaunlich inkompetent bin. Ich sprach mit verschiedenen Schlüsselschnepfen in der Universitätsverwaltung und kam endlich zu den Tutoren durch, wo ein lauernder Greis mir anvertraute, er persönlich könne da nichts entscheiden, aber er wäre sich ziemlich sicher, dass man irgendwo etwas für mich finden könne. Da wurde mir klar, dass ich mir halb und halb irgendein unüberwindliches Hindernis erhoffte, einen verstrichenen Bewerbungstermin oder so. Doch alles schien gut voranzugehen.
Ich weiß gar nicht, woher diese Hoffnung kam. Oxford bedeutete natürlich mehr Arbeit, aber das war kein Problem. Es bedeutete: mehr Prüfungen, aber auch da muss ich sagen, ich hab ganz gerne feste Perspektiven, vorhersehbare Paniksituationen, auf die ich meine Ängste konzentrieren kann. Vielleicht hatte ich – als jemand, der immer dazu neigt, sein Leben in starker Strukturierung zu sehen – die nächsten paar Monate schon im Hinblick auf meinen nahenden zwanzigsten Geburtstag geplant. Es waren ja immer noch ein paar Jugendangelegenheiten zu regeln: Ich müsste mir einen Job suchen, vorzugsweise körperliche, egalitäre Arbeit; eine erste Liebe erleben (oder zumindest mit einer älteren Frau schlafen); noch ein paar weitere unreife, spröde Gedichte verfassen, damit mein Zyklus Adoleszenzmonolog fertig wurde, und, nun ja, den zusammenfassenden Rückblick auf meine Kindheit werfen.
Es gibt eine weniger gestelzte Erklärung. Meine Familie wohnt in der Nähe von Oxford, also müsste ich, würde ich dort studieren, mehr Zeit als bisher zu Hause verbringen. Und überhaupt gefällt mir die Stadt nicht. Es tut mir leid – zu viele trendgeile Tücken, zu viele Upperclass-Arschlöcher, zu viele Regionalprolos mit Kartoffelkloß-mit-Soß-Visagen. Und die Straßen sind derart schmal, das wirkt so affektiert.
Es ist eine Tradition bei den Highways, dass am Sonntagnachmittag zwischen vier und fünf Uhr jeder Familienangehörige das älteste Mitglied in seinem sogenannten »Arbeitszimmer« aufsuchen kann, um dort alles Notwendige durchzusprechen, um Hilfe zu ersuchen, Beschwerden vorzubringen. Man klopft einfach und tritt ein.
Mein Vater, mittlerweile eine kleine, recht gehetzt wirkende Erscheinung, sagte Hallo und fragte, was er denn für mich tun könne, während er sich vorbeugte, um den letzten Rest aus dem Literkrug frisch gepressten Orangensaft einzugießen – eine Tagesration, die er für gewöhnlich schon vor elf Uhr morgens aufgebraucht hatte. Seine Augen traten über dem Rand des verfärbten Trinkglases misstrauisch hervor, als ich ihm sagte, es sei alles abgemacht. Es entstand ein kurzes Schweigen, und ich fragte mich, ob er vielleicht die ganze Sache schon vergessen hatte. Doch bald erholte er sich. Seine feindselige kleine Scherzhaftigkeit ging so:
»Super. Ich fahre morgen früh rüber, ich kann dich wohl ohne allzu große Mühe mitnehmen, falls du nicht dein gesamtes Hab und Gut mitzunehmen gewillt bist, heißt das. Und mach dir keine Sorgen wegen Oxford. Oxford ist nur die Kirsche auf der Sahne.«
»Wie bitte?«
»Ich meine, es ist wie eine kleine Prämie. Was obendrauf.«
»Oh, unbedingt. Vielen Dank übrigens für das Angebot, aber ich glaube, ich nehme den Zug. Bis zum Abendessen dann.«
Ich machte mir in der Küche einen Kaffee und blätterte in jenen Partien der Sonntagszeitungen, die nicht zeltartig über das Massiv meiner Mutter auf dem Wohnzimmersofa gebreitet lagen. Mein Gesicht zeigte ein müdes Grinsen. Was hast du erwartet?, dachte ich. Draußen beschattete sich der Himmel schon makrelengefleckt. Wann würde es Nacht sein? Ich beschloss, sofort nach London zu gehen, solange noch Zeit war.
Ich sollte wohl versuchen, die Sache näher zu erklären.
Es ist an dem, dass ich einer traurigen, ständig schrumpfenden Minderheit angehöre … Ich bin ein Kind aus einer intakten Familie. Diesen Mühlstein trage ich seit dem Alter von elf Jahren um den Hals, als ich auf die Oberschule kam. Da ging kein Tag vorbei, ohne dass sich von irgendjemandem herausstellte, dass er adoptiert war oder unehelich; man hatte Mütter, die gerade mit irgendeinem Typen auf und davon gingen, hatte tote Väter und peinliche Stiefväter. Was für ereignisreiche Leben! Wie ich meine Mitschüler um ihre guten Gründe dafür beneidete, in sich gekehrt herumzulaufen; um ihre vorgegebenen Zielscheiben aller gerechten Abneigung und noblen Anhänglichkeit!
Einmal während des letzten Schuljahrs, als meine ganze Klasse sich in der Cafeteria der Schule drängte (die anderen hatten Unterricht), machte mir langweiligerweise ein Freund den Vorwurf, ich »hasste« meinen Vater »ja tatsächlich«, und der sei doch kein Schuft, kein Despot, bloß eine triviale Existenz. Mein Freund wies ruhig darauf hin, dass er für seinen Vater »keine Hassgefühle empfand«, obwohl er (der Vater) anscheinend an den meisten Tagen ständig die eine Faust im Gebiss seiner Gattin und die andere im Arsch des Au-pair-Mädchens hatte. Genau, dachte ich. Ich kippte meinen Stuhl gegen die Wand und erwiderte (ein wenig pompös – ich hatte in jener Woche eine Sammlung von D. H. Lawrences Essays gelesen):
»Ganz und gar nicht, Pete, du siehst nicht, worum es hier geht. Hass ist die einzige emotional durchgeformte Reaktion auf ein steriles Familienleben. Es ist wohl eine destruktive und … schmerzliche Emotion, aber ich glaube, ich darf sie nicht verleugnen, wenn ich mir meine Familie in meiner Fantasie und in meinem Bauch am Leben erhalten möchte – wenn schon nicht in meinem Herzen.«
Menschenskind!, dachte ich, und die anderen dachten es auch. Pete sah mich jetzt mit mürrischem Respekt an, wie ein Skeptiker bei einer erfolgreichen Seance – und genauso schaute ich natürlich ebenfalls drein: Da hatte ich es, endlich, moralphilosophisch durchformuliert.
Nicht, dass es meiner Ansicht nach keine dringenden Gründe gäbe, ihn zu hassen; nur ist er als objektive Begründung meiner Gefühle so winzig, so unscheinbar, niemals tut er etwas, was gemeinen Glamour hätte. Und, liebe Zeit, heutzutage braucht ein junger Mensch eben was, worüber er sich erregen kann, mag das Ausgangsmaterial auch noch so spärlich sein. Und das starke Gefühl, das wie ein Einbrecher durch das Haus geht und an allen Türen rüttelt, hat meine als einzige unverschlossen gefunden – in der Tat stand sie bereits weit offen: Denn drinnen gibt es keine Wertgegenstände.
Nun knie ich mich hin, nehme den größten Stapel Papier vom Bett und fächere ihn auf dem Fußboden auf.
Es ist seltsam – obwohl mein Vater wahrscheinlich die am ausführlichsten dokumentierte Figur in meinen Unterlagen ist, verdient er kein eigenes Notizheft, geschweige denn einen Ordner. Mutter hat natürlich ihr eigenes Konvolut, und meine Brüder und Schwestern haben das übliche Quartheft (die ziemlich nebensächliche Samantha ausgenommen, die nur ein Notizheftchen von Smith’s zu Threepence abkriegt). Warum gar nichts für meinen Vater? Soll das eine Methode sein, sich an ihm zu rächen?
In die obere linke Ecke jeder Seite, auf der er vorkommt, schreibe ich ein V.
Mein Vater hat insgesamt sechs Kinder gezeugt. Ich hatte früher einmal den Verdacht, dass er sich deshalb so viele zugelegt hatte, um einen großzügig umfassenden Geschmack zu demonstrieren, sein Image als toleranter Patriarch zu festigen, der Welt zu beweisen, dass seine Lenden fruchtbar waren. Vier sind Jungen, und er hat uns zunehmend modische Namen gegeben: Mark (sechsundzwanzig), Charles, wie gesagt (geht rasch auf die zwanzig zu), Sebastian (fünfzehn) und Valentine (neun). Dagegen nur zwei Mädchen. Ich wünsche mir manchmal, ich wäre als Mädchen geboren, und sei es nur, um diese Ungerechtigkeit auszugleichen.
Der unangenehmste Zug an ihm oder jedenfalls einer seiner unangenehmsten Züge ist es, dass er mit zunehmendem Alter bei immer besserer Gesundheit ist. Sobald er anfing, reich zu werden (dieser rätselhafte Prozess begann vor acht, neun Jahren), begann er auf der Stelle, sich zunehmend liebevoll um seinen Körper zu kümmern. Er spielte an den Wochenenden Tennis und dreimal die Woche Squash in Hurlingham. Er gab das Rauchen auf und trank keinen Whisky mehr oder andere scharfe Sachen. Darin sah ich zu Recht das vulgäre Eingeständnis meines Vaters, dass er nun, da er reicher war, fest entschlossen war, auch länger zu leben. Vor ein paar Monaten ertappte ich den alten Arsch dabei, wie er auf seinem Zimmer Liegestütze machte.
Verschwitzt sieht er auch aus. Zweifellos mit verzögerter Schockwirkung strömte ihm – kurz nachdem das Geld angefangen hatte hereinzuströmen – sein Haar vom Kopfe herab. Eine Zeit lang versuchte er’s mit Strategien wie dem Vorwärtskämmen der Seetanglocken, praktisch vom Halsansatz hoch, was eine haarfestigerdurchsetzte Haube ergab, durch die bei jeder schnellen Bewegung der bleiche Schädel blinkte. Aber schließlich begriff er, dass nichts mehr drin war, und ließ das Haar seine eigenen Wege gehen – die dahin führten, dass es sich in zwei drahtige graue Flügel zu beiden Seiten des Kopfes zerlegte, der ansonsten haarfrei blieb. Das sah, ich muss es leider sagen, sehr viel besser aus und gab ihm in Verbindung mit seinem großen, spitzen Gesicht und dem kurzbeinigen Körper eine gewisse frettchenhafte sexuelle Aura.
Seit längerer Zeit gehört seine Frettchengunst nun schon einer Geliebten, wie mir im Alter von dreizehn Jahren von meinem großen Bruder versichert wurde. Mark sah das Ganze mit reifer Laszivität und war für meine piepsstimmige Empörung nicht zu haben. Gordon Highway, erläuterte er, war immer noch ein gesunder und kräftiger Mann; seine Frau andererseits war – na ja, schau doch mal selber.
Und ich schaute. Was für ein Wrack. Die Gesichtshaut war geschrumpft, was das Kinn betonte und die düsteren Augenteiche tief unterkellerte; ihre Brüste hatten lange schon die alte Heimat verlassen und flankierten nun ihren Nabel; und ihre Hinterbacken tanzten, wenn sie die elastischen Freizeithosen trug, wie Punchingbälle hinter ihren Knien. Die Weisheitsliteratur, die sie zu lesen pflegte, gab ihr das Recht, dem Schein des eigenen Äußeren zu entsagen. Weg mit dem Haar, her mit den Jeans und den Seemannspullovern! In ihrer Kleidung für die Gartenarbeit glich sie einem etwas weibischen, doch energisch ans Werk gehenden Landarbeiter.
Jedenfalls tobte ich bei dieser Enthüllung enthusiastisch, vor allem, glaube ich, als Reaktion auf die schmierige Toleranz meines Bruders. Auch war mir mein Vater nie besonders »kräftig« erschienen noch meine Mutter besonders unattraktiv – oder beide irgendwie anders als still und asexuell miteinander zufrieden. Und ich wollte sie auch jetzt nicht so sehen, in sexuellem Zusammenhang. Ich war zu jung.
Sogar dies jedoch, verstehen Sie, sogar dies brachte keinerlei wirklichen Biss, wirklichen Pfeffer in unser Familienleben.
Die Küche der Highways, neun Uhr, ein beliebiger Montagmorgen.
»Gehst du jetzt, Liebling?«
Mein Vater schiebt die Grapefruit beiseite, streift rasch mit der Serviette über seinen Mund. »Gleich.«
»Kann ich dich dann in der Stadtwohnung erreichen oder unter der Kensington-Nummer?«
»Aah, heut Abend die Wohnung und«, die Augen werden schmal, »am Mittwoch, glaube ich, auch.Also Kensington am Dienstag und wahrscheinlich« – Stirnrunzeln –, wahrscheinlich Donnerstag. Wenn was unklar ist, ruf im Büro an.«
Ich versuchte stets zu vermeiden, dass ich Zeuge dieser Gespräche wurde, und jedes Mal, wenn ich zufällig doch dabei war, war es mir immer, als müsste ich in die Hose pinkeln. Aber wenn man fair bleiben will – es war dann doch nicht die Art Situation, in die man sich groß hineinsteigern konnte. Wenn Mutter nur mehr darunter gelitten hätte. Sicherlich – dachte ich mir – muss sie sich doch gelegentlich fragen, wann er wohl anfängt, statt am Freitagabend am Samstagmorgen nach Hause zu kommen und statt Montagmorgen schon Sonntagabend wieder zu gehen, wann er wohl das Wochenende mit der Familie plötzlich und unwiderruflich zu seinem Tag mit den Kindern schrumpfen lassen würde.
Ich packte meinen Kram – die entscheidenden Jugendwerke, reichlich Taschenbücher und ein paar Sachen zum Anziehen – und schaute mich dann im Haus nach Personen um, von denen ich mich verabschieden konnte.
Mutter schlief noch, und Samantha war zum Übernachten zu einer Freundin gegangen. Das Arbeitszimmer war leer, also wanderte ich durch die dämmrigen Korridore und rief nach meinem Vater, doch es kam keine Antwort. Sebastian, der fünfzehn war, lag wahrscheinlich auf seinem Zimmer und starrte glutäugig die Decke an. Ein Bruder blieb noch übrig.
Valentine war im Spielzimmer auf dem Dachboden, bis zu den Knien in einer Metropole aus Bauelementen und Kabeln, er ließ Sportwagenmodelle herumfegen. Ich sagte, ich ginge jetzt fort, er solle alle schön von mir grüßen, aber er konnte mich nicht hören. Ich legte einen Zettel auf den Tisch im Vestibül und verdrückte mich.
Sieben Uhr zwanzig:
LONDON
Jetzt schaue ich mich im Zimmer um, und es wirkt wie ein ganz geselliger Ort: mit den zwei Weinflaschen, dem gedämpften Licht, der lustlosen, aber beruhigenden Gegenwart von Papier und Büchern. In Highways London,einem von meinen Notizbüchern, kann man nachlesen, dass ich das Zimmer an jenem Septembersonntag »bedrückend« fand, »mürrisch wegen all seiner Vergangenheit, in blassem Trotz zusammengekauert, als ich mich umwandte und es betrachtete«, an diesem Sonntag im September. Liebe Zeit. Ich war wohl damals stark stimmungsabhängig oder hatte größere Achtung vor meinen Stimmungen, ich glaubte eher, sie seien irgendwas wert.
Natürlich hassen wir alle – falls man sich auf Philip Larkin verlassen darf – unser Zuhause und hassen es, uns dort aufhalten zu müssen.
Es war gewiss schön, aus dem Haus zu kommen, und wenn ich so daran denke, kam ich mir recht aufgekratzt und männlich vor, als ich das haselnussübersäte Landsträßchen zum Dorf entlangging. Der Bus nach Oxford ging erst in einer Viertelstunde oder so, also zog ich ein wohlverdientes Bier im Pub und plauderte mit dem Wirt und seinem kaputten Eheweib, Mr und Mrs Bladderby. (Interessanterweise hat Mrs Bladderby eine noch kaputtere Mutter, die achtzig war und der darüber hinaus noch kürzlich bei einem kleinen Ausflug irgendeine grauenhafte Agrarmaschine das linke Bein eingeschluckt hatte; sie war viel zu debil, um am Schock zu sterben, tatsächlich hatte sie das fürchterliche Picknick seither gar nicht mehr erwähnt. Jetzt residierte Mrs Lockhart in dem Zimmer über der Wirtsstube und knallte ein verzogenes Billardqueue auf den Boden, wenn sie etwas brauchte.) Als Mrs Bladderby verschwand, um einer solchen Mahnung nachzugehen, wies Mr Bladderby mit einem Kopfrucken auf meine Koffer und fragte, ob ich wieder verreisen würde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!