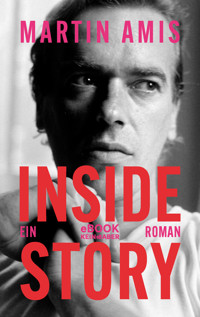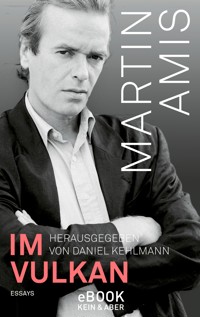14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vollgepumpt mit Alkohol, Testosteron und einem eher ungesunden Maß an Selbstvertrauen, pendelt John Self zwischen London und New
York, um seinen ersten eigenen Film zu realisieren. Doch trotz Dauerrausch gibt es immer wieder Situationen, in denen John klar wird, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt. Ein rasanter, böser Roman und ein unbestrittener Höhepunkt im Werk von Martin Amis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Martin Amis
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Martin Amis, geboren 1949 in Swansea, ist einer der bedeutendsten britischen Gegenwartsautoren. Er ist der Verfasser von vierzehn Romanen, sechs Sachbüchern und zwei Kurzgeschichtensammlungen. Für sein Romandebüt Das Rachel-Tagebuch (1973) erhielt er den Somerset Maugham Award. Zu seinen bekanntesten Werken zählen weiterhin Gierig (1984), London Fields (1989) und Pfeil der Zeit (1991), zuletzt erschien von ihm der Roman Interessengebiet (2015). Martin Amis lebt in New York.
ÜBER DAS BUCH
Ich hasse Leute mit Abschlüssen, mittlerer Reife, bestandenen Aufnahmeprüfungen, Iowa-Tests, Kurzschriftdiplomen … Und Ihr hasst mich, nicht wahr? O ja. Weil ich der neue Typus bin, der Typus, der Geld hat, es aber für nichts anderes als Hässlichkeit benutzen kann.
John Self ist das vollkommene Produkt unserer Gesellschaft. Zwei Motive bestimmen sein ganzes Handeln: Wie viel Geld bringt es, und wie verschafft es den maximalen Genuss. Eine brillante und scharfsichtige Satire auf die Maßlosigkeit und selbstverliebte Scheinwelt unserer Zeit.
Für Antonia
Dies ist ein Abschiedsbrief. Wenn Ihr ihn beiseitegelegt habt (und derlei Dinge sollte man stets langsam lesen, dabei auf Hinweise oder Andeutungen achten), wird es John Self nicht mehr geben. So jedenfalls ists geplant. Bei Abschiedsbriefen weiß man allerdings nie, oder? In der planetarischen Gesamtheit allen Lebens gibt es weit mehr Abschiedsbriefe als Selbstmorde. In dieser Beziehung sind Abschiedsbriefe wie Gedichte: Fast jeder hat sich irgendwann einmal daran versucht – mit oder ohne Talent. Wir alle schreiben sie in unseren Köpfen. Zumeist ist der Brief das Entscheidende. Man vollendet ihn und setzt dann seine Zeitreise fort. Nicht das Leben, der Brief hat sich erledigt. Oder umgekehrt. Bei Abschiedsbriefen weiß man allerdings nie.
An wen dieser Abschiedsbrief gerichtet ist? An Martina, an Fielding, an Vera, an Alec, an Selina, an Barry – an John Self? Nein. Euch allen da draußen gilt er, Euch, den Lieben, den Sanften.
M. A.
London, September 1981
Als mein Taxi, irgendwo zu Anfang der Hunderter vom FDR Drive abbog, schoss ein tiefergelegter Tomahawk voller schwarzer Jungs aus der Spur und scheuerte direkt an unserem Bug vorbei. Wir gerieten auf den Seitenstreifen, rasselten über den Straßenrand; zum Knall eines Gewehrschusses duckte sich das Taxidach runter und verpasste mir eine. Das hatte mir gerade noch gefehlt, kann ich Euch sagen, wo mir Kopf, Gesicht, Rücken und Herz sowieso schon die ganze Zeit wehtaten und ich vom Flieger noch ganz besoffen, durch den Wind und in Panik war.
»Oh Mann«, sagte ich.
»Ja«, sagte der Taxifahrer durch das zerdepperte Plastik seiner Trennscheibe hindurch. »Da sagen Sie was.«
Mein Taxifahrer war um die vierzig, schlank, mit Halbglatze. Die noch vorhandenen Haare eilten lang und feucht über Nacken und Schultern. Für den Fahrgast sind alle Taxifahrer in der Stadt so – irrer Nacken, irre Matte. Dieser irre Nacken war brisant pockig, narbig und gefleckt, und unter den puterroten Ohrlappen flackerte noch etwas jugendliche Virulenz. Er lümmelte in seiner Ecke, die langen Hände lässig am Steuer.
»Es braucht bloß hundert Jungs, hundert Jungs so wie mich«, brüllte er nach hinten, »und die ganzen Nigger und Puertos dieser Scheißstadt sind weg vom Fenster.«
Ich saß auf meinem Platz und hörte zu. Dank dieser neuen Krankheit, die ich Ohrensausen genannt habe, nehmen meine Ohren seit Kurzem Sachen wahr, Sachen, die eigentlich gar nicht hörbar sind. Jet-Starts, zerbrechendes Glas, Eis, das aus der Schale gekratzt wird. Das passiert meistens morgens, aber auch sonst. Zum Beispiel ist es mir im Flieger passiert. Zumindest glaubte ich das.
»Was?«, schrie ich. »Hundert Jungs? Das sind nicht viel.«
»Wir würden das schaffen. Mit den richtigen Spritzen schon.«
»Spritzen?«
»Spritzen, ja. Fünfundsechziger. Automatik.«
Ich lehnte mich zurück und rieb mir den Kopf. Zwei Stunden hatte ich an der Passkontrolle verbracht, verdammt. Ich habe so ein Antitalent für Schlangen. Man kennt das. Hohoho, dachte ich, während ich mich erfolgreich zur kürzesten Schlange durchkämpfte. Doch die kürzeste Schlange war aus einem interessanten Grund die kürzeste Schlange. Die vor mir waren alle von der Venus, Pterodaktylen, Männer und Frauen aus einem alternativen Zeitstrom. Sie mussten alle von dem ernsten Dreihundertpfünder in seinem erleuchteten Glaskasten viviseziert und abgeklopft werden. »Geschäftlich oder privat?«, fragte mich der Kerl schließlich. »Ich hoffe, nur geschäftlich«, erwiderte ich und meinte es auch. Geschäftlich geht bei mir in der Regel klar. Was mir immer diesen teuren Ärger macht, ist das Private … Dann eine halbe Stunde am Zoll und noch eine halbe Stunde, bis ich mir dieses Taxi gekrallt hatte – ja, und dann der übliche Irre, der an seinem Steuer schäumte. Ich bin schon in New York gefahren. Fünf Blocks, und man heult bloß noch vor barbarischem Brechreiz. Und was passiert bei diesen Neandertalern, die sie einstellen, um es den ganzen Tag für Geld zu tun? Versuchts mal.
»Warum sollten Sie denn so etwas tun wollen?«, fragte ich.
»Hä?«
»Die ganzen Nigger und Puertos umbringen?«
»Na, die glauben doch, wenn du’n Yellow Cab fährst«, sagte er und nahm lässig eine gespreizte Hand vom Steuer, »dann bist du irgend so ’n Stinkbeutel.«
Ich seufzte und beugte mich vor. »Wissen Sie was?«, fragte ich ihn. »Sie sind echt ein Stinkbeutel. Ich hielt das bloß für ein Schimpfwort, bis Sie kamen. Sie sind der erste echte, der mir begegnet ist.«
Wir fuhren rechts ran. Er wuchs auf seinem Sitz und drehte sich langsam zu mir um. Sein Gesicht war viel widerlicher, ungewaschener, überhaupt viel zweckmäßiger, als ich geglaubt hätte – picklig, tussimäßig, leuchtende Augen und zickiger Mund, als gäbe es da unter der Hautmaske noch ein zweites Gesicht, das wahre Gesicht.
»Okay. Raus hier. Ich hab gesagt, raus aus dem verdammten Auto!«
»Jaja«, sagte ich und schob meinen Koffer über den Sitz.
»Zweiundzwanzig Dollar«, sagte er. »Da, die Uhr.«
»Sie kriegen überhaupt nichts, Sie Stinkbeutel.«
Ohne die Blickrichtung zu ändern, langte er unters Armaturenbrett und zog den Spezialhebel. Alle vier Türschlösser schnappten mit einem öligen »Tschock« ein.
»Jetzt pass mal auf, du Fettarsch«, fing er an. »Wir sind hier Neunundneunzigste und Second. Das Geld. Gib mir das Geld.« Er sagte, sonst würde er mich noch zwanzig Blocks weiter fahren und mich dort rauswerfen.
Er sagte, wenn die Nigger dann mit mir fertig wären, wäre außer einem Büschel Haare und ein paar Zähnen von mir nichts mehr übrig.
Ich hatte noch ein paar Scheine in der Gesäßtasche von meiner letzten Reise. Ich schob einen Zwanziger durch die versiffte Scheibe. Er entriegelte die Türen, und ich kletterte raus. Es gab nichts mehr zu sagen.
Da stehe ich nun also mit meinem Koffer. In grellem Licht und Inselregen. Hinter mir eine geschlossene Wasserwand und das Industriekorsett des FDR Drive … Es muss schon auf acht zugehen, doch der weinerliche Atem des Tages beschirmt noch immer seinen Schein, einen triefenden Schein, sehr elend – verregnet, verpisst. Auf der anderen Seite der verdreckten Straße lungern drei schwarze Kids im Eingang eines leeren Schnapsladens herum. Aber ich bin groß, ja, ich bin ein großer Kerl, und sie wirken zu depresso, um mich anzumachen. Herausfordernd nehme ich einen Schluck von meinem zollfreien Sprit. Es ist nach Mitternacht, meine Zeit. Gott, wie ich diesen Film hasse. Und das ist erst der Anfang.
Ich halte nach einem Taxi Ausschau. Es kommt keins. Ich bin auf der First, nicht der Second, und die First liegt in Uptown. Alle Taxis fahren in die andere Richtung, machen, dass sie auf die Second und Lex kommen. Keine Minute in New York, und schon latsche ich los, den langen Gang die neunundneunzigste Straße entlang.
Wisst Ihr, vor einem Monat hätte ich das noch nicht getan. Damals nicht. Damals ging ich allem aus dem Wege. Jetzt warte ich einfach ab. Und mir passieren Sachen. Und wie. Sie passieren einfach so. Man passt auf – man wartet … Inflation, sagt man, putzt die Stadt durch. Die Knete krempelt die Ärmel hoch und mistet den Stall aus. Aber diese Sachen passieren hier immer noch. Du steigst aus dem Flieger, schaust Dich um, holst tief Luft – und wachst in der Unterhose wieder auf, irgendwo südlich von Soho oder auf einem Streckbett in Midtown, hast ein silbernes Tablett mit Narbenflächen und ein Schildchen auf der Brust, und ein Kerl in Weiß sagt: »Guten Morgen, Sir. Wie fühlen Sie sich heute? Das macht dann fünfzehntausend Dollar …«
Solche Sachen passieren hier noch, und etwas wartet darauf, mir zu passieren. Ich weiß es. Seit Kurzem fühlt sich mein Leben an wie ein grauenvoller Witz. Seit Kurzem nimmt mein Leben Formen an. Etwas wartet. Ich warte. Es wird bald aufhören zu warten – ich rechne jeden Tag damit. Schlimme Sachen können jederzeit passieren. Das ist das Schlimme daran.
Die Furcht ist angesagt auf diesem Planeten. Die Furcht ist dick und fett und stark angesagt. Die Furcht trifft uns alle hier unten wie ein Schlag. Und wie, Mann. Schwester, mach Dir doch nichts vor … Irgendwann geh ich noch mal hin zur Furcht. Genau da geh ich hin. Einer muss es ja tun. Da geh ich hin und sage: Ich habe gehört, alle Maulhelden seien in ihrem tiefsten Inneren Feiglinge. Die Furcht ist ein Maulheld. Trotzdem sagt mir etwas, dass sie kein feiger Hund ist. Ich habe den Verdacht, die Furcht ist echt unheimlich tapfer. Die Furcht wird mich gleich durch diese Tür führen, mich in den Gang zwischen die Kästen und leeren Flaschen stellen und mir zeigen, wer der Boss ist … Vielleicht verliere ich dabei den einen oder anderen Zahn, oder vermutlich könnte sie mir sogar den Arm brechen – oder mir ein Auge versauen! Die Furcht könnte sich da hineinsteigern, so was habe ich schon erlebt, zur nackten Zerstörungswut werden, wo alles egal ist. Vielleicht brauchte ich dann einen Rettungstrupp, eine Waffe oder eine Kanone. Jetzt, wo ich mir das so überlege, lass ich die Furcht vielleicht besser in Ruhe. Wenns zum Kampf kommt, bin ich echt tapfer – oder erbarmungslos oder gleichgültig oder einfach ungerecht. Aber die Furcht macht mir echt Angst. Sie prügelt zu gut, und ich habe sowieso schon zu viel Angst.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!