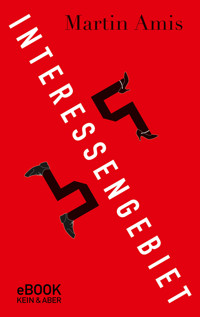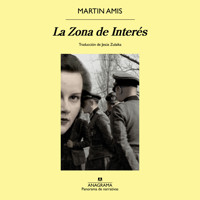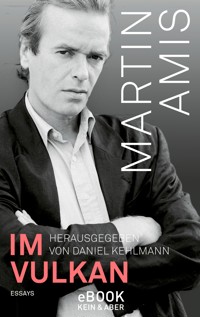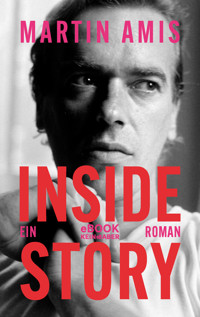
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auslöser für Martin Amis’ bisher persönlichstes Werk war der Tod seines engsten Freundes Christopher Hitchens. Aus der tiefen und weitreichenden Freundschaft der beiden Schriftsteller entfaltet sich dieser autobiografische Roman. Christopher Hitchens war Martin Amis’ Mitstreiter und Berater, seit ihren Anfängen in London bis hin zu den Jahren des Literatur- Klatsches, der romantischen Verwicklungen und beunruhigenden Obsessionen. Während Inside Story auch anderen wichtigen Personen in Amis’ Leben nachspürt – darunter seinem Vater Kingsley Amis, seinem Idol Saul Bellow und dem Dichter Philip Larkin –, widmet sich die Geschichte zärtlich und humorvoll den schwierigsten Fragen: Wie lebt, wie trauert und wie stirbt man? Das Ergebnis ist ein Liebesbrief an das Leben, der Einblicke in die außergewöhnliche Welt des Schriftstellers eröffnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 951
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Martin Amis, geboren 1949 in Oxford, ist einer der bedeutendsten englischen Gegenwartsautoren. Er ist der Verfasser von vierzehn Romanen, zwei Kurzgeschichtensammlungen und sechs Sachbüchern. Für sein Romandebüt Das Rachel-Tagebuch (1973) erhielt er den Somerset Maugham Award. Zu seinen bekanntesten Werken zählen weiterhin Gierig (1984), London Fields (1989) und Interessengebiet (2015). Bei Kein & Aber erschien zuletzt sein Essayband Im Vulkan (2018). Martin Amis lebt in New York.
ÜBER DAS BUCH
In diesem Stück literarischer Zeitgeschichte führt uns Martin Amis durch die aufregenden und aufreizenden Anekdoten seines Lebens, gibt uns Unterricht im Verfassen von Literatur und lässt die Welt- und Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts Revue passieren. Seit ihren Anfängen in den 1970ern in London bis hin zum Literatur-Klatsch, zu romantischen Verwicklungen und beunruhigenden Obsessionen waren Martin Amis und sein bester Freund Christopher Hitchens Mitstreiter in einer Welt, in der das Wort die schärfste Klinge ist. Während Inside Story weiteren wichtigen Personen in Amis’ Leben nachspürt – darunter seinem Vater Kingsley Amis, seinem Idol und literarischen Vater Saul Bellow und dem Dichter Philip Larkin –, widmet sich die Geschichte zärtlich und humorvoll den großen Fragen nach Leben, Liebe und Tod.
Für Isabel Elena Fonseca
Präludium
Willkommen! Treten Sie doch näher – es ist mir eine Freude und eine Ehre. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ich nehme Ihnen mal den Mantel ab und hänge ihn da hin (ach, hier geht’s übrigens zur Toilette). Setzen Sie sich auch gern aufs Sofa – dann können Sie selbst bestimmen, wie nahe Sie am Feuer sein wollen.
Also, was möchten Sie gern? Einen Whisky? Nur vernünftig bei diesem Wetter. Und ich habe schon vorausgesehen, erahnt, was Sie brauchen … Einen Blended oder einen Malt? Macallan? Den 12 Jahre alten oder den 18? Wie möchten Sie ihn – mit Soda, mit Eis? Und ich hole noch ein Tablett mit Snacks. Damit Sie bis zum Abendessen durchhalten.
… Hier bitte. Frohes 2016!
Meine Frau Elena ist gegen halb acht zurück. Und auch Inez kommt noch dazu. Genau – Betonung auf der zweiten Silbe. Im Juni wird sie siebzehn. Einstweilen sind wir auf nur ein Kind reduziert. Eliza, ihre ein wenig ältere Schwester – Eliza macht gerade ihr Gap Year in London, was ja auch ihre Heimatstadt ist (sie kam da zur Welt. Wie auch Inez). Jedenfalls hat Eliza, wie es der Zufall will, einen Besuch geplant – und gerade ist sie am JFK gelandet. Wir werden also zu fünft sein.
Elena und ich, wir sind noch nicht so weit, aber unser nächster Lebensabschnitt ist schon in Sicht. Ich meine das Empty Nest … In der durchschnittlichen Lebensspanne gibt’s nur ungefähr ein halbes Dutzend echte Wendepunkte, und das leere Nest scheint mir einer zu sein. Ich weiß auch noch gar nicht so recht, wie sehr ich mir Gedanken darüber machen soll.
Etliche unserer Altersgenossen haben, als ihr letztes Küken ausgeflogen ist, binnen Minuten heftigste Nervenzusammenbrüche erlitten. Und allermindestens werden meine Frau und ich uns wie jenes Paar in Pnin fühlen, ganz allein in einem großen, zugigen alten Haus, das »nun an ihnen hing wie die schlaffe Haut und die schlackernden Kleider eines Idioten, der ein Drittel seines Gewichts abgenommen hatte« … Das hat Nabokov (einer meiner Helden) 1953 geschrieben.
Also, Vladimir Nabokov – der hatte jedes Recht und jede Berechtigung, sich an einem autobiografischen Roman zu versuchen. Sein Leben war nicht »merkwürdiger als Literatur« (diese Wendung ist so gut wie bedeutungslos), aber es war ungeheuer ereignisreich und mit geohistorischem Glanz durchwirkt. Man entkommt dem bolschewistischen Russland und sucht Zuflucht im Berlin der Weimarer Republik; man entkommt Nazi-Deutschland und sucht Zuflucht in Frankreich, das Hitler dann prompt überfällt und besetzt; man entkommt der Wehrmacht und sucht – und findet – Zuflucht in Amerika (damals war »Zuflucht« Teil der Definition Amerikas). Nein, Nabokov war ein ganz seltener Fall: ein Schriftsteller, dem Dinge richtiggehend widerfahren sind.
Übrigens warne ich Sie jetzt schon, dass ich auf diesen Seiten das eine oder andere über Hitler zu sagen habe, auch über Stalin. Bei meiner Geburt 1949 war der Kleine Schnauzer vier Jahre tot, der Große Schnauzer (in unserem Hausblatt Daily Mirror war er weiterhin »Uncle Joe«) hatte noch vier Jahre vor sich. Ich habe zwei Bücher über Hitler und zwei über Stalin geschrieben, also habe ich rund acht Jahre in ihrer Gesellschaft zugebracht. Und wie ich sehe, gibt’s von beiden kein Entkommen.
Ich hatte nie das – zweifellos furchterregende – Vergnügen, VN persönlich zu begegnen, aber immerhin hatte ich einen denkwürdigen Tag mit seiner Witwe, Véra, schön, goldene Haut, Jüdin, was dazugesagt werden soll, und auch seinen Sohn habe ich kennengelernt, Dmitri Vladimirovich (ein extravagantes, verschwenderisches Wunderkind). Ich empfand es als doppelt traurig, als Dmitri vor drei, vier Jahren ohne Nachkommen starb. Dmitri war das einzige Kind der Nabokovs – 1934 in Berlin geboren und offiziell ein sogenannter Mischling … Beim Mittagessen im schweizerischen Montreux gingen Véra und Dmitri sehr liebevoll und reizend miteinander um. Über beide später mehr, in dem mit »Oktober« betitelten Abschnitt (er beginnt auf Seite 298). Ich hatte Véra ein Foto meines ersten Sohnes geschickt und eine zauberhafte Antwort von ihr erhalten, die ich natürlich verloren habe …
Ganz allgemein? Ach, ich bin ein lächerlich laxer und nachsichtiger Vater – worauf mich hinzuweisen meine Kinder immer wieder Anlass haben. »Du bist ein sehr guter Vater, Daddy«, vertraute mir Eliza mit acht oder neun Jahren an, als ich einmal allein für sie zuständig war: »Mummy ist auch eine sehr gute Mutter. Aber manchmal kann sie doch ein klein wenig streng sein.«
Der Sinn ihrer Aussage war klar. Ich bin unfähig, Strenge zu verkörpern, geschweige denn sie durchzusetzen. Dazu bedarf es echten Zorns, und den empfinde ich so gut wie nie. Ich habe versucht, ein zorniger Vater zu sein, aber nur einmal und dann auch nur für sechs, sieben Sekunden. Nicht bei meinen Töchtern, aber bei meinen Söhnen, Nat und Gus (die jetzt um die dreißig sind). Einmal – da waren auch sie acht oder neun – kam ihre Mutter, meine erste Frau Julia, verzweifelt zu mir ins Arbeitszimmer und sagte: »Die sind heute unmöglicher als sonst. Ich habe alles versucht. Jetzt geh du mal hin!« Jetzt geh du mal hin, so die Andeutung, und nimm sie unter dein männliches Feuer.
Also marschierte ich pflichtschuldig in ihr Zimmer und sagte mit erhobener Stimme:
»Also. Was zum Teufel ist hier los?«
»… Oh«, sagte Nat und hob träge die Brauen. »Jetzt kommt Dandys Zorn über uns.«
So viel also zum Zorn.
Ich halte eben nichts davon – vom Zorn. Die sieben Todsünden müssten zwar mal überarbeitet und aktualisiert werden, aber einstweilen sollen wir immer bedenken, dass Zorn rechtens in das klassische Septett gehört. Mit Zorn – cui bono? Bedauernswerter Zorn, bedauernswert diejenigen, die ihn verströmen, wie auch die, gegen die er sich richtet. Das englische anger: vom Altnordischen angre, »ärgern«, angr, »Kummer«. Ja – Kummer. Mit Zorn bestraft man sich selbst fast so offensichtlich wie mit Neid.
Im Vaterbereich mache ich mich nicht des Zorns schuldig, die Todsünde aber, zu der ich mich bekennen muss, ist Trägheit – moralische Trägheit. Der Mutter mehr zu tun geben … Davor hatte ich Elena gewarnt, leicht flehentlich (schließlich war ich bei Inez’ Geburt fünfzig). Ich sagte: »Ich werde ein Vater emeritus sein« (d.h. »pensioniert, den Titel aber als ehrenhalber führen dürfend«). Allgemein also ein träger Vater, wenngleich ich diese Ehre schnell – und begierig und dankbar – annehme.
Vor drei Jahren hielt ich an der Schule meiner mittleren Tochter hier in Brooklyn, an der Saint Ann’s (an die auch Inez geht), einen Vortrag. Da war Eliza fünfzehn.
»Das könnte peinlich werden, Dad«, sagte Gus (Sohn Nummer zwei), als ich mich anschickte, den Auftritt zu beschreiben, und sein älterer Bruder Nat sagte: »Definitiv. Jede Menge Raum für Peinlichkeiten dort.«
»Einverstanden«, sagte ich. »Aber es war nicht peinlich. Eliza war es nicht peinlich. Und ich kann’s beweisen. Hört zu.«
Die Aula der Schule war ein nahe gelegenes, vielleicht sogar angrenzendes Gotteshaus – eine echte (protestantische) Kirche mit poliertem Hartholz und Buntglas. Ich stand auf der Kanzel und blickte in eine große Gemeinde aus feuchten jungen Gesichtern (ich glaube, alle Neuntklässler hatten Anwesenheitspflicht); auf diesen Gesichtern lag eine gewisse »empfindsame Erwartung« (wie Lawrence es auf den ersten Seiten von Liebende Frauen über Gudrun und Ursula sagt), als ich das Mikrofon antippte, sie begrüßte, mich vorstellte und fragte: »Also, wie viele von euch haben schon einmal daran gedacht, Schriftsteller oder Schriftstellerin zu werden?« Und die Anzahl der Hände, die hochgingen, verrate ich gleich. Ich fuhr fort:
»Nun ist es ja so, dass gerade ihr ziemlich genau wisst, wie es ist – Schriftsteller zu sein. Ihr steht am Anfang oder in der Mitte eurer Teenagerjahre. Genau das Alter, in dem man eine neue Stufe der Selbstwahrnehmung erreicht. Oder eine neue des Umgangs mit sich selbst. Als würdet ihr eine Stimme hören, die ihr seid, die aber nicht wie ihr klingt. Nicht ganz – es ist nicht die gewohnte, sie klingt artikulierter und feiner, nachdenklicher und auch spielerischer, kritischer (und selbstkritischer), aber auch großzügiger und nachsichtiger. Ihr mögt diese fortgeschrittene Stimme, und um sie zu bewahren, schreibt ihr auf einmal Gedichte, führt vielleicht ein Tagebuch, schreibt ein Notizbuch voll. In willkommener Einsamkeit sinniert ihr über eure Gedanken und Gefühle, manchmal auch über die Gedanken und Gefühle anderer. In der Einsamkeit.
Das ist das Leben des Schriftstellers. Die Ambition beginnt jetzt, mit etwa fünfzehn, und falls ihr Schriftsteller werdet, verändert sich euer Leben nicht mehr groß. Ich mache es noch immer, ein halbes Jahrhundert später, tagaus, tagein. Schriftsteller sind stehengebliebene Heranwachsende, aber zufrieden stehengebliebene; sie genießen ihren Hausarrest … Euch erscheint die Welt merkwürdig: die Erwachsenenwelt, die ihr jetzt betrachtet, zwangsläufig mit Bangen, aber noch aus halbwegs sicherer Entfernung. Wie die Geschichten, die Othello Desdemona erzählt, die Geschichten, die ihr Herz eroberten, erscheint die Erwachsenenwelt als ›seltsam! Wundersam‹, aber auch ›rührend, unendlich rührend‹. Von dieser Prämisse entfernt sich ein Schriftsteller nicht mehr. Vergesst nicht: Als Jugendlicher ist man noch ein Kind, und ein Kind sieht Dinge voraussetzungslos und noch nicht abgesichert durch Erfahrung.«
Zum Ende hin deutete ich an, dass Literatur sich im Wesentlichen mit Liebe und mit Tod beschäftigt. Weiter führte ich es nicht aus. Was weiß man mit fünfzehn schon von Liebe, von erotischer Liebe? Was weiß man mit fünfzehn vom Tod? Man weiß, dass er Wüstenspringmäusen und Wellensittichen widerfährt, vielleicht weiß man schon, dass er älteren Verwandten widerfährt, darunter auch den Eltern der Eltern. Aber man weiß noch nicht, dass er auch einem selbst widerfahren wird, das weiß man erst dreißig Jahre später. Und erst weitere dreißig Jahre danach steht man auch persönlich vor dem wirklich heftigen Problem, erst dann ist man gefordert, die schwierigste Haltung einzunehmen …
»Und woher willst du wissen«, fragte Nat schließlich, »dass es Eliza nicht peinlich war?«
»Genau, Dad«, fragte Gus, »wie willst du das beweisen?«
Ich sagte: »Weil Eliza, als es zu den Fragen kam, nicht als Erste redete, aber auch nicht als Letzte. Sie hat geredet, klar und vernünftig … Also hat sie mich nicht verleugnet. Sie hat mich anerkannt, kann ich voller Stolz sagen. Sie hat mich, kann ich voller Stolz sagen, als den Ihren angenommen.«
Oh, und als ich meine Zuhörer fragte, wie viele je daran gedacht hätten, Schriftsteller zu werden? Welcher Anteil hob die Hand? Mindestens zwei Drittel. Was zum ersten Mal überhaupt in mir den Verdacht weckte, dass der Drang zu schreiben nahezu universell ist. Was er doch wohl ist, meinen Sie nicht? Wie sonst soll man überhaupt mit dem Umstand der eigenen Existenz auf Erden zurechtkommen?
Nun sind Sie ein genauer Leser, und Sie sind noch sehr jung. Das allein würde bedeuten, dass auch Sie bereits daran gedacht haben, Schriftsteller zu sein. Und vielleicht arbeiten Sie ja schon an etwas? Das ist ein sensibles Thema, und das soll auch so sein. Besonders bei Romanen, weil man sich darin als derjenige entblößt, der man wirklich ist. Bei keiner anderen schriftlichen Form ist das so, nicht einmal bei Gesammelten Gedichten und schon gar nicht bei einer Autobiografie oder auch nur impressionistischen Erinnerungen wie Nabokovs Erinnerung, sprich. Wenn Sie meine Romane lesen, wissen Sie schon absolut alles über mich. Daher ist dieses Buch nur eine weitere Fortsetzung, und Ausführlichkeit ist häufig willkommen …
Mein Vater Kingsley hatte eine hübsche Einleitungsformel für empfindliche Themen. Sie lautete: »Sprich so viel darüber, wie du magst, oder so wenig, wie du magst.« Sehr zivilisiert das, und ja, sehr sensibel. Vielleicht möchten Sie über Ihren Kram sprechen, vielleicht auch nicht. Aber Sie brauchen dabei nicht schüchtern zu sein. Sie haben in Ihrer bemerkenswert prägnanten Anmerkung gesagt: Ich will nicht, dass das von mir handelt. Tja, auch ich will nicht, dass das von mir handelt, aber das ist eben meine Aufgabe.
In jedem Fall gebe ich Ihnen ein paar gute Tipps zur Technik – zum Beispiel, wie man einen Satz verfasst, der das Ohr des Lesers erfreut. Aber nehmen Sie auch Ratschläge übers Schreiben, die ich Ihnen gebe, nicht allzu ernst. Nehmen Sie keine Ratschläge übers Schreiben sehr ernst. Das erwartet man von Ihnen. Schriftsteller müssen ihren eigenen Weg zu ihrer Stimme finden.
Ich habe mich an diesem Buch schon einmal vor über zehn Jahren versucht. Und bin gescheitert. Damals trug es den vorläufigen und anmaßenden Titel Life (und den neckischen Untertitel A Novel). An einem Wochenende in Uruguay im Jahr 2005 zwang ich mich dazu, das Ganze vom ersten bis zum letzten Wort zu lesen: Es waren rund 100 000. Und danach war Life tot.
Dass ich offenbar rund dreißig Monate vergeudet hatte (dreißig Monate, in denen ich mich auf einem matschigen Friedhof abplackte), war noch das Wenigste. Ich dachte, ich sei am Ende. Wirklich. Wie zur Bestätigung dessen – das war in Uruguay, in dem Dorf José Ignacio im Norden nahe Maldonado, unweit der brasilianischen Grenze – ging ich ans Meer und setzte mich mit meinem Notizbuch auf einen Stein, wie ich es recht häufig tat: der heranbrandende Südatlantik, die Felsbrocken von der Größe und Form schlummernder Dinosaurier, der Leuchtturm massig vor dem Babyblau des Himmels. Und schrieb keine Silbe. Die Szene löste nichts in mir aus. Ich dachte, ich sei am Ende.
Eine schrecklich unvertraute Situation, eine Art Anti-Inspiration. Kommt einem ein Roman, entsteht das vertraute, aber immer wieder überraschende Gefühl einer Wärmeinfusion; man fühlt sich gesegnet, gekräftigt und herrlich bestätigt. Nun aber lief der Strom in die andere Richtung. Etwas in mir schien reduziert, es wich zurück – mit der Hand am Mund zum Adieu …
Natürlich gestand ich Elena das Ableben von Life: A Novel. Niemandem aber gestand ich ein, dass ich am Ende war. Und das war ich auch nicht. Ich konnte eben nur nicht Life schreiben. Trotzdem. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen – das Wegbranden der Essenz. Schriftsteller sterben zweimal. Und dort am Strand dachte ich: Ah, jetzt kommt er. Der erste Tod.
Jeden Moment werde ich Ihnen nun von einer perversen Geistesperiode erzählen, die ich in den frühen mittleren Jahren durchlief. Und ich frage mich oft, ob sie viel mit diesem Nadir oder Wendepunkt am Strand, diesem schwindelerregenden Absturz des Glaubens an mich selbst zu tun hatte. Ich glaube nicht. Denn die Perversion ging ihr ja voraus und hielt darüber hinaus an. Ja, aber solche Dinge lassen sich mit dem Kommen und auch mit dem Gehen Zeit.
Mein ältestes Kind Bobbie. Ich lernte sie erst kennen, als sie neunzehn war. Da war sie schon in Oxford (und studierte Geschichte).
»Ja, so packt man das an«, sagte mein Kumpel Salman (oh, und ich entschuldige mich gleich im Voraus für dieses ganze Namedropping. Sie gewöhnen sich schon noch dran. Auch ich musste es. Und außerdem ist es gar keins. Es ist keines, wenn man mit fünf »Dad« sagt). »Man lernt sie erst kennen«, sagte Salman, »wenn sie schon in Oxford sind.«
Eine hübsche Bemerkung, aber so läuft das nicht, wie uns beiden klar war. Und ich bedaure oft, manchmal unangenehm heftig, dass ich Bobbie nicht als Säugling, Kleinkind, Kind, Fast-Jugendliche und Jugendliche gekannt habe. Aber so ist es nun mal. Über sie wird hier nur wenig stehen: Sie war schon die Hauptfigur in einem Buch, das ich nach dem Tod meines Vaters 1995 schrieb, und jetzt ist sie einen ganzen Ozean weit weg …
Ich habe also zwei Jungs mit großgezogen und auch zwei Mädchen. Ich kenne mich mit Jungs aus und auch mit Mädchen; worin ich mich nicht so gut auskenne: wie sie miteinander zurechtkommen. Vor wenigen Jahren hat Bobbie mir, wie es so heißt, zwei Enkel »geschenkt«, einen perfekten Jungen und ein perfektes Mädchen. Also lerne ich vielleicht doch etwas darüber – mit dem Abstand einer Generation, durchs falsche Ende des Teleskops.
Andererseits wuchs ich als Mittelkind auf: mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester. Nicolas war und ist ein Jahr und zehn Tage älter als ich (mein irischer Zwilling). Aber Myfanwy (Míwennwie ausgesprochen), vier Jahre jünger als ich, starb im Jahr 2000. Auch dieses Ereignis hatte eine lange Vorgeschichte und lange Nachwehen.
Ein Wort zu dem unnatürlichen Interesse, das ich zunehmend am Suizid zeigte – nämlich meine ausgedehnte Periode der gemeinhin »Suizidalität« genannten Vorstellungen.
Sie begann offiziell am 12. September 2001. Es war keine Reaktion auf die selbstmörderischen Ereignisse des Vortags (auch wenn mich das vermutlich ungewöhnlich durchlässig und dünnhäutig gemacht hatte). Wer mich umhaute, war nicht Osama bin Laden. Sondern eine Ex-Freundin, eine Frau namens Phoebe Phelps (und Phoebe wird nicht zulassen, dass sie viel länger unerwähnt bleibt).
… Der Dichter Craig Raine sagte von Elias Canetti, er habe bezüglich Menschenmassen »einen ganzen Schwarm Flöhe« im Ohr gehabt (sein bekanntestes Buch trug den Titel Masse und Macht). Ach, hier wäre noch ein Stück interessanter Klatsch: Canetti, der Nobelpreis-gekrönte Dichter, war ein Liebhaber der jungen Iris Murdoch (und man rätselt über die Art ihres Bettgeflüsters). Phoebe Phelps hatte mir einen Floh ins Ohr gesetzt – aber es fühlte sich an wie ein ganzer Schwarm.
Sie werden’s nicht glauben, aber für Männer ist Sechzigwerden eine große Erleichterung. Zunächst einmal eine große, weil man die Fünfziger hinter sich hat. Von den sieben Dekaden: die Dreißiger sind der Prinz, die Fünfziger der Arme. Ich nahm an, meine Sechziger unterschieden sich von meinen Fünfzigern nur insofern, als sie noch viel schlimmer wären, doch finde ich das Gefälle unerwartet sanft; vielmehr ist es mir peinlich zu sagen, dass ich nur in der Kindheit glücklicher war. Gut, man muss sich mit einem unangenehmen neuen Gedanken befassen, nämlich: Sechzig … Mm. Das kann ja doch unmöglich gut enden. Doch selbst dieser Gedanke ist besser als fast alle, die man in den Fünfzigern hatte (einer Epoche, auf die ich noch schmerzlich zurückkomme).
In jüngerer Zeit frage ich mich: Wie genau komme ich hier raus? Auf welche Weise, mit welchem Beförderungsmittel? Nicht dass ich besonders darauf erpicht bin, tot zu sein (nicht einmal auf dem Höhepunkt meiner Suizidalitätsphase war ich erpicht darauf, tot zu sein). Man spürt einfach, dass der Ausgang näher rückt – und man (in der würdevollen Wendung eines amerikanischen Schriftstellers, dem wir schon sehr bald begegnen werden) zur »Vollendung der eigenen Realität« hingezogen wird.
Und mit lachhafter Eile näher rückt. Eigentlich kommt man sich jedes Mal zunehmend ein bisschen wie geprellt vor, wenn man die Augen aufschlägt und aufsteht. Die psychische Uhr (darüber wurde schon geschrieben) beschleunigt sich eindeutig … Nachdem ich sechzig geworden war, hatte ich zweimal jährlich Geburtstag, dann dreimal. Die Atlantic Monthly kam zunehmend halbmonatlich, und jetzt ist sie die Atlantic Weekly. Seit Kurzem rasiere ich mich täglich oder meine es jedenfalls (und ich rasiere mich nachweislich nicht täglich). In der New York Times schrieb der Kolumnist Thomas L. Friedman nur jeden Mittwoch, jetzt schreibt er aber ein Stück alle vierundzwanzig Stunden (und folgt damit dem Beispiel Gail Collins’ und Paul Krugmans), und wenn’s ganz schlimm ist, widme ich mich diesen Autoren alle Dreiviertelstunde bei einem gemütlichen Frühstück (Obst, Flakes, weich gekochtes Ei).
Man kommt sich blöd und idiotisch vor, weil es irgendwie so aussieht, als strebe man dem eigenen Ableben entgegen. Ein gewisser Dichter, der ebenfalls in Kürze erscheinen wird, hat es in »Aubade« (Aubade – ein Gedicht oder Musikstück, passend zum Morgengrauen) düsterer formuliert:
Vorhangsränder, die sich bald in Helligkeit eintunken.
Und sehe dann, was immer dort schon harrt,
leibhaftig, rastlos: Tod, und näher jetzt um einen vollen Tag.
Die Zeit fühlt sich nun an wie ein führerloser Zug, der durch Bahnhof um Bahnhof rast. Doch damals, als ich auf Bäume kletterte, Rugby spielte und mit den Mädchen auf dem Schulhof gelegentlich Himmel und Hölle spielte (alle drei Aktivitäten erscheinen mir heute als erschreckend gefährlich) –, fuhr der führerlose Zug auch nicht langsamer. Nabokov nennt sogar die Geschwindigkeit: 5000 Herzschläge pro Stunde. Das Leben rennt dem Tod mit 5000 hs/h entgegen.
Sie müssen davon wissen – und es muss Sie gereizt haben: das riesige Sub-Genre »Life Writing«, wie man das heute nennt. Es umgreift alles von Proust bis zu Kontaktanzeigen, von Söhne und Liebhaber bis zum Reisestück, von Wirkt mein Hintern darin dick? bis … ich wollte schon Mystic Megs Astrologiekolumne sagen, aber immerhin hat sich Mystic Meg die Mühe gemacht, alles zu erfinden.
In gewisser Weise reizt mich die Herausforderung, aber für einen Schriftsteller ist das Dumme am Life Writing, dass das Leben eine gewisse Qualität oder Eigenschaft hat, die der Literatur gänzlich entgegensteht. Es ist formlos, es verweist auf nichts und versammelt sich um nichts, es ist nicht kohärent. In künstlerischer Hinsicht ist es tot. Das Leben ist tot.
Aber eben nur in künstlerischer Hinsicht. In sachlicher, realistischer und materieller ist das Leben natürlich hellwach und strotzt vor Energie, und alles spricht dafür. Doch dann geht das Leben zu Ende, während die Kunst mindestens noch ein Weilchen länger überdauert.
Sorgen Sie sich wegen des Great Pretenders? Ich meine diesen spitzenmäßigen Bingo-Conférencier, der bei den Republikanern die Poleposition einnimmt? Alle paar Jahre verspüren sie den Drang, einen Ignoranten zu valorisieren (vielleicht erinnern Sie sich noch an Joe den Klempner). Sie mögen es, dass ihr neuer Champion, dieser Schieber von Beefsteaks und falschen Diplomen, weder über Erfahrung noch Qualifikationen verfügt; falls er siegt, wird das allererste politische Amt, das er innehat, die Führung der freien Welt sein. Bis vor Kurzem war er nichts als ein halbwegs guter makabrer Scherz. Aber leider werden wir noch eine Weile länger ein schmerzerfülltes und feuchtes Auge auf ihn haben müssen.
Nur einmal habe ich Trump leibhaftig gesehen, vor rund fünfzehn Jahren war das, und Elena und ich hatten eine hervorragende Sicht auf ihn. Es war auf einem winzigen Flugplatz auf Long Island. Er schritt sehr langsam vom Flugzeug (nicht seinem Flugzeug, nur irgendeinem Propeller-Shuttle) zum Wagen, in respektvollem Abstand gefolgt von zwei Schönheitsköniginnen mit Schärpen: Miss USA und Miss Universe. Er wirkte unter Druck und still leidend; die Limousine stand lästig weit weg, und der Flachlandwind veranstaltete mit seiner Frisur einen Tag beim Rennen.
Wie gesagt, damals in Uruguay konnte ich den Roman nicht schreiben, jetzt aber schon, glaube ich – weil die drei Hauptfiguren, die drei Schreiber (ein Dichter, ein Romancier und ein Essayist) allesamt tot sind. Der Dichter starb 1985, der Romancier 2005 und der Essayist 2011. Der Essayist war mein engster und längster Freund und genau mein Altersgenosse. Was mir sein Tod auch sonst zufügte und für mich leistete (eine ganze Menge), er gab mir mein Thema und bedeutete zudem, dass Life sich seinen Untertitel verdienen konnte. Es gab mehr Manövriermasse, mehr Freiheit, und Literatur ist Freiheit. Life war tot. Künstlerisch ist das Leben tot. Der Tod wiederum ist, so gesehen, sehr lebendig.
Ich zeige Ihnen gleich Ihr Zimmer. Vielmehr Ihre Etage. Dieses Haus hat einmal aus getrennten Wohnungen bestanden. Auf jedem Treppenabsatz ist eine dicke Tür mit einem klotzigen Schloss und einem Spion – sie trennt den privaten Raum vom öffentlichen. Bei uns hier nennen wir Ihre Etage »Thugz Mansion«, mit Zett. Oder einfach Thugz. Sie erhielt ihren Namen, als Nat und Gus da waren. Wenn Sie wollen, können Sie ihn ändern, aber er steht unter Ihrer Klingel am Eingang – Thugz. Also sagen Sie etwaigen Besuchern Bescheid.
Wir essen in ungefähr einer halben Stunde, Sie haben also Zeit, sich zu waschen, sich hinzulegen, auszupacken oder einfach sich zu orientieren. Thugz besteht aus einem Schlafzimmer mit einem Alkoven als Arbeitsnische, einem Wohnzimmer und einer Küche. Und zwei Bädern. Ja, zwei. In Cambridge, England, habe ich in einem Haus mit acht Zimmern und einem (beengten) Badezimmer direkt überm Boiler im Erdgeschoss gewohnt. Aber hier sind wir schließlich in den Vereinigten Staaten. Es wird einiges darüber zu sagen geben, wie es ist, hier zu leben, in diesem Land, Amerika.
Im Grunde ist das hier ein Frauenhaus: Zu den Mahlzeiten setze ich mich zu Elena, Eliza und Inez – und oft auch Betty (Schwiegermutter) und Isabelita (Nichte). Mein einziger Genosse und Kumpel, mein einziger Homeboy ist Spats, der Kater.
Da ist er auch schon. Ein ganz netter kleiner Kerl, wie Sie feststellen werden. Und außergewöhnlich hübsch, sagt Elena. Wenn ich ihr vorhalte, Spats zu verwöhnen, sagt sie: »Wenn man so gut aussieht, wird man auch verwöhnt.« Auf die Frage des Aussehens kommen wir noch zu sprechen: eine zutiefst rätselhafte und lästige menschliche Sphäre.
Da kommt er … Ist Ihnen schon aufgefallen, wie anspruchsberechtigt Katzen wirken? Anspruchsberechtigt und unverfroren eigenständig. Das ist der Hauptunterschied zwischen Katzen und Hunden. Das und dass Katzen leise sind.
Oh, vielen Dank, Spats!
Das hat er jetzt ziemlich witzig getimt, finden Sie nicht? Ja, Spats, das hast du. Er wird Sie nicht groß stören. Sollten Sie hier unten sein, und wir sind alle sonst wo, und er maunzt, dann will er entweder rausgelassen werden oder … Ich zeige Ihnen, wo sein Trockenfutter und die Dosen stehen – die Fancy Feasts. Und Sie werden so froh wie ich darüber sein, dass er zum Scheißen in den Garten geht.
Er ist bald wieder weg, Spats. Er zieht sich in die Hamptons zurück, wo er Familie hat. Auch Elena hat dort Familie – eine Mutter, eine Schwester und (manchmal) einen Bruder … Und nun hoffe ich, dass Sie Ihren Aufenthalt hier nicht völlig unanregend finden. Sie und ich, wir werden unsere Gespräche haben, und Sie sind bei Tisch stets sehr willkommen, aber ansonsten nehmen Sie es als das, was es ist – ein Wohnblock. Zu dem Sie Ihre eigenen Schlüssel haben.
Diese Endfassung wird übrigens unglaublich lange Zeit dauern – mindestens zwei Jahre, schätze ich. Sehen Sie, anders als Gedichte sind Romane grenzenlos, ja endlos verbesserbar. Man kann sie nicht abschließen, man kann sie nur hinter sich lassen … Einstweilen wird es also an den meisten Nachmittagen ein, zwei Stunden »Buchgeplauder« geben, wie Gore Vidal es nannte, bis Sie in Ihre eigene Wohnung ziehen. Und dann werden Sie auch lange Zeiten weg sein, ich ebenso. Viel davon wird per Mail gehen. Wir sehen einfach mal, wie’s läuft.
Das Buch handelt von einem Leben, dem meinen, es wird sich also nicht wie ein Roman lesen – eher wie eine Ansammlung miteinander verbundener Kurzgeschichten mit essayistischen Abstechern. Idealerweise sollte Inside Story sprunghaft und anfallartig, mit viel Überblättern, Aufschieben und Zurückblättern gelesen werden – und natürlich mit vielen Denk- und Atempausen. Jetzt schon leid tun mir die armen Hunde, die Profis (Lektoren und Rezensenten), die das ganze Ding in einem Rutsch durchlesen müssen, und das auch noch gegen die Uhr. Das muss ich natürlich auch, irgendwann 2018 oder eventuell 2019 – mein letzter Durchgang, bevor ich dann SENDEN drücke.
Bis dahin genießen Sie New York. Und noch einmal – willkommen im Strong Place!
Und jetzt nehmen Sie Ihr Glas und ich Ihren Koffer.
Das ist keine Last. Es gibt einen Aufzug … Ach, keine Ursache – de nada. Die Ehre ist ganz meinerseits. Sie sind mein Gast. Sie sind mein Leser.
I. TEIL
1. Kapitel
Ethik und Moral
Könnten Sie mich zu Saul Bellow durchstellen?
Die Zeit war Sommer 1983, der Ort West London.
»Durrants?«, sagte der Mann am Empfang.
Ich räusperte mich – das dauerte nicht nur einen Augenblick – und sagte: »Entschuldigen Sie. Äh, hi. Könnten Sie mich bitte zu Saul Bellow durchstellen?«
»Selbstverständlich. Wen darf ich melden?
»Martin Amis«, sagte ich. »Also Ei Emm I Ess.«
Lange Pause, kurz zurück zur Zentrale, dann das unverwechselbare »Hallo?«.
»Saul, guten Tag, ich bin’s, Martin. Haben Sie vielleicht kurz Zeit?«
»Oh, hallo Marr-tin.«
Martin versuchte sich einmal in den sehr frühen mittleren Jahren aus irgendeinem Grund an einer polemischen Arbeit mit dem Titel Die Kack-Generation.1 Es sollte Non-Fiction und in kurze Abschnitte eingeteilt sein, darunter »Kack-Musik«, »Kack-Slang«, »Kack-TV«, »Kack-Ideologie«, »Kack-Kritiker«, »Kack-Historiker«, »Kack-Soziologen«, »Kack-Klamotten«, »Kack-Hautritzungen« – einschließlich Kack-Piercings und Kack-Tätowierungen – und »Kack-Namen«. Tja, und Martin fand, dass »Martin« auch ein richtiger Kack-Name war. Er schaffte es nicht mal in einem Stück über den Atlantik. Gut, heutzutage nannten ihn die meisten Amerikaner ganz natürlich und entspannt Marrtn. Die in Sauls Alter jedoch, die es vielleicht nötig fanden, sein Englischsein zu würdigen, kamen auf einen zögerlichen Spondeus: Marr-tin. In Uruguay (wo »Martin« MarrrTIEN war, ein volltönender, männlicher Jambus), hatte Martin einen attraktiven Freund namens Cecil (wohltönend SeiCIEL ausgesprochen). Und auch »Cecil« schaffte die Durchquerung des Rio Grande nicht intakt und wurde zu einem lächerlichen Trochäus. »Mann, in Amerika«, sagte Cecil, »nennen sie mich CIEsl. Beschissen.« Am Telefon sagte Martin zu Saul Bellow aber nicht »Marr-tin? Beschissen.« Dabei sollten wir aber auch das einräumen: »Martin« im guten alten Englisch war ebenfalls nicht so toll. Es war bloß ein Kack-Name.
Ich sagte zu Saul: »Hm, wissen Sie noch, die Sonntagszeitung, in der ich letztes Jahr was über Sie geschrieben habe?« Es war der Observer. »Die haben mir großzügigerweise gesagt, ich könne Sie zum Essen einladen, wo ich will. Könnten Sie das irgendwie einrichten?«
»Ach, ich glaube schon.«
Bellows Stimme: Die hatte er dem verträumten, wohlhabenden, aber irgendwie gehemmten und innerlichen Erzähler jener spektakulären neunzig Seiten langen Erzählung »Vettern und Kusinen« geliehen. Er sagte, … dass meine Stimme mit zunehmenden Jahren tiefer geworden sei. Ja. Mein basso profundo diente lediglich dazu, kleinen Höflichkeiten mehr Tiefe zu verleihen. Wenn ich bei einer Abendgesellschaft einer Dame einen Stuhl zurechtrücke, dann wird sie von einem tiefen Laut umfangen. Dergestalt umhüllt, sagte ich:
»Zufällig weiß ich, dass Sie ein gutes Stück Fisch mögen.«
»Das stimmt. Es zu leugnen wäre müßig. Ich habe eine Schwäche für ein gutes Stück Fisch.«
»Also, dieses Lokal ist auf Fisch spezialisiert. Vielleicht gibt’s da sogar nur Fisch. Und es ist bei Ihnen in der Nähe. Haben Sie was zu schreiben? Devonshire Street. Odin’s – wie der nordische Gott.«
»Odin’s.«
Ich sagte: »Hätten Sie was dagegen, wenn ich meine ernste Freundin mitbringe?«
»Das wäre wunderbar. Ihre ernste Freundin – meinen Sie, sie ist ernst oder mit euch ist es ernst?«
»Wahrscheinlich beides.« Das war das Entscheidende: Wir waren beide ernst. »Sie ist Amerikanerin – Boston –, aber das würden Sie nicht merken.«
»Anglisiert.«
»Eher europäisiert. Amerikanische Eltern, aber in Paris geboren und in Italien aufgewachsen. Erwachsen dann in England. Sie hat einen englischen Akzent. Sie ist derart abwesend, dass sie ihr nicht mal einen amerikanischen Pass geben.«
»Nicht?«
»Nein. Es sei denn, sie verbringt ein halbes Jahr in einer Armeekaserne in Deutschland, keine Ahnung. Die geben ihr erst einen, sagt sie, wenn sie genug GIs gevögelt hat.«
»Na, sehr ernst scheint sie ja nicht zu sein.«
»Ist sie auch nicht. Sie ist genau richtig. Sie heißt Julia. Möchten Sie auch jemanden mitbringen?«
»Meine liebe Frau Alexandra ist in Chicago, also nein, ich komme allein.«
Der amerikanische Adler
Martin war im Dezember 1982 nach Chicago geflogen, um den Mann zu interviewen, den sogar John Updike – ein ungewöhnlich großzügiger Kritiker, aber auch ungewöhnlich knauserig, ungewöhnlich kleinlich, wenn er einen ihm offensichtlich überlegenen Lebenden vor sich hatte – als unseren überschwänglichsten und melodischsten Nachkriegsromancier2 lobte. Wie sich zeigen sollte, hing von diesem Treffen viel ab.
Ich checkte in meinem Hotel ein: groß und billig und nach den Standards des Mittleren Westens unfassbar alt (es war ein Quality Inn geworden, aber die älteren Einheimischen nannten es weiterhin das Oxford House), Innenstadt, zwischen IBM Building und der El, in Chicago, das »Verachtungszentrum« der USA, wie Bellow es nannte. Ich war in Hochstimmung, einem Zustand evolutionärer Erregung – weil mein Leben sich verändern sollte, so tiefgreifend, wie ein junges Leben es nur kann3 … Am nächsten Morgen frühstückte ich zeitig, duschte, warf mich für unseren Lunch in Schale und trat sodann kühn hinaus in die Windy City. Lachhafterweise so genannt übrigens wegen ihres Rufs für Großsprecherei und »heiße Luft« – nicht deshalb, weil die Stadt tatsächlich ungeheuer windig war und ist und eisige Böen (genannt »the Hawk – der Habicht«) vom Lake Michigan hereinpfeifen …
Bellow war achtundsechzig, ich vierunddreißig, genau halb so alt wie er (ein Zusammentreffen, das sich so natürlich nicht wiederholte). Aber ich war bei der Abfertigung amerikanischer Schriftsteller ja schon ein alter Hase, nachdem ich über Gore Vidal, Kurt Vonnegut, Truman Capote, Joseph Heller und Norman Mailer geschrieben hatte. Trotzdem, jetzt war es anders: Als ich 1975 meinen ersten Bellow las, Das Opfer (1947), dachte ich: Der schreibt nur für mich. Also habe ich alles von ihm gelesen.
Als der einzige andere Schriftsteller, der das tat – bei der Abfassung jedes Satzes an mich denken –, erwies sich Nabokov. (Noch eins hatten er und Bellow gemein: Beider Wurzeln liegen in Sankt Petersburg.) In meinem unmittelbaren Umfeld gab es keine überzeugten Nabokovianer, mit denen ich jauchzen und jubeln konnte. Aber ganz in meiner Nähe gab es einen überzeugten Bellowianer; damals war er noch Journalist und »kometenhafter Trotzkist« und noch nicht der vielgeliebte Essayist, Memoirenschreiber und blasphemische Polemiker, der er einmal sein würde. Ich meine Christopher Hitchens. Christopher Hitchens hatte 1981 England verlassen und lebte nun in »the projects« – »in der Sozialwohnsiedlung« – in Washington DC, wie er sie stolz und liebevoll nannte …
Um halb eins verließ ich also das Oxford House und lief zum Chicago Arts Club. Innerlich skizzierte ich für den Artikel, den ich bald schreiben würde, schon ein paar vorläufige Passagen, wovon eine wie folgt lautete (wobei ich weiß, es zeugt von sehr schlechtem Stil, sich selbst zu zitieren, und es kommt auch nicht wieder vor4):
Über Schriftsteller zu schreiben ist ambivalenter, als das Endprodukt es üblicherweise einräumt. Als Fan und Leser will man, dass der Held wahrhaft inspiriert. Als Journalist hofft man auf Verrücktheiten, Trotz, bedauerliche Indiskretionen, einen ausgewachsenen Zusammenbruch mitten im Interview. Und als Mensch ersehnt man sich den Beginn einer schmeichelhaften Freundschaft.
Also drei Wünsche. Der erste ging in Erfüllung. Ebenso der dritte – aber noch nicht, noch nicht. Das kam erst 1987 in Israel, und dessen Erfüllung war der vermittelnden Figur von Bellows fünfter und letzter Frau zu verdanken, Rosamund. Letztlich hat sie mich mit Saul Bellow verbunden.5
Am Telefon hatte er mir fröhlich gesagt, er sei »an gewissen Anzeichen des Verfalls zu erkennen«. Tatsächlich aber wirkte er empörend fit – er sah aus wie der Amerikanische Adler. Und als er anfing zu reden, überfiel mich ein Höhenschwindel, und ich dachte an die Beschreibung von Caligula, dem Adler in Die Abenteuer des Augie March (1953):
[Er] hatte eine Natur, die den Triumph spürte, sich in die höchsten Höhen durchzuschlagen, die Fleisch und Blut erreichen konnten. Und das aus eigenem Willen, nicht wie andere Lebensformen in dieser Höhe, die Sporen und Fallschirmsamen, die dort nicht als Individuen waren, sondern als Boten ihrer Art.
Sie hören deine Medaillen klirren
Aber wir wollen doch im Rahmen und im Kontext bleiben: schön der Reihe nach. Meine Figur sollte sich schicksalhaft offenbaren, ich schritt voran zu einer weiteren und höheren Phase der Anpassung an die Erwachsenenwelt, ich stand im Begriff zu heiraten, und nicht nur das …
Und vorerst war das alles geheim. Vorgeblich noch eine Freundschaft (unsere Mütter waren schließlich Expat-Nachbarinnen im spanischen Ronda, und wir kannten uns schon einige Jahre), blieb unsere Affäre erst mal inoffiziell. Unter Androhung des Todes war mir untersagt, jemandem davon zu erzählen, also erzählte ich es nur Hitch.
»Julia und ich haben eine Affäre«, sagte ich.
»… Ich bin überglücklich, das zu hören. Ich ahnte allerdings schon so etwas. Komm mit ihr zu mir zum Essen. Nur wir vier. Keine Sorge, ich verrate nicht, dass ich es weiß. Heute Abend.«
Es geschah, und es war ein Bombenerfolg.
»Hitch«, sagte ich, als er und ich kurz allein waren (die Frauen waren auf die Portobello Road gegangen – es war das Wochenende des Karnevals in Notting Hill). »Ich glaube, die Suche ist zu Ende. Ich glaube, sie ist die … Ich glaube, sie ist die andere Hälfte.«
»Oh, zweifellos. Binde sie mit Stahlbändern an dich, Klein Keith. Sehr klug, sehr attraktiv und«, sagte er (das war das Entscheidende), »und eine Terroristin.«
Auch Christopher stand im Begriff, eine Terroristin zu heiraten, die feurige griechisch-zypriotische Anwältin Eleni Meleagrou … Für Christopher bedeutete eine Terroristin eine Frau mit einer starken Persönlichkeit – stark genug, um Furcht einzuflößen (einmal erregt, wurden Terroristinnen unwiderstehlich), und Anfang der 1980er gab es davon noch nicht allzu viele, da sich die sexuelle Revolution erst im zweiten Jahrzehnt befand. Ich sagte:
»Also, Eleni ist eindeutig eine Terroristin. Und ja, Julia wohl auch.«
»Die besten sind immer welche.«
»Sie sind selbstredend Feministinnen, aber nicht mal die sind alle Terroristinnen. Vielmehr, nicht alle Feministinnen sind Terroristinnen. Gott. Ich will doch nur sagen, es ist nicht dasselbe.«
»Nein, noch nicht. Gehen wir auch runter. Nimm dein Glas mit.«
Und dann tanzten wir vier zum Reggae in der Golborne Road wie in einem urbanen Fruchtbarkeitsritus, die Jungs schlurfend (und betrunken), die Mädels mit Hingabe und Verve, schleuderten die Hände immer wieder anmutig nach hinten über den Kopf …
Martin flog nach Chicago, »riesig, schmutzig, brillant und mies«, in den Worten seines Schutzgeists (und die einzige amerikanische Stadt, die, wie eine Terroristin, Angst machte und stolz darauf war, mit jenen unterirdischen Metallschütten bei der Einfahrt, wie ein Liefersystem in die urbane Zukunft). Doch Chicago ließ ihn ein und auch wieder hinaus. Er flog zurück und gab seinen langen Artikel beim Observer ab. Wenig später führte er dann zufällig ein transatlantisches Gespräch mit Sauls Agentin Harriet Wasserman, die sagte:
»Ihr Artikel. Ich hab’s ihm am Telefon vorgelesen.«
»Am Telefon?« Der Artikel war über 4000 Wörter lang. »Das ganze Ding?«
»Das ganze. Und was glauben Sie, was er gesagt hat, als ich fertig war. Er hat gesagt: ›Lies es noch mal.‹«
1974 bestand die inoffizielle Shortlist für den Nobelpreis aus: Bellow, Nabokov und Graham Greene6. In jenem Jahr erhielten den Preis gemeinsam zwei Schweden von tiefer und dauerhafter Obskurität, Eyvind Johnson und Harry E. Martinson. Aber Saul erhielt ihn, anders als Greene und Nabokov, später tatsächlich, 1976. Da war er einundsechzig. Und der Nobel war mehr oder weniger der einzige Preis (oder die Auszeichnung, der Orden, Reichsapfel oder Gong), den er noch nicht hatte. Und dennoch saß er da, am Telefon, eine gute Stunde lang, und lauschte dem Lob.
Als Bellow dann also im Frühjahr 1984 nach London kam und ich zu der von George Weidenfeld gegebenen Willkommensparty ging, brachte ich sie bei ihm (indirekt) zur Sprache, die Empfänglichkeit des Schriftstellers für Lob und Tadel (hört das denn nie auf?). Wir waren auf dem Balkon und blickten aufs Embankment und die Themse, und Saul sagte:
»Das ist ein Berufslaster. Man kämpft dagegen an und will es nicht zugeben, aber nie ist man frei davon. Kennen Sie diese Geschichte? … Es war einmal ein Mädchen in einem Dorf, das war in allem sehr gut und gewann alle Medaillen. Sie war von Kopf bis Fuß mit Medaillen behängt. Da kam ein Wolf ins Dorf, und die Kinder rannten alle zitternd fort und versteckten sich und verhielten sich so still sie konnten. Doch der Wolf fand das kleine Mädchen und fraß es auf. Denn er hatte es gehört. Er hatte seine Medaillen klirren hören.
Das passiert, wenn man alles gewonnen hat und sich einbildet, endlich in Sicherheit zu sein. Tatsächlich aber ist man verletzlicher denn je. Sie hören die Medaillen klirren.«
Cocktails im Odin’s
Ich redete ständig von Bellow, daher war meine heimliche Verlobte halbwegs vorbereitet. Anders als die meisten meiner engen Freundinnen las Julia. Also las sie Der Regenkönig (sein untypischster Roman) und mochte ihn. Doch einige Tage später blickte sie von Seite 30 in Augie March auf und sagte:
»Passiert in dem Roman eigentlich was?«
»Also, der Titel spricht von seinen Abenteuern. Es gibt zwar keine richtige Handlung, aber eine Entwicklung.«
»Aha«, sagte sie. »Dann ist es also ein Quasselroman.«
»Ein Quasselroman?«
»Na ja. Dass er einfach so vor sich hin schreibt.«
Statt mich über den Quasselroman zu verbreiten, statt den Quasselroman zu verteidigen (als Weg zur Selbstbefreiung), sagte ich bloß:
»Was zählt, ist das Kaliber des Quasselromans. Egal. Ist dir das mit dem Essen recht?«
»Kümmere dich nicht um mich. Wahrscheinlich bin ich anfangs noch still. Tu so, als wär ich gar nicht da. Sprich mit Saul. Du brauchst dich um mich nicht zu kümmern.«
Der Chicagoer Arts Club hatte einen de Kooning, einen Braque und eine Zeichnung von Matisse aufzuweisen – »aber wie Sie sehen«, hatte Saul bemerkt, »es ist kein Kunstverein. Sondern nur ein exklusiver Grillroom für elegante Hausfrauen.« In ähnlicher Weise bekannte sich das Odin’s kokett zu dem Reiz (und den Kosten) der Hochkultur – es war praktisch tapeziert mit modernen Meistern, Lucian, Freud, Francis Bacon, David Hockney, Patrick Procktor. Vor dieser Kulisse hatten Julia und ich uns schon auf unseren Samtstühlen eingerichtet, als Saul Bellow zum Tisch geleitet wurde.
Ich sah ihn kommen. Fedora, karierter Anzug mit karminrotem Futter (nicht unbedingt grell, aber doch etwas bunt, wie die Engländer sagen); knapp unterdurchschnittlich groß (einmal klagte er, die Zeit habe ihn um mindestens fünf Zentimeter verkleinert), resolutes, schönes rundes Gesicht, eine stattliche Erscheinung. Ein halbes Jahrzehnt später sollte ich Saul bei Begrüßung und Abschied ganz selbstverständlich umarmen, wobei mir stets auffiel, wie kompakt Brust und Schultern waren: die Statur eines Schauermanns. Mit sieben hatte das Ghettokind von Montreal ein Jahr seines Lebens an Tuberkulose verloren; eine der vielen Veränderungen, die dies bei ihm bewirkte, war die Entschlossenheit, kräftig zu werden … 1984 war Bellow mitten in seiner dritten Ehe – oder war es die vierte? In Wahrheit studierte ich Sauls Privatleben nicht sehr aufmerksam (in literarischen Dingen war ich dafür viel zu ernst); nein, viel aufmerksamer studierte ich den Stil, den Ton, das Gewicht, die entkörperten Wörter.
Julia wurde vorgestellt und gebührend in eine tiefe Silbe gehüllt. Ein, zwei Minuten lang tauschten sie sich herzlich über den Regenkönig aus (»Ach, der hat Ihnen gefallen?«). Dann sagte ich:
»Wir haben schon Cocktails bestellt. Was möchten Sie?«
Und Saul überraschte – und erfreute – mich damit, dass er in einen Scotch einwilligte.
Während ich mich nach einem Kellner umschaute, sagte ich: »Der Besitzer ist heute Abend nicht da.« Ich meinte Peter Langan, den kontroversen irischen Gastronomen. »Es sei denn, er schläft unter einem Tisch hier. Er ist nämlich Kelte und das, was man einen Saufbold nennt. Aber trotzdem nett. Es heißt, er kann vor dem Lunch drei Flaschen Champagner leeren.«
Saul fragte: »Und wie oft bewerkstelligt Peter das?«
»Ach, täglich, glaube ich.«
Natürlich folgte darauf ein Gespräch über Trunkenheit und Trinker (wobei Saul die beiden Trinker beschrieb, die er am besten gekannt hatte, die Dichter Delmore Schwartz und John Berryman). Da hatte Saul noch nicht eine der großen Beobachtungen über Trunkenheit und Trinker formuliert (sie steht in der späten Erzählung »Damit du dich an mich erinnerst«): Für Trunksucht gab es gewisse Regeln, die zum Teil von den Trinkern selbst eingeführt worden waren. Sie beruhten auf der grundsätzlichen Behauptung, Bewusstsein sei etwas Schreckliches.7 Und dann gab es natürlich noch diese rätselhafte amerikanische Neigung, Schriftsteller und Selbstmord zu verknüpfen …
Ich sagte: »In Humboldts Vermächtnis steht ein Absatz. Den fand ich großartig und habe ihm auch sofort zugestimmt, aber so richtig verstehe ich ihn nicht. Vielleicht muss man dazu Amerikaner sein.«
»Mal sehen, ob ich ihn verstehe«, sagte Julia.
»Okay. Dann werden wir wissen, wie sehr du Amerikanerin bist und ob du einen Pass verdienst … Die Passage, Saul, in der du sagst, dass Amerika sich mit dem Selbstmord seiner Schriftsteller brüstet. Das Land ist stolz auf seine toten Dichter.8 Warum das? Weil sich die Amerikaner dabei potent fühlen?«
»Ja, genau. Ich hatte das Business-Amerika, das technologische Amerika gemeint.«
»Jemand hat geschrieben, man könne die amerikanischen Schriftsteller, die nicht am Alkohol gestorben sind, an zwei Händen abzählen. Er meinte wohl die heutigen, denn Hawthorne ist doch nicht am Alkohol gestorben, oder? Melville nicht. Whitman nicht.«
»Whitman gehörte der Abstinenzbewegung an. Mit Schwächeperioden.«
»Henry James auch nicht. Heutzutage sind es aber nur die Juden, die nicht am Alkohol sterben, da wette ich. Weil die überhaupt nicht trinken. Was sagt Herzogs Vater über seinen hoffnungslosen Untermieter? ›Ein jüdischer Trinker!‹ Das ist demnach ein Oxymoron. Nicht mal ihre Schriftsteller trinken.«
»Mit Ausnahmen wie Delmore. Frage ich mich. Roth trinkt kaum.«9
»Vielleicht erklärt das die Dominanz des jüdisch-amerikanischen Romans.«
»Ja. Wir haben nur in der Hängematte gelegen, bis die Luft rein war.«
Auch ich rätselte. »Heller trinkt ein bisschen. Mailer trinkt aber.«
»Allerdings.«
»Mm. Ich mag den alten Norman.«
»Ich auch.«
»Schon komisch. Keiner benimmt sich schlechter oder redet größeren Mist als Norman, trotzdem ist er allseits beliebt … Bleibt die Frage: Warum trinken Juden nicht?«
»Na, das ist doch genau wie mit den jüdischen Errungenschaften allgemein«, sagte Saul (als sein Scotch kam). »Und diese Errungenschaften sind unverhältnismäßig.10 Einstein hat das ziemlich gut gesagt. Der große Irrtum liegt in der Annahme, es sei irgendwie angeboren. So lügt der Antisemitismus. Es ist nicht angeboren. Es hat damit zu tun, wie man großgezogen wird. Alle guten jüdischen Kinder wissen, dass man die Älteren nur mit Nutzanwendung beeindruckt. Nicht mit Sport, Körperkraft oder äußerlicher Schönheit, auch nicht mit den Künsten. Sondern mit Lernen und Studieren.«
»Wann hat Einstein das gesagt?«
»Ich glaube, kurz vor dem Krieg. 1938 … Da lebte Einstein ja in Princeton, und 1938 wurden die Erstsemester befragt, wer der bedeutendste lebende Mensch sei. Er, Einstein, war zweiter. Als Erster kam Hitler.«
»Herrgott«, sagte ich. »Und war der amerikanische Antisemitismus vor dem Krieg sehr stark?«
»Während des Krieges – da war sein historischer Höhepunkt.«
»Ich muss gestehen, ich verstehe ihn einfach nicht, den Antisemitismus. Sie haben da mit Der Dezember des Dekans auch einiges davon abgekriegt, nicht?«
»Ja, aber aus einer anderen Ecke. Nicht aus der Welt des primitiven Aberglaubens, sondern aus der hochakademischen.«
»Von Hugh Kenner, nicht?«
»Ach. Hugh Kenner. Der hat Delmore gequält, und jetzt quält er mich. Auch in der Verteidigung der, na, ›traditionellen Kultur‹ ist er noch mal ausgerastet.«
»Also der nichtsemitischen Kultur?«
»Der nichtsemitischen Kultur, in dem Fall. Der traditionellen Kultur von Pound, Wyndham Lewis und T. S. Eliot.«
»Mm. Tja, zwei Spinner und ein Monarchist. Und Wyndham Lewis ist immerhin auf diese herrliche Wendung gekommen … Was glauben Sie übrigens, wie das lief? Ich meine, das schwachsinnige Inferno?«
»Ich fand, das schwachsinnige Inferno lief ganz gut.«
»Ich auch. Das schwachsinnige Inferno lief sehr schön.«
»Was«, fragte Julia, »ist denn das schwachsinnige Inferno?«
Das schwachsinnige Inferno
Zwei, drei Tage davor hatten Saul und ich eine Fernsehsendung mit dem Titel (mit einem Seitenblick auf Freud) Modernity and its Discontents aufgezeichnet; der Moderator war Michael Ignatieff, und das war Michaels erste Frage gewesen. »Ich wüsste doch gern, was Sie, Saul Bellow, damit meinten, als Sie Wyndham Lewis’ Wendung übernahmen: das schwachsinnige Inferno.« Worauf Saul antwortete:
Also, das bedeutet einen chaotischen Zustand, dem zu widerstehen niemand über die ausreichende innere Organisation verfügt. Ein Zustand, in dem man von allen möglichen Kräften überwältigt wird – politischen, technologischen, militärischen, ökonomischen und so weiter –, die alles mit einer Art heidnischer Unordnung, in der wir mit allen unseren menschlichen Eigenschaften überleben sollen, vor sich hertragen.
Und wir stehen nun vor der Frage, fuhr Saul fort, ob das möglich ist … Also redeten wir darüber, im Hinterkopf die Erwartung, dass Schriftsteller angeblich »über eine ganz gut organisierte Individualität verfügen«, wie er sagte, und daher in der Lage sind, Widerstand aufzubauen – einen inneren Widerstand gegen das schwachsinnige Inferno …
Das dauerte ungefähr eine Stunde, dann setzte der Wagen Saul und mich in der Gower Street ab, und wir bummelten durch Bloomsbury – die Grünanlagen, die Plaketten und Statuen, die Museen, die Gotteshäuser und die der Gelehrsamkeit. Als wir den Fitzroy Square überquerten, äußerte ich mich abschätzig über die Bloomsbury Group (in meinen Augen eine Schande für die Boheme), und wir gelangten weiter zu den größeren Klassenantagonismen, die erst jetzt allmählich schwanden … Saul musste nicht extra aufgestachelt werden, um über das, wie er es nannte, »Patriziertum« Bloomsburys schlecht zu denken, auch wenn er deren Judenphobie erstaunlich locker nahm.
»Aber Saul, die war doch so heftig, die hatten sie doch alle.«
»Ja, sogar Maynard Keynes. Aber das waren nur reflexartige Antisemiten. Das kam nicht von innen. Antisemitisch sein war lediglich eine der Pflichten als Snob.«
»… Vielleicht auch eine der Pflichten, zweitrangig zu sein. Der Einzige, der es nicht war, war Forster – nicht antisemitisch und auch nicht zweitrangig. Und Virginia Woolf …«
»Aber bedenken Sie bitte, dass sie mit einem Juden verheiratet war. Leonard … Dieser Salon-Antisemitismus – das war doch nur eine Pose. Über alles Ernste in diesem Zusammenhang wären sie entsetzt gewesen.«
»Stimmt. Vermutlich. Trotzdem, diese Virginia … Man stelle sich vor, man liest Ulysses und hat hinterher nur den Eindruck, dass Joyce vulgär war.11 Also, gewöhnlich. Das fällt ihr am meisten auf … Unfassbar.«
»Tja, ein hartes Leben, Snob zu sein. Man kann sich keinen Augenblick entspannen … Vor zehn Jahren habe ich ja sechs Wochen im Landhaus der Woolfs in East Sussex verbracht. Es war sehr kalt, und ich erwartete schon, dass Virginia mich heimsucht und bestraft. Aber sie hat’s nicht getan.«
Danach der volle English Tea im Hotel, gut möglich rindenlose Gurkensandwiches, vielleicht sogar Scones und Cream, wir beide von der Spitze und dem Chintz des Durrants umhüllt. Wie ich merkte, war Saul von alldem still geschmeichelt. An dem Nachmittag sagte er denn auch einmal tatsächlich (und offenbarte damit auch eine Vorliebe für Anglizismen):
»Wissen Sie, die behandeln mich hier sehr gut. Weil sie mich für einen ›toff‹ halten.«
Und ganz allgemein, wie angenehm, wie anrührend, wie humorig es war, London durch die Augen älterer amerikanischer Freunde neu zu erleben, die die Stadt als eine Bastion von Höflichkeit, Verwurzeltsein und unerschütterlicher Kontinuität sahen (und ich sie durch sie ebenfalls); sonst jedoch, im Alltag, empfand ich London als unzufriedene Modernität, geschürt von unterirdischen Mächten …
Das Gespräch mit Michael Ignatieff wurde in einer BBC-Publikation abgedruckt, daher ist das längere Zitat von Saul auch wortwörtlich. Die Abschrift lässt taktvollerweise meine letzte Bemerkung weg – als ich mich selbst mit einem bebenden cri de cœur erschreckte. Ich sagte, Bellow stehe über dem schwachsinnigen Inferno und könne es von weit oben betrachten, ich hingegen sei noch drin, noch darunter, gefesselt und zappelnd, und schaute hinaus.
Worauf ich mich dabei bezog, war, wie ich später merkte, meine erotische Pikareske im frühen Mannesalter. Eine meiner Hoffnungen mit Julia war diese: dass sie mich von dem schwachsinnigen Inferno meines Liebeslebens befreite (am besten verkapselt in der Person Phoebe Phelps’) …
Ehre
Odin, der Gott der Dichtung und des Krieges … Gestärkt von einer zweiten Runde Cocktails kamen wir auf Amerika zu sprechen – Amerika und die religiöse Rechte sowie die irrenden Geistlichen des Bibelgürtels.
Saul erzählte uns von einer Schlappe, die die Gemeinde der Wiedergeborenen in West Virginia erlitten hatte. Gegen einen ungewöhnlich puritanischen Video-Vikar (er hoffte, den Ehebruch zu kriminalisieren) wurde vonseiten der Bundespolizei ermittelt, weil er seine Herde betrogen haben soll (er verhökerte Wundermittel, hieß es, und hatte es auf die Kranken und Alten abgesehen). Zudem hatte man den bedrängten Geistlichen in Miami in einem Luxus-Sexclub namens Gomorrah unter einem Haufen Huren erwischt, und den Besuch hatte er mit Kirchenmitteln bezahlt …
»Die Frage der Heuchelei mal beiseite«, sagte Saul. »Dazu, dass er Christen um ihren Schmuck und ihre Behindertenleistungen gebracht hatte, sagte er nur: Aber das macht doch jeder – was natürlich keine Rechtfertigung ist, auch wenn es zufällig wahr ist. Und was die Huren und die Kirchenmittel betrifft … Da müssen Sie verstehen, dass es in Amerika zwei grundverschiedene Sphären von Vergehen gibt.«
»Nämlich?«
»Ethik und Moral. Ins Gomorrah zu gehen – das ist Moral. Das Gomorrah mit Geld aus dem Klingelbeutel zu bezahlen – das ist Ethik. Moral ist Sex und Ethik ist Geld.«
… Nun hatte Saul eine berühmte Lache: Der Kopf flog nach hinten, das Kinn ging hoch, und dann folgte das langsame, tiefe, gutturale Stakkato. Im Übrigen liebte Saul ausnahmslos alle Witze, die schwächsten, die schmutzigsten, die geschmacklosesten. Aber das mit der Ethik und der Moral war für Saul Bellow eher kein Witz: Es war nur eine nüchterne Feststellung über Amerika (und ist eine Tatsache, die täglich aufs Neue bestätigt wird).
Es war demnach nicht Sauls Lache, nach der sich alles umdrehte, die die Tische verstummen, die Kellner erstarren und lächeln ließ – sondern Julias. Eine orchestrale Lache, eruptiv, freudig, mit einem Schuss purer Anarchie, den ich nicht im Traum in ihr vermutet hätte.
Saul und ich sahen einander staunend an … Und dann runzelten wir fröhlich die Stirn über den Speisekarten und bestellten unsere schönen Stücke Fisch und unseren kostspieligen Weißwein, und dann endlich begann das Essen.
Sie war in meinem Alter und sie war Witwe. Ihr erster Mann, ein gut aussehender, vitaler Philosoph, war mit fünfunddreißig an Krebs gestorben. Mehr noch, sie war eine schwangere Witwe, und ich war der Vater.
Als mein erotisches Leben anlief, Mitte der Sechziger war das, beschloss ich nämlich ziemlich schnell, dass ich mich nicht mit der Sorge um Ehre belasten wollte. Angesichts der historischen Lage (von wegen sexuelle Revolution und so weiter) schien mir Ehre zu nichts als Ärger zu führen.
Und der Mensch, der mir bei all dem den Kopf zurechtrücken sollte – nicht durch Zureden, sondern durch sein Beispiel –, war an dem Abend im Odin’s schon da. Eine winzige Amphibie, weniger wie ein Molch denn eine Kaulquappe, die da drin herumwuselte und -rutschte, umschoßt. Es war Nathaniel, mein erster Sohn.
Abschließend: Erinnerung eines Philosemiten
Der 4. Juni 1967 war ein Sonntag.
Im Nahen Osten schienen die Armeen dreier Nationalstaaten bereit, Israel anzugreifen – mit einem Feldzug, der, wie Gamal Abdel Nasser, ihr de facto Generalissimo, versprach, »total« und dessen »Ziel Israels Zerstörung« sein werde.
In London W9 sah ich am Nachmittag des 4. Juni zu, wie sich eine Zionistin anzog. Sie griff nach einem Kleidungsstück, das, wie ich nun wusste, Miederhöschen genannt wurde. Es war weiß wie Brautsatin; dann griff sie nach ihrem Rock, der schwarz wie eine Trauerschleife war; dann nach ihrer blutroten Bluse.
Sie hieß … oh, meine Fingerspitzen brennen darauf, ihn hinzutippen, den sonoren Doppeldaktylus ihres wahren vollen Namens. Aber ich habe schon zweimal über sie geschrieben (in einem Roman, in einer Erinnerungsschrift), und ihr Pseudonym ist auch hier bewahrt: Rachel.
Der schwarze Rock, die rote Bluse.
»Ich muss los«, sagte sie.
Rachel blickte sich um, als hätte sie vielleicht etwas zurückgelassen. Und das hatte sie auch: Sie hatte es unter der Decke vergessen, wo ich noch lag … Noch in den sechziger Jahren hörte man gelegentlich jenen zarten Euphemismus für die Jungfräulichkeit: »unerweckt«. Was Rachel an jenem Sonntagnachmittag zurückgelassen hatte, war ihr unerwecktes Ich, ihre Unerwecktheit.
Ich ging auf die Achtzehn zu, sie war ein Jahr älter – genauso alt wie Israel. Es war erste Liebe, unsere erste Liebe, meine erste, ihre erste.
»Es ist schon halb fünf«, sagte sie.
»Du kommst schon rechtzeitig. Sind doch bloß zwei Haltestellen.«
»Aber es ist Sonntag. Sonntags dauert’s länger, weil sie unbedingt sehen wollen, wie man sich erholt. Warum, weiß ich nicht. Sie sehen einem zu, wie man seinen Tee trinkt und seinen Keks isst. Außerdem schließen sie früher. Manchmal schicken sie die Leute sogar wieder weg.«
Ich wusste genau, wovon sie sprach. Und war auch schon auf und zog mich an. »Ich bring dich zum Bus.«
»Dann beeil dich.«
Wir umarmten und küssten uns und sanken auf die Seite, aber nicht für lange. Rachel, eine Sephardin mit ebenholzschwarzen Haaren, einer schönen Tomahawk-Nase, breiten Lippen von derselben Farbe wie ihr Teint (wie feuchter Sand am Meer). Ich war siebzehn, ich las Gedichte, und ich bildete mir ein zu wissen, wie eine Epiphanie aussah.
Rachel musste zum Institut, an einem Sonntag musste sie schnell zum Institut, um noch rechtzeitig für Israel Blut zu spenden. Und die schlichte Wahrheit war, dass sie ihr Blut eben noch mir gespendet hatte.
Was ausgereicht hätte, mehr als das, um etwas Dauerhaftes auszulösen. Doch das war schon ausgelöst, es war schon da.
Ein Blitzbesuch am ersten Weihnachtstag 1961. Nach einem vierstündigen Mittagessen spiele ich mit Kingsley und Theo Richmond (ein sehr naher Freund der Familie) Scrabble. Mein Vater nimmt zwei Steine von seinem Bänkchen und legt für einen aufreizenden Augenblick, bevor er sie wieder wegnimmt, das Wort YID. Da bin ich zwölf.
Weiß ich überhaupt schon, was das Wort bedeutet? Kingsley jedenfalls lacht achselzuckend, und auch Theo lacht irgendwie (es ist nicht sein wahres Lachen), und ich verziehe hölzern das Gesicht so weit, dass es wie ein Lächeln wirkt. Noch jetzt, als ich das hinschreibe, erinnere ich mich, wie sich meine Wangen anfühlten: wie Pappe.
Während dieses Augenblicks hatte ich wohl diverse recht anstrengende Schlüsse gezogen. Dass Theo Jude war,12 dass yid ein Hasswort für Jude war und dass der Hass auf Juden existierte und vollkommen gängig war. Und dunkel, heiß, heimtückisch und gewalttätig war.13
Worauf stützte ich mich? Nur auf ein paar Fotografien, die ich im Daily Mirror gesehen hatte, damals in Swansea, als ich neun oder zehn war, und auf folgendes Gespräch mit meiner Mutter.
»… Mum.«
Sie sah, dass mich etwas umtrieb. »Ja, Mart.«
»Hitler und diese vielen halb verhungerten Leute.« Ich dachte an die Gleise, die Schornsteine. »Warum war Hitler … warum war er –?«
»Ach, mach dir wegen Hitler keine Sorgen«, sagte sie (sehr typisch). »Du bist blond und blauäugig. Dich hätte Hitler geliebt.«
Aus dieser Beruhigung – dass Hitler mich geliebt hätte – erwuchsen schließlich zwei ganze Romane. Weil Romane aus einer lange marinierten und unbeachteten Angst, aus stummer Angst heraus entstehen …
Am Sonntag spendete Rachel Blut. Am nächsten Morgen um 07:10 israelischer Zeit begann der Junikrieg – heute bekannt als Sechstagekrieg. Auch Rachels Angst war stumm, jedenfalls weitgehend; am Mittwoch hatte sie sich gelegt, und am folgenden Wochenende war sie vor Erleichterung still und ruhig überwältigt.
Heute frage ich mich: Wie viel wusste sie? Wusste sie von Nassers Versprechen – dass er »den jüdischen Staat für alle Zeiten vollkommen vernichten« werde? Wusste sie von der Vernichtung? Ihre kleine, geistreiche Großmutter, die im Haus der Familie draußen in der Finchley Road wohnte, war orthodox in einem Maße, dass sogar ihr Pulverkaffee, ihr Gold Blend mit dem grünen Etikett, den Koscher-Stempel trug; sie wusste über die Vernichtung Bescheid. Rachels Onkel, Onkel Balfour, wusste darüber Bescheid …
Und ich, was wusste ich? Nichts. Ich war siebzehn und politisch losgelöst, mehr noch, ich fand, dass die Geschichte mich nicht erreichen konnte, dass sie mich irgendwie nicht erreichen konnte. Dank meiner Hautfarbe für Hitler unangreifbar, war ich auch für Nasser unbedeutend, aus demselben Grund. Beide Männer hätten mich eventuell aber eines minderen Vorwurfs für schuldig befunden: Ich sympathisierte mit den Zionisten, und ich liebte die Juden.
So war es. Ich liebte Rachel, natürlich (denn wer würde sie nicht lieben?). Die Sache ist aber die, ich liebte auch Theo, von frühester Kindheit an. Ich betrachtete gern seine Augen, die mir beinahe kaleidoskopisch erschienen, wie ein Mobile über dem Kinderbett. In seinem Fall ein lebendiges, erregendes Muster aus allen freundlicheren menschlichen Impulsen. Die intelligente Sanftheit dieser Augen.
»Wie war das? Fünfhundert Milliliter alle sechs Wochen? Du gibst so viel«, sagte ich, »ich mache mir schon Sorgen, dass du ganz verschwindest. Und du isst nichts. Und schläfst nicht.«
Sie waren an der Bushaltestelle, und er hatte die Arme um ihre Taille. »Du bist sowieso so schmal. Das Miederhöschen – warum trägst du das?«
»Weil mein Bauch raussteht.«
»Der steht nicht raus. Der rundet sich nach vorn. Das ist schön, mir gefällt das.«
Sie umarmten und küssten sich, als der Doppeldecker nachsichtig seufzend heranfuhr.
Eine Theorie – hier in aller gebührenden Schüchternheit vorgetragen.
Der Philosemit und der Antisemit stehen einander nicht diametral gegenüber, nicht ganz. Sie sind gleichermaßen unfähig, sich neutral zu dem zu verhalten, was Bellow »die jüdische Aufladung« nannte, die gespeicherte Energie der Juden. Aufladung: »die Eigenschaft von Materie, die für elektrische Phänomene verantwortlich ist und in positiver wie negativer Form existiert.«
Die gespeicherte Energie, die gespeicherte Geschichte, die in positiver wie negativer Form existiert.
1Mit der »Kack-Generation« meinte ich diejenige, die nach den Babyboomern kam – die um 1970 Geborenen (die Generation Xer). Natürlich konnte ich mir nicht sicher sein, aber die Generation, die nach der Kack-Generation kam (die um 1990 Geborenen – die Millennials), schienen mehr oder weniger okay … Das Projekt Kack-Generation