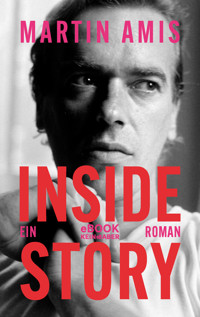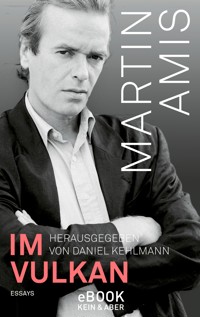14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nicola Six kann in die Zukunft sehen und weiß daher, dass sie bald ermordet wird. Sie kennt den Zeitpunkt, sie kennt den Ort, sie kennt das Motiv, sie kennt die Umstände. Nur wer ihr Mörder ist, weiß sie nicht. Ein lustiger, genial-vielschichtiger Roman und ein Höhepunkt in dem beeindruckenden Werk von Martin Amis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 898
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
MARTIN AMIS, geboren 1949 in Oxford, ist einer der bedeutendsten englischen Gegenwartsautoren. Er ist der Verfasser von vierzehn Romanen, zwei Kurzgeschichtensammlungen und sechs Sachbüchern. Für sein Romandebüt Das Rachel-Tagebuch erhielt er den Somerset Maugham Award. Zu seinen bekanntesten Werken zählen weiterhin Gierig, London Fields und Interessengebiet. Bei Kein & Aber erschien zuletzt sein Essayband Im Vulkan. Martin Amis lebt in New York.
ÜBER DAS BUCH
Samson Young, ein Schriftsteller mit Schreibblockade, betritt eine verruchte Bar und findet die Hauptakteure eines Dramas versammelt, die nur darauf warten, loszulegen: Guy Clinch (das Medium), Keith Talent (der Betrüger) und vor allem Nicola Six (die Mordgeweihte, die auf der Suche nach ihrem Mörder ist). Es ist ein Geschenk einer Geschichte aus dem wirklichen Leben, und Samson muss sie nur niederschreiben, wie sie sich vor seinen Augen abspielt. Ein brillanter, humorvoller und überaus vielfältiger Roman.
»Martin Amis’ Arbeitsbesteck sind scharfe Klingen, hochauflösende Mikroskope, Humor und Empathie.« 3sat Kulturzeit
»Ein Meisterwerk, das nicht zum größten Londoner Roman aller Zeiten geworden ist, aber genau das ist.« GQ
Für meinen Vater
Vorbemerkung
Ein Wort zum Titel. Mehrere Alternativen boten sich an. Eine Zeit lang spielte ich mit Pfeil der Zeit. Dann fand ich, Millennium wäre ungeheuer kühn (ein weit verbreiteter Glaube: Alles heißt heutzutage Millennium). Spät nachts kokettierte ich sogar mit Der Tod der Liebe. Am Ende war der ernsthafteste Kandidat Die Mordgeweihte, was mir sowohl unheilschwanger als auch ungeheuer eingängig erschien. Und dann geriet ich ins Schwanken und kam auf Kompromisse wie Die Mordgeweihte, letzte Fassung …
Aber wie man sieht, habe ich meinem Erzähler ironische Treue gehalten; zweifellos hätte er mich gern daran erinnert, dass es zwei Arten von Titeln gibt – zwei Klassen, zwei Gruppen. Die erste Art von Titeln wählt einen Namen für etwas, das es schon gibt. Die zweite Art von Titeln ist ständig präsent: Sie lebt und atmet auf jeder Seite oder versucht es wenigstens. Meine Vorschläge (und sie haben mich Schlaf gekostet) gehören alle zur ersten Art von Titeln. London Fields gehört zur zweiten. Nennen wir’s also London Fields. Dieses Buch heißt London Fields. London Fields …
M. A.
London
Dies ist eine wahre Geschichte, aber ich kann nicht fassen, dass sie wirklich geschieht.
Dazu noch eine Mordgeschichte. Ich kann mein Glück nicht fassen.
Komischerweise auch eine Liebesgeschichte (glaube ich), und das so nah am Ende des Jahrhunderts, so nah am Ende des verdammten Tags.
Dies ist die Geschichte eines Mordes. Er ist noch nicht geschehen. Aber er wird. (Will ich ihm auch geraten haben.) Ich kenne den Mörder, ich kenne die Mordgeweihte. Ich kenne den Zeitpunkt, ich kenne den Ort. Ich kenne das Motiv (ihr Motiv), und ich kenne das Werkzeug. Ich weiß, wer das Medium, der Narr, der arme Wurm sein wird, ebenfalls völlig zerstört. Und ich könnte nichts aufhalten, glaube ich jedenfalls, selbst wenn ich wollte. Das Mädchen wird sterben. Das wollte sie schon immer. Hat man erst mal angefangen, hält einen keiner mehr auf. Hat man erst mal angefangen zu gestalten, hält einen keiner mehr auf.
Welch ein Geschenk! Eine kurze Träne der Dankbarkeit befeuchtet diese Seite. Im Allgemeinen hat es der Romanautor ja nicht so gut, dass etwas Wirkliches geschieht (etwas Einheitliches, Dramatisches und ziemlich Verkaufsträchtiges) und er es einfach hinschreiben kann.
Ich muss Ruhe bewahren. Schließlich ist auch mir hier eine Frist gesetzt, vergessen wir das nicht. Oh, die schwangere Erregung. Jemand kitzelt mir mit zarten Fingern das Herz. Der Tod beschäftigt alle sehr.
Vor drei Tagen (tatsächlich?) bin ich mit dem Nachtflieger aus New York eingeflogen. Ich hatte das Flugzeug praktisch für mich allein. Ich breitete mich aus, rief häufig und kläglich die Stewardessen wegen Codein und kaltem Wasser. Doch der Nachtflieger tat, was Nachtflieger eben so tun. O je. Herrgott, ich sehe aus wie der Hund von Baskerville … Um halb zwei morgens, meine Lieblingszeit, wegen eines pappigen Brötchens wach gerüttelt, schob ich mich auf einen Fensterplatz und sah durch die hellen Nebelschwaden, wie die Felder sich zu Regimentern formierten, in voller Paradeaufstellung, die traurigen Grafschaften, wie eine Armee von der Größe Englands. Dann die Stadt selbst, London, straff und präzise wie ein Spinnennetz. Ich hatte das Flugzeug für mich allein, weil niemand, der bei Verstand ist, nach Europa will, nicht jetzt, nicht zurzeit; alles will in die andere Richtung, wie Heathrow mir bestätigt hat.
Es stank nach Schlaf. Somnopolis. Es stank nach Schlaf, nach der Sorge und Unruhe der Schlaflosigkeit und nach vereitelter Flucht. Denn mitten in der Nacht sind wir alle Dichter oder Babys, ringen mit dem Sein. Außer mir kam kaum jemand an. Der Flughafen fertigte nur Abflüge ab. Ich stand in einem ausgestorbenen Gang, horchte auf die Informationsberieselung und blickte durch den beleidigend dichten morgengrauen Regen hinab auf die Parkplätze und Pisten: Die ganzen Haie da mit ihren hochgereckten Flossen, Protzer, Suhler, große weiße – Killer. Jeder Einzelne ein Killer.
Und die Wohnung – na, die raubt mir glatt den Atem. Wirklich. Als ich durch die Tür komme, mache ich Ti-hi-hi. Ich bin total perplex. Das alles über eine Kleinanzeige im New York Review of Books? Da hab ich aber wirklich das bessere Los gezogen. Ja, ich habe Mark Asprey glasklar abgezockt. Ich streife durch die Zimmer und denke voller Scham an meine versiffte kleine Bude in Hell’s Kitchen. Schließlich ist er ja Autor wie ich, und genau gleich hätte es ja nicht sein müssen, aber vielleicht doch einigermaßen ausgewogen. Natürlich dämmert sogar mir, dass die Wohnung mit bedauernswertem Geschmack eingerichtet ist. Was schreibt dieser Mark Asprey überhaupt? Musicals? Reizende Zettel schreibt er. »Lieber Sam: Willkommen!«, fängt seiner an.
Aber auch nichts hier gibt sich damit zufrieden, lediglich praktisch oder zweckmäßig zu sein. Die Klobürste ist ein Zepter mit Schnäuzer. Die Hähne in der Küche eine Riesenorgie Wasserspeier. Ganz klar, das ist einer, der sich seinen Morgenkaffee mit dem sengenden Wind tscherkessischer Tänzerinnen heiß macht. Mr. Asprey ist Junggeselle: Daran besteht kein Zweifel. Beispielsweise hängen jede Menge signierter Fotos an der Wand – Models, Schauspielerinnen. In der Hinsicht ist sein Schlafzimmer wie eine Kneipe namens Zwei kleine Italiener. Aber der Junge ist aus London; und gelobt wird da nicht seine Pasta. Die bemühte Inschrift und die geschwungene Unterschrift: Selbstverstümmelung, der zarten, der berühmten Kehle zugefügt.
Zu all dem darf ich auch noch sein Auto fahren, sein A-nach-B-Gerät, das gehorsam am Bordstein meiner harrt. Auf seinem Zettel entschuldigt sich Mark Asprey dafür, er lässt mich wissen, dass er noch ein besseres hat, ein viel besseres, das an seinem Häuschen auf dem Land, seinem Landhaus, seinem Landgut vertäut ist. Gestern bin ich mal rausgewankt und habs mir angesehen. Das neueste Modell, bestrebt, den Zustand steingrauer Unsichtbarkeit zu erreichen. Es fand selbst meine prüfenden Blicke maßlos peinlich. Zur Ausstattung gehörten täuschend echte Schrammen, ein abnehmbares Rosttoupet auf der Motorhaube und überall auf dem Lack selbst klebende Schlüsselkratzer. Eine englische Strategie: Neidprävention. Während der letzten zehn Jahre hat sich viel verändert, ist viel gleich geblieben. Londons Pub-Aura, die hat sich eindeutig verdichtet: der Qualm und der Sand und Staub der Bauarbeiter, der strenge Toilettenduft, die Straßen wie ein schrecklicher Flickenteppich. Bestimmt gibts Überraschungen, wenn ich mich erst mal umschaue, aber ich habe immer zu wissen geglaubt, wohin England steuerte. Was man im Auge behalten musste, war Amerika …
Ich stieg ein und drehte eine Runde. Ich sage Runde, um den zehnminütigen Schwindelanfall zu erklären, den ich hatte, als ich wieder in die Wohnung kam. Dessen Gewalt beeindruckte mich. Schwindelgefühl und ein neuer Ekel, ein moralischer Ekel, der aus dem Bauch kam, wo jede Moral herkommt (wie wenn man aus einem bösen Traum erwacht und voller Angst nach dem Blut an den Händen sieht). Auf dem Beifahrersitz, unter dem eleganten Fetzen eines weißen Seidenschals, liegt ein schweres Autowerkzeug. Mark Asprey muss Angst vor etwas haben. Er muss Angst vor den Londoner Armen haben.
Drei Tage hier, und ich bin bereit – bin schreibbereit. Hört nur, wie meine Knöchel knacken. Das wirkliche Leben drängt so schnell heran, dass ich nicht mehr länger warten kann. Es ist unglaublich. Zwei Jahrzehnte mäkelige Quälereien, zwei Jahrzehnte Nichtbeginn, und plötzlich bin ich bereit. Na ja, dieses Jahr sollte schon immer das des seltsamen Benehmens werden. Ich möchte an dieser Stelle mit der gebotenen Bescheidenheit und Vorsicht sagen, dass ich das Zeug dazu habe, einen richtig flotten kleinen Thriller zu schreiben. Auf seine Art auch originell. In dem es nicht darum geht, wer’s war. Eher darum, warum. Ich bin kränklich und entflammt. Ich bin leichenblass. Ich glaube, ich bin weniger ein Romanautor als ein Schriftführer mit leichten Übelkeitsgefühlen, der über das wirkliche Leben Protokoll führt. Genauer gesagt mache ich mich vermutlich auch der Beihilfe schuldig, aber vorerst mal zum Teufel damit. Ich bin heute aufgewacht und habe gedacht: Wenn London ein Spinnennetz ist, wer oder was bin dann ich? Vielleicht bin ich die Fliege. Ich bin die Fliege.
Jetzt aber los. Ich war immer davon ausgegangen, dass ich mit der Mordgeweihten anfange, mit ihr, mit Nicola Six. Aber nein, das wäre nicht ganz das Richtige. Fangen wir mit dem schlimmen Finger an. Ja. Keith. Fangen wir mit dem Mörder an.
Kapitel 1: Der Mörder
Keith Talent war ein Schlimmer. Keith Talent war ein ziemlich Schlimmer. Man könnte sogar sagen, dass er ein ganz Schlimmer war. Aber nicht der Schlimmste, nicht der Allerschlimmste überhaupt. Es gab durchaus Schlimmere. Wo? Dort im heißen Licht von CostCheck beispielsweise, mit Autoschlüsseln, beigem Trikothemd und einem Sechserpack Peculiar Brews, Handgemenge an der Tür, fiese Drohung und Ellbogen im schwarzen Genick der jammernden Frau, dann das Auto mit dem Rost und der wartenden Blondine, und auf zum nächsten Ding, egal was, egal was nötig ist. Der Mund dieser Schlimmsten – ihre Augen. Ein kleines, todernstes Universum in diesen Augen. Nein. So schlimm war Keith nicht. Manches sprach auch für ihn. Er hasste niemanden aus vorgefassten Gründen. Immerhin neigte er zum Multikulturellen – wenn auch gedankenlos, hilflos. Intime Begegnungen mit fehlfarbigen Frauen hatten ihn etwas gnädig gestimmt. Alles, was für ihn sprach, hatte einen Namen. Die ganzen Fetnabs und Fatimas, die er gekannt hatte, die Nketchis und Iqbalas, die Michikos und Boguslawas, die Ramsarwatees und Rajashwaris – in der Hinsicht war Keith ein Mann von Welt. Sie waren die Löcher in seinem rabenschwarzen Panzer: Gott segne sie alle.
Obwohl Keith fast alles an sich gefiel, hasste er seine versöhnlichen Züge. In seinen Augen stellten sie seinen einzigen größeren Mangel dar – seinen einzigen tragischen Makel. Als es so weit war, im Büro neben der Laderampe der Fabrik an der M 4 bei Bristol, das grobe Gesicht ins kratzige Nylon gezwängt, als die stolze Frau vor ihm den zitternden Kopf schüttelte und Chick Purchase und Dean Pleat beide Hau zu schrien, Hau zu (noch immer hatte er sie vor Augen, diese verzerrten Münder hinter dem Garn), da hatte Keith es eindeutig verpasst, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Er hatte sich als unfähig erwiesen, die Asiatin auf die Knie zu knüppeln und weiterzuknüppeln, bis der Mann in der Uniform den Safe aufmachte. Warum hatte er versagt? Warum, Keith, warum? In Wahrheit war ihm alles andere als wohl gewesen: Die halbe Nacht in einer Seitenstraße in einem nach dem Fußschweiß rülpsender Verbrecher stinkenden Auto; kein Frühstück, kein Stuhlgang; und zu allem Übel dann noch grünes Gras, frische Bäume und wogende Hügel, wohin er auch blickte. Zudem hatte Chick Purchase da schon den zweiten Wachmann zum Krüppel gemacht, und Dean Pleat war bald darauf über den Schalter zurückgegrätscht und selbstgerecht mit dem Gewehrkolben auf die Frau losgegangen. Keith’ Gewissensbisse hatten also nichts geändert – bis auf seine Berufsaussichten in Sachen bewaffneter Raubüberfall. (Es ist hart ganz oben, wie auch ganz unten; hinfort war Keith’ Name besudelt.) Hätte er es gekonnt, er hätte es getan, mit Freuden. Aber er hatte einfach nicht … er hatte einfach nicht das Talent dazu.
Danach kehrte Keith dem bewaffneten Raubüberfall ein für alle Mal den Rücken. Er verlegte sich aufs Racketeering. Racketeering in London hieß, grob gesagt, um Drogen kämpfen; in dem Teil West-Londons, in dem Keith zu Hause war, hieß Racketeering, mit Schwarzen um Drogen kämpfen – und Schwarze kämpfen besser als Weiße, weil sie es, neben anderen Gründen, alle tun (da gibt es keine Zivilisten). Racketeering funktioniert durch Eskalation und Eskalationssteuerung: Erfolg haben diejenigen, die den Exponenzialsprung schaffen, diejenigen, die mit ihrer Gewalttätigkeit regelmäßig überraschen können. Keith brauchte etliche deftige Prügel und die ersten Anzeichen dafür, dass er Geschmack am Krankenhausessen fand, bevor er einsah, dass er fürs Racketeering nicht geschaffen war. Während einer seiner Genesungszeiten, die er größtenteils in den Straßenlokalen der Golborne Road zubrachte, beschäftigte Keith vor allem ein Rätsel. Das Rätsel war Folgendes: Wie kommt es, dass man so oft Schwarze mit weißen Mädels sieht (durchweg Blondinen, durchweg, vermutlich zur maximalen Kontraststeigerung), aber nie Weiße mit schwarzen Mädels? Verprügelten die Schwarzen die Weißen, die mit einem schwarzen Mädel gingen? Nein, oder nicht oft; doch man musste diskret sein, und seiner Erfahrung nach wurden nur selten längere Beziehungen eingegangen. Aber wie lief es dann? Ein Gedanke durchzuckte ihn wie ein Blitz. Die Schwarzen verprügelten die schwarzen Mädels, die mit Weißen gingen! Das wars. Auch viel einfacher. Er grübelte über die Weisheit, die darin lag, und zog eine Lehre daraus, die er tief im Innern schon lange begriffen hatte. Wenn du gewalttätig werden willst, dann halte dich an Frauen. Halt dich an die Schwachen. Keith gab das Racketeering auf. Er schlug ein neues Kapitel auf. Nachdem er dem Gewaltverbrechen abgeschworen hatte, prosperierte er und stieg stetig bis in die höchsten Höhen seiner neuen Profession: gewaltloses Verbrechen.
Keith arbeitete als Betrüger. Da steht er an der Straßenecke mit drei, vier Kollegen, drei, vier Betrüger-Kumpels; sie lachen und husten (sie husten immer) und schlagen mit den Armen, um sich aufzuwärmen; sie sehen aus wie üble Vögel … An guten Tagen stand er früh auf und riss lange Stunden ab, ging hinaus in die Welt, in die Gesellschaft, um sie zu betrügen. Keith betrog mit seinem Mietwagenservice an Flughäfen und Bahnhöfen; er betrog mit seinen falschen Düften und Parfüms an Straßenständen in Oxford Street und Bishopsgate (seine wichtigsten Kollektionen waren Scandal und Outrage); er betrog mit nichtpornografischer Pornografie im Hinterzimmer von kurzfristig gemieteten Läden, und er betrog überall auf der Straße mit dem umgedrehten Pappkarton oder Milchkasten und den drei krummen Karten: Finde die Dame! Dabei und gelegentlich auch anderswo war die Grenze zwischen Gewaltverbrechen und dessen gewaltlosem kleinem Bruder oft schwer auszumachen. Keith verdiente dreimal so viel wie die Premierministerin und hatte nie Geld, weil er im Mecca, dem Wettbüro in der Portobello Road, täglich schwere Verluste erlitt. Nie gewann er. Manchmal grübelte er darüber nach, nämlich jeden zweiten Donnerstag zur Mittagszeit, im Schaffellmantel, den Kopf über die Rennseite gebeugt, während er für sein Arbeitslosengeld anstand, und fuhr daraufhin trotzdem prompt wieder zum Wettbüro in die Portobello Road. So hätte Keith’ Leben über die Jahre dahingehen können. Das Zeug zum Mörder hatte er nicht, nicht von sich aus. Er brauchte seine Mordgeweihte. Die Ausländer, die karierten, hundszahnigen Amerikaner, die lüsternen, linsengesichtigen Japaner, die da steif über dem Pappkarton oder dem Milchkasten standen – nie fanden sie die Dame. Aber Keith. Keith fand sie.
Natürlich hatte er schon eine, die kleine Kath, die ihm unlängst ein Kind geschenkt hatte. Im Großen und Ganzen hatte Keith die Schwangerschaft begrüßt: Sie war, wie er gern witzelte, eine recht praktische neue Art, seine Frau ins Krankenhaus zu bringen. Er hatte entschieden, dass das Baby, wenn es kam, Keith heißen sollte – Keith Jr. Erstaunlicherweise hatte Kath andere Vorstellungen. Doch Keith blieb unbeugsam, er geriet nur einmal ins Wanken, als er kurz erwog, das Baby Clive zu nennen, nach seinem Hund, einem großen, älteren und unberechenbaren Schäferhund. Aber dann änderte er noch einmal seine Meinung; es sollte nun doch Keith heißen … In Blau gewickelt kam das Baby nach Hause, samt der Mutter. Keith half ihnen persönlich vom Krankenwagen ins Haus. Als Kath sich daranmachte, den Tisch zu decken, saß Keith vor dem gestohlenen Kaminfeuer und blickte den Neuankömmling stirnrunzelnd an. Etwas stimmte nicht mit dem Baby, etwas ganz Wesentliches. Das Dumme an dem Baby war, dass es ein Mädchen war. Keith blickte tief in sich hinein und sammelte sich. »Keithette«, hörte Kath ihn murmeln, während sie sich auf dem kalten Linoleum niederkniete. »Keithene. Keitha. Keithinia.«
»Nein, Keith«, sagte sie.
»Keithnab«, sagte Keith mit der Miene eines Mannes, dem langsam etwas dämmert. »Nkeithi.«
»Nein, Keith.«
»… Warum ist es so scheißgelb?«
Ein paar Tage später hatte Keith es aufgegeben, seine Frau zu beschimpfen, und klatschte sie auch nicht mehr sehr überzeugend an die Wand, wenn sie das Baby zaghaft mit »Kim« anredete. Schließlich hieß auch einer von Keith’ Helden, einer von Keith’ Göttern »Kim«. Und in jener Woche betrog Keith heftig, betrog jeden, wie es schien, und vor allem seine Frau. So blieb es also bei Kim Talent – Kim Talent, Klein-Kim.
Der Mann hatte Ehrgeiz. Sein Traum war es, ganz nach oben zu kommen; er kleckerte nicht. Er hatte weder die Absicht noch den Wunsch, den Rest seines Lebens Betrüger zu bleiben. Sogar er fand die Arbeit zermürbend. Und bloßes Betrügen würde ihm nie bringen, was er wollte, all die Waren und Dienstleistungen, nicht, solange ihm die Serie entscheidender Gewinne im Wettbüro weiter durch die Lappen ging. Er spürte, dass Keith Talent für ein bisschen was Besonderes gemacht war. Fairerweise muss gesagt werden, dass er einen Mord nicht im Sinn hatte, noch nicht, außer vielleicht in einer gespenstischen potentia, die allem Denken und Tun vorausgeht. … Charakter ist Bestimmung. Von diversen Friedensrichtern, Freundinnen und Bewährungshelfern hatte Keith oft genug zu hören bekommen, er habe einen »schlechten Charakter«, und das hatte er auch stets offen und gern zugegeben. Aber hieß das denn, dass ihm eine armselige Bestimmung blühte? … Wachte er einmal früh auf, etwa wenn Kath sich schwerfällig aus dem Bett wälzte, um die kleine Kim zu stillen, oder war er eingekeilt in einen der Verkehrsstaus, die seinen Tagen routinemäßig Fesseln anlegten, verfolgte Keith im Geiste eine andere Vision, eine Vision von Reichtum, Ruhm und einer Art funkelnder Supergesetzestreue – die blitzenden Chromspeichen einer möglichen Zukunft im Weltdarts.
Sein Leben lang, bis zurück zu dem kahlen Board an der Küchentür, war er eher Gelegenheitsdarter oder -pfeilwerfer gewesen, doch unlängst war es für Keith ernst geworden. Natürlich hatte er schon immer für sein Pub geworfen und den Sport verfolgt: Man konnte fast die Engel singen hören, wenn Keith an jenen besonderen Abenden (drei- bis viermal die Woche) die Zigaretten auf der Armlehne der Couch bereitlegte und sich auf Darts im Fernsehen vorbereitete. Nun jedoch hatte er Pläne für die andere Seite des Bildschirms. Zu seiner eigenen, aufwendig verborgenen Überraschung war Keith unter die letzten sechzehn des Sparrow Masters gelangt, eines alljährlichen Wettbewerbs der Pubs, in den er einige Monate zuvor auf den Rat diverser Freunde und Bewunderer hin unbekümmert eingestiegen war. Am Ende jenes Weges nämlich winkten die Aussicht auf ein im Fernsehen übertragenes Finale, ein Scheck über 5000 £ sowie eine ebenfalls übertragene Play-off-Runde mit seinem Helden und Dartsvorbild, der Nummer eins der Welt, Kim Twemlow. Und danach, tja, danach war der Rest Fernsehen.
Und das Fernsehen, das hatte alles, was er nicht hatte, und war voll mit Leuten, die er nicht kannte und wie die er nie sein würde. Das Fernsehen, das war das Große, leicht elektrisierte Schaufenster, an das Keith die Nase presste. Da sah er nun zwischen den tanzenden Stäubchen und den unmöglichen Preisgewinnen eine Tür oder einen Pfeil oder eine winkende Hand (mit einem Dart darin), und alles sagte – Darts. Profidarts. Weltdarts. Und jetzt ist er unten in seiner Garage, seit Stunden schon, und die Augen brennen ihm noch von der unbeschreiblichen, der herzzerreißenden Schönheit eines nagelneuen Dartboards, das er an ebenjenem Tag gestohlen hat.
Ein wunderbarer Anachronismus. Die Werte und Sitten des modernen Verbrechers schätzte Keith gering. Er hatte keine Zeit für das Gym, das Schicki-Restaurant, den strammen Bestseller, den Urlaub im Ausland. Nie hatte er sich sportlich betätigt (es sei denn, man rechnete Einbrechen, Davonlaufen und Verprügeltwerden dazu); nie hatte er wissentlich ein Glas Wein getrunken (oder nur, wenn er jenseits von Gut und Böse war); nie hatte er ein Buch gelesen (davon nehmen wir hier aus: Darts: So wird man zum Meister); nie war er außerhalb Londons gewesen. Nur einmal. Als er nach Amerika fuhr …
Dorthin war er mit einem Freund gereist, wie er ein junger Betrüger, ebenfalls Dartsspieler, der wie er Keith hieß: Keith Double. Das Flugzeug war überbucht, und die beiden Keiths mussten zwanzig Reihen auseinander sitzen. Sie dämpften ihre Todesangst mit mörderischem Trinken, dank Stewardess und Duty-free-Tüte und indem sie ungefähr alle zehn Sekunden »Prost, Keith!« brüllten. Wir können uns das Vergnügen der anderen Passagiere vorstellen, die während des siebenstündigen Fluges über tausend dieser Brüller verzeichneten. Nach der Landung in New York wurde Keith Talent in das öffentliche Krankenhaus in Long Island City eingeliefert. Drei Tage später, er stakste gerade ins Treppenhaus, um eine zu rauchen, begegnete er Keith Double. »Prost, Keith!« Es stellte sich heraus, dass die obligatorische Krankenversicherung auch Alkoholvergiftung abdeckte, und so waren alle glücklich und wurden noch glücklicher, als die beiden Keiths sich rechtzeitig zum Rückflug wieder erholt hatten. Keith Double war nun in der Werbung und schon häufig nach Amerika geflogen. Keith nicht; er betrog noch immer auf Londons Straßen.
Und die Welt und die Geschichte konnten nicht so umgeordnet werden, dass sie ihm begreiflich geworden wären. In einiger Entfernung vom Strand in Plymouth, Massachusetts, lag einst ein großer Felsbrocken, angeblich das erste Stück Amerika, das vom Fuß eines Pilgervaters berührt wurde. Im achtzehnten Jahrhundert als solches identifiziert, musste dieses Vorzeigestück einer US-Immobilie näher ans Ufer gerückt werden, um Erwartungen, wie Geschichte sich zutragen sollte, zu befriedigen. Um Keith zu befriedigen, um mit Keith überhaupt weiterzukommen, müsste man den gesamten Planeten umbauen – große Szenenwechsel, kolossale Neuordnungen in seinem Hinterkopf. Und dann müsste sich das Revolverblattgesicht in Falten werfen.
Keith sah nicht wie ein Mörder aus. Er sah aus wie der hündische Helfershelfer eines Mörders. (Nichts gegen Keith’ Hund Clive, der schon lange vorher angeheuert hatte und dem Keith ohnehin nicht im Geringsten ähnlich sah.) Keith sah aus wie der hündische Helfershelfer eines Mörders, wie der eifrige Handlanger eines Schlitzers, Leichenräubers oder Grabschänders. In seinen Augen stand ein eigentümliches Leuchten – einen Augenblick lang erinnerte es an Gesundheit, an verborgene oder schlafende oder auf andere rätselhafte Weise abwesende Gesundheit. Obwohl diese Augen häufig blutunterlaufen waren, schienen sie einen zu durchbohren. In Wirklichkeit aber prallte das Licht von ihnen zurück. Und er war alles andere als angenehm oder ermutigend, dieser Einbahnglanz. Keith’ Augen waren das Fernsehen. Das Gesicht selbst war löwenartig; aufgedunsen von Sehnsüchten und trocken wie weicher Pelz. Keith’ krönende Pracht, sein Haarschopf, war dicht und voll, doch sah er immer aus, als wäre er kürzlich gewaschen, unvollständig ausgespült und dann, schmierig von billigem Shampoo, langsam in einem randvollen Pub getrocknet worden – in der Thermik des Alks, dem fahlen Kippenqualm. Diese Augen und ihre Großstadtstrenge … Wie der traurig stimmende Frohsinn einer mittellosen Kinderklinik (Willkommen auf der Peter-Pan-Station) oder wie der cremefarbene Rolls-Royce eines Verbrechers, der in der Dämmerung zwischen einer U-Bahn-Station und einem Blumenkiosk parkt, so strahlten Keith Talents Augen eine ungeheure, dem Geld verpflichtete Anpassung aus. Und Mord? Die Augen – waren sie dafür blutunterlaufen genug? Jetzt nicht, noch nicht. Er hatte das Talent dazu, irgendwo, doch er würde die Mordgeweihte brauchen, um es herauszukitzeln. Bald würde er die Dame finden.
Oder sie ihn.
Chick Purchase. Chick. Höchst unpassend für so einen bekannten Preisboxer und Satyromanen. Ein Diminutiv von Charles. In Amerika heißt das Chuck. In England anscheinend Chick. Ist das ein Name. Ist das ein Land … Natürlich schreibe ich diese Worte in der ehrfürchtigen Stille, die auf die Fertigstellung des ersten Kapitels folgt. Noch wage ich nicht, es durchzusehen. Ob ich das überhaupt je mache?
Aus Gründen, die mir noch nicht ganz klar sind, habe ich wohl einen jovialen und überheblichen Ton angeschlagen. Er wirkt altmodisch, falsch: wie Keith. Aber erinnern wir uns: Keith ist modern, modern, modern. Na ja, ich denke, ich werde noch besser. Und bald muss ich mich der Mordgeweihten widmen.
Es wäre schön, wenn ich mich darüber verbreiten könnte, wie gut das ist, mich nach all den Jahren hinzusetzen und tatsächlich anzufangen, Literatur zu schreiben. Aber nur keine Flausen. Das alles geschieht nämlich tatsächlich.
Woher weiß ich beispielsweise, dass Keith als Betrüger arbeitet? Weil er versucht hat, mich zu betrügen, auf dem Weg von Heathrow in die Stadt. Etwa eine halbe Stunde hatte ich unter dem Schild mit der Aufschrift TAXI gestanden, als der königsblaue Cavalier nach seiner zweiten Runde in die Parkbucht einfuhr. Herausgestiegen kam er.
»Taxi, Sir?«, sagte er und griff nach meinem Koffer, sachlich, ganz der routinierte Profi.
»Das ist aber kein Taxi.«
Worauf er sagte: »Keine Sorge. Hier kriegen Sie kein Taxi, mein Freund. Nichts drin.«
Ich fragte ihn nach dem Preis, und er nannte mir einen: eine haarsträubende Summe.
»Limo eben«, erklärte er.
»Das ist auch keine Limo. Das ist ein stinknormales Auto.«
»Sie zahlen, was auf der Uhr steht, ja?«, sagte er; aber da stieg ich schon hinten ein und war fest eingeschlafen, noch bevor wir losfuhren.
Einige Zeit später wachte ich auf. Wir näherten uns Slough, und auf der Uhr stand 54,50 £.
»Slough!«
Seine Augen funkelten mich argwöhnisch durch den Rückspiegel an. »Moment, Moment«, legte ich los. Das hat mit meiner Krankheit oder Befindlichkeit zu tun. Nie war ich mutiger. Sie flößt mir Kraft ein – ich spüre es richtig. Als würde ich nach den richtigen Wörtern suchen und sie finden, die Kraft finden. »Hören Sie mal. Ich kenn mich hier aus. Ich bin nicht hier, um mir Harrods und den Buckingham Palace anzusehen oder Stratford-upon-Avon. Ich sage nicht zwanzig quids und Trafaldschar Square und auch nicht Barnet. Slough? Was soll das? Wenn das eine Entführung oder ein Mord werden soll, dann reden wir darüber. Wenn nicht, dann fahren Sie mich jetzt für den vereinbarten Betrag nach London.«
Ohne Eile fuhr er links ran. O Gott, dachte ich: Das wird ja wirklich ein Mord. Er drehte sich um und schenkte mir ein vertrauliches Grinsen.
»Also, die Sache ist die«, sagte er, »die Sache ist die – okay. Ich hab gesehen, dass Sie schlafen. Da hab ich mir gedacht: ›Der schläft. Der sieht aus, als hätt er’s nötig. Das kenn ich. Da schau ich schnell bei meiner Mum rein.‹ Beachten Sie das Ding gar nicht«, sagte er und nickte jäh und wegwerfend zu der Uhr hin, ein eigenartiges Konstrukt, das wie selbst gebastelt aussah und inzwischen auf 63,80 £ stand. »Das macht Ihnen doch nichts, oder, mein Freund?« Er zeigte auf eine Reihe Rauputzhäuser – wir waren, wie ich nun sah, in einer Art Schlafvorstadt, Grünflächen, keine Geschäfte. »Also, die ist nämlich krank. Dauert keine fünf Minuten. Okay?«
»Was ist das?«, sagte ich. Ich meinte die Geräusche, die aus dem Autoradio drangen, dumpfe Tocks, gefolgt von gebrüllten Zahlen, alles vor einem wilden Hintergrund von höhnischen Schreien.
»Darts«, sagte er und schaltete es aus. »Ich würd Sie ja mit reinbitten, aber – meine alte Mum. Da. Lesen Sie das.«
Und so saß ich hinten im Cavalier, während mein Fahrer seine Mum besuchen ging. In Wirklichkeit tat er nichts dergleichen. Was er wirklich tat (wie er mir später stolz anvertraute), war, eine leicht bekleidete Analiese Furnish wie eine Schubkarre durchs Wohnzimmer zu stoßen, während ihr momentaner Beschützer, der nachts arbeitete, im Zimmer darüber seinen legendären Tiefschlaf hielt.
In Händen hielt ich eine vierseitige Broschüre, die mir der Mörder hineingedrückt hatte (Wobei er da natürlich noch kein Mörder war. Das dauerte noch). Auf der Rückseite war ein Farbfoto von der Königin und eine grob darübergelegte Parfümflasche: »Outrage – von Ambrosio.« Vorn prangte ein Schwarz-Weiß-Foto meines Fahrers, der unzuverlässig lächelte. »KEITH TALENT«, und darunter:
* Chauffeur und Kurierdienst
* Eigene Limousine
* Casinoberater
* Luxuswaren und Edelobjekte
* Dartsunterricht
* Londoner Vertreter von Ambrosio of Milan, Parfüms und Pelze
Es folgten nähere Informationen über die Parfüms Scanda, Outrage sowie kleinere Serien namens Mirage, Disguise, Duplicity und Sting, und darunter, in einfachen Anführungsstrichen, begleitet von einer Adresse und Telefonnummer, die Apostrophe an der falschen Stelle: Keiths’ the Name, Scents’ the Game. Die beiden Innenseiten der Broschüre waren leer. Ohne mir viel dabei zu denken, faltete ich sie zusammen und steckte sie in die Innentasche; aber inzwischen hat sie sich als unschätzbar für mich erwiesen.
Zwei lässige Korrekturen am Gürtel vornehmend, kam Keith den Gartenweg heruntergeschlendert.
Als das Auto hielt und ich wieder aufwachte, stand auf der ratternden Uhr 143,10 £. Langsam kletterte ich aus dem Schlaf- und Wohnwagengeruch des Autos, wie aus einem zweiten Flugzeug, und faltete mich vor dem Haus auseinander – und das Haus war gewaltig wie ein altertümlicher Terminal.
»Die Staaten? Find ich toll«, sagte Keith gerade. »New York? Toll. Madison Square. Park Central. Find ich toll.« Er fuhr zusammen und verstummte, als er meine Tasche aus dem Kofferraum hob. »Das ist ja eine Kirche …«, sagte er staunend.
»Es war mal ein Pfarrhaus oder so was.« Ich zeigte auf die gravierte Tafel hoch oben im Mauerwerk. Anno Domini 1876.
»1876!«, sagte er. »Dann hat das also alles mal ’nem Pfaffen gehört.«
Seinem Gesicht nach war klar, dass Keith jetzt über den tragischen Rückgang des Bedarfs an Pfarrern grübelte. Tja, die Waren, das Zeug, das die Pfarrer unterschiedlicher Art vermittelten, brauchten die Leute noch immer. Aber Pfarrer brauchten sie nicht.
Mit nicht geringen Höflichkeitsbekundungen trug Keith meine Tasche durch den eingezäunten Vorgarten hinein und wartete, während ich bei der Frau im Souterrain meine Schlüssel holte. Nun kommt einem die Lichtgeschwindigkeit im normalen Alltag nicht allzu häufig unter: Nur, wenn es blitzt. Die Schallgeschwindigkeit ist da schon vertrauter: der Mann in der Ferne mit einem Hammer. Wie auch immer, ein Mach-2-Knall ist ein plötzliches Ereignis, und unter so etwas duckten Keith und ich uns nun plötzlich: Den massierten Frequenzen dreier Düsenjäger, die über die Hausdächer schossen. »Mann«, sagte Keith. Und ich sagte es auch. »Was ist das denn?«, fragte ich. Keith zuckte die Achseln, mit Gleichmut, mit mildem Hochmut. »Geheimhaltung, ne. Schleier des Geheimnisses sozusagen.«
Wir traten durch eine Doppeltür ein und gingen eine breite Treppe hoch. Ich glaube, wir waren beide gleichermaßen beeindruckt von der Opulenz und den Ausmaßen der Wohnung. Das ist vielleicht ein Laden, muss ich schon sagen. Nach ein paar Wochen hier hätte sich sogar der große Presley so ganz allmählich nach der Eleganz und Schlichtheit von Graceland zurückgesehnt. Keith ließ seinen hellen Blick mit dem grausamen und doch professionellen Auge des Plünderers umherschweifen. Zum zweiten Mal an dem Morgen zog ich nonchalant die Möglichkeit in Betracht, gleich umgebracht zu werden. Zehn Minuten später wäre Keith dann wieder draußen, über der Schulter meine Reisetasche, ausgebeult von Einrichtungsgegenständen. Stattdessen fragte er mich, wem das gehörte und was der Besitzer tat.
Ich sagte es ihm. Keith machte ein skeptisches Gesicht. Das passte einfach nicht. »Vor allem fürs Theater und fürs Fernsehen«, sagte ich. Nun war alles klar. »TV?«, sagte er cool. Aus irgendeinem Grund setzte ich hinzu: »Ich bin auch beim Fernsehen.«
Keith nickte wissend. Auch etwas ernüchtert; und ich muss sagen, er berührte mich, dieser ernüchterte Blick. Natürlich (dachte er) kennen sich die TV-Leute alle untereinander; sie fliegen zwischen den großen Städten hin und her und leihen einander die Wohnung. Vernünftig. Ja, hinter den ganzen Oberflächenaktivitäten von Keith’ Augen bildete sich die Vision einer himmlischen Elite heraus, die ihre Spur quer durch die Troposphäre zog wie das Satellitenfernsehen – über, jenseits von allem.
»Ja gut, ich komm auch bald im Fernsehen. Hoffentlich. In ein paar Monaten. Darts.«
»Darts?«
»Darts.«
Und dann fing es an. Er blieb dreieinhalb Stunden. Die Leute sind unglaublich, nicht? Die erzählen einem alles, wenn man ihnen nur die Zeit gibt. Und ich war schon immer ein guter Zuhörer. Ich war schon immer ein talentierter Zuhörer. Ich möchte es wirklich hören – ich weiß auch nicht, warum. Klar, zu dem Zeitpunkt war mir das noch völlig gleichgültig; ich hatte keine Ahnung, was da passierte, was sich da unmittelbar vor mir herausbildete. Binnen einer Viertelstunde wurde mir in schockierenden Einzelheiten von Analiese erzählt – und von Iqbala, Trish und Debbee. Lakonische, aber unverfrorene Erwähnung von Frau und Tochter. Und dann der ganze Kram über Gewaltverbrechen und Chick Purchase. Und New York. Gut, ich gab ihm dabei anständig zu trinken: Bier, vielmehr Lager, in Mark Aspreys Kühlschrank in Massen gestapelt wie Bomben in ihren Gestellen. Am Ende verlangte er 25 £ für die Fahrt (vielleicht ein TV-Sonderpreis) und schenkte mir einen Kugelschreiber in Form eines Darts, mit dem ich jetzt diese Worte schreibe. Er sagte mir auch, er sei jeden Mittag und Abend in einem Pub namens The Black Cross in der Portobello Road zu finden.
Da würde ich ihn finden, o ja. Und die Dame auch.
Nachdem Keith gegangen war, legte ich mich sofort in die Falle. Nicht, dass ich darauf viel Einfluss gehabt hätte. Zweiundzwanzig Stunden später schlug ich wieder die Augen auf und wurde von einem unwillkommenen und Besorgnis erregenden Anblick begrüßt. Dem meiner selbst, im Deckenspiegel. Am Kopfteil ist auch ein Spiegel und an der Wand gegenüber noch einer. Das hier ist ein Spiegelsaal, die reinste Spiegelhölle … Ich sah – ich sah nicht gut aus. Ich schien zu flehen, mich selber anzuflehen. Dr. Slizard meint, das werde noch ein rundes Vierteljahr dauern, dann werde alles anders werden.
Inzwischen habe ich mich ein bisschen umgesehen; ja, ich habe etliche zaghafte Ausflüge hinter mich gebracht. Das Erste, was mir auf der Straße auffiel (ich wäre fast hineingetreten), fand ich durch und durch englisch: Ein aufgeweichter Weißbrotlaib, wie das Gehirn eines Tieres, das dümmer ist als jedes Schaf. Aber bis jetzt finde ich es nicht so schlimm, wie manche sagen. Wenigstens ist alles verständlich, mehr oder weniger. Zehn Jahre war ich jetzt weg, und was ist seitdem passiert? Zehn Jahre relativer Niedergang.
Wenn London ein Pub ist und man die ganze Wahrheit will, wo geht man hin? Man geht in ein Londoner Pub. Und der eine Augenblick im Black Cross brachte die ganze Geschichte ins Rollen. Keith habe ich in der Tasche. Keith ist cool. Und jetzt kümmere ich mich um unseren Dritten im Bunde, das Opfer, den armen Wurm, Guy Clinch, der zu meinem Entsetzen ein richtig reizender Mensch zu sein scheint. Ich finde, ich habe ein Riesentalent, mich einzuschmeicheln. Aber ohne das Mädchen wäre gar nichts ins Rollen gekommen. Ohne das Mädchen hatte ich nicht die geringste Hoffnung. Nicola Six war das Wunder, die absolute Ausgangsbasis. Sie ist ideal für mich. Und jetzt nimmt sie die Sache selber in die Hand.
Die Engländer, der Herr beschütze sie, sie reden übers Wetter. Aber heutzutage macht das doch jeder. Im Moment ist das Wetter superatmosphärisch und daher gewissermaßen supermeteorologisch (Kann man das wirklich Wetter nennen?). So soll es noch den ganzen Sommer bleiben, sagen alle. Das finde ich gut, mit einer Einschränkung. Es hat sich dafür das falsche Jahr ausgesucht: das Jahr des seltsamen Benehmens. Ich schaue zu ihm hinaus. Das Wetter, wenn wir es noch so nennen können, ist häufig sehr schön, aber es treibt mich fast zur Hysterie, wie überhaupt alles jetzt.
Kapitel 2: Die Mordgeweihte
Das schwarze Taxi wird davonfahren, unwiderruflich und für immer, der Fahrer von der Mordgeweihten bezahlt und mit einem hübschen Trinkgeld versehen. Sie wird die Sackgasse entlanggehen. Der schwere Wagen wird schon warten; seine Scheinwerfer werden aufflammen, während er langsam auf sie zurollt. Er wird anhalten, mit laufendem Motor, die Beifahrertür wird aufschwingen.
Sein Gesicht wird im Dunkel verborgen sein, aber sie wird zersplittertes Glas auf dem Beifahrersitz sehen und das Autowerkzeug griffbereit auf seinem Schoß.
»Steig ein.«
Sie wird sich vorbeugen. »Du«, wird sie in schockierter Erkenntnis sagen: »Immer du.«
»Steig ein.«
Und sie wird einsteigen …
Was ist diese Bestimmung, dieser Zustand (und vielleicht tendiert er wie die Wortendung zum Weiblichen: Zu einem weiblichen Ende), was ist das, was heißt es, eine Mordgeweihte zu sein?
Im Fall der Nicola Six, hochgewachsen, dunkel, vierunddreißig, war es mit einer Wahnvorstellung verbunden, lebenslang, aber an sich durchaus zu kontrollieren. Von Anfang an, von dem Augenblick an, da sie begann, zusammenhängend zu denken, wusste Nicola zwei seltsame Dinge. Das zweite seltsame Ding war, dass sie niemandem von dem ersten seltsamen Ding erzählen durfte. Das erste seltsame Ding war Folgendes: Sie wusste immer, was als Nächstes geschehen würde. Nicht ständig (die Gabe wurde nicht obsessiv genutzt) und nicht in allen Einzelheiten; doch sie wusste immer, was als Nächstes geschehen würde. Gleich von Beginn an hatte sie eine Freundin – Enola, Enola Gay. Enola gab es eigentlich nicht. Enola kam von innen aus Nicola Six’ Kopf. Nicola war ein Einzelkind, und sie wusste, sie würde es immer sein.
Man kann sich vorstellen, wie das abgelaufen sein mag. Nicola ist beispielsweise sieben Jahre alt, und ihre Eltern nehmen sie zu einem Picknick mit einer anderen Familie mit: Na, die hübsche Dominique wird auch da sein, eine Freundin vielleicht, eine lebendige Freundin für das Einzelkind. Doch die kleine Nicola, in romantische Gedanken versunken und mit Enola völlig glücklich, will nicht mitkommen (Seht nur, wie sie schreit und sich festklammert!). Sie will nicht mitkommen, weil sie weiß, dass der Nachmittag in einer Katastrophe enden wird, mit Blut und Jod und Tränen. Und so kommt es auch. Hundert Meter von den Erwachsenen entfernt (die so unzugänglich um das quadratische Tuch in der Sonne gruppiert sind) steht Nicola mit ihrer neuen Freundin, der hübschen Dominique, am Rande eines Abhangs. Und natürlich weiß Nicola, was als Nächstes geschehen wird. Das Mädchen wird zögern oder stolpern: Nicola wird die Arme hochreißen, um sie festzuhalten, und ihre Spielgefährtin dabei unabsichtlich hinabstoßen, hinab ins Geröll und Gerank. Dann wird sie losrennen und schreien müssen und schweigend irgendwo hinfahren und sich auf eine Krankenhausbank setzen, wo sie mit den Beinen schlenkern und teilnahmslos um ein Eis bitten wird. Und so kommt es auch. Mit vier hat sie im Fernsehen die Warnungen gesehen und die Kreise konzentrischer Verwüstung, und London war wie das Bull’s-Eye in der Mitte des Boards. Sie wusste, dass auch das geschehen würde. Es war nur eine Frage der Zeit.
Wenn Nicola brav war, dann war sie sehr, sehr brav. Aber wenn sie böse war … Ihren Eltern gegenüber hatte sie keine Gefühle, weder in die eine noch in die andere Richtung: Das war ihr stummes, verborgenes Geheimnis. Sie waren ohnehin beide zusammen gestorben, wie sie es immer gewusst hatte. Warum sie also hassen? Warum sie lieben? Nachdem sie den Anruf bekommen hatte, war sie automatisch zum Flughafen gefahren. Der Wagen war wie ein windiges schwarzes Loch. Ein Vertreter der Fluggesellschaft brachte sie in die VIP-Lounge: Darin befanden sich eine Bar und vierzig, fünfzig Leute in unterschiedlichen Stadien der Verzweiflung. Sie trank den Brandy, den ihr der Steward in die Hand gedrückt hatte. »Kostenlos«, hatte er bestätigt. Ein Fernseher wurde hereingerollt. Und dann zeigten sie unglaublicherweise (selbst Nicola war konsterniert) Liveaufnahmen von dem zerschellten Wrack und von den Leichensäcken, die auf den Feldern Frankreichs aufgereiht waren. Ein alter Herr, völlig außer sich, bot einem PR-Mann in Uniform immer wieder Geld an. Nicola trank kühl weitere Brandys und überlegte, wie der Tod die Menschen so unvorbereitet treffen konnte. In jener Nacht trieb sie es akrobatisch mit einem seelenlosen Piloten. Da war sie neunzehn und schon lange von zu Hause weg. Auf machtvolle, wunderbare, unbeherrschbare Weise attraktiv, aber noch nicht schön. Doch sie war bereits ein böser Wirbelwind, der nichts Gutes mit sich brachte.
Allgemeiner betrachtet – wenn man sich die menschlichen Wracks ansah, die sie in ihrem Sog zurückließ, die Nervenzusammenbrüche, die ruinierten Karrieren, die Selbstmordankündigungen, die zerstörten Ehen (und noch mieseren Scheidungen) – hatte Nicolas Fertigkeit, in die Zukunft zu schauen, sie mit ein, zwei handfesten Gewissheiten ausgestattet: Dass keiner sie jemals genug lieben würde und dass die, die es dennoch taten, es nicht wert waren, wiedergeliebt zu werden. Die typische Nicola-Romanze pflegte an der Tür ihrer Mansardenwohnung zu enden, wobei der gerade aktuelle Mann den Gang entlangsprintete, die Hose um die Knie, eine zerrissene Jacke über das zerrissene Hemd geworfen, und Nicola (mal im Nachthemd, mal in Unterwäsche, mal nackt unter einem flüchtig umgewickelten Handtuch) ihm dicht auf den Fersen, entweder um ihn mit einem Hagel von Beleidigungen und einem gekonnt geschleuderten Aschenbecher hinauszujagen oder um mittels Entschuldigungen, Liebkosungen oder schierer Gewalt seine Liebe zurückzugewinnen. In jedem Fall lief der gerade aktuelle Mann weiter. Oft stürmte sie bis auf die Straße hinaus. Mehrere Male hatte sie das wartende Auto mit einem Ziegelstein bearbeitet. Andere Male hatte sie sich davorgelegt. Das alles hatte natürlich nichts geändert. Stets fuhr der Wagen mit der höchsten Geschwindigkeit, zu der er technisch in der Lage war, davon, zuweilen allerdings zugegebenermaßen im Rückwärtsgang. Nicolas Männer und ihre Fluchtgeschwindigkeiten … Wieder in der Wohnung, wo sie dann vielleicht das Blut am Handgelenk stillte und sich einen Eiswürfel auf die Lippen (oder einen Klumpen Fleisch aufs Auge) presste, betrachtete sie sich im Spiegel, besah sich, was übrig geblieben war, und dachte, wie seltsam – wie seltsam, dass sie es von Anfang an gewusst hatte. Sie hatte gewusst, dass es so enden würde. Und jedes Mal hatte es sich bestätigt. Das Tagebuch, das sie führte, war daher nur die Chronik eines vorhergesagten Todes …
Als einer jener Menschen, die gar nichts trinken sollten, trank Nicola in Mengen. Aber das wechselte. Ein paar Mal im Monat, morgens, stolzgesteift, betäubt vom Aspirin (und übermütig von Bloody Marys), gelobte sie ernsthaft Besserung: Beispielsweise nur zwei kolossale Cocktails vor dem Essen, zum Essen dann als grobes Maximum eine halbe Flasche Wein und nur den einen Whisky oder digestif vor dem Schlafengehen. Häufig hielt sie sich an die neue Verordnung bis zum Whisky oder digestif vor dem Schlafengehen am nächsten Tag, beide natürlich eingeschlossen. Doch da lag das Schlafengehen schon wieder ganz fern. Davor musste stets reichlich gebrüllt und geprügelt werden. Und was war nach dem Schlafengehen oder nach dem ersten Schlafengehen, wenn noch etliche Runden des einen oder anderen Kampfes anstanden? Es wurde also nie etwas damit. Sie sah sich scheitern (da, es wird mal wieder nichts), also wurde es auch nichts. Trank Nicola Six allein? Ja, sie trank allein. Aber hallo. Und warum trank sie allein? Weil sie allein war. Und jetzt, nachts, war sie mehr allein als früher. Und schon gar nicht auszuhalten war, wie sich herausstellte, die letzte Zeitschwade, bevor der Schlaf kam, der Weg vom langen Tag zur noch viel längeren Nacht, ein kleiner Tod, während die Gedanken noch aufgeregt herumflatterten. Und so knallte das Glas auf den runden Tisch; der angeblich geruchfreie Aschenbecher gab einen letzten schwachen Rauchwirbel von sich, und dann das Kleinkindgeeier, der verpönte Gang Richtung verhasstes Bettzeug. So musste es enden.
Das andere Ende, der wirkliche Tod, das Letzte, was in der Zukunft schon existierte, wurde größer, während sie vorwärtsstrebte, um sich ihm entgegenzustellen oder es zu begrüßen. Wo würde sie den Mörder sehen, wo würde sie ihn finden – im Park, in der Bibliothek, im traurigen Café, oder würde er auf der Straße halb nackt an ihr vorübergehen, eine Bohle über der Schulter? Es gab einen Ort und ein Datum, sogar einen Zeitpunkt für den Mord: wenige Minuten nach Mitternacht, an ihrem fünfunddreißigsten Geburtstag. Nicola würde durch das Dunkel der Sackgasse stöckeln. Dann der Wagen, das Quietschen der Bremsen, die aufschwingende Tür und der Mörder (sein Gesicht im Schatten, das Autowerkzeug auf dem Schoß, eine Hand nach ihren Haaren ausgestreckt), der sagte: Steig ein.Steig ein … Und sie stieg ein.
Das stand fest. Das stand geschrieben. Der Mörder war noch kein Mörder. Doch die Mordgeweihte war immer eine Mordgeweihte gewesen.
Wo würde sie ihn finden, wie würde sie ihn sich erträumen, wann würde sie ihn rufen? Am entscheidenden Morgen erwachte sie schweißnass von den üblichen Albträumen. Sie nahm sogleich ein Bad und lag lange darin, mit großen Augen, die Haare hochgesteckt. An entscheidenden Tagen fühlte sie sich immer als Objekt prüfender Blicke, lüsterner und wütender Blicke. Ihr Kopf wirkte, verglichen mit den sich schlängelnden Zerrbildern der Riesin unterm Wasserspiegel, klein oder komprimiert. Mit dramatischer Abruptheit erhob sie sich aus der Wanne und hielt inne, bevor sie nach dem Handtuch griff. Dann stand sie nackt mitten in dem warmen Raum. Ihr Mund war voll und ungewöhnlich breit. Ihre Mutter hatte immer gesagt, es sei ein Hurenmund. An beiden Winkeln schien er sich um zwei zusätzliche Zentimeter auszudehnen, wie der Mund des Clownmädchens in der Pornografie. Doch die Wangen des pornografischen Clownmädchens wären weiß geschminkt, weißer als die Zähne. Nicolas Gesicht war immer dunkel, und ihre Zähne hatten einen schattenhaften Schimmer, standen nach innen, wie um die Breite der Lippen auszugleichen, oder auch nur infolge der Saugkraft der gefräßigen Seele. Ihre Augen wechselten je nach Licht bereitwillig, begierig die Farbe, doch ihr Grundton war ein vehementes Grün. Sie hatte so eine Vorstellung vom Tod der Liebe …
Die Beerdigung, die Einäscherung, der sie an dem Tag beiwohnen sollte, war nicht sehr wichtig. Nicola Six, die die Verstorbene kaum gekannt hatte und sich kaum an sie erinnerte, hatte eine lästige halbe Stunde am Telefon verbringen müssen, bis sie es geschafft hatte, überhaupt dazugebeten zu werden. Vor Jahren hatte die Verstorbene Nicola für kurze Zeit in ihrem Antiquitätenladen beschäftigt. Ein paar Monate hatte die Mordgeweihte zigarettenrauchend in dem freudlosen Loch hinter der Fulham Road gehockt. Dann war sie nicht mehr hingegangen. So lief es in letzter Zeit immer mit Nicolas Jobs, die eine Weile doch ziemlich zahlreich gewesen waren. Sie machte den Job, und dann, nach einer eskalierenden und schließlich endlosen Serie von morgendlichen Verspätungen, vierstündigen Mittagspausen und frühem Nachhausegehen, betrachtete man sie als eine, die alle im Stich gelassen hatte (nie war sie da), und sie ging gar nicht mehr hin. Nicola wusste immer, wann es so weit war, und ging genau an dem Tag auch nicht mehr hin. Dass Nicola wusste, wie es enden würde, belastete jeden Job, den sie annahm, mit einer großen Anspannung, gleich von der ersten Woche, dem ersten Tag, dem ersten Morgen an … In der weiter zurückliegenden Vergangenheit hatte sie als Gutachterin für einen Verlag gearbeitet, als Cocktailbardame, als Telefonistin, als Croupier, als Reisebegleiterin, als Model, als Bibliothekarin, als Kissogramm-Girl, als Archivarin und als Schauspielerin. Schauspielerin – damit hatte sie es ziemlich weit gebracht. Mit Anfang zwanzig hatte sie Repertoire gemacht, Royal Shakespeare, Weihnachtsmärchen, ein paar Fernsehspiele. Noch immer hatte sie Koffer voller Kostüme und ein paar Videos (armes kleines reiches Mädchen, flotte Neuvermählte, nackte Huri, aufreizend erhascht durch Nebelschwaden und Schleier). Spielen war für sie Therapie, wenngleich dramatische Rollen sie eher noch mehr verwirrten. In Komödien, Farcen, Sahnetortenslapsticks fühlte sie sich wohl. Die beständigste Zeit ihres Erwachsenenlebens war das Jahr in Brighton gewesen, wo sie die Hauptrolle in Jack und die Bohnenranke spielte. Einen Mann zu spielen schien ihr gutzutun. Sie gab den Jack in kurzem Blazer und schwarzer Strumpfhose und mit hochgesteckten Haaren. Millionen Mütter fragten sich, warum ihre Söhne so grün und fiebrig nach Hause kamen und sich ohne Abendessen gedrückt ins Bett verzogen. Doch dann löste sich ihre Schauspielerseite aus der Verankerung und trieb hinaus ins wirkliche Leben.
Ein Handtuch um den Bauch, saß sie vor dem Spiegel, der mit seinem Proszenium brutaler Birnen selbst ans Theater gemahnte. Wieder hatte sie das Gefühl, dass unfreundliche Blicke auf ihrem Rücken spielten. Sie ging ihr Gesicht wie eine Künstlerin an, Trauerfarben, Schwarz, Beige, Blutrot. Sie stand auf, wandte sich zum Bett und begutachtete ihre Trauerkleidung und deren kompromissloses Schwarz. Selbst ihre aufwendige Unterwäsche war schwarz; selbst die Clips an ihrem Hüftgürtel waren schwarz, schwarz. Sie öffnete den Kleiderschrank, der den hohen Spiegel freigab, stellte sich seitlich davor, eine Hand flach auf dem Bauch, und fühlte alles, was eine Frau in einem solchen Augenblick zu fühlen hofft. Als sie sich aufs Bett setzte und sich für den ersten schwarzen Strumpf vorneigte, riefen Geist und Körper Erinnerungen an frühere Waschungen, Selbstuntersuchungen, intime Vorbereitungen zurück. An ein Wochenende auf dem Land mit einem neuen gerade aktuellen Mann. Freitagnachmittags im Auto nach dem schweren Lunch, während sie durch Swiss Cottage zur Autobahn schlichen oder auf verschlungenen Routen durch Clapham und Brixton und weiter hinausfuhren (dorthin, wo London das Land nur widerwillig freizugeben scheint, wo es sich bis an die Felsen und Kliffe und das Wasser über die Felder ausbreiten will), verspürte Nicola einen Druck in ihrem besten Höschen, gewissermaßen das Gegenteil von Sex, als regte sich ein neues Hymen, das sich da rosa bildete. Wenn sie dann in Totteridge oder Tooting ankamen, war Nicola wieder Jungfrau. Mit welcher Verwirrung pflegte sie sich der wortreichen Enttäuschung zuzuwenden, dem plappernden Fehler neben ihr mit den Händen am Steuer. Nach einem kurzen Blick auf die Bäume in der Dämmerung, eine Kirche, ein verdattertes Schaf trank Nicola dann im Hotel oder gemieteten Häuschen wenig und schlief unberührt, die Hände überm Herzen gekreuzt wie eine Heilige. Eingeschnappt entschlummert, erwachte der gerade aktuelle Mann dann dennoch, um festzustellen, dass praktisch sein halber Rumpf in Nicolas Mund steckte; und der Samstagmittag war dann immer eine Orgie an allen Fronten. Bis Sonntag hielt sie es kaum einmal durch. Noch am gleichen Abend war das Wochenende vorbei: Eine fassungs- und wortlose Rückfahrt über die Autobahn, eine Minitaxifahrt für eine Person, von gespenstischer Länge und Kostspieligkeit, oder Nicola Six stand allein auf einem triefnassen Bahnsteig, aufrecht und unbewegten Blicks, mit einem Koffer voller Schuhe.
Über eins wollen wir uns jedoch im Klaren sein: Sie hatte große Fähigkeiten – große Fähigkeiten. Alle Frauen, deren Gesicht und Körper mehr oder weniger ins zeitgemäße Klischee passen, haben eine Ahnung von diesem Privileg und Zauber. Während ihres glanzvollen Zenits, wie kurz und relativ auch immer, stehen sie im erotischen Mittelpunkt. Manche kommen sich dabei verloren vor, manche umstellt oder bedrängt, doch da stehen sie nun einmal, in einem Wald teaksolider Verehrung von der Größe Chinas. Und bei Nicola Six war die Sehnsucht nach dem Geschlecht vermittelt, war fantastisch überhöht: Sie kam in der Form menschlicher Liebe über sie. Sie hatte die Macht, Liebe zu wecken, nahezu überall. Von wegen starke Männer zum Weinen bringen? Fünfzig-Kilo-Pazifisten rempelten sich durch Straßenkrawalle, um zu Hause zu sein, falls sie anrief. Familienväter ließen ihre kranken Kinder im Stich, um im Regen vor ihrer Wohnung auszuharren. Geistig minderbemittelte Bauarbeiter und Bankiers sandten ihr Sonette. Gigolos machte sie arm, Hengste kastrierte sie, Herzensbrecher brachte sie ins Krankenhaus. Sie wurden nie wieder die Alten, sie verloren den Kopf. Und die Sache mit ihr (Was war das nur mit ihr?), die Sache mit ihr war, dass sie diese Liebe annehmen und postwendend ins Gegenteil verkehrt zurückschicken musste, nicht einfach nur storniert, sondern ruiniert. Charakter ist Bestimmung; und Nicola wusste, wo ihre Bestimmung lag.
Eine Viertelstunde später rief sie, herausgeputzt für den Tod, ihr schwarzes Taxi, trank zwei Tassen schwarzen Kaffee und genoss gierig den schwarzen Tabak einer französischen Zigarette.
In Golders Green schickte sie das Taxi weg, und es fuhr für immer davon. Sie wusste, irgendjemand würde sie mit zurücknehmen; bei Beerdigungen war das immer so. Der Himmel über dem Backsteingebäude, das sie betrat, war jedenfalls trüb genug, dass ein Mensch mit Gleichmut von ihm Abschied nehmen konnte. Wie immer war sie ziemlich spät dran, doch der Hagel fahler Blicke drang nicht zu ihr durch. Ohne auch nur den Versuch zu machen, unauffällig zu sein, ging sie gleichmütig nach hinten und glitt in eine leere Reihe, woran kein Mangel bestand. Die Verstorbene wurde nicht von vielen verabschiedet. Mehr bekam man also nicht: die schmierigen Koteletten und die Onanistenblässe eines alten Teds im schwarzen Anzug und das säkulare Leichenbegängnis. Nicola sehnte sich gleichermaßen nach einer Zigarette und den Zeilen, die man manchmal hörte: Eine kurze Zeit auf Erden, voller Elend. Besonders bewegte sie immer – weswegen sie auch kam – das Spektakel der hinterbliebenen Alten, insbesondere der Frauen. Die armen Schafe, die verdatterten Schafe (sogar die bloße Natur macht sie verdattert), verlässlich wie Berufstrauernde, aber eigentlich zu gut darin, zu leidenschaftlich, mit Haaren wie ein Flederwisch und hinfällig gekrümmt von brutaler Trauer, diese selbstsüchtigen Ungeheuer … Nicola gähnte. Alles um sie herum roch nach Schule, die Büsten und Tafeln und die ganzen Paneele, die mit ihrem Holz nur ersticken und dämpfen wollten. Sie nahm kaum wahr, dass diskret der Sarg hereingerollt wurde; sie wusste, er war leer, der Leichnam schon vom Feuer in Luft aufgelöst.
Anschließend dann auf dem Wandelplatz (eine schwarze Amsel flog tief und schräg über das nasse Gras) erklärte Nicola Six, die sehr, sehr gut aussah und wirkte, diversen Interessierten, wer sie war und was sie hier tat. Es tröstete die Alten, bei den vergleichsweise Jungen eine solche Pietät zu finden. Sie musterte die Gesellschaft mit ahnungsvoll prüfenden Blicken und enttäuschtem innerlichem Achselzucken. Auf dem Parkplatz bekam sie mehrere Mitfahrgelegenheiten angeboten; eine nahm sie mehr oder weniger wahllos an.
Der Fahrer, der Bruder des Schwagers der Toten, ließ sie, wie angewiesen, in der Portobello Road aussteigen. Nicola verabschiedete sich brav von ihm und seiner Familie, streckte ihnen eine behandschuhte Hand entgegen und nahm Dank und Lob dafür entgegen, dass sie gekommen war. Sie hörte sie noch lange nachdem der Wagen wieder abgefahren war, während sie auf der Straße stand und ihren Schleier richtete. So ein nettes Mädchen. Wie nett von ihr, dass sie gekommen ist. Diese Haut! Diese Haare! Auf der ganzen Rückfahrt hatte Nicola gedacht, wie gut jetzt eine Zigarette wäre, weiß und rund zwischen ihren schwarzen Fingern. Doch die Zigaretten waren ihr ausgegangen, nachdem sie sich auf dem Hinweg nach Golders Green fast mit Tabak vergast hätte. Nun ging sie die Portobello Road entlang und erblickte ein Pub, an dessen Namen sie Gefallen fand. »TV UND DARTS« lautete eine weitere Empfehlung auf einem gemalten Schild an der Tür, und daran war ein Stück Pappe angeheftet, das »UND FLIPPA« verkündete. Sämtliche Himmel Londons schienen sich unmittelbar über ihr zu versammeln, der Donner kurz davor, seinen Hammer herabzuwerfen …
Sie betrat das Black Cross. Sie betrat das Pub und seine Trübnis. Ihr war, als setzte alles einen Herzschlag lang aus, als die Tür sich hinter ihr schloss, doch das hatte sie erwartet. Überhaupt wäre es ein schlechter Tag (und der Tag würde nie kommen), wenn sie einen Raum voller Männer beträte, ein überfülltes Männerklo wie das da, und sich keine Köpfe umdrehten, nicht aufgestöhnt und nicht geflüstert würde. Sie ging geradewegs zur Bar, hob mit beiden Händen ihren Schleier wie eine Braut, ließ den Blick über die Hauptakteure der Szene schweifen, und sofort wurde ihr schmerzlich, mit schwangerem Stocken, mit eindringlicher Klarheit bewusst, dass sie ihn gefunden hatte, ihren Mörder.
Als sie endlich wieder in ihrer Wohnung war, legte Nicola ihre Tagebücher auf dem runden Tisch aus. Sie machte einen Eintrag, der ungewöhnlich knapp und detailliert war: den letzten Eintrag. Die Notizbücher, die sie dazu verwandte, waren italienische, die Deckel mit lateinischer Schrift verziert … Nun hatten sie ihren Zweck erfüllt, und sie überlegte, wie sie sie loswerden könnte. Die Geschichte war zwar nicht zu Ende, aber das Leben. Sie stapelte die Bücher aufeinander und griff nach einem Band … »Ich habe ihn gefunden. In der Portobello Road, in einer Kneipe namens Black Cross, habe ich ihn gefunden.«
Ich glaube, es war Montherlant, der gesagt hat, dass das Glück sich mit Weiß schreibt: Man sieht es nicht auf dem Blatt. Den Brief mit der ausländischen Briefmarke, der von gutem Wetter, angenehmem Essen und bequemer Unterkunft berichtet, liest man nicht mit annähernd so viel Freude wie den, der von verrottenden Chalets, Durchfall und Nieselregen berichtet. Wer anders als Tolstoi hat das Glück so richtig mit Schwung aufs Blatt gebracht? Wenn ich mir nun Kapitel 3 vornehme, wenn ich mir nun Guy Clinch vornehme, dann muss ich, na ja, nicht Glück, aber doch immerhin Nettigkeit hinkriegen. Das wird hart.
In dem Augenblick, als Keith Talent Nicola Six erblickte, ließ er seinen dritten Dart fallen. Und fluchte. Der 32-Gramm-Wolfram-Trebler hatte seinen großen Zeh durchbohrt … Ich hatte gedacht, ich könnte hier ein hübsches Sinnspiel einbauen. Amors Dart oder so etwas. Pfeile des Begehrens? Doch es war nicht Begehren, was Nicola Six in Keith Talent erregte. Nicht in erster Linie. Ich würde sagen, zuerst kamen Gier und Furcht. Guy Clinch, der am Flipperautomaten auf Rekordjagd war, erstarrte mitten im Gefuchtel: Man konnte die Kugel ins Loch kollern hören. Dann Stille.
Während sich die Szene entwickelte, verzog ich mich, wie es so schön heißt, in dèn Hintergrund. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was da vor meinen Augen Gestalt annahm. Keine Ahnung? Na ja, eine leise vielleicht. Der Augenblick in dieser Kneipe, dieser Pub-Augenblick, auf den werde ich immer wieder zurückkommen müssen. Während ich mich an der Bar entlangdrückte, war ich nur im zivilen Sinn erregt, das allerdings gewaltig. Jedes Pub hat seinen Superstar, seinen Helden, seinen Pub-Athleten, und Keith war der Ritter vom Schwarzen Kreuz: Er musste vortreten, um sich mit der königlichen Touristin zu befassen. Das musste er schon für die Jungs: für Wayne, Dean, Duane, für Norvis, Shakespeare, Big Dread, für Godfrey den Barmann, für Fucker Burke, für Basim und Manjeet, für Bogdan, Maciek, Zbigniew.
Keith handelte im Namen der Männlichkeit. Ebenso handelte er natürlich im Namen der Klasse. Klasse! Ja, so was gibts noch. Wahnsinniges Stehvermögen, wider alle historischen Erwartungen. Was ist das nur mit diesem alten, uralten Kram? Das Klassensystem weiß einfach nicht, wann Feierabend ist. Sogar ein Super-GAU würde es, meine ich, kaum einbeulen. Wenn die Leute dann durch das jodierte Scheißhaus kriechen, das einmal England war, würden sie noch immer über Akzente und abgespreizte kleine Finger grübeln, über Mädchennamen und Couch oder Sofa, darüber, wie man in Gesellschaft eine Kakerlake isst. Also wie nun? Trennt man erst den Kopf ab, oder fängt man bei den Beinen an? Um Klassen hatte Keith sich nie geschert; er hatte sozusagen nie darüber nachgedacht; als Teil einer längst vergangenen Ära, was immer das auch war, hatte das Klassensystem ihn nie gekümmert. Keith wäre ziemlich überrascht, würde man ihm sagen, dass gerade das Klassensystem jeden seiner lichten Momente vergiftete. Jedenfalls lag es, unterschwellig oder sonst wie, am Klassensystem, dass Keith bei seiner Kontaktaufnahme mit Nicola Six einen dritten Akteur hinzuzog. Es lag am Klassensystem, dass Keith Guy Clinch hinzuzog. Aber vielleicht war es auch die Mordgeweihte. Vielleicht brauchte sie ihn. Vielleicht brauchten sie ihn beide, als eine Art Treibstoff.
Ob ich ihn brauche? Ja. Offensichtlich. Guy hat sich mir aufgedrängt, genauso wie die beiden anderen.
Gegen vier verließ ich das Black Cross. Es war mein dritter Besuch dort. Ich brauchte die Gesellschaft, so haarsträubend sie zum großen Teil war, und unter Keith’ Patronage machte ich mich da auch ganz gut. Er stellte mich den Polacken und den Brüdern vor, das heißt, er stellte mich vor ihnen zur Schau. Einmal spielte er Billard mit mir. Er zeigte mir, wie man den Spielautomaten austrickste. Ich schmiss etliche Runden und ließ wegen meiner Orangensäfte, meiner Mineralwässer, meiner Colas etliche heftige Anmachen über mich ergehen. Ich fasste mir ein Herz und aß einen Pork-pie. Bislang erst eine richtige Schlägerei. Ein unglaublicher Hagel von Faustschlägen und Kopfstößen, der damit endete, dass Keith eine gestürzte Gestalt, eingekeilt in den Gang zum Männerklo, sorgfältig in ausgesuchte Stellen trat; dann kam er an die Bar zurück, trank einen großen Schluck Bier und ging wieder hin, um noch ein wenig weiterzutreten. Es war zu vernehmen, dass der Übeltäter sich an Deans Darts zu schaffen gemacht hatte. Nachdem der Krankenwagen da gewesen und wieder weg war, beruhigte Keith sich. »Nicht mit den Darts von ’nem Kumpel«, sagte er immer wieder, den Tränen nah und den Kopf schüttelnd. Man brachte ihm Brandys. »Das macht man einfach nicht … nicht mit seinen Darts.«
Gegen vier verließ ich das Black Cross. Ich ging zurück in die Wohnung. Ich setzte mich an den Schreibtisch vor dem Erkerfenster von Mark Aspreys Arbeitszimmer, Studio oder Bibliothek. Eigentlich ist es eher ein Trophäenzimmer. Eigentlich ist das ganze verdammte Haus eine Trophäensammlung. Auf dem Weg vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer – und ich denke da an die signierten Fotos, die erotischen Drucke – fragt man sich, warum er nicht einfach eine Galaxie G-Strings an die Wand genagelt hat. Hier drin ist es anders. Hier ist man umgeben von Pokalen und Schärpen, von Tonys und Guggies, von gerahmten Preisen und Auszeichnungen. Gerühmt und gleichermaßen geschätzt vom Kritiker-Establishment, von den Medien und der Welt der Wissenschaft, besitzt Mark Asprey Ehrentitel, Doktorhüte, je einen Talar von Oxford, Cambridge und dem Trinity College in Dublin. Ich muss mir mal seine Bücher ansehen, die in ungeheuren Mengen, in ungeheuer vielen Ausgaben, in ungeheuer vielen Sprachen herumstehen. Ungarisch. Japanisch.