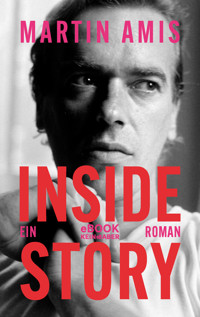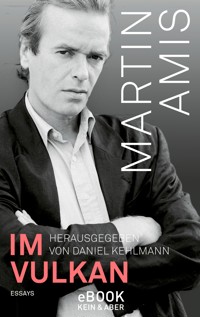
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Martin Amis porträtiert mit unnachahmlicher Offenheit Salman Rushdie, Steven Spielberg oder Donald Trump, schreibt mit frischer Leichtigkeit über Kafka oder Cervantes, immer brillant über die schwarzen Löcher und toten Winkel unserer Gesellschaft. Seine Stimme bekommt eine sentimentale Tiefe, wenn er von der Königsfamilie erzählt, er begleitet Tony Blair zu Angela Merkel, beobachtet das gleichzeitige Heranströmen von Oktoberfestbesuchern und Flüchtlingen in München, schreibt mit sprachlicher Schärfe über nukleare Aufrüstung und den Krieg gegen das Klischee, stets die Zwischenräume, Auslassungen und Verzerrungen unseres Denkens im Blick. Martin Amis nimmt einen in seinen Texten mit, als wären es Abenteuer, die man am besten zu zweit genießt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Martin Amis, geboren 1949 in Oxford, ist einer der bedeutendsten englischen Gegenwartsautoren. Er ist der Verfasser von vierzehn Romanen, zwei Kurzgeschichtensammlungen und sechs Sachbüchern, darunter fünf Essaybände. Für sein Romandebüt Das Rachel-Tagebuch (1973) erhielt er den Somerset Maugham Award. Zu seinen bekanntesten Werken zählen weiterhin Gierig (1984), London Fields (1989), Pfeil der Zeit (1991) und Interessengebiet (2015). Martin Amis lebt in New York.
ÜBER DAS BUCH
Martin Amis porträtiert mit unnachahmlicher Offenheit Salman Rushdie, Madonna oder Donald Trump, schreibt mit einer besonderen Leichtigkeit über John Lennon, immer brillant über den Körper, vernichtend in seiner Ablehnung des Todes, seiner Sorgen und Erniedrigungen. Seine Stimme bekommt eine sentimentale Tiefe, wenn er von der Königsfamilie erzählt, er begleitet Tony Blair zu Angela Merkel, bezeugt das gleichzeitige Heranströmen von Oktoberfestbesuchern und Flüchtlingen in München, schreibt mit analytischer Schärfe über Madonna, nukleare Aufrüstung und den Krieg gegen das Klischee. Jeder Satz schnappt mit frischer und heftiger Genauigkeit zu. Martin Amis hat die einzigartige Fähigkeit, den Leser mitzunehmen, als wären seine Essays Abenteuer, die man am besten zu zweit genießt.
VORWORT
Im Jahr 1993 zog ich in Wiens einziger englischer Buchhandlung eine Neuerscheinung aus dem Regal. Ich war ein nahezu fanatischer Verehrer von Vladimir Nabokov, naturgemäß konnte ich unmöglich an dem Titel Visiting Mrs Nabokov vorbeigehen.
Es war eine andere Epoche, es waren die letzten Jahre, bevor das Internet alles veränderte. Ein Buch aus dem englischsprachigen Ausland zu bestellen, dauerte über einen Monat, und man konnte auch nicht so leicht nachsehen, wer ein Autor war und was er bisher geschrieben hatte. So kam es, dass ich Martin Amis, noch bevor ich seine Romane kannte, als Reporter begegnete, der Véra Nabokov besuchte, Steven Spielberg interviewte, sich Filmsets ansah und Nuklearexperten darüber befragte, ob die Menschheit Chancen aufs Überleben habe. Auf den ersten Blick waren das konventionelle Zeitungs- und Magazintexte, aber auf den zweiten sah man die Gesprächspartner dieses jungen Reporters gewissermaßen zögern und blinzeln – man bemerkte ihre Überraschung darüber, was für eine blendend helle Ausnahmeintelligenz ihnen entgegentrat, und als Leser teilte man ihre Überraschung. Das waren keine gängigen Gebrauchstexte, sondern es waren deren Versionen aus einem Paralleluniversum der Brillanz und Perfektion.
Man kann also Amis’ Essays nicht nur empfehlen, man muss auch vor ihnen warnen, denn ihre Wirkung ist unerhört. Seitdem ich vor einem Vierteljahrhundert Visiting Mrs Nabokov aus dem Regal einer längst nicht mehr existierenden Buchhandlung zog, prägt Amis mein Denken. Lese ich einen neuen Roman, wird irgendwo ein Demagoge gewählt, gerät die Welt aus den Fugen, so kann ich gar nicht mehr anders als mir die Frage stellen: Was wird wohl Amis darüber schreiben? Und dann ertappt man sich als sein langjähriger Leser immer wieder bei dem Versuch, seine Formulierungen vorauszuahnen, aber das gelingt nie, denn nur Amis ist Amis, und nur er verfügt über die einzigartige Mischung aus Klarheit, Bosheit, Mitleid und Witz, die jeden seiner Sätze unverwechselbar macht.
Sieben Bände umfasst dieses essayistische Werk mittlerweile – und hätte er nichts anderes geschrieben, so wäre er allein dadurch schon einer der großen Schriftsteller unserer Zeit. 1986 erschien die Sammlung The Moronic Inferno, 1993 Visiting Mrs Nabokov, 2001 The War Against Cliché und 2008 The Second Plane, ein Buch über den 11. September und den islamischen Fundamentalismus. Im Jahr 2017 folgte als bisher letzte die Sammlung The Rub of Time. Dazu kommen noch zwei Essays in Buchlänge: Experience (dt. Die Hauptsachen), ein Buch über seinen Vater Kingsley, veröffentlicht im Jahr 2000, und Koba the Dread (dt. Koba der Schreckliche), seine Auseinandersetzung mit dem Stalinismus, aus dem Jahr 2002. Beide finden in dieser Sammlung keine Berücksichtigung. Man kann sie nicht zerstückelt in Ausschnitten präsentieren; wer sie lesen will, muss sie ganz lesen.
Amis’ zentrales Charakteristikum ist wohl seine Neugier und durch sie bedingt seine Offenheit. Beginnt er, ein Buch zu lesen, dann merkt man ihm keine vorgefassten Erwartungen an, und unternimmt er eine Reise, so tut er es ohne eine vorgeprägte Idee davon, was ihn am Ziel erwartet; deswegen begleitet man ihn als Leser mit vollkommenem Vertrauen. Diese Offenheit verhindert natürlich nicht, dass auch Amis seine bevorzugten Felder hat, um die er immer wieder kreist; er hat seine Lieblingsautoren – allen voran die »Zwillingsgipfel« Saul Bellow und Vladimir Nabokov – und seine Hauptthemen.
Das Phänomen, das Martin Amis wohl mehr beschäftigt als alle anderen, ist der Terror – in der umfassendsten Bedeutung des Wortes: zunächst der staatliche Terror, den Nationalsozialismus und Kommunismus gegen die eigene Bevölkerung entfesselten, dann der individualisierte Terror des islamischen Fundamentalismus, und dazu noch der große und wirre Schrecken, den die Existenz der Nuklearwaffen über unser Leben legt. Bei aller Bereitschaft zum Spott ist Amis ein hochmoralischer Autor, stets von Neuem erschrocken darüber, was Menschen einander im Namen theoretischer Konstrukte antun, immer verblüfft von dem Schauspiel, wie aus Utopien das blanke Entsetzen wuchert. Kein Schriftsteller der westlichen Welt hat auf den 11. September so schnell und profund, mit solch erstaunlichem Verständnis für das Weltbild der Fanatiker reagiert, ebenso wie eineinhalb Dekaden später keiner das Phänomen des zerstörerischen Horrorclowns Donald Trump mit so viel Verachtung, Witz und Klarheit zu analysieren wusste.
Klarheit – der Begriff drängt sich beim Lesen dieser Essays immer wieder auf. Natürlich sind sie sehr witzig (wer sie lesen kann, ohne je laut zu lachen, lacht ziemlich vermutlich niemals), doch ihre Komik entsteht aus Blitzschlägen des Erkennens. Martin Amis hat das Geschäft des Romanschreibens als »Krieg gegen das Klischee« beschrieben. Ebendiesen Krieg führt er auch in den Essays mit den Mitteln des Paradoxons, der gezielten Übertreibung, des wohlgesetzten Adjektivs und des unverstellten Blicks. Nebeneinandergestellt in ihrer Vielfalt – Reportage, Think Piece, Starporträt, Autobiografie, Erlebnisbericht, Burleske und so mancher Text, der all dies in einem ist –, sind sie tatsächlich nicht weniger als eine Schule des Denkens, Schauens und Zuhörens, eine Impfung gegen Fanatismus und alle Arten geistiger Kurzschlüsse. Im ewigen Krieg gegen die Klischees, der nie ganz gewonnen werden kann, der aber auch nie verloren sein wird, solange es gute Schriftsteller und gute Leser gibt, haben Martin Amis’ Texte die Sprenggewalt einer Nuklearwaffe.
Daniel Kehlmann, August 2018
SALMAN RUSHDIE:VERBANNT AUF DIE TITELSEITE
Salman Rushdie, der Autor eines vieldiskutierten Romans mit dem Titel Die satanischen Verse, ist immer noch bei uns. Es scheint mir wichtig, diesen Umstand hervorzuheben: dass es ihn noch gibt. Er ist in einer Falle gefangen, einer Art Pastiche des eigenen Lebens, denn er sieht sich gezwungen, seine fiktionalen Themen persönlich auszuagieren: Exil, Bann, Bruch, persönliche Neuerfindung. Er bewohnt eine Art Schattenland, aber er bleibt überaus lebendig. Die Rushdie-Diskussion scheint einen Punkt erreicht zu haben, wo niemand mehr in der Lage ist, sich auf normale Weise daran zu beteiligen. In diesem Sinne haben die Kräfte der Humorlosigkeit bereits triumphiert. Rushdies Leben wurde permanent verbogen. Ich bestätige deshalb hiermit, dass seine Menschlichkeit unbeeinträchtigt und vollständig ist.
Direkte Begegnungen mit dem Mann bleiben selten und sind sehr umständlich. Wenn man sich mit dem Minotaurus treffen will, muss man das Labyrinth seiner Sicherheitsvorkehrungen betreten. Doch gibt es unter seinen Freunden immer Nachrichten von diversen Sichtungen und Auftritten: Rushdie, der sich um Mitternacht erbötig macht, die sämtlichen Werke von Bob Dylan zu rezitieren; der letzten Sommer die Weltmeisterschaft im Fernsehen verfolgt (und seine gnadenlosen Parodien der Sportreporter hören lässt); der bei der Darbietung einer ehrgeizig tief gelegten Variante des Twists umfällt; der Pizza isst und Jimi Hendrix lauscht. Rushdies Lage ist wahrhaft manichäisch, aber er ist weder ein Gott noch ein Teufel, er ist nur ein Schriftsteller – komisch und endlos wandelbar, ironisch und leidenschaftlich. Um dies zu bestätigen, hat Rushdie jetzt einen trotzig gutgelaunten und ritterlichen Roman veröffentlicht, ein Kinderbuch für Erwachsene, das Harun und das Meer der Geschichten heißt. Es gibt Zeiten, da sich Rushdies Situation anfühlt wie eine bedeutungslose Nebensächlichkeit, ein chaotischer Zwischenfall; zu anderen Zeiten erscheint sie als etwas von entscheidender Bedeutung, ungeheuer, exemplarisch. Ich vermute, Rushdies Freunde denken jeden Tag an ihn. Die Schriftsteller unter seinen Freunden aber dürften wohl jede halbe Stunde an ihn denken. Er ist immer noch bei uns. Und wir sind bei ihm.
»Als ich die Nachricht zuerst gehört habe, da habe ich gedacht: Ich bin ein toter Mann. Du verstehst: Das wars. Ein Tag noch. Zwei Tage.« Dieses Interview fand im September statt, an einem geheimen Ort. Wir hatten uns über etwas in Verbindung gesetzt, das Harun ein P2C2E genannt hätte: einen Prozess, der zu kompliziert ist, als dass man ihn erklären könnte. »In solchen Augenblicken kommen einem die üblichen sentimentalen Gedanken. Man denkt: Du kannst nicht dabei zusehen, wie deine Kinder erwachsen werden. Du kannst die Arbeit nicht mehr abschließen, die du dir vorgenommen hast. Eigenartigerweise tun einem diese Dinge mehr weh als die eigentliche Vorstellung, tot zu sein. Diese Realität kann man irgendwie nicht fassen.«
Die Realität schien ganz allgemein etwas unwirklich an jenem Tag, dem 14. Februar 1989 – dem Tag von Chomeinis Fatwa. Selbst der Himmel war, wie ich mich erinnere, übernatürlich strahlend. Rushdie erfuhr die Neuigkeit, als ein Radiosender bei ihm anrief – um seine Reaktion zu erfahren. »Was sagen Sie dazu, dass der Ajatollah Sie zum Tod verurteilt hat? Wie wärs mit einem kurzen Kommentar, den wir zitieren können?« Er brachte den Kommentar zustande (»Weiß Gott, was ich da gesagt habe«) und rannte durchs Haus, um die Vorhänge zuzuziehen und die Läden vorzulegen. Als Nächstes absolvierte er schlafwandlerisch ein Interview mit den Morgennachrichten der CBS und ging dann zu seinem bislang letzten Auftritt in der Öffentlichkeit: dem Gedenkgottesdienst für seinen Freund Bruce Chatwin.
Es war eine griechisch-orthodoxe Kirche, düster, staubig, hochgewölbt und voller Schriftsteller. Rushdie trat rasch ein, mit seiner damaligen Ehefrau, der amerikanischen Romanautorin Marianne Wiggins. »Ich stand unter Schock«, sagte er jetzt. Er sah aufgeregt aus. Wir sahen alle aufgeregt aus. Saul Bellow nennt das »Ereignisglamour«. »Salman«, sagte ich, als wir uns umarmten (er umarmt gern seine Freunde, nie routinemäßig, immer bedeutungsvoll), »wir machen uns Sorgen um dich.« Und er antwortete: »Ich mache mir Sorgen um mich.« Die Rushdies setzten sich neben mich und meine Frau. Ich spürte den beschämenden Impuls, ihn auf die schönen leeren Sitze am anderen Ende der Kirche hinzuweisen. Rushdie sah immer wieder über die Schulter: Die Journalisten wurden von seinem Agenten Gillon Aitken zurückgehalten. »Salman!«, rief Paul Theroux lustig wie ein Schuljunge. »Nächste Woche sind wir wieder hier, für dich!«
Angemessenerweise war der Gottesdienst eine Qual – schon in sich, mit vielen unverständlichen Jodeleinlagen und Fürbitten. Ich stellte fest, dass alle meine Gedanken leise, aber hartnäckig um Blasphemien kreisten. Die Priester in ihren Gewändern schwenkten die rauchenden Gefäße in der Luft wie griechische Kellner, die in Brand geratene Aschenbecher abräumen. Dies, schloss ich, war der letzte Scherz, den Bruce Chatwin sich mit seinen Freunden und Verwandten machte: Sein heterodoxer Theismus hatte sich am Ende unbeirrbar eine Religion ausgesucht, die niemand, den er kannte, begreifen oder mitempfinden konnte. Wir setzten uns hin und standen auf, standen auf und setzten uns hin und versuchten, das langweilige Theater eines fremden Glaubens nicht durch Seufzen oder Gähnen zu stören. Als es vorbei war, liefen Salman und Marianne mit eingezogenen Köpfen an den wartenden Journalisten vorbei und wurden in der Limousine eines Freundes weggefahren. Rushdie verbrachte dann den Rest des Tages auf der Suche nach seinem Sohn Zafar – und, nehme ich an, nach einer Form, sich von ihm zu verabschieden, da er nun sein neues Leben beginnen musste.
Ich blieb noch kurz auf dem Empfang nach dem Gottesdienst. Unter gewöhnlichen Umständen hätten wir die Gelegenheit ergriffen und über den von uns betrauerten Freund gesprochen. Aber es dachte niemand an Bruce, niemand sprach von ihm. Alle Gedanken und Gespräche galten Salman, seiner Gefahr, seiner drastischen Erhebung in fremde Höhen. Auf dem Heimweg tat ich etwa ein halbes Dutzend Dinge, die Salman Rushdie nun nicht mehr gestattet waren. Ich ging in einen Buchladen, ein Spielzeuggeschäft, einen Imbiss; ich ging nach Hause. Unterwegs kaufte ich eine Abendzeitung. Die riesige Schlagzeile: richtet rushdie hin, sagt der ajatollah. Salman war in der Welt der gigantischen Blockbuchstaben verschwunden. Verschwunden in den Schlagzeilen der Zeitungen.
Sein Fall ist natürlich einzigartig. Er ist von peinlicher Einzigartigkeit. Die Formulierungen der Fatwa (die gleichzeitig ein Todesurteil ist und eine lebenslängliche Verurteilung); die Höhe des Kopfgeldes (dreimal so viel wie das vermutete Honorar für den Lockerbie-Anschlag); das Wesen des Exils, das den Romancier sowohl von seinem Gegenstand (der Gesellschaft) wie von seinem Arbeitsziel (gelassene literarische Reflexion) abhält: Rushdie ist, mit seinen eigenen Worten, »fest an die Historie angekettet«. Seine Einzigartigkeit ergibt das Maß seiner Isolation. Vielleicht ist sie auch das Maß seines Stoizismus. Denn niemand – gewiss kein anderer Autor – hätte so gut überlebt wie er.
Ich sage ihm das oft. Ich sage ihm oft: Wenn der Rushdie-Skandal beispielsweise der Amis-Skandal wäre, dann wäre ich mittlerweile ein weinerlicher sedierter Dickwanst ohne Wimpern und Nasenhaare (wegen diverser Missgeschicke mit der Spritze und der Crack-Pfeife). Er hat ein wenig zugenommen (»nicht genug Bewegung«) und hat sein sehr mäßiges Zigarettenrauchen wieder angefangen; eine Weile litt er an einer Art Stress-Asthma. Aber Rushdie ist unverändert: die rosige Hautfarbe, die seitliche Falte in der Oberlippe, wenn er lächelt (die den Eindruck hinterlässt, er habe kindlich kurze Schneidezähne), die Augen, deren Lider so exotisch tief hängen, dass er sich schon lange mit dem Gedanken an eine Operation auseinandergesetzt hat, welche verhindern würde, dass die Augenlider am Ende die Pupillen verdecken. Seine dringlich intensive Gegenwart ist unvermindert, ungeschmälert. Manchmal, wenn man ihn anruft, fehlt seinem »Ach, mir gehts gut!« die letzte Überzeugungskraft. Ansonsten ist er ein Wunder an Gelassenheit.
Wie kommt das? Fraglos verfügt Rushdie über eine große Menge natürlichen Ballast. Er kennt sich aus mit dem Exil, mit dessen Entwurzelungen und dessen überraschenden Möglichkeiten zu neuer Ausdehnung, er weiß, wie man sich dort anfühlt, gleichzeitig nackt und unsichtbar, wie im Traum. Es war immer etwas Olympisches an Salman Rushdie. Sein Glaube an die eigene Begabung ist jedoch (im Gegensatz zu anderen Glaubensformen) nicht monolithisch und hat insofern etwas Prekäres. Dieser Glaube ist agil, kapriziös, drollig. Als ich ihm vor sieben Jahren zum ersten Mal begegnete, erwähnte er, er habe kürzlich an dem historischen Fußballspiel einer Schriftsteller-Elf in Finnland teilgenommen.
»Tatsächlich?«, sagte ich. »Wie ists dir ergangen?« Ich rechnete mit der üblichen komödiantischen Nummer: Hab mir den Knöchel verstaucht, Herzattacke, Unbeholfenheit, Beschämung. Aber er führte eine andere Komödie auf, eine ganz und gar unerwartete.
Er sagte: »Nun, ich habe, ähhm, einen Hattrick hingelegt.«
»Das soll wohl ein Witz sein. Du hast wahrscheinlich einfach den Fuß hingehalten. Die Bälle sind irgendwie reingekullert.«
»Das erste Tor war ein hüfthoher Volley aus knapp zwanzig Metern. Beim nächsten bin ich am Strafraumrand an zwei Gegenspielern vorbei und hab den Ball mit dem linken Außenrist in den Winkel geschlenzt.«
»Und das dritte, Salman? Ein Glückstreffer.«
»Nein. Das dritte Tor war ein massiver Kopfball.«
Selbst, wenn der Leser sich mit dieser Sportart nicht auskennt, wird er die Grundidee einer solchen Geschichte begreifen. Das ist Rushdies Stil. Er fordert einen immer heraus: Soll man das nun buchstäblich nehmen oder nicht?
Nun, gewisse zeitgenössische Mächte haben ihre Entscheidung getroffen, und sie sind schließlich zu einem Urteil gekommen, wie es der Buchstabengläubigkeit entspricht: ewige Verramschung. Ich glaube, Rushdie kann das Gewicht dieses Anathemas und den verbreiteten Hass ertragen, weil er sich lange in solche Zusammenhänge eingeübt hat. Schließlich hatte er schon zuvor Gefechte mit Politikern ausgetragen: In Scham und Schande mit General Zia (das Buch wurde natürlich in Pakistan verboten) und in Mitternachtskinder mit Mrs Gandhi (die ihn wegen Verleumdung verklagte). Doch dann begann das intensive Training, das am 26. September 1988 begann, dem Tag, als Die satanischen Verse veröffentlicht wurde. Verbote und Bücherverbrennungen, Petitionen und Demonstrationen, Aufruhr in Islamabad (sechs Tote), Aufruhr in Kaschmir (ein Toter, hundert Verletzte). Rushdie hielt zu jener Zeit daran fest, dass diese Tode nicht er »auf dem Gewissen habe«, doch fühlte er sich, wie er sagte, mittlerweile »ganz und gar fürchterlich. Es war absolut schockierend – bis dann das wirklich Schockierende kam.« Der Aufruhr in Pakistan und Kaschmir fand an aufeinanderfolgenden Tagen statt. Am dritten Tag wurde die Fatwa verkündet. Rushdie wusste jetzt, dass sein Buch Fragen auf Leben und Tod gestellt hatte. Er hatte keine Wahl; er musste welthistorisch werden.
»Zuerst fand ich es mehr oder weniger unmöglich, abzuschalten, mich abzuwenden. Ehe der Ajatollah die Fatwa verkündete, sah ich mich als Teilnehmer einer Debatte. Jetzt ging die Debatte weiter, aber ich war von ihr ausgeschlossen.«
Rushdie war ein unsichtbarer Zuschauer seines eigenen Prozesses – ein weiterer Zustand wie im Traum. Und Rushdie stellte fest, dass es seine ganze Zeit beanspruchte, den Vorgängen zu folgen. Sein Tag begann mit den Breakfast News um halb sieben und endete mit Newsnight um 22:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt berichtete jede überregionale Tageszeitung täglich drei Seiten lang über den Fall Rushdie, und dazwischen gabs immer die Lektüre des Bradford Telegraph and Argus, der Weekly Mail aus Südafrika, des Osservatore Romano, der Wiener Kronen Zeitung, es gab Al Ahram, Al-Noor, die Muslim Voice und India Today. Wohin er sah, erblickte er abgefackelte Hardcoverausgaben und zornig zuckende Schnurrbärte.
Scherzfrage: Was hat langes blondes Haar, große Titten und wohnt in einem Iglu in Island? Antwort: Salman Rushdie … Derartige Witzchen, die man in jeder Kneipe und an jeder Bushaltestelle hören konnte, wurden Rushdie von seinen Leibwächtern (vom »Special Branch« der Londoner Polizei) weitererzählt; er wurde auch zum beliebten Topos für Fernsehkabarettisten, eine Verkörperung des Gejagten, des Gebrandmarkten, des Phantoms. Rushdie fand bestimmte Rushdie-Witze komisch, andere weniger. Was ihn aber irritierte, war die plötzliche Promiskuität seines Ruhms. »Ich dachte immer wieder: Was zum Teufel habe ich da zu suchen? In einer Sitcom? Was zur Hölle mache ich in der Jasper-Carrot-Show?« In gewisser Weise ist jedoch die Fatwa selbst eine Art Rushdie-Witz. Über die Frage der Blasphemie lässt sich zumindest debattieren – und Rushdie möchte diese Debatte fortsetzen. Aber was soll man von Chomeinis rasendem Gefasel halten, das Rushdie als einen literarischen Kriegshund zeichnet, der sich vom Weltjudentum hat kaufen lassen, um den Islam am Vorabend eines neokolonialistischen Blitzkriegs gezielt zu schwächen? Das ist nun genuin komisch. Wenn man schreibt, wenn man versucht, zu belehren und zu unterhalten, will man auch, dass die Welt aufmerksam wird. Nur eben nicht buchstäblich. Und hier haben wir in den Abendnachrichten die pulsierenden Lichtpunkte auf der farblich durchcodierten Weltkarte – Bombay, Los Angeles, Brüssel; Aufruhr, Brand und Mord. Was ist das für eine Nachricht? Du selbst bist die Nachricht, dein Buch ist die Nachricht. Und nun ein weiteres Kapitel voller Aneinander-vorbei-Gerede, unbegriffener Ironie, entsetzlicher Missverständnisse.
Genauer hinzusehen, heißt, ihn zu gefährden, aber ein klein wenig lässt sich über die Art und Weise sagen, wie er nun lebt. Er lebt wie ein Geheimagent; als Nomade und Einsiedler. »Ein durchschnittlicher Tag? Bei mir gibt es keine durchschnittlichen Tage, weil es immer möglich ist, dass ich sofort umziehen muss. Ich lese viel. Ich bin viel am Telefon – zwei, drei Stunden am Tag. Ich mache Computerspiele. Schach. Super Mario. Ich bin ein Meister in Super Mario I und II. Ansonsten tue ich, was ich ohnehin tue. Ich fange um halb elf zu arbeiten an, ich esse nie zu Mittag, und ich höre so gegen vier auf.« Ein Schriftsteller ist, alles in allem, am lebendigsten, wenn er alleine ist. Dann kann man weitermachen mit der Aufgabe, sich andere Menschen vorzustellen. Aber normalerweise herrscht ein geselliges Gemurmel hinter der Einsamkeit – ein Gemurmel, das Rushdie nun nicht mehr hört. »Das Sonderbare ist es, dass man abends nicht mehr rausgehen kann. Oder nachmittags. Oder am Morgen. Um sich den Kopf durchzulüften.«
Es ist keine Überraschung, dass ein Todesurteil die Konzentrationsfähigkeit nicht erhöht. Harun und das Meer der Geschichten ist das Ergebnis ungekannter Mühen. »Die Ablenkungen waren eher innerlich als äußerlich. Wenn ich schreibe, dann versinke ich in dem Teil meiner selbst, wo der Roman herkommt. Aber ich musste mir den Weg freikämpfen, vorbei an all dem anderen Kram, an der Krise. Und wenn ich dann angekommen war, war ich in einem elenden Zustand.« Harun begann als eine Reihe von Gutenachtgeschichten, die Rushdie seinem Sohn Zafar erzählte – »oder besser Gutesbadgeschichten. Er lag in der Wanne und hörte zu, oder er saß da, in Handtücher gehüllt.« Als Rushdie mit den Satanischen Versen fast fertig war, nahm ihm Zafar das Versprechen ab, eine Weile die Erwachsenen zu vergessen und ein Buch für Kinder zu schreiben. »Ich hätte einen Roman für Erwachsene gar nicht schreiben können. Ich hatte nicht den Abstand, die Ruhe. Ich musste dieses Versprechen halten, weil es das einzige war, das ich ihm noch halten konnte. Das war die Peitsche, mit der ich mich vorangetrieben habe. Es hat mir die Energie gegeben, etwas derart Bizarres zu tun: ein Märchen zu schreiben, während ich in einem Albtraum lebte. Es gibt nichts Unbedingteres als das Versprechen, das du deinem Kind gibst. Das kannst du nicht brechen.«
Das neue Buch kann und wird gelesen werden als fantastischer Kommentar zur Lage des Autors. Eine solche Lesart ist zweifellos naiv, aber eine rein literarische Reaktion zu erwarten, gehört ebenfalls zu den Privilegien, die Rushdie resigniert aufgeben musste. Zumindest für die nächste Zeit. Alle seine Bücher scheinen jetzt seine gegenwärtige Situation zu beschreiben und zu analysieren, und es gibt Stellen in den Satanischen Versen, die auf fast vulgäre Weise hellsichtig sind (»Deine Blasphemie, Salman, kann nicht vergeben werden … Deine Worte gegen die Worte Gottes zu stellen …«). Jedenfalls ist Harun ein Klassiker leidenschaftlicher Erfindungskraft. Und der Wechsel des Genres ist schließlich ganz nahtlos: Was ist der »magische Realismus« anderes als die von Wünschen wimmelnde Großzügigkeit kindlicher Fantasie? Hier sind die Geschichten, die Rushdie seinem Kind erzählen wollte. Darüber hinaus aber sieht man auch das Kind in Rushdie selbst – sein Entzücken, seine Lust an Streichen, seine Unschuld, den Eifer seines Herzens.
Auf die Frage, ob er einen Plan für die Zukunft hat, erwidert Rushdie: »Einen Plan … Nun, ›Plan‹ wäre ein ziemlich großartiges Wort dafür.« Sein Überleben wie seine Fähigkeit, weiter zu hoffen, hängen nach wie vor von täglichen Improvisationen ab. Von Zeit zu Zeit hört man eine Verlautbarung aus Teheran, die etwa so geht: Wenn Rushdie erstens zugibt, dass er im Unrecht war, zweitens auf eine Paperbackausgabe verzichtet, drittens die gebundene Ausgabe zurückruft und einstampfen lässt, viertens umfangreiche Wiedergutmachungszahlungen leistet und fünftens ein guter gläubiger Moslem wird, dann ist das alles noch immer nicht genug. Was wäre denn genug? Der Tenor dieser Herausforderung lässt an einen unglücklich verliebten, narzisstisch verletzten Halbwüchsigen denken. Es könnte fast jemand sein wie Harun, allerdings weniger gutmütig als dieser und ohne die Gabe des Verzeihens. Fülle das Meer mit deinen Tränen. Cry me a river.
Als Rushdie einmal mit seinem Märchen auf den Weg gekommen war, fielen alle Schwierigkeiten weg. Er schrieb die erste Version in zweieinhalb Monaten; er schrieb die zweite in vierzehn Tagen – »mit enormem Tempo. Ein Kapitel am Tag«. Der Durchbruch hatte nichts mit irgendwelchen Veränderungen seiner Lebensumstände zu tun. Er hing zusammen mit der Formulierung des ersten Satzes, »der eine Menge Energie zu enthalten schien. Er war wie eine Stimmgabel.« Und Rushdie zitiert ihn:
Es war einmal im Lande Alifbay eine traurige Stadt, die traurigste der Städte, eine so verderblich traurige Stadt, dass sie ihren Namen vergessen hatte.
Aber der Leser ist bereits traurig, bereits bewegt und gerührt von der Widmung des Buches, einem Akrostichon, das sich auf erzwungene Distanz bezieht, auf ein Gefühl versagter Heimkehr und eine verlorene Zeit, die kein Happy End wieder herbeischafft:
Z embla, Zenda, Xanadu:
A ller Traum wird wahr im Nu.
F abelwelt geht auf – und zu …
A ch, ich wandere fern. Und du?
R uf mich lesend heim zur Ruh.
Vanity Fair, 1990
ROMAN POLANSKI:DAS LEBEN, DAS ER LEBT
»Als sie mich vom Hotel zur Polizeiwache gefahren haben, kams bereits im Autoradio. Die Journalisten haben die Polizei angerufen, noch ehe ich verhaftet worden bin, um zu sehen, wann sie die Nachricht rausgeben können. Ich konnte es einfach nicht glauben … Ich dachte, verstehen Sie, ich würde gleich wieder aufwachen. Mir ist natürlich klar, wenn ich jemanden umgebracht hätte, dann wäre das bei Weitem nicht so reizvoll für die Presse, ja? Aber … ficken, nicht wahr, und die jungen Mädchen. Die Richter wollen junge Mädchen ficken, die Geschworenen wollen junge Mädchen ficken – jeder will junge Mädchen ficken! Nein, da war mir klar, das wird jetzt wieder eine große, große Sache.«1
Eine Bemerkung wie »Das könnte mir nie passieren« wird Roman Polanski niemals machen können. Wenn seltsame Dinge geschehen, dann ist er die Art von Mann, dem sie zustoßen. Trotz seines Rufes als genialer Drahtzieher, als Mann ekstatischer, schikanöser Rücksichtslosigkeit, ist er in vieler Hinsicht immer der Narr des Schicksals gewesen. Wenn er enthusiastisch und vielleicht ein wenig sentimental von all den großen Versprechungen der Sechzigerjahre spricht, von deren Flair und deren Freiheit, denkt man sich: Es gibt ja niemanden, der auf spektakulärere Weise zum Opfer der abgründigen Ironien dieses Jahrzehnts geworden wäre. Die Sechziger waren für ihn Jahre hoher Energie und großer Erfolge, was dann (wie es in gewisser Weise für uns alle geschah) am 9. August 1969 mit dem blutigen Mord an seiner schwangeren Ehefrau Sharon Tate endete. Als er sich hiervon langsam zu erholen versuchte, wurde dies von ständigen (und infam boshaften) Presseberichten begleitet, in denen es hieß, Mr und Mrs Polanski hätten doch wohl selbst ihrer Nemesis die Tür geöffnet – indem sie mit Drogen experimentierten, mit dekadentem Lifestyle, bizarren Ritualen und so fort. Es war dies nicht seine erste Erfahrung mit ungewöhnlichem Schmerz und unverhältnismäßiger Demütigung. Und jetzt, zehn Jahre später, steckte er in einer noch ganz anderen Klemme.
Ich ging zuerst in seine luftige, vom Dekor her an Hockney erinnernde Wohnung zwischen den Champs-Élysées und der Seine, die man unbedingt als »Bijou« bezeichnen könnte. Es dürfte wenig elegantere Häuser in Paris geben: Marlene Dietrich bewohnte hier ein Stockwerk, und im Augenblick residiert hier auch irgendein verdienstvolles Mitglied der Familie Pahlavi. Ich wartete ein paar Minuten in dem bücherlosen Wohnzimmer, und Polanskis agiler Hausangestellter fragte mich, ob ich mein Bier mit oder ohne Schaum wolle. Ich entschied mich für den Schaum und bereute es nicht. Dann schlenderte Polanski pünktlich aus seinem Zimmer; er trug Maßjeans und ein blaues Hemd mit Monogramm. Mit seinen ein Meter fünfundsechzig und mit der großen Lebhaftigkeit seiner Bewegung in Gang und Gestik wirkte er wie ein Sechzehnjähriger. Dieser Eindruck verflüchtigte sich auch nach mehreren Stunden mit ihm nicht. Ich dachte: Sein beträchtlicher und wohldokumentierter Erfolg bei Frauen dürfte viel mit dieser Anmutung zu tun haben. Beim Anblick des kleinen Roman würden Frauen weniger das Gefühl haben, dass ein sexbesessener, hemdsärmelig alle Probleme aus dem Weg räumender Filmregisseur sie anmachte; eher würden sie versucht sein, das arme Waisenkind mit nach oben zu nehmen und es in ihren Armen schniefend einschlafen zu lassen.
Wenn man aussieht wie sechzehn, gibt einem das natürlich nicht das Recht, mit Minderjährigen ins Bett zu gehen. Trotz allem, was Polanski sagt, gilt: Nicht jeder möchte junge Mädchen ficken. Man kann sich nicht hinter einer erschlichenen Allgemeinheit verstecken; man darf nicht Sicherheit in einer großen Zahl suchen. Im Übrigen ficken die meisten Leute, die gerne junge Mädchen ficken würden, keine jungen Mädchen. Eine größere moralische Herausforderung stellt offensichtlich dar, scheinbar willige junge Mädchen nicht zu ficken. Aber selbst Humbert Humbert war es klar, dass junge Mädchen nicht wirklich wissen können, ob sie willig sind oder nicht. Der aktive Pädophile raubt Kindheiten. Polanski – das Gefühl hat man – hat niemals auch nur versucht, diesen Zusammenhang zu begreifen.
»Sie trinken Bier?«, fragte er mit routiniert gespielter Ungläubigkeit. Seine Stimme ist ausholend, pathetisch, er spricht nicht nur mit Akzent, sondern stark akzentuiert.
»Richtig«, sagte ich. »Kenneth Tynan schreibt über Sie, dass Sie fast überhaupt nichts trinken. Ist das –?«
»Ach. Ken Tynan erzählt lauter Scheiße«, sagte er und ging im Zimmer auf und ab. »Ich trinke gestern Abend sogar eine Menge Wein … Aber jetzt bin ich sehr hungrig.«
Wir aßen in einem lauten deutschen Restaurant um die Ecke zu Mittag. Polanski isst so hektisch, wie er spricht. »Hier, nehmen Sie was von diesem Haring … Nicht Haring, Hering … Der ist hier hervorragend … Möchten Sie? Hier, ich mache Ihnen eine hübsche kleine Portion, etwas Zwiebel obendrauf – da!« Andere Gäste deuten auf ihn und murmeln, und die makellos gekleideten Kellner umsorgen ihn devot. Er gehört zu den Leuten, die nach der Bedienung schreien können, ohne dass man es ihnen übelnimmt. Wenn er lauthals ein Bier bestellt, dann macht er es, weil er unbedingt ein Bier braucht, und zwar sofort.
Zeitungsberichten zufolge nahm man Polanski in Paris nach seiner Flucht aus Amerika Anfang des Jahres 1978 kühl auf (»Ich habe ihn nicht aufgesucht, und ich werde es auch nicht tun«, sagte Joseph Losey. »Ein feiges Manöver. Die Reihen schließen sich, man will nichts mit ihm zu tun haben«, sagte Robert Stack.). Er ist sich seines katastrophenaffinen Naturells bewusst und sieht in Paris einen Ort, wo ihm nichts zustoßen dürfte. »Eine sehr erwachsene Stadt hier«, sagt er und fügt einen typischen kleinen Ausbruch verrutschter Rhetorik hinzu, wie er gelegentlich in seinem etwas rostigen, stakkatoschnellen, immer liebenswerten Englisch vorkommt: »Ich möchte diese Umstände in meinem Charakter entlasten, die mich herausstechen lassen als ein bunter Hund.« (Ich liebe dieses »als«.) Er ist entschlossen, nach Amerika zurückzukehren, trotz der entfernten Möglichkeit einer fünfzigjährigen Gefängnisstrafe für die ihm vorgeworfene Betäubung und Vergewaltigung einer Dreizehnjährigen. »Aber man hat mich sehr freundlich aufgenommen in Paris, und ich werde eine Weile bleiben. Falls nicht etwas geschieht.«
Schließlich ist er hier geboren, im Jahr 1933.
Die ersten Jahre seines Lebens waren relativ frei von Katastrophen. 1936 ging seine Familie nach Krakau zurück. Als Kind sah Polanski, wie am Ende der Straße Barrikaden errichtet wurden: Die Nazis riegelten das Getto ab. 1943 wurden seine beiden Eltern in Lager verschleppt. Kurz, ehe das Getto gestürmt wurde, entkam Polanski durch eine Lücke im Stacheldraht. »Eines Tages sah ich draußen vom Getto Leute in einer langen Reihe marschieren, von Deutschen bewacht. Mein Vater war darunter. Ich ging eine Zeit lang daneben her, aber er machte mir Zeichen, ich soll weglaufen. Er hat vier Jahre lang im Lager überlebt, aber das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe.« Seine Mutter starb in Auschwitz.
Polanskis Jugend war weiterhin von Beinahe-Katastrophen gezeichnet. Er wurde von katholischen Bauern tief in der polnischen Provinz aufgenommen. Eines Tages, als er Brombeeren pflückte, schossen deutsche Soldaten beiläufig auf ihn – »als wäre ich ein Eichhörnchen oder was«. Als er 1945 wieder im befreiten Krakau war, schleuderte ihn die einzige Bombe, die während eines der letzten deutschen Luftangriffe noch abgeworfen wurde, durch eine Toilettentür, wobei er sich den linken Arm verletzte. Mit sechzehn, als er in Krakau Kunst studierte, wurde er eines Tages von dem Freund eines Freundes, der ihm angeblich ein Rennrad verkaufen wollte, in einen unterirdischen Bunker geführt. »Ich wollte schon immer ein Rennrad haben.« Er beschreibt, was dann folgte, sehr lebhaft, in nachdenklichen Metren, vorgebeugt und sein Haar auseinanderziehend, damit man die Narben auf seinem Schädel sehen kann.
»Ich ging im Tunnel entlang, ja? Er war hinter mir. Er war hinter mir. Ich sagte immer wieder: ›Aber wo ist das Rad, mein Herr?‹ Dann dachte ich, ich bekomme plötzlich einen elektrischen Schlag, dachte, ich berühre ein Kabel oder so etwas – oder ich dachte, da unten wartet ein Angreifer. Ich konnte es nicht glauben, dass der Mann mir von hinten auf den Kopf schlug.« Aber das tat er, mit einem Stein, fünfmal. Polanskis Angreifer, der noch am selben Tag verhaftet wurde, hatte bereits drei Morde begangen. Als Polanski aus dem Bunker stolperte, lief so viel Blut an ihm herunter, dass ihn immer noch jedes Mal die Angst befällt, wenn er unter die Dusche tritt.
Und trotz seiner internationalen Erfolge war Polanskis Leben nie frei von groteskem Unheil. Im Laufe der Jahre fand mindestens ein halbes Dutzend seiner engen Freunde einen gewaltsamen, unwahrscheinlichen Tod – Selbstmorde, merkwürdige Krankheiten, ein bizarres Zugunglück. Es ist mittlerweile ein Klischee, dass seine Filme, in denen Schrecken, Einsamkeit und Wahnsinn eine so große Rolle spielen, nichts anderes als ein dämonischer Kommentar zu seinem Leben scheinen. Aber dieser Eindruck ist spätestens angesichts der entsetzlichen Ereignisse im Cielo Drive 1969 unausweichlich. Polanski, möchte man meinen, hat genug durchgemacht für zwanzig Menschenleben.
»Natürlich ist mein Leben sehr eigenartig gewesen, voll von seltsamen Dingen. Aber mir erscheint es nicht so, wissen Sie – von meiner Seite aus gesehen. Mein Leben ist einfach etwas, das ich lebe, ja? Nur wenn ich ein paar Schritte zurücktrete, sehe ich, wie eigenartig es gewesen ist.«
Indirekt und ironisch betrachtet, entspricht dies präzise der Figur, die Polanski bei seinen gelegentlichen Auftritten in den eigenen Filmen spielt. Er hat keine hohe Meinung von Schauspielern (»Der intelligente Schauspieler ist eine Seltenheit, fast ein Paradox.«) und erhebt keine großen Ansprüche für seine eigenen Fähigkeiten vor der Kamera: »Ich setze mich nur deshalb ein, weil ich billig bin und keine Schwierigkeiten mache. Mit mir kann man hervorragend arbeiten, wissen Sie, ich mache immer das, was ich mir sage.« Tatsächlich ist er ein Schauspieler mit schmalem Rollenfach, aber makelloser Präsenz: Er hat ein nie versagendes Gefühl für die Komik und das Pathos der Verletzlichkeit. In seinen zwei denkwürdigsten Rollen, als der nervöse Vampirjäger in Tanz der Vampire und als der scheue, ganz und gar angreifbare polnische Angestellte in Der Mieter, stellt Polanski mit authentischer Sympathie den kleinen Mann dar, dem seltsame Dinge zustoßen. Der kleine Mann in diesen Filmen erwartet geradezu, dass ihm Seltsames geschieht, und er fügt sich mit gehorsamem, klaglosem Entsetzen, solange die Seltsamkeit andauert. Er scheint zu glauben: Wenn ihm diese seltsamen Dinge nicht zustießen, dann würden stattdessen andere seltsame Dinge geschehen.
An diese Rollenfigur musste ich mehrere Male während des Mittagessens denken, als Polanski seine kürzlich durchlebte Haft im Zusammenhang mit dem Vergewaltigungsvorwurf in Los Angeles schilderte. Zuerst zögernd, dann in einer Stimmung großer Heiterkeit (mit schmerzhaften Quietschlauten entzückter Erinnerung) erzählte er mir, wie sein sechswöchiger Aufenthalt im Gefängnis begann.
»Als ich mitten in der Nacht ankam, konnte ich gar nicht in das verdammte Gefängnis rein! Es waren zu viele Reporter und Kameras da! Und die ganzen Gefangenen im Hof, weil sie das in den Nachrichten gehört haben, die rufen: ›He, wie läufts so, Planski!‹ Aber es war wie ein Urlaub, ein Asyl. Es war wunderbar. Ich hätte gar nichts dagegen, wieder hinzugehen, nachdem ich jetzt weiß, wie das ist. Es ist interessant, auf die andere Seite zu gehen, wo böse Menschen sind. Voll von unglaublichen Mördern! Einer war da, der tötet sechzehn Menschen!« Er nickt und fügt leiser, mit resignierter Stimme hinzu: »Das ist die Schwierigkeit – man weiß nie, wann einer einen absticht, ja? Das ist das einzige Problem, dass man jederzeit einfach getötet werden kann.«
Der Zug des Resignativen, der stoischen Anspannung war vielleicht das, was Polanski an der Figur der Tess von den d’Urbervilles angezogen hat. Unter dem schlichten Titel Tess lief dieser jüngste Film Polanskis spät im letzten Jahr in Frankreich an, mit ermutigendem kritischem und kommerziellem Erfolg. Es ist eine respektvolle, vielleicht allzu getreue, gewiss allzu lange und prinzipiell etwas schiefe Literaturverfilmung. Die Schwierigkeit des Films (und auf andere Weise auch die Schwierigkeit des Romans) liegt in der Figur des Angel Clare, dem angeblich wundervollen Gegenbild zu Tess’ säuischem Verführer Alec d’Urberville. Der springende Punkt ist, dass Thomas Hardy mit diesen melodramatischen Kontrasten spielt (Angel klimpert unter dem Dach auf seiner Harfe, Alec sieht man durch Flammen hindurch mit einer Forke in der Hand), aber uns gleichzeitig klarmacht, dass Angel auf eine subtile Weise viel verachtungswürdiger ist, als Alec es je sein könnte. Polanski war sich dieser Ambiguität bewusst, aber ich glaube nicht, dass er je mit ihr zurechtkam.
»Ja, reden wir über Filme. Filme sind meine Abteilung, my cup of tea, wie man sagt – in England.« Er schaut verwundert auf. »Ich glaube, ich werde jetzt eine Zigarre rauchen. Mögen Sie eine? … Was mich an der Figur der Tess angezogen hat, war ihre unglaubliche Integrität, verbunden mit ihrem – Gefüge? Nein, ihrer Gefügigkeit. Und ihrem Fatalismus. Sie klagt nie. All diese äußerst … unfairen Dinge stoßen ihr zu, und sie klagt bis zum Ende nicht. Das Buch ist moralisch komplizierter, als man zuerst meint. Alec hatte eine kalte, materialistische Haltung dem Leben gegenüber, aber er ist nach heutigen Maßstäben nicht allzu schlecht.«
»Und was meinen Sie zu Angel?«
»Oh, Angel ist für mich ein totaler Scheißkerl. Er ist sehr stark der junge Mann voller revolutionärer Ideale, aber sobald es ihn persönlich betrifft, stellt er sich als genauso heuchlerisch heraus wie alle anderen.«
Ich musste an diesem Punkt sagen, dass mir die Besetzung von Peter Firth als Angel fragwürdig schien. (Tatsächlich ist sie verheerend.) Angel muss wenigstens scheinbar die Züge eines romantischen Protagonisten aufweisen. Die vulgäre Wahrheit ist es, dass Peter Firth hier hervorragend wäre, wenn er mehr wie Robert Redford und weniger wie Jimmy Carter aussähe. Polanski zuckte die Achseln und war anderer Ansicht, wobei er nicht mehr als leise Enttäuschung an den Tag legte. Aber wir empfanden gemeinsame Erleichterung, als wir dazu übergingen, Nastassja Kinskis wundervoll stetige Darstellung der Tess zu rühmen. Polanski sprach mit gefühlvoller Bewunderung und mit ein klein wenig Wichtigtuerei von ihr: Er hatte sie sehr gefördert, und es hatte natürlich auch eine Beziehung zwischen den beiden gegeben.
Ich fragte ihn, welchen seiner Filme er am meisten mochte. »Filme sind wie Frauen«, erfuhr ich. (Polanski ist der Ansicht, dass eine ganze Reihe von Dingen wie Frauen sind.) »Man liebt immer die Letzte am meisten, bis die Nächste kommt. Aber natürlich gibt es schon Filme, für die man etwas Besonderes empfindet. Einige von meinen höchst gelobten Filmen – Rosemaries Baby, Ekel, Der Mieter –, das waren im Wesentlichen Auftragsarbeiten, die ich wegen der Zeit oder dem Geld gemacht habe oder um einem bestimmten Produzenten einen Gefallen zu tun. Ich hätte sie mir nicht ausgesucht, ja? Aber mein Kopf sagt mir: Mein bester Film ist Wenn Katelbach kommt – es ist der Film, der vollkommen in sich geschlossen ist. Er hat seine Bedeutung nur als ein Film, als er selbst. Mein Herz sagt mir, dass Tanz der Vampire mein Lieblingsfilm ist. Ich mag diesen Film von Jahr zu Jahr mehr. Ich durchlebe wohl zunehmend die glückliche Zeit damals wieder, als ich ihn gedreht habe. Gegen Ende der Sechzigerjahre. Alle waren voller Hoffnung und guter Laune. Ich habe eine Komödie gemacht mit Leuten, die ich mochte, und natürlich mit Sharon … Aber Tess ist mir jetzt auch sehr lieb.«
Es wäre überaus kühn, wenn man sich von jemandem wie Polanski ein eindeutiges Bild machen wollte. Er redet viel und laut daher, seine Suada ist voll von Klischees (»Jack Nicholson – das ist ein großer Profi«) und von bewusst auf Zitierbarkeit angelegten vorgefertigten Sprüchen (»Ich mag Essen, ich mag Frauen, und besonders mag ich Frauen, die gerne essen« usw. usf.). Aber es gibt sehr viel an ihm, das generös ist, natürlich, geradezu durchsichtig. Sein Selbstvertrauen beispielsweise ist echt und nicht das ruinöse Grinsen, das oft in der Filmwelt als Selbstvertrauen gilt. Ganz offensichtlich hat er sich manchmal von den Reizen verführen lassen, die ihm sein Fast-Lane-Milieu offeriert, wie der Gerichtsfall in Kalifornien nur allzu deutlich zeigt. Aber er hat ein ganz außerordentliches Leben überstanden, und er ist noch er selbst.
Nach dem Essen lud er mich ein, ihn zu dem Schneideraum an den Champs-Élysées zu begleiten, wo er die englischen und amerikanischen Versionen von Tess vorbereitet. Es war eine düstere Wohnung, voll mit düsteren, Gitanes rauchenden Franzosen. Polanski verbrachte zwanzig Minuten damit, aus einer Reaktionseinstellung auf ein neues Stadium in Tess’ traurigem Abstieg eine halbe Sekunde herauszunehmen. Ich fragte ihn, ob er die Sorge hätte, man könne Tess als eine Art Propagandafilm für die Frauenbewegung missverstehen.
»Was? Tess reagiert angemessen auf Ereignisse, als Person. Die Frauenbewegung ist eine Absurdität! Ein paar berechtigte Forderungen machen noch keine berechtigte Bewegung. Wie kann sich eine Hälfte der Menschheit gegen die andere organisieren? Es gibt niemanden, der nicht irgendwann einmal gesagt hätte: ›So sind die Frauen.‹ Die Dinge sind so, wie sie sind, wegen der Evolution! So ist es zwischen Affen, zwischen Hunden und zwischen Schmetterlingen!«
»Was ist mit den Spinnen?«
»Spinnen, hmmm«, sagte er nickend und schaute ernst drein. »Nein, Spinnenmännchen habens nicht so gut. Vielleicht sollten sie sich zusammenschließen und etwas unternehmen. Ich weiß auch nicht.«
Tatler, 1980
DIE ATOM-METROPOLE
Washington ist die atomare Stadt. Bei jedem vorstellbaren militärischen Schlagabtausch (wie »chirurgisch«, »massiv«, »kathartisch« oder »therapeutisch« auch immer) würde Washington verschwinden (und San Diego, Seattle und San Francisco ebenfalls). Washington würde »eliminiert«. Die baumreichen Malls würden verschwinden, die Museen und Monumente, ein beträchtlicher Teil der Geschichte, über die Amerika verfügt, zusammen mit all dem konfusen Leben einer großen Stadt: den Jazzbars von Georgetown, den exzentrischen Villen von Capitol Hill, den Bettlern (Lobbyisten der Straße), dem Graffiti no nukes, dem Autoaufkleber no fat chicks, der Matisse-Ausstellung »Die frühen Jahre in Nizza« in der National Gallery (und dem speziellen dort verkörperten Interesse an der menschlichen Gestalt und Haltung), dem Rosengarten, den Ganztagsschulen. Alles würde verschwinden. Da steht Washington, wie ein König im Henkerskarren, der auf die Guillotine wartet.
Wenn man die Atomwaffen einmal als etwas Reales begriffen hat, wenn sie aufgehört haben, einem nur um die Ohren zu summen, und tatsächlich in den Kopf vorgedrungen sind, dann vergeht kaum eine Stunde ohne ein plötzliches Pochen oder Blinken, ein massives Pulsieren, eine in der Fantasie ablaufende Superkatastrophe. Man starrt auf den vieläugigen Helm des Kapitols und sieht schon die Wolken darüber entflammt, den Winterhimmel in Brand, eliminiert. Ja, jetzt ist es Zeit, das zu sehen; dein Kopf ist der Ort, wo es sichtbar werden sollte. Denn die Realität wird dann von niemandem gesehen werden. Manche Leute in Virginia werden wohl das glühende Hirn, den sengenden Regen, die Idiotenfaust des Wolkenpilzes sehen. Aber niemand wird die zerplatzende Stadt »sehen«. Bei diesem Verbrechen wird es keine Augenzeugen geben, nur Millionen unschuldige Ahnungslose. Das Kino hat oft versucht, sich die Nuklearattacke auf eine große Stadt auszumalen. Was das Kino nicht erfassen kann, was wir nicht fassen können, ist die Gleichzeitigkeit: Alles wird nichts, alles auf einmal.
Washington ist noch in einem anderen Sinne Thermopolis, die atomare Stadt. Mit legendärer Verschwendungslust und Gier verschleißen Atomwaffen Ressourcen, fressen Geld, binden Wissen. Was aber wird aus den intellektuellen Ressourcen, was wird aus der Denkanstrengung, der Geistesschärfe, der Konzentration, die sie stündlich aufzehren? In Instituten, Stiftungen, Ausschüssen sitzen den ganzen Tag lang Leute herum und denken nach über diese vom Menschen geschaffenen Nuklearwaffen – diese sonderbarsten Gegenstände mit ihrer Dreckigkeit, ihrer Obszönität und Widerlichkeit, mit ihrer süchtig machenden Faszination und ihrem entsetzlichen Glamour, ihrer einzigartig allumfassenden Komplexität. Nachdem ich einen Meter Bücher zum Thema gelesen hatte, war ich nach Washington gereist, um dort einen weiteren Meter zu lesen, zu reden und zuzuhören und den atomaren Campus zu beobachten. Diese Leute haben all die Atomwaffen hervorgebracht, und dann haben die Atomwaffen all diese Leute hervorgebracht, die Denker, die Aufpasser, die sich fragen, was nun geschehen soll, was man mit dem Zeug anfangen soll, ob man ohne es auskommen könnte.
»Einige dieser Figuren«, sagte mir ein Experte, »sind Atomfreaks durch und durch. Nur das eine Thema. Atomares dies, atomares jenes.« Ihre Bürowände sind mit Sandsackwällen von Atomliteratur zugestellt, auf dem Fußboden stapeln sich atomare Broschüren und Computerausdrucke. Sie lieben Karten, Grafiken, Tafeln. Sie sprechen meist mit unmenschlicher Geschwindigkeit. Man sitzt da und lauscht Kaskaden von XYZ-Kürzeln, Tornados von Abkürzungen. In manchen Gesichtern kann man Spuren einer Belastung erkennen, einer moralischen Besorgnis, aber viele von ihnen haben die hektische Ausgelassenheit, die robuste gute Laune von Leuten, die mit ihrem Hobby glücklich sind. Zwei Dinge fallen einem sofort auf, oder jedenfalls mir: Es gibt hier keine Frauen. Und es gibt keine Raucher.
Das letztgenannte Detail beschäftigte mich weit über das vertraute Unbehagen des Nikotinentzugs hinaus. Nach einem halben Nachmittag intensiver Diskussion, als meine Lungen anfingen, zu schluchzen und um ihren Halbstundensnack zu betteln, überwand ich manchmal die vertrauten Empfindungen von Scham und Kriminalität und fragte: »Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich eine rauche?« »Ehrlich gesagt, ja«, lautete die Standardantwort. In gemeinsamer Verlegenheit stolperten wir dann mühsam zurück in unsere Erörterungen zu Röntgenlasern und Hard-Kill-Potenzialen. Selbst wenn man diese Leute aus den Büros rauskriegt in eine Bar, fangen sie sofort an zu husten und zu würgen und mit den Händen zu wedeln, wenn man sich eine Zigarette ansteckt. Es scheint merkwürdig, dass die Experten für Thermalimpulse und superstellare Temperatur, die Feuerballdealer und Infernokünstler, grün im Gesicht werden beim Anblick einer Marlboro. Aber man ist schnell in tiefe Widersprüche verstrickt – komische, tragische, unfasslich banale –, wenn es um Atomwaffen geht.
Atomwaffen sind alles und nichts. Darin liegt das Geniale. Einerseits sind sie Spielmarken am Verhandlungstisch, Schachfiguren in einem Propagandawettstreit, Friedensgaranten – ein doppelter Bluff, den wir alle unterschreiben. Sie sind nichts. Wie kann ein »Schutzschirm« irgendjemandem tatsächlich wehtun? Andererseits sind Atomwaffen nun einmal, was sie sind, und sie tun, was sie tun: Sie multiplizieren die Masse mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat; ihre Wirkung bemisst sich in Tonnen von Blut und Schutt; sie sind Werkzeuge der Massenvernichtung. Sie sind alles, weil sie alles zerstören können. Gut für sie, dass es dabei aussieht, als wären sie nichts.
Marcus Raskin, der jetzt für das Institute for Policy Studies in Washington arbeitet, erzählt folgende Geschichte aus der Zeit, als er der »Strategiegruppe« unter Kennedy angehörte. Das war 1961. Es kursierte das Gerücht, die Sowjetunion würde bald eine Wasserstoffbombe von fünfzig Megatonnen testen. Alle griffen nach ihren Rechenschiebern. »Fünfzig Megatonnen«, murmelte man gelassen. »Viermal so viel wie Hiroshima.« Es brauchte mehrere Minuten, bis ihnen klar wurde, worum es hier ging: nicht um das Äquivalent von fünfzigtausend Tonnen TNT, sondern um das Äquivalent von fünfzig Millionen Tonnen TNT. Und das waren Fachleute, die sich mit kaum etwas anderem befassten. Wie Raskin sagt: Wenn man die Atomwaffen lange genug anstarrt, verliert man den Zugriff auf das, was sie eigentlich sind, was sie wirklich vermögen.