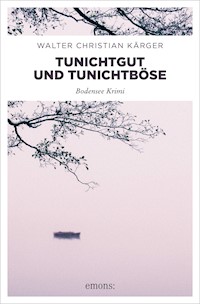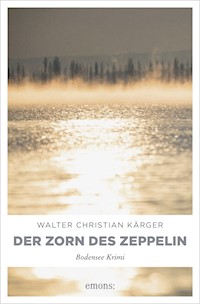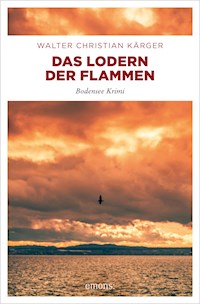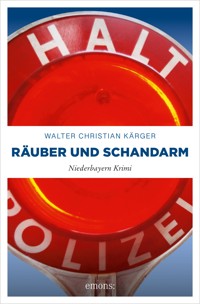Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Max Madlener
- Sprache: Deutsch
Serienmorde am Bodensee Ein missglückter Überfall auf einen Geldtransporter bringt Max Madlener und Harriet Holtby auf die Spur einer lang gesuchten RAF-Terroristin. Während die Ermittler alles daransetzen, die flüchtige Frau zu stellen, offenbart sich in einer Klinik ein weiteres Grauen: Eine soziopathische Krankenpflegerin treibt dort offenbar seit Jahren ihr heimliches Unwesen. Als Harriets Tante in ebendiese Klinik eingeliefert wird, kommt es zu einem gefährlichen Wettlauf gegen die Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, absolvierte die Hochschule für Fernsehen und Film und arbeitete dreißig Jahre als Drehbuchautor in München. Über hundert seiner Drehbücher wurden für Kino oder TV verfilmt. Er lebt als Romanautor in Memmingen.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Westend61/Holger Spiering
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Julia Lorenzer
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-312-0
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen
insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß
§ 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Der Schnee fiel herab,
schwebte lautlos durch das Universum,
und lautlos fiel er auf all die Lebenden und Toten.
James Joyce
Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen.
Solon
Die Wiege schaukelt über einem Abgrund,
und der platte Menschenverstand sagt uns,
dass unser Leben nur ein Lichtspalt
zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist.
Vladimir Nabokov
In einem gottlosen Universum gibt es keinen Plan.
Außer wir Menschen schmieden ihn.
Albert Camus
Wollen ins Tiefste – Himmel oder Hölle – dringen,
Ins Unbekannteste, und sehn: Gibt’s Neues dort?
Charles Baudelaire
1
»Geht’s?«, fragte sie, als sie sich auf den Beifahrersitz des betagten VW Golf schwang, den Sicherheitsgurt festzurrte und die Kalaschnikow quer vor sich auf den Schoß legte.
»Es muss gehen«, antwortete er mit schmerzverzerrtem Gesicht und drückte seinen Anschnallgurt ins Schloss, was ihm sichtlich Mühe bereitete, nicht nur, weil ihm die Glock im Hosenbund im Weg war. Nein, seit Monaten hatte er immer öfter das Gefühl, dass ihm Eisenringe die Brust einklemmten und Stiche ins Herz schossen, so wie jetzt.
Er war schließlich nicht mehr der Jüngste. Vierundsiebzig, um genau zu sein.
Seinen Lebensunterhalt in dem Alter mit Raubüberfällen bestreiten zu müssen, war wahrlich kein Zuckerschlecken. Aber was blieb ihnen anderes übrig – die Kampfgenossen von früher waren entweder im Knast, hatten das Zeitliche gesegnet, einige bekamen zweimal am Tag Besuch vom Pflegedienst oder vegetierten in Altersheimen dahin, wo sie ihre Zeit mit Sitzgymnastik in Stuhlkreisen, infantilen Spielen, endlosen Soaps im Fernsehen und gnädigem Dahindämmern verbrachten. Wenigstens waren sie nicht mehr in der Verfassung, jemanden zu verpfeifen, weil sie sich meistens nicht mal an ihren eigenen Namen erinnern konnten. Oder wollten.
Für sie alle galt sowieso ein ehernes Verschwiegenheitsgesetz wie bei der Mafia, die Omertà.
Kurioserweise erinnerte es fatal an das Motto des englischen Königshauses: Never explain, never complain. Niemals erklären, niemals beschweren.
Sie beide waren noch auf freiem Fuß, das letzte Duo aus der Hochzeit des RAF-Terrors, als sie im Verbund mit zahlreichen Kampfgenossen und Helfershelfern die Bundesrepublik in den achtziger und neunziger Jahren in Angst und Schrecken versetzt hatten.
Lange her.
Seit über dreißig Jahren lebten Jens-Uwe Burkart und seine Lebensgefährtin Irmgard Baselitz jetzt schon mit falschen Namen unter dem Radar der Behörden, die normalerweise jedes menschliche Wesen in Deutschland unbarmherzig im Visier hatten. Ob es das Finanzamt war oder die Krankenversicherung, das Einwohnermeldeamt, die Pflegekasse oder irgendeine andere Instanz – in ihrem speziellen Fall die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Polizei –, nichts war auf Dauer so schwierig, wie sich illegal und quasi unsichtbar durchs Leben zu schlagen.
Bei der kleinsten zufälligen Kontrolle konnte man auffliegen, und man musste mit den schlimmsten Konsequenzen rechnen, wenn man als immer noch steckbrieflich gesuchter Terrorist auf der Fahndungsliste stand, auch wenn die Schwarz-Weiß-Fotos auf den Plakaten aus Zeiten stammten, die schon »historisch« genannt werden mussten.
Burkart und Baselitz waren sozusagen zwei der letzten Mohikaner der dritten Generation, alt und gebrechlich geworden im Laufe der Jahre, in denen sie ständig fluchtbereit waren und bei jedem betont unauffälligen Auto, das mit zwei Insassen in ihrer Straße parkte, darauf gefasst sein mussten, dass man sie endgültig ausfindig gemacht hatte und bereits überwachte.
Das war kein Leben – aber sie hatten keine andere Option.
Sich der Justiz zu stellen?
Auf das nächste Polizeirevier zu gehen und zu sagen: »Guten Tag – wir sind die Letzten von der RAF, die Sie noch nicht gefasst haben«?
Ein Ding der Unmöglichkeit. Schließlich wussten sie nur zu genau, was dann unweigerlich auf sie zukäme. Endlose Verhöre, ein monatelanges, wenn nicht gar jahrelanges Verfahren, währenddessen Isolationshaft und Videoüberwachung. Sie würden an den Pranger gestellt werden, das ganze Bohei um die letzten verbliebenen Terroristen würde erneut in den Medien und der Öffentlichkeit aufflammen und breitgetreten.
Wie das aussah, hatten sie in letzter Zeit wieder zur Genüge vor Augen geführt bekommen, als Fahnder mehr oder weniger durch Zufall auf eine frühere Kombattantin von ihnen gestoßen waren. Erniedrigende Fotos und Videos der Verhaftung, der Abführung mit Handschellen, des Flugs im Hubschrauber zur Generalbundesanwaltschaft, tagelang auf allen TV-Kanälen und in sämtlichen Gazetten. Wiederaufwärmen der alten Geschichten – wer war beteiligt am Attentat auf Alfred Herrhausen, am Attentat auf Siegfried Buback und seine Begleiter, an dem auf Detlev Karsten Rohwedder und an der Ermordung von Hanns Martin Schleyer? Da waren auch nach so langer Zeit bis zum heutigen Tag noch allzu viele Fragen offen.
Vielleicht war es für ihre frühere Kampfgefährtin Daniela Klette, die nach dreißig Jahren Fahndung festgenommen worden war, eine gewisse Art von Erleichterung, endlich erwischt worden zu sein. Sie wussten es nicht, sie hatten seit dem Zeitpunkt, als sich die RAF 1998 für aufgelöst erklärt hatte, keinen Kontakt mehr gehabt. Aber sie ahnten es.
Nein, öffentlich bloßgestellt und zum Affen gemacht zu werden – das war für sie undenkbar, ein Horrorszenario. Ganz abgesehen davon, dass es keine angenehme Vorstellung war, den Lebensabend hinter Gittern verbringen zu müssen. Und den Knast würden sie dann nur noch mit den Beinen voraus verlassen.
Lieber hatten sie sich damit abgefunden, immer – im übertragenen Sinn – über die Schulter zu schauen, keinerlei soziale Kontakte zu pflegen, sich nicht auf Facebook, Instagram, X oder TikTok herumzutreiben, bei jedem Klingeln an der Wohnungstür zusammenzuzucken, durch den Türspion zu spähen und damit zu rechnen, dass einem ein bis an die Zähne bewaffnetes SEK-Kommando gegenüberstand.
Aber es war das einzige Arrangement, das ihnen übrig geblieben war. Es gab für sie keine Alternative.
Nein, das war kein Leben. Es war die Hölle.
Wenn man in seinen Zwanzigern ist und sich mit Leib und Seele der Schnapsidee verschrieben hat, dass man mit seinen Aktionen die Welt gewaltsam verbessern sollte, und genügend gleichgesinnte fanatische Mitstreiter um sich herum hat, kann man das vielleicht eine Weile machen. Selbst wenn sich die angeblich hehren Ideale früher oder später als Irrwege entpuppen und an eine Umkehr nicht mehr zu denken ist – der Point of no Return ist nach ersten Anschlägen mit Menschenopfern schnell erreicht. So zynisch sich das auch anhört: The show must go on.
Aber nicht mit Ende sechzig, Anfang siebzig.
Als die Illusionen endgültig den Bach hinuntergegangen, die letzten Kampfgefährten gefasst, getötet oder im Knast gelandet waren, die biologische Uhr unwiderruflich im Ablaufen begriffen war, sich Diabetes, Arthritis und andere mehr oder weniger schwere Altersbeschwerden immer stärker bemerkbar machten und – kein Witz, sondern unbarmherzige Wirklichkeit – Burkart erste untrügliche Anzeichen von Demenz bei sich registrierte, was er seiner Lebensgefährtin wohlweislich verschwieg, da bestand der Wille zum Weitermachen nur noch aus purer Verzweiflung.
Sie wohnten in Freiburg in einer kleinen Altbauwohnung, die einem letzten verbliebenen Unterstützer gehörte, der aus großbürgerlichem Milieu stammte und mehrere Wohnhäuser geerbt hatte. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen. Obwohl immer das Damoklesschwert über ihnen schwebte, von ihm verraten zu werden. Schließlich war für Hinweise, die zu ihrer Verhaftung führten, eine relativ hohe Belohnung ausgesetzt. Aber er war nicht auf Geld angewiesen und wegen seines schlechten Gewissens, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden zu sein, noch von der früheren revolutionären Überzeugung beseelt – zumindest was seine geheime innere Einstellung zu ihrer Vergangenheit anging. Außerdem: Was sollten sie sonst tun?
Die Miete wurde bar bezahlt, ebenso Strom, Gas und Wasser, der Eigentümer überwies dann die Rechnungsbeträge an die Versorger.
Gemeldet waren sie unter falschen Namen, gefälschte Ausweise hatten sie genug. Die waren aber alle abgelaufen, keine Chance, sie offiziell zu verlängern. Und der einzige der alten Kameraden, der eine Fälscherwerkstatt besaß und damit umgehen konnte, der Freund von Daniela Klette, war dem Teufel beziehungsweise den Fahndern im letzten Augenblick von der Schippe gesprungen und seither spurlos verschwunden.
Es war von Anfang an ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen, daran konnte man sich nie gewöhnen. Aber leben musste man damit.
Doch das war nicht der einzige Stress. Die Geldbeschaffung war das größte Problem. Und mit dem höchsten Risiko verbunden. Waffen besaßen sie aus der sogenannten »bleiernen Zeit« noch von einem Depot, das nie entdeckt worden war. Ein Fluchtauto zu besorgen, war relativ einfach. Das brauchten sie, wenn es ernst wurde. So wie jetzt.
Im Laufe der Jahre hatten sie sich darauf spezialisiert, Geldtransporter zu überfallen, die in großen Supermärkten und Einkaufszentren eingesetzt wurden, um die Tageseinnahmen abzuholen. Das war ihrer Meinung nach vom Verhältnis Risiko zum Ertrag her gesehen am praktikabelsten, wenn man es gut vorbereitete und professionell durchzog. In heutigen Zeiten eine Bank zu überfallen, war der helle Irrsinn. Und um einen Bankautomaten zu sprengen, was seit geraumer Zeit in bestimmten kriminellen Kreisen in Mode gekommen war, hatten sie weder das Know-how noch die nötige Ausrüstung. Ein zwar riskanter, aber schnell durchgezogener Überfall auf einen Geldtransporter war üblicherweise wenigstens lohnend – normalerweise reichte das dabei erbeutete Geld für ein Jahr, wenn sie Glück hatten.
Obwohl – »riskant« war eigentlich nicht der angemessene Ausdruck dafür. Es war eher jedes Mal das reinste Kamikaze-Unternehmen.
Eine Alternative wären nur Tankstellenüberfälle gewesen, aber da war nicht viel Bares zu holen. Sie hätten gezwungenermaßen alle paar Wochen zuschlagen müssen. Viel zu gefährlich. Und irgendwie unter ihrer Würde. Das hatten sie schnell verworfen.
Diesmal hatten sie einen großen Supermarkt – wie immer weit entfernt von ihrem Wohnort – im Visier, nämlich in der Bodenseeregion. Dazu mieteten sie sich ein Ferienhaus, observierten wochenlang ihr Zielobjekt, kundschafteten alle möglichen Fluchtwege aus und legten schließlich den günstigsten Zeitpunkt für den Überfall fest.
Es fing an zu schneien, als sie in ihrem Wagen mit den geklauten Nummernschildern auf den riesigen »Bestkauf«-Parkplatz bei Friedrichshafen fuhren und in der Nähe des Eingangs parkten.
Jens-Uwe Burkart sah auf seine Uhr und versuchte, den ekelhaft stechenden Schmerz zu ignorieren, der wieder einmal seine linke Brustseite wie ein innerer Wespenstich malträtierte.
»Was ist?«, fragte Irmgard Baselitz besorgt.
»Nichts«, entgegnete er, massierte seine Brust, atmete tief durch und spürte erleichtert, wie der Schmerz allmählich nachließ. »Noch vierzig Minuten«, sagte er. »Dann müssten sie kommen.«
»Ja«, stimmte Irmgard zu, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Wie immer war sie die Ruhe selbst, bevor es losging. Burkart beneidete sie darum. Irmgard war von Anfang an die Kaltblütigere von ihnen beiden gewesen. Das war bis zum heutigen Tag so geblieben. Ihm schlug das Herz bis zum Hals, obwohl er zur Beruhigung eine hoch dosierte Tavor und einen Betablocker extra eingeworfen hatte.
Der Niederschlag wurde stärker und ging in Schneeregen über. Er betätigte den Scheibenwischer, um wieder klare Sicht zu bekommen. Die Gelegenheit war günstig, bei diesem Schietwetter und um diese Zeit war fast niemand unterwegs.
In Gedanken ging Burkart noch einmal den geplanten Ablauf durch. Sobald der Geldtransporter vor dem Eingang angehalten hatte, mussten sie ihre bereitgelegten gruseligen Latexhorrormasken über den Kopf ziehen, und wenn die Hecktür des Transporters geöffnet wurde, war die Zeit gekommen, um das übliche Prozedere durchzuziehen, das ihnen schon in Fleisch und Blut übergegangen war.
Die martialische Ouvertüre war das Wichtigste. Irmgard war diejenige, die durch Brüllen und Herumfuchteln mit ihrer respekteinflößenden Halbautomatik unmissverständlich vom ersten Augenblick an die Ernsthaftigkeit ihrer Unternehmung zu demonstrieren hatte. Es durfte dabei nicht der geringste Zweifel aufkommen, wer in diesem kritischen Moment das Sagen hatte. Im Notfall würde sie auch einen Warnschuss in die Luft abgeben oder sogar auf den Geldboten feuern, wenn er den Versuch unternahm, seine Waffe zu ziehen.
So was wie Skrupel kannten sie nicht. Schließlich galt es, nicht zu zögern oder zimperlich zu sein, wenn man ungeschoren davonkommen wollte.
Er, Burkart, hatte sich um die Geldkassetten zu kümmern, sie im Eiltempo in den Golf einzuladen und sich auf den Fahrersitz zu schwingen, der Motor des Wagens würde bereits laufen.
Irmgard würde inzwischen die Geldboten zwingen, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen, sie mit ihrer Waffe in Schach halten und dann, wenn er hupte, in den startbereiten Wagen springen. Bevor sie die Tür ganz zugeschlagen hätte, würde er schon Vollgas geben, ab durch die Mitte, ohne Rücksicht auf irgendwelche schreckstarren Kunden, die mit ihren Einkaufswagen vielleicht glotzend im Weg standen und gar nicht checkten, was da gerade vor sich ging.
Ablauf und Rückzug ihrer Raubzüge waren im Laufe der Jahre fast schon zur Routine geworden. So weit, so gut. Hatte zigmal nach dem gleichen Muster funktioniert. Auch wenn es den einen oder anderen Kollateralschaden gegeben hatte.
In ganz Deutschland waren sie als »Horrorduo« mit einem unscharfen Foto von einem Überwachungsvideo zur Fahndung ausgeschrieben, das Video war sogar in »Aktenzeichen XY … ungelöst« gezeigt worden. Ohne Erfolg. Außer den Horrormasken war nicht viel zu erkennen. »Schwer bewaffnet und gefährlich!«, stand als Zusatz unter dem Bild auf den Plakaten.
Die Bezeichnung »Horrorduo« war von der Zeitung mit den großen Buchstaben erfunden und von der übrigen Presse und den sozialen Netzwerken bereitwillig übernommen worden. Eine Boulevardzeitung, die noch origineller sein wollte, genierte sich nicht, sie mit Bonnie und Clyde zu vergleichen und sie »Duo infernale« zu nennen.
Aber darauf kam es in ihrer Situation auch schon nicht mehr an. Niemand wusste wirklich, wer sie waren, die Spekulationen über ihre Identität wurden immer abenteuerlicher. Ein geheimnisvolles Gangsterpaar, das sich seit über zwanzig Jahren gnadenlos den Weg freischoss, wenn jemand versuchte, es aufzuhalten. Und das einfach nicht zu fassen war.
Das war im Grunde genommen alles, was die Polizei an Fakten hatte: die immer gleiche brutale Vorgehensweise und ein paar unscharfe Videoaufnahmen. Keine DNA, keine Fingerabdrücke. Das Auto, das sie für ihren Überfall benutzten, wurde anschließend in irgendeiner Kiesgrube mit Benzin übergossen und abgefackelt.
Sie tauchten so regelmäßig irgendwo in Deutschland auf wie eine Stechmückenplage im Sommer nach ausgiebigem Regen, hatte eine Zeitung geschrieben. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie nicht nur lästig waren, sondern gefährlich.
Richtig gefährlich.
Jens-Uwe Burkart sah zum wiederholten Male nervös auf seine Uhr.
Hatte der Geldtransporter Verspätung? Oder hatten sie diesmal eine andere Ankunftszeit gewählt?
Er warf Irmgard einen Seitenblick zu und stupste sie an.
»Ist es so weit?«, fragte sie, ohne die Augen zu öffnen.
»Nein. Wollte nur wissen, ob du noch wach bist.«
»So wach, wie man nur sein kann.«
2
Ganz leise und vorsichtig öffnete sie eine der Flügeltüren zur Kapelle und warf erst einmal einen Blick hinein, um zu prüfen, ob sie auch leer war.
Der pastorale fensterlose Raum des Klinikums war nicht besonders geräumig – in der angedeuteten Apsis stand der schlichte hölzerne Altar, ein stilisiertes großes Kruzifix dahinter an der Wand, rechts und links vom Mittelgang waren sechs Sitzreihen mit je fünf Stühlen, ein Rednerpult an der Seite, gedämpftes, indirektes Licht, zwei brennende Kerzen, Stille.
Sie machte zwei Schritte hinein, drückte die Tür sanft hinter sich zu und begab sich nach vorne zum Altar, auf dessen Decktuch eine geschlossene Bibel neben einem frischen Blumenstrauß in einer Vase lag.
Sie schlug die Bibel am Lesezeichenbändel auf und sah nach, welche Stelle als Grundlage für die obligatorische Sonntagspredigt gedient hatte.
Johannes 11,39–43.
Jesus sprach: Hebt den Stein weg! Spricht zu ihm Marta, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich allezeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich’s, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!
Ja, genau. Das passte wieder einmal perfekt für das, was sie noch tun musste. Für Alexa Voss waren diese Bibelverse in diesem Augenblick – und nicht nur in diesem – ein himmlischer Fingerzeig.
Ihr ganzes neues Leben hatte sie nach diesen Vorzeichen und überirdischen Hinweisen ausgerichtet, nach der zutiefst menschlichen Enttäuschung, als sie dahintergekommen war, dass ihr langjähriger Freund sie von Anfang an betrogen hatte. Und am Ende, bevor er bei Nacht und Nebel mit ihrem Ersparten verschwunden war, hatte er sie auch noch in einer heftigen Auseinandersetzung – es war nicht die erste – grün und blau geschlagen, sodass sie eine ganze Woche nicht zur Arbeit gehen konnte und sich mit einer Ausrede krankschreiben lassen musste.
Danach war sie in ein tiefes Loch gefallen. Bis die Erleuchtung gekommen war. Vor drei Jahren.
In Form dieses seltsamen Mannes, der wie aus dem Nichts in ihr Leben getreten und genauso schnell wieder daraus verschwunden war. Aber er hatte etwas für sie hinterlassen, einen Fingerzeig, eine Tür, die nur für sie kurze Zeit geöffnet war, in einem Spalt des Universums.
Nichts auf dieser Welt war Zufall, alles hatte sich einem göttlichen Willen untergeordnet. Das war für sie nach dieser nächtlichen Begegnung zu einer unerschütterlichen Überzeugung geworden. Dieser Gedanke der Vorsehung, der nach Jahren der Depression, des Selbstmitleids und unzähligen fruchtlosen Therapien urplötzlich über sie gekommen war wie eine Erleuchtung, war nun ihre Leitlinie und Motivation, der sie sich bereitwillig unterordnete.
Das Universum hatte noch etwas vor mit ihr. Etwas Grundsätzliches, Großes. Eine Aufgabe, die nur für sie bestimmt war. Etwas, das ihrem Leben wieder einen Sinn gab.
Ein Leben, das vor ihrer Erleuchtung nur noch von der täglichen kräftezehrenden Arbeit als Pflegekraft auf der Intensivstation geprägt gewesen war. In der Klinik Hohenschönegg, einem riesigen Krankenhauskomplex im Hinterland des Bodensees zwischen Markdorf und Ravensburg, am Rand des Deggenhauser Tals gelegen. Ein Leben wie in »Und täglich grüßt das Murmeltier«, in einer Endlosschleife. Bestehend aus schlaflosen Nächten, wenn sie normalen, und schlaflosen Tagen, wenn sie Nachtdienst hatte. Das permanente Klingeln des Weckers, dann der lange Weg von ihrem Ein-Zimmer-Apartment zum überfüllten Bus. In den Pausen die hastig im Hinterausgang gerauchten Zigaretten, der ständig übersäuerte Magen wegen zu viel schlechtem Kaffee. Irgendwie funktionierte sie trotzdem, mit der stetigen Hoffnung auf einen trostlosen Feierabend vor der Glotze und einem Singlemenü aus der Mikrowelle. Wenn sie sich dann endlich ins Bett quälte, um wach zu liegen und an die Decke zu starren, wusste sie meistens überhaupt nicht mehr, was sie sich da stundenlang vor dem Bildschirm reingezogen hatte. Die Depression der täglichen nichtssagenden Repetition eines sinnlosen Lebens hatte sich von Woche zu Woche mehr manifestiert. Die Lethargie des alltäglichen Hamsterrads war zu ihrem freudlosen Lebensinhalt geworden, wie sie in einem seltenen Moment der Selbstreflexion feststellte.
Am Morgen ihres vierzigsten Geburtstags, mitten in der Coronazeit, war ihr mit einem Schlag klar geworden, dass sie einen Großteil ihres Lebens bereits verplempert hatte. So konnte es nicht weitergehen. Aber wie sollte sie das ändern? Indem sie auf irgendeiner Partnerbörse im Netz nach einem neuen Mann suchte? Hatte sie auch schon probiert und nach drei erfolglosen und eher hochnotpeinlichen Treffen die Notbremse gezogen und diese Form der Partnersuche endgültig eingestellt.
Am Abend ihres Geburtstags hatte sie Bilanz gezogen, ganz ohne Larmoyanz oder Weltschmerz oder Wut. Einfach so. Lange genug hatte sie dieses belanglose Leben ertragen, aber jetzt war es an der Zeit, damit Schluss zu machen. Sie wusste auch schon, wie.
Es würde schnell gehen. Kurz und schmerzlos.
Es gab nichts und niemanden, dem sie nachtrauerte, als sie sich nach Mitternacht zu Fuß auf den Weg zur Uferpromenade von Friedrichshafen aufmachte, dick vermummt gegen die beißende winterliche Kälte. Der Wintereinbruch in verhängnisvoller Kombination mit der Coronapandemie hatte Land und Leute mit einer lähmenden Tristesse gleichsam paralysiert. Bald war Weihnachten. Die Straßen waren wie leer gefegt, die Stille war fast schon unheimlich. Bisher war in diesem Winter kaum Schnee gefallen, die Sterne funkelten am klaren Himmel, der See lag spiegelglatt und pechschwarz da. In Ufernähe schimmerte der Schein der Straßenlaternen im Wasser, am gegenüberliegenden Schweizer Ufer glitzerten die Lichter von Kesswil, Uttwil und Romanshorn.
Alles war so friedlich, nicht einmal das Gekrächze irgendwelcher Möwen oder Wasservögel war zu hören. Aber es war eine Art von Friedhofsruhe. Genau die richtige Stimmung, um stilvoll abzutreten.
Sie ging die Mole zum Aussichtsturm hinaus. Der Turm war zweiundzwanzig Meter hoch, hundertsiebzehn Stufen führten zur obersten Plattform hinauf, das wusste sie, sie war schon oft hier gewesen und hatte sie gezählt.
Langsam, Schritt für Schritt, begann sie mit dem Aufstieg. Hundertsiebzehn Stufen zum Schafott, dachte sie mit einem jähen Anflug von verzweifelter Selbstironie und versuchte, die nun doch aufkeimende Angst vor dem Unumkehrbaren zu verdrängen.
3
Es war drei Jahre her, er erinnerte sich ganz genau. Damals hatte er noch zwei- oder dreimal die Woche unter Schlaflosigkeit gelitten, und in dieser Nacht war es wieder so weit gewesen. Eine Woche vor Weihnachten.
Er dachte an den traurigen Höhepunkt dieser schrecklichen Coronazeit mit Lockdowns und Ausgangssperren, Massenimpfungen und Maskenpflicht, Hysterie allenthalben, Leute wurden denunziert und angezeigt, weil sie auf einer Parkbank saßen und ein Buch lesen wollten oder weil der Nachbar eine heimliche Party mit ein paar Freunden in seiner Wohnung veranstaltete. Jeden Tag gab es neue Rekordzahlen von Todesfällen in sämtlichen Medien, dazu noch Pandemieleugner- und Querdenkerdemos, zu denen die Leute aus nah und fern busweise herangekarrt wurden und ihre Haltung mit beinahe schon religiöser Inbrunst und einer gehörigen Portion Fanatismus kundtaten. Und vereinzelt kam es sogar vor, dass Impfgegner und Impfbefürworter dem Druck nicht mehr standhielten und ihre Argumente nicht mehr verbal austrugen, sondern indem sie mit ihren Protestplakaten zuschlugen und mit Fäusten aufeinander losgingen.
Allmählich ähnelte der Zustand der Republik einem dystopischen Endzeitszenario, wie es sich ein Horrorspezialist wie Stephen King nicht besser hätte ausmalen können.
Die Welt schien aus den Fugen geraten zu sein, wie es bei Shakespeare geschrieben stand. Madleners Achillesferse war, dass er leider eine ausgeprägte Grübelneigung hatte, die sich zuweilen zu einer regelrechten Qual ausweiten konnte. Insbesondere, wenn er in seiner Arbeit nicht gefordert wurde und zu viel allein war, weil seine Lebensgefährtin Simone, die nicht bei ihm, sondern im geerbten Reihenhaus ihres Vaters wohnte, beruflich auf Achse war. Er konnte sich nicht einmal mehr damit ablenken, seine gedankliche Playlist der hundert besten Rocknummern aller Zeiten zu vervollständigen, die er inzwischen auf zweihundert ausgeweitet hatte, weil ihm immer mal wieder ein Song eingefallen war, den er nicht missen wollte. Meistens ein One-Hit-Wonder, das längst in Vergessenheit geraten war und das er zufällig gehört hatte und sentimentale Erinnerungen in ihm hochkommen ließ – wenn er allein in seiner Wohnung war und sich den Titel bei einem Glas Spätburgunder von der Winzergenossenschaft Meersburg auf seinem MP3-Player vorspielte, den ihm Simone geschenkt hatte. Einer dieser Songs war von Curved Air, »Back Street Luv«, einer »Baby Did a Bad Bad Thing« von Chris Isaak, der dritte Titel »Classical Gas« von Mason Williams, der vierte von Corey Hart, »Sunglasses At Night«. Und der fünfte, last, but not least: »Driver’s Seat« von Sniff ’n’ The Tears.
Im Grunde genommen war er wohl ein hoffnungsloser Romantiker, wie es seine junge Kollegin und beste Freundin Harriet Holtby einmal formuliert und ihn damit aufgezogen hatte. Sie durchschaute ihn, auch wenn er das nie zugegeben hätte.
Doch seinem Selbstverständnis nach war er eher ein hoffnungsvoller Romantiker, aber in letzter Zeit war ihm das immer schwerergefallen. Denn leider viel zu oft musste er an seine Listen der allgemeinen Lebenszumutungen denken; es waren zwei. Die eine befasste sich mit völlig überflüssigen Dingen, die andere mit Menschen, die die Welt nicht brauchte oder sie nur noch schlimmer machten. Seine negativen Favoriten wurden angeführt von notorischen und narzisstischen Lügnern wie Wladimir Putin und Donald Trump, während in der zweiten – der mit den überflüssigen Dingen – der Laubbläser auf der Spitzenposition war. Diese infernalisch lauten Geräte wurden vor allem im Spätherbst in der Regel um sieben Uhr morgens penetrant und stundenlang eingesetzt, anstatt das Laub wie früher per Hand mit einem einfachen Rechen oder einem Besen aufzuhäufen, bevor es abtransportiert werden konnte. Ohne unnötigen Lärm.
Gleich danach auf dieser Liste kamen die winzigen Ablageflächen an der Supermarktkasse für bereits abgescannte Einkäufe bei bestimmten Discountern – sie entsprachen maximal drei Bierdeckeln nebeneinander –, was nichts anderes war als der unverschämt unverhohlene Hinweis darauf, dass der Kunde, sobald er bezahlt hatte, ab sofort unerwünscht war und gefälligst schnellstens die Fliege machen sollte.
Aber der Höhepunkt der Missachtung von »König Kunde« – oder musste man jetzt genderkorrekt auch »Königin Kundin« sagen? – war die neue EU-Verordnung für die mit einer festen Lasche versehenen Deckel auf Plastikflaschen, die mit ihren scharfkantigen abstehenden Rändern dafür sorgten, dass man ohne nerviges Getüftel nicht mehr direkt aus der Flasche einschenken oder trinken konnte, was ja eigentlich der Sinn der Sache war, wenn man Durst hatte. Und wieder zudrehen konnte man die Deckel auch nur unter größten Schwierigkeiten, weil sie sich regelmäßig verkanteten. Außerdem bestand beim umständlichen Ansetzen der Flasche an den Mund die Gefahr, sich die Hornhaut vom Augapfel anzuritzen. Welcher sadistische Freak in Brüssel hatte sich das denn in drei Teufels Namen ausgedacht?
Madleners Meinung nach war das die unpraktischste und impertinenteste bürokratische Gängelung der Menschheit seit der Einführung der zweiundzwanzigstelligen IBAN. Dass es dagegen keine Protestwelle gegeben hatte, verstand er bis heute nicht.
Überhaupt: die Verpackungen von Lebensmitteln! Darüber hätte er einen stundenlangen geharnischten Vortrag im anklagenden Stil eines Robespierre vor dem Wohlfahrtsausschuss der Französischen Revolution halten können, hier und heute beim BDVI, dem Bund Deutscher Verpackungsingenieure, der im Grunde genommen auch noch für den ganzen Plastikmüll verantwortlich war, der den Weltmeeren und deren Bewohnern endgültig den Garaus zu machen drohte. Von den Mikroplastikteilchen, die vom menschlichen Organismus am Ende der Nahrungskette mit unabsehbaren Folgen aufgenommen und gespeichert wurden, ganz zu schweigen.
Inzwischen musste er sich wenigstens nicht mehr mit den Milch- und Konfitürenplastikdöschen herumplagen, mit deren Inhalt er sich regelmäßig bekleckert hatte, als er noch Hotelgast im »Silbernen Zeppelin« gewesen war, weil sie sich nicht unfallfrei öffnen ließen. Doch das Kreuz mit dem Verpackungswahn war seiner Meinung nach nur noch schlimmer geworden. Immer mehr Tüten, Beutel und Dosen waren so gestaltet, dass man an ihren Inhalt nicht mehr herankam, ohne bei Tüten die Chips und Flips auf dem Boden zu verstreuen, sobald man die gezackte Sollöffnungsstelle anleitungsgemäß aufmachen wollte und das Zellophan mit zu viel Kraftaufwand dabei ganz aufriss. Oder bei Beuteln und Gläsern notgedrungen gezwungen war, eine Schere oder ein scharfes Messer einzusetzen. Stets musste man damit rechnen, sich zu schneiden, wenn man nicht mit der Vorsicht und Akribie eines Gehirnchirurgen zu Werke ging. In den meisten Supermärkten gab es sowieso nur noch eingeschweißte Wurst und verplombten Käse. Die Deckel von Gurkengläsern oder Marmelade zum Beispiel saßen so fest, als hätte sie Arnold Schwarzenegger persönlich zugedreht. Wenn man nicht gerade die händische Hebelwirkung eines bayerischen Fingerhaklers hatte, blieb nach zahlreichen vergeblichen Anläufen nur noch ein wütender Gewaltexzess mit einer Rohrzange, einem Schraubenzieher oder einem spitzen Konservendosenöffner übrig, der bei nicht sachgemäßer Durchführung des Stichversuchs beziehungsweise einem unfreiwilligen Abgleiten von der glatten Oberfläche des Deckels zu übelsten Verletzungen führen konnte, die eine sofortige Einweisung in die Notaufnahme der nächsten Unfallklinik zur Folge hatten.
Noch schlimmer waren nur noch die windigen Deckel von Joghurt- oder Sahnebechern. Wie oft hatte er so ein Behältnis sorgfältig in seiner Tasche verstaut, um zu Hause feststellen zu müssen, dass der dünnhäutige Deckel beim Transport perforiert worden war und den gesamten Einkauf mit dem flüssigen Inhalt des Bechers mariniert hatte.
Der gesunde Menschenverstand war irgendwo zwischen der Eroberung des Mondes und der Eroberung der Krim auf der Strecke geblieben.
So viel zum üblichen Wahnsinn in der kleinen Welt des Alltags.
Auf Liste Nummer eins, angeführt von Putin und Trump, folgten in der großen weiten Welt der Politik neben den kriegs- und mordlüsternen Hauptübeltätern des Terrors noch sämtliche anderen Autokraten und Diktatoren, eine stattliche Anzahl. Ihm kam auf Anhieb mindestens ein Dutzend in den Sinn, darunter etliche unfähige, aber gefährliche Politclowns wie Boris Johnson zum Beispiel, der in den schlimmsten Coronazeiten jede Zusammenkunft oder Gesellschaft von mehr als zwei Personen verbot, selbst aber in Downing Street 10 eine feuchtfröhliche Party nach der anderen feierte. Wasser predigen und Wein trinken, fiel Madlener dazu ein.
Dann war da noch Kim Jong-un, der anhand von zwanzig Fotografien, die wie Steckbriefe aussahen, zwingend vorschrieb, welche Frisuren seine Untertanen haben durften und welche nicht. Bei Zuwiderhandlung musste man mit empfindlichen Konsequenzen rechnen bis hin zur Einweisung in eine Besserungsanstalt. Eine nordkoreanische Besserungsanstalt wohlgemerkt – dagegen war ein europäisches Gefängnis das reinste Bullerbü.
Oder Nicolás Maduro aus Venezuela, der sich per Dekret zum wiedergewählten Staatspräsidenten erklärte, obwohl offensichtlicher Wahlbetrug in großem Stil begangen worden war. Er verfügte tatsächlich als erste wichtigste Amtshandlung, selbstverständlich neben der sofortigen Verhaftung sämtlicher politischer Gegner, Weihnachten auf Oktober vorzuverlegen.
Alles Anekdoten aus der Agenda von Staatsoberhäuptern, die erst seit Kurzem nicht mehr, noch oder wieder im Amt waren. Kaum zu glauben, aber wahr. Madlener hätte lachen können, wenn es nicht so traurig gewesen wäre.
Wenn er die haarsträubende Hybris der ganzen machtbesoffenen Psychopathen innerlich Revue passieren ließ, brachte ihn das garantiert endgültig um den Schlaf.
Seine Lebensgefährtin Simone, die Einzige, bei der er seine Wut auf die Ungerechtigkeiten und Dummheiten der Welt zügeln konnte, war wieder einmal bei ihren erwachsenen Kindern in Berlin, und als sich nach Mitternacht trotz des Konsums von alten Musikvideos auf YouTube und einer interessanten Dokumentation über Stalin immer noch keine Müdigkeit eingestellt hatte, beschloss er, in seinen Mantel zu schlüpfen, die warmen Stiefel anzuziehen und einen kleinen Ausflug zu machen. Ein wenig Bewegung an der frischen Luft war auf jeden Fall besser, als sich von links nach rechts zu wälzen, über den Verpackungsirrsinn nachzudenken oder sich mörderische Diktatoren zu vergegenwärtigen, wie sie sich in einer abgeschotteten, aber bestens bewachten Datscha an einem gemütlichen Abend in trauter Runde unter ihresgleichen schmutzige Witze erzählten, amerikanische Western anschauten, dabei reichlich dem Wodka zusprachen und sich gegenseitig in neuen Methoden übertrafen, Andersdenkende zu drangsalieren und zu exekutieren. So wie das bei Stalin und seinem Geheimdienstchef Beria über Jahre hinweg üblich gewesen war. Wehe, es lachte keiner, wenn Genosse Stalin einen seiner berüchtigten schlechten Scherze machte. Dann konnte es gut sein, dass man selbst auf der schwarzen Liste für sofortige Festnahmen landete, die Genosse Beria jeden Morgen nach durchzechter Nacht mitnahm, um sie umgehend in die Tat umsetzen zu lassen oder selbst in den Folterkellern der Lubjanka Hand anzulegen, wenn ihm danach war. Und ihm war oft danach.
Madlener merkte schon, dass es dringend notwendig war, sein Gehirn ein wenig durchzulüften und einen nächtlichen Spaziergang an die Uferpromenade zu machen, bevor er noch anfing, über sämtliche Unmenschen und Übeltäter der vergangenen Jahrhunderte nachzudenken. Also verließ er seine Wohnung und marschierte los.
Am nächsten Morgen war um acht Uhr in der Früh ein angeblich wichtiger Besprechungstermin beim Kriminaldirektor angesetzt, dabei würde es um so eminent dringende Themen wie Budgetbegrenzungen, Überstundenabbau, Krankmeldungshöchststände, Urlaubsplanung und Personalnot in einigen Bereichen gehen. Madlener graute schon davor, er wusste beim besten Willen nicht, was für einen Beitrag er dazu leisten konnte. Aber Kriminaldirektor Cornelius legte Wert auf seine Anwesenheit und seinen Rat, da konnte er nicht mit einer fadenscheinigen Ausrede daherkommen, sosehr er auch damit liebäugelte.
Als er die Uferpromenade erreichte, warf er einen Blick auf seine Uhr. Ein Uhr dreizehn.
Warum sollte er, der begeisterte Hobbyastronom, der allein auf weiter Flur war, nicht auf die oberste Plattform des Moleturms steigen und den Sternenhimmel in seiner ganzen Pracht betrachten, jetzt, wo der Mond gerade verschwunden und der Nachthimmel klar war wie selten, weil normalerweise der Dunst, der aus dem See aufstieg, oder der übliche Nebel in der kalten Jahreszeit die Sicht stark beeinträchtigte oder sogar unmöglich machte?
Gedacht, getan. Hundertsiebzehn Stufen, anstrengend, aber gut für seine ständig vernachlässigte Kondition, er war schon oft da oben gewesen in der Nacht und hatte sie gezählt.
Die Sterne nicht, dafür waren es zu viele. Sie hatte er nur im wahrsten Sinne des Wortes angehimmelt und versucht, alle Sternbilder, die er kannte, aufzuspüren und zu bestimmen.
Genau das wollte er zu dieser fortgeschrittenen Stunde tun. Weil es ihm half, seinen inneren Seelenfrieden zu finden, wenn die Neuronen in seinem Kopf wieder einmal verrücktspielten.
4
Zur selben Zeit beugte sich Alexa Voss über das Geländer auf der obersten Plattform des Aussichtsturms und blickte in den Abgrund hinunter, der schwarz und scheinbar unergründlich darauf wartete, dass sie ihr Vorhaben umsetzte.
Was von unten gar nicht so aussah – wenn man oben stand, waren zweiundzwanzig Meter verdammt hoch. Jedenfalls hoch genug für das, was sie jetzt tun wollte.
Oder war das doch nicht hoch genug? Was, wenn sie sich nicht sofort das Genick oder den Schädel brach, an den kantigen Felsbrocken, die an der Molenkante entlang aufgeschüttet waren, sondern sich nur schwer verletzte und fortan für ein noch jämmerlicheres Leben als das, was sie jetzt schon führte, querschnittsgelähmt und ständig auf Hilfe angewiesen, vor sich hindämmerte?
Beim Gedanken daran fuhr ihr ein kalter Schauder über den Rücken, obwohl sie sich winterfest mit ihrer dicken Daunenjacke und ihrem Lieblingsschal eingekleidet hatte. Die Kapuze mit dem künstlichen Pelzbesatz hatte sie sich so weit über den Kopf gezogen, dass ihr Gesicht kaum zu erkennen war.
Durch ihre Arbeit als Krankenpflegerin auf der Intensivstation wusste sie allzu genau, was es bedeutete, wenn man nur noch »Gemüse« war, wie manche ihrer Kollegen beim Pausentee in schlecht verhohlenem Sarkasmus ihre Hilflosigkeit als unangebrachten Scherz über besonders krasse Fälle zum Ausdruck brachten, weil bei einigen Patienten abzusehen war, dass sie kein menschenwürdiges Leben mehr führen konnten.
Da hörte sie, wie jemand mit schweren Schritten die Metallstufen heraufstapfte. Wer in Gottes Namen konnte das sein, jetzt, um diese Zeit?
Sie drehte sich um und wartete darauf, dass dieser Jemand die oberste Plattform erreichte.
Ein großer Mann in seinen mittleren Jahren tauchte auf und blieb stehen, als er sah, dass noch eine Person hier oben in luftiger Höhe war. Er hatte einen dicken Mantel an, einen Schal um den Hals, trug Winterstiefel, Handschuhe und einen schicken Hut. Alles in Schwarz.
Wie ein Bote aus dem Jenseits, dachte sie in ihrem überreizten emotionalen Zustand.
Nach einer kleinen Verschnaufpause, in der er kurz durchpustete, taxierten sie sich gegenseitig, bevor der Mann höflich seinen Hut lüftete und sagte: »Hallo. Ich hoffe, ich störe Sie nicht …«
»Nein, nein.« Sie schüttelte den Kopf.
Auf seltsame Weise fühlte sie sich verpflichtet, ihre Anwesenheit an diesem Ort und zu dieser Zeit begründen zu müssen. Sie wusste nicht, warum. Der Mann hatte nichts Bedrohliches an sich, im Gegenteil. Sie geriet ins Stottern, weil sie natürlich nicht über die wahren Beweggründe ihres Aufenthalts auf dem Aussichtsturm sprechen wollte. Sie zeigte nach oben. »Ich wollte nur … weil … Es ist so … so sternklar heute …«
Er machte es ihr leicht, weil er wohl erkannte, wie verunsichert sie war, fast als hätte er sie bei etwas Unstatthaftem ertappt. »Ein Zwiegespräch mit dem Universum, ich verstehe«, sagte er, stützte sich auf das Geländer, sah zum Firmament und lächelte, was sie nicht sehen konnte, aber ahnte.
»So kann man es nennen, ja«, sagte sie und zwang sich ebenfalls zu einem Lächeln.
»Dann sind wir ja schon zwei«, erklärte er seine Gegenwart.
Sie drehte sich wieder zum See um, lehnte sich auch an das Geländer und warf dem Mann einen versteckten Seitenblick zu.
Hatte er etwa das Gleiche vor wie sie? Nein, danach sah er nicht aus. Aber wer konnte das schon sagen? Sie wirkte wahrscheinlich auch nicht wie jemand, dessen Motivation, auf den Aussichtsturm zu klettern, die Absicht war, von ihm hinunterzuspringen.
»Und?«, sagte er nach einer Weile. »Hat es schon geantwortet?«
»Was?«, fragte sie zurück, weil sie mit ihren Gedanken ganz woanders gewesen war.
»Das Universum. Hat es Ihre Anfrage schon beantwortet?«
»Tut es das? Ich habe eher den Eindruck, dass es für gewöhnlich schweigt.«
»Ja, das stimmt natürlich. Aber gelegentlich … wenn man genau zuhört …«
»Was sagt es dann?«
Sie ließ sich tatsächlich auf das Gespräch mit dem Mann ein, der ihr seltsam vorkam, aber auf eine gewisse Art fühlte sie sich von ihm durchschaut. Vielleicht, weil sie spürte, dass dieser Mann, der aus dem Nichts gekommen war, genau wusste, was sie eigentlich vorhatte. Obwohl er ein völlig Fremder war. Sie hatte das Gefühl, dass er ihr etwas zu sagen hatte. Nicht direkt, aber doch so, dass es eine Bedeutung für sie hatte. Warum wäre er denn sonst ausgerechnet in diesem Moment aufgetaucht? Vielleicht war er das Zeichen, auf das sie ihr ganzes Leben lang gewartet hatte.
Aus Verlegenheit und alter Gewohnheit tastete sie nach ihrem Fettstift, schraubte ihn auf und benutzte ihn wie einen Lippenstift, bevor sie ihn wieder wegsteckte.
»Ich will ehrlich sein«, sagte der Mann. »Normalerweise spricht es nicht zu uns, das Universum. Das ist zumindest meine Erfahrung. Es ignoriert uns, wenn Sie so wollen. Weil es nicht dazu da ist, sich zu erklären. Geschweige denn, den Menschen Hinweise oder zumindest Zeichen für den Grund und den Sinn ihres Daseins zu liefern. Auch wenn sämtliche Kulturen seit Tausenden von Jahren danach forschen und darüber spekulieren. Nein, es kommuniziert durch seine pure Existenz.«
»Was sind Sie? Ein Philosoph?« Zum ersten Mal lächelte sie offen, weil dieser seltsame Mann bei ihr ein Sensorium berührt hatte, von dem sie dachte, dass es schon längst abgestorben war.
»Um Gottes willen, nein«, meinte er. »Kalt, sehr kalt. Ich bin nur ein Bewunderer des Universums. Es fasziniert mich immer wieder, wenn ich in einer sternklaren Nacht nach oben schaue und mir jedes Mal bewusst wird, dass das, was wir sehen, bereits Vergangenheit ist.«
»Vergangenheit?«
»Ja. Einige der Sterne, die hier funkeln, sind schon längst verglüht, vor Millionen von Jahren. Und manche sind aufgegangen, obwohl wir ihr Licht noch nicht einmal sehen können. Aber wenn wir, ich meine die Menschheit, eines Tages nicht mehr da sind, existiert das Universum immer noch. Wenn man sich das vor Augen hält, vor sein inneres Auge, sollte ich vielleicht besser sagen, erkennt man zuweilen einen Moment lang, was Zeit und Ewigkeit bedeuten …«
Er schwieg, wie um über seine eigenen Worte nachzudenken.
Auch Alexa sagte nichts und schaute nur hoch zum Himmel.
Bis der Mann fortfuhr: »Ewigkeit – das ist viel für einen Menschen, dessen Leben begrenzt ist. Eigentlich zu viel. Im Grunde genommen unvorstellbar. Finden Sie nicht auch?«
»Ich weiß nicht …«
»Das Leben ist im Vergleich dazu nur sehr kurz. Und daher so kostbar. Weshalb fragen wir uns ständig: Was ist unsere Bestimmung? Unsere Zukunft? Können wir sie tatsächlich beeinflussen durch das, was wir tun? Eigene Entscheidungen treffen? Wenn uns das Universum seine Gleichgültigkeit demonstriert, heißt das: Es überlässt uns unseren Willen. Das ist ein Geschenk. Wir sollten es annehmen und nutzen.«
Sie merkte, wie er sie nach und nach in seinen Gedankengang hineingezogen hatte. So als hätte er direkt in ihr Innerstes gesehen. Aber das war ihr nicht unangenehm. Im Gegenteil, sie fühlte sich verstanden nach so langer Zeit belangloser Schwätzereien unter Kollegen in der Klinik zwischen »Guten Morgen«, »Mahlzeit« und »Schönen Feierabend«. Sonstige soziale Kontakte hatte sie nicht, sie war auch nicht im Netz unterwegs.
Eine wahrlich seltsame Begegnung. Ein philosophisches Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich noch nie zuvor über den Weg gelaufen waren, sich also nicht kannten und sich über grundsätzliche Fragen unterhielten an einem Ort, der in diesem Moment durch seine besondere Exposition etwas näher an den Sternen war als für gewöhnlich. Nur ein paar Meter, gemessen an der unvorstellbaren Ausdehnung des Alls nicht der Rede wert. Aber ihr kam es auf einmal vor, als spürte sie hier oben einen Hauch der Unendlichkeit.
»Es lohnt sich, darüber nachzudenken, glauben Sie mir. Das Universum hat noch etwas vor mit mir und mit Ihnen, da bin ich mir sicher«, sagte der Mann, tippte sich grüßend an den Hut und machte sich wieder auf den Weg nach unten.
Sie hörte seine Schritte auf den Metallstufen, wie sie allmählich leiser wurden.
Von ihrer Plattform aus konnte sie schließlich beobachten, wie er auf der Mole zur Uferpromenade gelangte und schemenhaft in der Dunkelheit zwischen den Häusern verschwand.
Als er nicht mehr zu sehen war, überlegte sie kurz, ob ihre Begegnung wirklich stattgefunden hatte oder ob das alles nur Einbildung oder eine seltsame Art von Wunschvorstellung gewesen war.
Sie blickte erneut zum Sternenhimmel hoch und wusste auf einmal, wozu sie auserkoren war. Sie hatte Macht, das wurde ihr in dem Moment klar. Sie, die unscheinbare Alexa Voss. Ihr bezeichnendes Merkmal war ihre Durchschnittlichkeit, aber sie war examinierte Krankenpflegerin auf der Intensivstation der Klinik Hohenschönegg und hatte Macht über Leben und Tod.
In diesem Augenblick war ihr die Erleuchtung gekommen. Sie spürte es geradezu körperlich, die göttliche Eingebung strömte förmlich durch sie hindurch. Die Erkenntnis, dass es Vorbestimmung war, mit ihrer Arbeit ein segensreiches Werk zu tun, das Wohlgefallen fand vor dem Angesicht des Herrn.
Sie war fortan das Werkzeug eines höheren Willens und beschloss, sich ihm mit Haut und Haaren zu verschreiben. Dieser Entschluss gab ihr den inneren Seelenfrieden zurück, nach dem sie sich so sehr gesehnt hatte.
Sie atmete einmal tief durch, dankte dem Universum, das tatsächlich dieses erste und einzige Mal zu ihr gesprochen hatte, wenn auch nur indirekt durch diesen seltsamen Mann, und machte sich entschlossen an den Abstieg. Morgen würde sie den ersten Schritt in ein neues Leben tun. Sie wusste auch schon, wie.
Madlener war in eine Seitengasse der Uferpromenade gegangen, hatte angehalten und beobachtet, im Schatten versteckt, ob sein kleiner Diskurs über das Universum und das Leben an sich Wirkung gezeigt hatte – so wie es von Anfang an seine Absicht gewesen war. Instinktiv hatte er gespürt, was diese Frau dort oben auf dem Aussichtsturm vorhatte.
Anscheinend war seine Ansprache von Erfolg gekrönt. Er konnte sehen, wie die Frau in ihre Daunenjacke eingemummt – ihr Gesicht hatte er gar nicht erkennen können – vom Turm herunterkam, zielstrebig die Mole entlanglief, nach rechts abbog und sich aus seinem Sichtfeld entfernte.
Er war erleichtert, anscheinend das Richtige gesagt und getan zu haben, und begab sich zu seiner nahe gelegenen Wohnung.
Er hoffte, dass er jetzt genügend frische Luft geschnappt hatte, um endlich einschlafen zu können.
5
Diese Begegnung war jetzt drei Jahre her. Madlener hatte sie längst vergessen, er und die Welt waren wieder in die Normalität zurückgekehrt.
Aber was hieß das schon – Normalität? Es gab mehr als genügend andere und neue Konfliktherde. Corona war zwar so gut wie überstanden, aber inzwischen beherrschte der Angriffskrieg des russischen Imperiums in der Ukraine die Schlagzeilen, nahm die Inflation unverhältnismäßig zu und verlangsamte sich wieder, der DAX fiel ins Bodenlose und erklomm eine Woche später neue Höchstwerte, der endlose Wahlkampf in den USA hatte durch Kamala Harris und den Rückzug von Joe Biden wieder Fahrt aufgenommen, Donald Trump benahm sich weiter wie ein unzurechnungsfähiger Wüterich, der merkte, wie ihm die Felle allmählich davonschwammen. Die üblichen Waldbrände in den Mittelmeerstaaten waren, durch den Klimawandel erst recht aufgeheizt, in noch nie da gewesenen Dimensionen ausgebrochen. Ebenso wie die heftigen Überschwemmungen durch extremen Starkregen. Jetzt stand der Winter vor der Tür, die Brände hatten sich nach Kalifornien, Brasilien und Australien verlagert, die Überschwemmungen nach Afrika, Indien und Pakistan.
In dieser Hinsicht hatte Europa eine kleine Verschnaufpause bis zum nächsten Jahrhunderthochwasser, dem dritten oder vierten innerhalb von zwanzig Jahren. Dafür nahmen die Terroranschläge durch IS-Sympathisanten zu, analog zu der schleichenden Gefahr für die Demokratie durch das Aufkommen der Rechtspopulisten quer durch den alten Kontinent. Im Nahen Osten war durch die Gräuel der Hamas erneut ein Krieg provoziert worden, der zu eskalieren drohte.
Normalität? Auch ohne Corona war die Welt aus den Fugen.
Was blieb Madlener und Harriet angesichts dieser Lage anderes übrig, als nach ihrem gemeinsamen Motto »Keep calm and carry on!« weiterzumachen?
Sie gingen routinemäßig ihrer Arbeit nach, im Moment stand außer der Bearbeitung von Altfällen und dem üblichen Papierkram nichts Außergewöhnliches an, was in ihren speziellen Aufgabenbereich fiel, den der Mordkommission, offiziell »Dezernat für vorsätzliche Tötungsdelikte, Geiselnahme und Menschenraub« genannt.
Harriet widmete sich in ihrer Freizeit wieder wie eine Besessene ihrem Boxtraining, da konnte sie am besten ihren Frust und ihre Wut abreagieren, und Madlener half seiner Lebensgefährtin Simone bei der Einrichtung ihres Antiquitätengeschäfts. Sie hatte einen leer stehenden Laden in Friedrichshafen ausgemacht, den sie gemeinsam renovierten, wobei Madlener zu seiner eigenen Überraschung seine Fertigkeiten als Handwerker entdeckte und Spaß daran entwickelte, zu planen, zu vermessen und Wände zu streichen. Es war ihm nach Feierabend eine willkommene Abwechslung zur öden Schreibtischarbeit, und allmählich hatte Simone auch einen soliden Grundstock an Antiquitäten zusammen, um ihr Geschäft in guter Citylage mit einer großen Eröffnungsparty einweihen zu können. Sie hatten lange diskutiert, wie sie das Geschäft nennen sollten, und sich schließlich auf »Antik & Art« geeinigt – das erschien ihnen schlicht und treffend.
Beide fanden, dass der Laden mit seinem Angebot sehr schön geworden war, er war geräumig genug, um auch gut erhaltene alte Möbel unterzubringen. In England hatte Simone eine Lieferung mit antiken Möbeln und Krimskrams bestellt, den Rest hatte sie bei einigen Auktionshäusern günstig ersteigert. Das war alles in allem keine kleine Investition, aber sie hatte durch den Verkauf ihres Geschäfts in Berlin vor ihrem endgültigen Umzug an den Bodensee genügend beiseitegelegt, um ihren Traum in Friedrichshafen verwirklichen zu können, ohne ihre letzten Reserven angreifen zu müssen. Sie hatte über die Jahre eine Menge Kontakte geknüpft und einen sicheren Geschmack dafür, was die potenzielle Kundschaft von Bregenz bis Konstanz anzog und was nicht.
Bei der Eröffnungsfeier war alles eingeladen, was in Friedrichshafen und Umgebung Rang und Namen hatte, und natürlich war auch das Polizeipräsidium ausreichend vertreten. Simone gab mehrere Führungen durch das Geschäft, und anschließend ging es nach Fischbach, wo die eigentliche Feier stattfand.
Madlener und Harriet, die eigentlich per se alles andere als begeisterte Partygänger waren, sprangen bereitwillig bei der Vorbereitung ein, sie gaben sich die größte Mühe, um die Eröffnungsfeier so cool und glanzvoll wie möglich zu gestalten und niemanden zu vergessen, dessen Anwesenheit ihnen wichtig war. Selbst Simones erwachsene Kinder samt Anhang und Madleners Sohn mit Freundin waren dabei. Madlener neckte seinen Sohn immer noch, indem er ihn »Olli« nannte, aber in Wirklichkeit war er stolz auf ihn. Oliver hatte inzwischen sein Studium als Landschaftsgärtner abgeschlossen und eine Stelle in Norwegen angenommen, die er in Kürze antreten wollte.
Der Junge hatte sich wirklich gut gemacht, seine eher abenteuerliche Schulzeit und die üblichen Un- und Leichtsinnigkeiten wie eine Kinderkrankheit überwunden und war zu einem verantwortungsvollen Menschen herangewachsen. Was nicht unbedingt Madleners Verdienst war, wie er selbst fand. Nach der Scheidung von Olivers Mutter war er eher ein lausiger Vater gewesen.
Alles inzwischen vergeben und vergessen, dafür war Madlener dem Schicksal immer noch dankbar.
Kriminaldirektor Cornelius gab sich mit seinem Mann die Ehre, Kommissar Götze und Miriam Mosacher, die neue Kollegin im Kommissariat – die beiden waren inzwischen offiziell verlobt –, nahmen teil, ebenso ihr pensionierter Ex-Kollege Binder mit Gattin und selbstverständlich auch Frau Gallmann. Sie alle zeigten sich beeindruckt davon, was Simone mit Hilfe von Madlener so schnell auf die Beine gestellt hatte, und ließen sie spüren, dass es keine Lobhudelei war, sondern ehrlich gemeint.
Mit einem Shuttleservice wurden die Gäste zum »Bahnhof Fischbach« gebracht, einem stylish restaurierten Gasthof, der auf Veranstaltungen jeglicher Größenordnung spezialisiert war; für die fast einhundert Gäste hatten sie dort einen Saal gemietet.
Nach den üblichen kurz gehaltenen Ansprachen – sogar Madlener sagte ein paar überraschend launige Worte – stellte sich schnell ein entspanntes Miteinander ein, was erstens den großzügig ausgeteilten Drinks und zweitens der chilligen Musik zu verdanken war, die von Harriets türkischem Boxtrainer aufgelegt wurde, der als DJ fungierte und dem bei seinem bärbeißigen Aussehen mit schwarzem Vollbart und Tattoos niemand zugetraut hätte, so ein Händchen für die passende Musik zu haben und damit für die richtige Stimmung zu sorgen. Niemand außer Harriet, die ihn extra dafür vorgeschlagen hatte.
Das Büfett wurde von Simone schließlich für eröffnet erklärt, und der lockere Teil des Abends nahm seinen Verlauf.
Später, als nur noch der harte Kern übrig geblieben war, zeigte sich die Pathologin und ehemalige Freundin von Madlener, Dr. Ellen Herzog, die ebenfalls mit von der Partie war, von einer Seite, wie Madlener sie noch nie gesehen hatte. Sie und Harriet tanzten, als wollten sie Uma Thurman und John Travolta in der berühmten Tanzszene aus »Pulp Fiction« Konkurrenz machen, indem sie die beiden gekonnt imitierten. Sogar Madlener wurde übermütig und schloss sich an.
Er kam aus dem Staunen über sich und auch über Harriet gar nicht mehr heraus, so ausgelassen hatte er seine Kollegin noch nie erlebt. Am Ende der Nummer standen alle noch anwesenden Gäste im Kreis um sie herum und klatschten begeistert Beifall.
Madlener hatte sich trotz der vielen Menschen lange nicht mehr so wohlgefühlt und war glücklich, auch weil Simone, der strahlende Mittelpunkt, glücklich war.
Aber Glück hat nun einmal eine kurze Halbwertszeit.
Deshalb sollte man es genießen, solange es anhält, dachte er, als er das Fest um drei Uhr in der Früh im Bett geistig Revue passieren ließ und endlich müde und erschöpft neben Simone einschlief.
6
Das alles war jetzt, kurz vor Weihnachten, Schnee von gestern, stellte Madlener fest, als er im Polizeipräsidium aus dem Fenster des Büros von Kriminaldirektor Cornelius schaute und beim Anblick des Hagelschauers, der heftig gegen die Fensterscheibe prasselte und von Blitz und Donner begleitet wurde, noch einmal an Simones Einweihungsparty dachte, die glücklicherweise bei schönstem Sommerwetter stattgefunden hatte.
Das Wetter schlug, wie immer in letzter Zeit, Kapriolen. Letzte Woche war es – Anfang Dezember – überraschenderweise noch einmal fast spätsommerlich warm gewesen, und jetzt das. Aber so konnte man sich wenigstens auf das kommende Weihnachten und die Feiertage einstellen, was bei zwanzig Grad plus eher schwierig gewesen war. Auch wenn der unermüdlich blau-weißrot blinkende künstliche Weihnachtsbaum von der Größe einer Topfpflanze, der mit einer silbernen Glittergirlande umwickelt war und in der Ecke stand – ein Mitbringsel von Götze aus seiner Fortbildung beim FBI in Quantico, Virginia –, sich größte Mühe gab, so etwas wie weihnachtliche Atmosphäre auf Amerikanisch zu verbreiten. Madlener mochte ihn und fand ihn in seiner hilflosen Bemühung, stimmungsvoll zu sein, irgendwie rührend.
Harriet stand neben ihm, beobachtete regungslos das Wetterschauspiel und kaute an ihrem üblichen überscharfen Kaugummi, von dem sie, auch wie üblich, Madlener ebenfalls ein Exemplar angeboten hatte, obwohl sie ganz genau wusste, dass er ihn verabscheute. Aber das war so eine Art Ritual zwischen ihnen, wenn sie nachdachten. Manchmal nahm Madlener, gedankenverloren, wie er des Öfteren war, den Kaugummi reflexhaft an und steckte ihn sich in den Mund, was ihn jedes Mal beim ersten Biss auf der Stelle in die Realität zurückbrachte und das Gesicht verziehen ließ. Er musste bei so einem Fauxpas nur Harriets Grinsen sehen, um zu kapieren, dass er wieder einmal hereingelegt worden war. Doch den Triumph, den Kaugummi sofort auszuspucken, gönnte er ihr nicht. Im Gegenteil, er grinste zurück und kaute tapfer weiter, bis der beißende Geschmack endlich nachließ, auch wenn Zunge und Gaumen ganz taub geworden waren.
Draußen vor dem Polizeipräsidium zeigte sich der urplötzlich und ohne gnädigen herbstlichen Übergang einsetzende Winter gleich auf Anhieb von seiner garstigsten Seite. Eine schwarze Wolkenwand war rasch mit unheilverkündendem Donnergrollen aufgezogen, mit einem Schlag war es dunkel geworden, mitten am Vormittag. Windböen fauchten an- und abschwellend um das Gebäude, zuweilen hörte es sich an wie in einem alten schottischen Schloss zur Geisterstunde. Der mit Graupel vermischte Schneefall ging schließlich in Schneeregen über, und Madlener war ausnahmsweise froh, dass er sich nicht irgendwo da draußen an einem Tatort herumtreiben musste, obwohl er normalerweise lieber im Außeneinsatz war, als hinter dem Schreibtisch zu sitzen.
Sie warteten auf Kriminaldirektor Cornelius, der sie an diesem Vormittag zu einer wichtigen Sitzung gebeten hatte. Dass er unpünktlich war, kam sehr selten vor.
Frau Gallmann, die blass aussah und sich seltsam fahrig verhielt, wie Madlener besorgt feststellte, war bemüht, ihren Chef zu entschuldigen – er stecke irgendwo auf der A 30 zwischen Meckenbeuren und Kehlen im Stau fest, es habe einen Unfall gegeben.
»Wo sind eigentlich Götze und Miriam, wenn dieses Treffen gar so wichtig ist?«, fragte Madlener und spuckte den widerlichen Kaugummi schnell und unauffällig in sein Tempotaschentuch, weil Harriet gerade nicht herschaute.
»Haben seit heute Urlaub«, sagte Frau Gallmann.
»Was?«