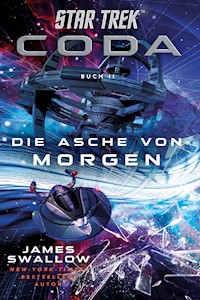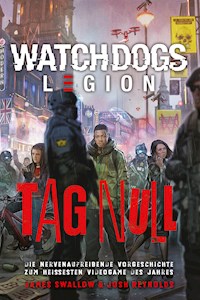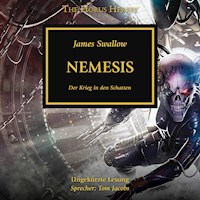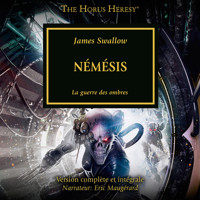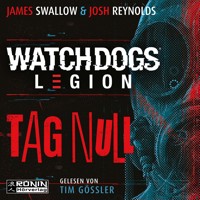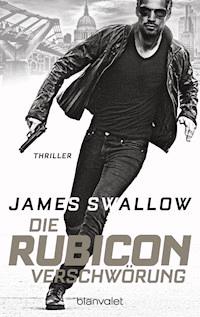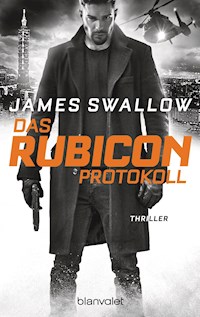
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marc Dane
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Agent Marc Dane: »Die britische Antwort auf Jason Bourne.« Daily Mail
Nachdem sich auf der ganzen Welt schockierende Anschläge ereignen, braucht Agent Marc Dane all seine Fähigkeiten und seinen Scharfsinn, um den mysteriösen Drahtzieher aufzuspüren – eine gesichtslose Verbrecherin, die nur unter dem Namen “Madrigal” bekannt ist und mithilfe einer Gruppe von Hackern einen skrupellosen Rachefeldzug führt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Lucy Keyes und dem restlichen Rubicon-Team begibt Marc sich auf eine gefährliche Verfolgungsjagd. Doch kann er all seinen Mitstreitern vertrauen? Und wie können sie den Terror stoppen, bevor er die Welt in den Krieg stürzt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Nachdem sich auf der ganzen Welt schockierende Anschläge ereignen, braucht Agent Marc Dane all seine Fähigkeiten und seinen Scharfsinn, um den mysteriösen Drahtzieher aufzuspüren – eine gesichtslose Verbrecherin, die nur unter dem Namen »Madrigal« bekannt ist und mithilfe einer Gruppe von Hackern einen skrupellosen Rachefeldzug führt. Gemeinsam mit seiner Kollegin Lucy Keyes und dem restlichen Rubicon-Team begibt Marc sich auf eine gefährliche Verfolgungsjagd. Doch kann er all seinen Mitstreitern vertrauen? Und wie können sie den Terror stoppen, bevor er die Welt in den Krieg stürzt?
Autor
James Swallow wurde für seine Drehbücher unter anderem für einen BAFTA Award nominiert und hat zahlreiche erfolgreiche Video- und Hörspiele, Kurzgeschichten und Science-Fiction-Romane verfasst. Nach »Die Rubicon-Verschwörung« und »Die Rubicon-Mission« ist »Das Rubicon-Protokoll« sein dritter Thriller um den britischen Agenten Marc Dane. James Swallow lebt und arbeitet in London.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
JAMES SWALLOW
DAS RUBICON-
PROTOKOLL
THRILLER
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»Ghost« bei Zaffre Publishing, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © James Swallow, 2018
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020
by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
© Johannes Frick unter Verwendung von Motiven von Nik Keevil/Arcangel Image, iStock.com (© Lorado, © tobiasjo
© Marcus Lindstrom) und Shutterstock.com (© Andre Muller,
© Avesun, © Vandathai, © da-kuk)
AF · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-24668-6V001
www.blanvalet.de
Für alle, die den Kampf um Freiheit und Vernunft
noch nicht aufgegeben haben.
Zum Angedenken an meinen Vater, Terrance Swallow.
Kapitel 1
Panik erfüllte ihn. Dickflüssig und zäh sickerte sie in seine Lunge und sammelte sich in seinem Magen, der sich zu einem schweren Klumpen formte. Die schwüle Mittagsluft wurde immer drückender, aber Lex setzte einen Fuß vor den anderen, so lange, bis seine Knie nachzugeben drohten. Er musste unbedingt für einen Moment verschnaufen, musste wieder zu Atem kommen, also rettete er sich in den Eingang einer Apotheke in den etwas kühleren Schatten, wo er Schutz vor der hochstehenden Sonne fand. Die Belegschaft machte bereits Siesta.
Er duckte sich und versuchte, seine Angst und seine Schwäche wieder in den Griff zu bekommen, strich sich die Haare aus dem rundlichen Gesicht. Entsetzen lag in seinem Blick. Er blinzelte, rückte seine Brille zurecht und verschmierte dabei die Gläser.
Lex ließ den Blick an sich hinabgleiten.
Jetzt nahm er zum ersten Mal die winzigen rostroten Flecken auf dem weißen T-Shirt wahr, das er unter seiner weiten schwarzen Kapuzenjacke trug. Der Schraubstock, der sein Herz umklammert hielt, zog sich noch ein bisschen fester zusammen. Er legte die Hand an seine Wange. Danach war sie mit rubinroten Streifen beschmiert. Hastig rieb er sein Gesicht mit dem Ärmel sauber, zerrte an dem Reißverschluss seines Hoodies und zog ihn ein Stück hoch, um die Spritzer zu verstecken.
Es war das Blut des Griechen. Lex hatte nicht einmal gemerkt, dass er etwas davon abbekommen hatte, so sehr war er mit all seinen Sinnen auf die Flucht konzentriert gewesen.
Es ist alles so rasend schnell passiert. Als Treffpunkt hatten sie eine große Piazza am südlichen Rand der Altstadt von Rabat abgemacht. Lex war schon seit Tagen auf der Mittelmeerinsel, die mit jeder Stunde ein wenig zu schrumpfen schien. Er wollte nur noch weg. Als die Nachricht endlich eintraf, hatte er gar nicht schnell genug zum Treffpunkt kommen können.
Die Nachricht bestand lediglich aus einer digitalen Zeichenfolge und wurde auf einen verschlüsselten Tor-Server geleitet, den Lex gleich am Tag seiner Flucht eingerichtet hatte. Sie enthielt die Zusage eines griechischen Schmugglers, der bereit war, ihn aus Europa zu schaffen und in ein Flugzeug nach Kanada zu setzen. Kyrkos, so hieß der Mann. Sie waren sich einig gewesen, der Ablauf genauestens geplant.
Sie wollten sich in Rabat treffen und gemeinsam nach Valetta fahren, wo Kyrkos ein Boot liegen hatte. Lex hatte alles genau vor Augen gehabt: Den Abend würden sie schön auf See verbringen, wo er sich den Sonnenuntergang im Meer anschauen würde. Anschließend wollte er ein kleines Ritual abhalten und seine sämtlichen Ausweispapiere verbrennen (und die Aschereste ins Wasser streuen). Ein Neubeginn.
Lex Wetherby würde auf See bestattet werden und wäre für immer verschollen. Genau so war es vorgesehen gewesen, weil niemand wusste, wo er war. Er war in Sicherheit.
Aber nachdem er sich dem Griechen gegenüber an einen Cafétisch gesetzt hatte, hatte der bullige Leibwächter in seiner Nähe plötzlich gestutzt, als hätte er etwas Ungewöhnliches bemerkt. Nur eine Sekunde später riss es ihn ruckartig nach hinten, als hätte ihn ein Pferd getreten.
Lex hatte schon öfter gesehen, wie jemand erschossen wurde, und jedes Mal hatte er dabei einen Schuss, einen lauten Knall gehört. Aber dieses Mal nahm er gar nichts wahr, was das ganze Geschehen seltsam unwirklich machte.
Kyrkos sprang von seinem Stuhl auf und stieß ein Weinglas um. Er hatte gerade noch Zeit, um Lex zu beschimpfen, dann zerfetzte das nächste Projektil – ebenfalls schallgedämpft – sein Gesicht. Der Grieche brach an Ort und Stelle zusammen. Ein Tourist an einem Nachbartisch bemerkte das Blut, ein Kind kreischte laut auf.
Lex ergriff die Flucht. Instinktiv, aus reinem Selbsterhaltungstrieb, kippte er dabei den Tisch zur Seite. Die dritte Kugel riss eine Ecke aus der hölzernen Tischplatte. Während er auf die nächste Gasse zustürmte, die ihm als vages Versprechen auf Sicherheit erschien, blickte er sich um, auch das eine instinktive Handlung, völlig unwillkürlich.
Touristen und Einheimische standen völlig erstarrt da, mit entsetzten Mienen, die Hände vor den Mund geschlagen. Die einzigen Menschen, die in seine Richtung blickten, waren ein Mann und eine Frau. Beide waren durchschnittlich groß und trugen identische Baseballmützen sowie große schwarze Sonnenbrillen, die die Hälfte ihres Gesichts verdeckten. Er sah die dunklen, kantigen Pistolen in ihren Händen, und dann setzte sein Verstand einfach aus. Dafür kochte die Panik in ihm hoch wie ein ausbrechender Geysir.
Er lief durch eine enge, stickige Gasse voller widerlicher abgestandener Gerüche und stieß etliche Häuserblocks nördlich der Piazza auf die Kbira Street, folgte dem Verlauf der Straße an den altehrwürdigen Mauern der Kollegiatskirche St. Paul vorbei. Rabat lag auf einem Hügel, und durch die mittelalterlichen Straßen wehte eine gleichmäßige Brise, die ihm die Haare zerzauste und Papierfetzen an den Randsteinen entlangblies. Zu allen Seiten standen dicht gedrängt sonnengebleichte Gebäude, und jetzt, am Nachmittag, waren die meisten Geschäfte geschlossen.
Lex rannte weiter, wie auf Autopilot, bis ihm klar wurde, dass er beinahe einen verhängnisvollen Fehler begangen hätte. So war er mit weichen Knien vor der Tür der Apotheke zum Stehen gekommen. Jetzt versuchte er, seinen Verstand wieder einzuschalten und sich an all das, was er über die Stadt wusste, zu erinnern. Nicht weit von hier entfernt, dort, wo Rabat auf die Mauern der alten Festungsstadt Mdina traf, gab es einen Busbahnhof. Er musste lediglich in einen der Nahverkehrsbusse schlüpfen und sich unter die Fahrgäste mischen, dann würde er ungesehen entkommen. Den Rest konnte er sich dann unterwegs überlegen, aber im Moment war er vor allem damit beschäftigt, sich nicht erschießen zu lassen.
Das zerfetzte Gesicht des Griechen tauchte vor seinem geistigen Auge auf, und als er versuchte, das Bild wieder loszuwerden, musste er würgen. Nestor Kyrkos war gut vernetzt und hatte Feinde gehabt, das wusste Lex. Vielleicht hatte das Killerpärchen mit den Baseballmützen ihn ja wegen einer ganz anderen Sache getötet, einer Sache, von der er, Lex, nicht einmal etwas ahnte. Vielleicht waren sie überhaupt nicht an ihm interessiert.
Doch dann erkannte er im Schaufenster der Apotheke das Spiegelbild eines olivfarbenen Gesichts, halb verdeckt von einer schwarzen Sonnenbrille. Jetzt wusste Lex mit absoluter Sicherheit, dass er das eigentliche Ziel war – und nicht Kyrkos und der Leibwächter. Kollateralschäden, bedauerlich, aber nun ja. Die Attentäter hatten die beiden nur getötet, um jede mögliche Gefahr auszuschalten, bevor sie sich ihrer eigentlichen Beute zugewandt hatten.
Lex huschte aus dem Schatten des überdachten Eingangs und schob sich durch eine Gruppe betagter englischer Touristen, die in der entgegengesetzten Richtung unterwegs waren. Trotz ihres leisen Murrens über seine Rücksichtslosigkeit hörte er das tiefe Dröhnen einer Unterschallkugel einen Sekundenbruchteil, bevor in einem sandfarbenen Steinblock in der Mauer neben ihm auf Kopfhöhe plötzlich ein Einschusskrater aufplatzte. Die Touristen reagierten mit zurückhaltender Verblüffung auf das laute Geräusch, während Lex sie bereits hinter sich gelassen hatte und sich nun dicht an die gelben Steinmauern der Nachbargebäude presste, um vor den Blicken der Attentäter geschützt zu sein, bis er die nächste Ecke erreicht hatte.
Kein Knall, nichts. Die Waffen, die die beiden benutzten, waren so gut wie lautlos. Außer ihm schien niemand zu begreifen, was sich hier gerade abspielte.
Lex hastete weiter, so schnell es nur ging, aber ohne zu rennen. Er wollte der Panik auf keinen Fall nachgeben, aus Angst, dass sie ihn ins Verderben führen würde. Bei seinem überstürzten Aufbruch aus dem Café hatte er seine Kuriertasche zurückgelassen, aber sie enthielt nur wenige Dinge, die unersetzlich waren. Das Wichtigste, das unschätzbar Wertvolle, trug er bei sich. Seit er Berlin den Rücken gekehrt und seine Kameraden zurückgelassen hatte, hatte er den Anlass für diesen Verrat immer in seiner unmittelbaren Nähe gehabt.
Bei diesem Gedanken zuckte seine Hand und krampfte sich kurz zusammen. Nervös strich Lex mit den Fingern der anderen Hand über die Narben an seiner Handfläche, kratzte an der alten, längst verheilten Wunde. Sein rechtes Bein fing an zu schmerzen, wie immer, wenn es schwierig wurde, doch er verdrängte den Phantomschmerz, indem er die Taschen seiner Cargohose und seiner Kapuzenjacke abklopfte, um sich zu vergewissern, was er alles bei sich hatte.
Nicht viel. Säuerliches Adrenalin sammelte sich in seinem Mund und hinterließ einen metallischen Nachgeschmack. Das war nicht die Art von Angst, die er kannte, nicht dieser Rausch der Geschwindigkeit, wenn er mit dem Fallschirm von einer Felsenklippe sprang oder auf dem Surfbrett eine Welle ritt. Damit kam er klar, weil er in diesen Situationen immer noch die Kontrolle hatte. Aber diese Angst jetzt kam brachial und schroff und überwältigend daher, und er musste sich zusammenreißen, um halbwegs klar denken zu können.
Diese Leute wollen mich ermorden. Jetzt traf ihn die Erkenntnis mit voller Wucht und presste ihm die Luft aus der Lunge.
Die schicksalhafte Entscheidung, die er vor Wochen noch in Deutschland getroffen hatte, fiel ihn jetzt von hinten an. Die Menschen, mit denen er zusammengelebt, mit denen er gefeiert, die Menschen, die er zu kennen geglaubt hatte … Er fragte sich, ob er sie überhaupt jemals wirklich verstanden hatte. Er hatte absichtlich die Augen verschlossen vor dem, was tatsächlich vor sich ging, vor den Plänen, die geschmiedet wurden. Er hatte ganz bewusst die Scheuklappen aufgesetzt und die unbarmherzigen Fragen ignoriert, die ihm den ganzen Spaß verdorben hätten. So lange, bis er nicht mehr länger hatte wegschauen können.
Lex verabscheute sich dafür. Und als es zu viel geworden war, als er vor lauter Angst nachts nicht mehr schlafen konnte, da war er weggerannt, war hierher geflüchtet – und jetzt saß er in der Falle. Jetzt würden die Attentäter, die seine ehemaligen Freunde ihm auf den Hals gehetzt hatten, ihren Auftrag erfüllen, und Lex’ viel zu späte Reue würde sich als sinnlos erweisen. Er stieß einen unterdrückten Fluch aus und versuchte, die Übelkeit erregende Furcht abzuschütteln, die ihn zu ersticken drohte.
Er fing an zu joggen, vermied bewusst die Ziergartenanlagen im Norden von Rabat, sondern lief durch den Park. Keuchend kauerte er sich hinter einen dicken Johannisbrotbaum und wagte erneut einen Blick in die Richtung, aus der er gekommen war. Der Killer stand keine fünfzig Meter entfernt, blickte in die entgegengesetzte Richtung und suchte die Straßen nach seiner Zielperson ab. Lex sah, wie er den Mund bewegte, konnte jedoch kein Wort verstehen. Der Mann hatte zwei Finger an den Hals gelegt, als würde er seinen Puls messen, und als er die Hand sinken ließ, erkannte Lex, dass an seiner Kehle ein kleines Pflaster klebte, wie ein Nikotinpflaster.
Der Mann blickte in Richtung des Busbahnhofs und nickte, lauschte einer Stimme, die nur er hören konnte.
Lex folgte seinem Blick, und dann krampfte sich sein Magen zusammen, als die Frau zwischen zwei Bussen in sein Sichtfeld trat. Die Pistole versteckte sie in den Falten ihrer hellen Jacke.
Sie drehte den Kopf, sodass die grelle Sonne sich in ihren großen Brillengläsern spiegelte, und blickte genau in Lex’ Richtung. Augenblicklich veränderte sich ihre Körpersprache, als hätte sie einen Schalter umgelegt. Langsam und ohne Hast kam sie auf ihn zu. An ihrem Hals klebte das gleiche Pflaster wie bei ihrem Komplizen, und jetzt bewegte sie den Mund, aber wieder konnte Lex nicht erkennen, was sie sagte.
Wenn er überleben wollte, dann blieb ihm nur noch eine einzige Möglichkeit. Der Busbahnhof schied aus, und dorthin zurück, wo er hergekommen war, konnte er auch nicht, weil er dann in jedem Fall den Weg der Attentäter gekreuzt hätte.
Also musste Lex sich unter die Menschen mischen, die die mauergesäumte Altstadt von Mdina besuchen wollten. Dazu musste er die uralte steinerne Brücke überqueren, die zu dem historischen Stadttor führte. Die Touristen dienten als Deckung. So schnell er nur konnte, hastete er vorwärts, während schon wieder stechende Schmerzen sein Bein durchzuckten; dabei duckte er sich hinter ein paar lachenden Besuchern, die eifrig ein Selfie nach dem nächsten machten.
Während er sich dem barocken Portal näherte, kam er sich seltsam entwurzelt vor. Er wusste nicht viel über Mdinas Geschichte, aber dieses Bauwerk kannte er gut, weil es gleich in mehreren Fantasy-Serien als geheimnisumwobene Schlosskulisse gedient hatte. In den langen, einsamen Nächten, während sein Laptop mit der Kompilierung diverser Codetexte beschäftigt gewesen war, hatte Lex diese Serien regelrecht verschlungen. Er hätte sich nicht gewundert, wenn die Leute auf der Brücke Schwerter gezogen und sich auf ihn gestürzt hätten. Irgendwie hatte er das Gefühl, als sei die ganze Welt hinter ihm her.
Er verspannte sich mit jedem Schritt, erwartete den nächsten lautlosen Schuss, rechnete fest mit einer Kugel zwischen seinen Schulterblättern, aber nichts dergleichen geschah. Als er die schattigen Straßen der mittelalterlichen Burgfeste betrat, zitterte er unwillkürlich.
Kurz hinter dem Stadttor gabelte sich der Weg in drei Teile. Die Touristen zogen weiter und gingen schnurstracks geradeaus die Triq Villegaignon entlang, vorbei an der St.-Agatha-Kapelle, der ersten von insgesamt einem halben Dutzend Kapellen in der über tausend Jahre alten Festungsanlage. Lex löste sich von ihnen und huschte in eine Nebenstraße, die sich an der südlichen Stadtmauer entlangzog. Aus dem Taxi, mit dem er hier angekommen war, hatte er gesehen, dass es im Westen noch ein zweites Stadttor gab. Wenn er es bis dorthin schaffte und dann einen Haken schlug, hatte er immer noch eine Chance, ungesehen zu entkommen.
Er fing an zu laufen, doch es fiel ihm schwer: Jedes Mal, wenn er mit seinem versehrten Bein auf das Kopfsteinpflaster trat, durchfuhr ihn ein schmerzhafter Stich. Schon bald wurde die Gasse enger, rückten die Mauern näher, sodass er sie schließlich links und rechts gleichzeitig berühren konnte, wenn er die Arme seitlich ausstreckte. Trotz der Enge fiel an etlichen Stellen Sonnenlicht auf die Sandsteinmauern und warf Schatten, die ihm die Möglichkeit boten, kurz stehen zu bleiben und sich zu sammeln. Jenseits der touristischen Trampelpfade schien Mdina menschenleer zu sein, was das seltsame Gefühl, sich in einer Filmkulisse zu befinden, noch verstärkte. Doch Lex konnte es sich nicht erlauben, lange zu verschnaufen, nicht jetzt, wo die Attentäter ihm so dicht auf den Fersen waren.
Schlingernd hastete er um die nächste Ecke und entdeckte den Bogen des westlichen Tors. Von den Einheimischen wurde Mdina die »Stille Stadt« genannt, weil im Inneren des Mauerrings nur einige wenige Autos zugelassen waren. Aber es gab noch einen anderen Grund. Die engen Gassen schienen jedes Geräusch in ein seltsames, gespenstisches Echo zu verwandeln oder gleich ganz zu verschlucken. Lex wusste nicht, ob es sich bei den hastigen Schritten, die er hinter sich wahrnahm, um den Nachhall seiner eigenen oder doch um die einer der Killer handelte. Aber er wagte nicht, langsamer zu werden und der Sache auf den Grund zu gehen.
Dann hatte er das Tor erreicht und rannte hindurch, gelangte wieder ins grelle Tageslicht und stand nun am oberen Ende einer Rampe, die hinunter zur Straße führte.
Doch die Frau mit der Mütze und der Sonnenbrille hatte seinen Plan durchschaut. Mit schnellen Schritten kam sie die Rampe heraufgelaufen, das Gesicht von der Anstrengung gerötet. Ihre Waffe hielt sie eng an die Hüfte gedrückt. Als sie einander sahen, verharrten sie beide für einen Augenblick.
Sie schüttelte ihre Verblüffung als Erste wieder ab und riss ihre Waffe nach oben. Der klobige schwarze Revolver wirkte fast zu groß für ihre langen, schlanken Finger. Lex wurde kurz geblendet, dann erkannte er, dass die Waffe eine Laser-Zielvorrichtung besaß, dass ein roter Punkt über sein Gesicht, seine Kehle, seine Brust wanderte.
Er war bereits wieder auf dem Weg zurück zum Tor, als sie zwei Schüsse abgab. Die Waffe gab ein leises metallisches Klirren von sich, das sich eher nach klapperndem Schlüsselbund als nach Schuss anhörte. Gelbe Steinbröckchen splitterten aus dem Torbogen, und Lex spürte, wie etwas Heißes unmittelbar an seiner Wange vorbeizischte.
Er jagte den Weg zurück, den er gekommen war, bog jedoch bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ab, bohrte sich tiefer in die Stadt, um aus dem Blickfeld der Frau zu gelangen. Noch während er um die Kurve schlitterte, schlug eine dritte Kugel krachend in die Gehwegplatten vor seinen Füßen ein. Die Erbauer der schmalen Straßen von Mdina hatten die Gässchen ganz bewusst nicht länger gehalten, als ein Pfeil an Reichweite besaß – dadurch hatten eventuelle Eindringlinge keine Möglichkeit gehabt, sich zu formieren und weiter vorzustoßen –; doch im Zeitalter moderner Schusswaffen hatten solche Überlegungen keine Bedeutung mehr. Lex hastete einen sanften Hügel hinauf, unter farbigen Glaslaternen hindurch, die in Reihen quer über die Straße gespannt waren, an vergitterten Fenstern und verriegelten Türen vorbei. Er entdeckte den roten Punkt des Lasers vor sich auf einer Mauer und warf sich erneut zur Seite, bevor er noch in das Schussfeld der Attentäterin geriet.
Schließlich landete er auf einer weitläufigen Piazza. Auf der gegenüberliegenden Seite ragten die helle Fassade und die Glockentürme der Kathedrale St. Paul in die Höhe. Davor drängten sich jede Menge Touristen, ältere Leute von den Kreuzfahrtschiffen, die unten in Valetta angelegt hatten, oder Familien mit aufgeregten Kindern. Sie waren damit beschäftigt, zu fotografieren oder den jeweiligen Fremdenführern zuzuhören. Lex sah sich um, er musste einen anderen Ausweg finden.
Die wenigen Autos, die im Inneren der Altstadt erlaubt waren, parkten hier auf diesem Platz, und er musterte sie voller Verzweiflung. Vielleicht konnte er ja ein Fahrzeug stehlen.
Da fiel sein Blick auf den zweiten Attentäter. Der Mann war auf der anderen Seite des Platzes stehen geblieben und tat so, als interessierte er sich brennend für die komplizierten Schnörkel des gusseisernen Geländers eines Balkons im ersten Stock. Eine Hand hatte er vor dem Bauch unter seine Jacke geschoben. Jetzt drehte sich der Mann in Lex’ Richtung, mit einer Bewegung, die bewusst beiläufig und unauffällig wirken sollte.
Erneut wurde Lex von Panik erfasst. Er blickte in die Gesichter der ahnungslosen Urlauber. Am liebsten hätte er laut um Hilfe gebrüllt. Aber was hätte er damit erreicht? Vor seinem geistigen Auge sah er, wie die beiden Killer wild drauflos in die Menge feuerten und bei dem Versuch, ihn zu ermorden, zahlreiche andere Menschen töteten.
Lex ging los, schnell und zielstrebig. Er zog seine Jacke fester. Einen letzten Trumpf hatte er noch im Ärmel, ein letztes riskantes Manöver, mit dem er womöglich entkommen konnte. Aber dafür musste er auf eine gewisse Höhe gelangen.
Er kam an einer Boutique mit teurer Glaskunst vorbei, die im Erdgeschoss einer ehemaligen mittelalterlichen Herberge untergebracht war. Er legte den Kopf in den Nacken und fragte sich für einen Moment, ob er von dem Verkaufsraum wohl bis aufs Dach des Gebäudes gelangen konnte. Vor der Boutique stand die lebensgroße Figur eines Malteserritters, der jetzt schlagartig zurückgerissen und gegen die Mauer geschleudert wurde. Die Bruchstücke landeten vor Lex’ Füßen. Er registrierte die hellen silbrigen Kanten an den Rändern des Einschusslochs in der Brustplatte des Ritters und stolperte rückwärts. Dabei fiel sein Blick auf die Frau, die in der Mündung einer kleinen Gasse stand. Sie hielt ihre Waffe genauso versteckt wie ihr Partner. Ihr Schuss war mitten durch die Menschenmenge gegangen und hätte sein Ziel um ein Haar getroffen. Sämtliche Touristen blickten jetzt in Lex’ Richtung. Das Durcheinander irritierte sie, aber immer noch ahnte keiner von ihnen, dass sich ganz in der Nähe zwei zu allem entschlossene Attentäter befanden.
Jetzt endlich warf Lex alle Zurückhaltung über Bord, versuchte nicht länger, sich irgendwie in die harmlose Touristenschar einzufügen. Er rannte los, schlängelte sich zwischen den Menschen hindurch, die die Hauptstraße entlangschlenderten, ohne auf die Schreie und Beschimpfungen zu achten, die ihm hinterhergebrüllt wurden. Er setzte darauf, dass seine Verfolger etwas vorsichtiger vorgehen würden als er, weil sie wussten, dass der von ihm eingeschlagene Weg an einem ganz bestimmten Punkt zu Ende war. Lex lief absichtlich in eine Sackgasse, schnitt sich sämtliche anderen Fluchtwege ab.
Die Gasse führte auf die Piazza Tas-Sur, besser bekannt als »Bastion Square«. Die restaurierten Palazzi mit ihren roten Türen, die den Platz umschlossen, dienten nun als Museen oder Terrassenrestaurants und boten einen herrlichen Blick über die nördlichen Schutzwälle der Altstadt. Auf den breiten Stufen, die zu den Zinnen der Festungsmauer führten, standen zahlreiche Besucher und genossen den Blick an der steilen Felswand hinab oder über das kleine Dorf Ta’Qali bis zu den dahinter liegenden Weinbergen. An einem klaren Tag, so wie heute, konnte man bis auf die St. Paul’s Bay oder die Feriensiedlung Buggiba an der Nordküste Maltas blicken.
Die Schmerzen in Lex’ verletztem Bein sammelten sich rund um das Kniegelenk, und er verzog das Gesicht, während er seine Schritte verlangsamte und wieder in ein zügiges Schritttempo wechselte. Dann kontrollierte er jeden Reißverschluss und jede Schnalle an seiner Kleidung. Unter anderen Umständen hätte das, was er jetzt vorhatte, ihm einen positiven Adrenalinschub versetzt. Er hätte sich eine GoPro auf den Helm geschnallt und alles mitgefilmt. Stattdessen empfand er mehr Angst als je zuvor in seinem ganzen Leben. Dieses Mal war seine Triebfeder nicht die Gier auf ein actiongeladenes Abenteuer, sondern nur seine erbärmliche Furcht.
Lex zog den Reißverschluss seines Kapuzenpullovers zu und holte einen Behälter aus einer Tasche seiner Cargohose. Er hatte ungefähr die Größe einer großen Bierdose und hing an einem Leinengeflecht, das er sich jetzt über die Schulter schlang und mit einem Karabiner sicherte. Er zog die Leinen fest, und der Behälter stabilisierte sich zwischen seinen Schulterblättern auf dem Rücken.
Lex holte tief Luft und stieg die Stufen bis zu den Zinnen hinauf, immer zwei auf einmal nehmend. Oben angekommen, spürte er angesichts der steil abfallenden Felsenkante ein leises Ziehen in der Magengrube.
Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann war’s das, sagte er sich. Aber wenn er nichts machte, dann würden die Attentäter ihn hier vor aller Augen erschießen. Er drehte sich um und machte die Augen zu, spürte den Wind auf seinen Wangen, fühlte die Richtung, aus der die Böen kamen.
Dann legte er eine Hand auf den Rücken und bekam den roten Plastikgriff an der Unterseite des Behälters zu fassen. Mit einem Schritt ließ er die Warnschilder hinter sich und kam auf der Kante der Festungsmauer zum Stehen.
Lex’ Verfolger hatten ihre Revolver eng an die Hüften gedrückt, versteckt in den Falten ihrer Jacken. Sie schossen, doch obwohl sie ausgezeichnete Schützen waren, verfehlten sie ihr Ziel. Ein Schuss traf eine verlassene Wasserflasche auf einer Treppenstufe, der zweite riss etliche Zentimeter vom Fuß der Zielperson entfernt eine Staubwolke aus dem Mauerwerk. Wieder drehten sich die Gesichter der Umstehenden in seine Richtung.
»Er bringt sich um«, sagte der männliche Attentäter über sein Kehlkopfmikro. Damit hatte er nicht gerechnet.
»Nein«, erwiderte die Frau, und ihre Antwort löste ein Kribbeln auf seiner Haut aus. »Das glaube ich nicht …«
Die Zielperson machte eine ruckartige Armbewegung, und der Behälter auf ihrem Rücken platzte auf. Leuchtend orangefarbener Stoff und weiße Leinen kamen zum Vorschein. Innerhalb von Sekundenbruchteilen hatte sich das hauchdünne Material in der Brise zu einem schmalen Rechteck entfaltet.
»Ein Fallschirm?« Der Mann vergaß jede Einsatzregel und sprang in der Hoffnung vorwärts, die Zielperson noch zu erwischen, bevor sie endgültig abspringen konnte.
Das kleine luftgefüllte Stoffviereck entlockte den umstehenden Touristen verblüffte Schreie, dann stieß die Zielperson sich ab und schwebte davon.
Die Frau packte ihren Partner an der Schulter und zog ihn zurück. »Warte.« Sie war bereits dabei, ihre Pistole einzustecken.
Er wehrte sich, wollte noch nicht aufgeben, war verärgert, weil sie ihren Auftrag nicht zu Ende gebracht hatten. Der Schirm war kaum mehr als ein Spielzeug und würde den Absturz der Zielperson nur unwesentlich bremsen. Wenn er sich über die Kante beugen, wenn die Frau ihm Deckung geben würde, dann konnte er vielleicht doch noch einen tödlichen Schuss abgeben. Die Vorstellung, dass dieser Zivilist ihnen entkommen würde, war mehr als ekelerregend.
»Ihr zieht euch zurück, und zwar alle beide«, meldete sich da eine dritte Stimme zu Wort. »Ich übernehme.«
Lex hatte klammheimlich befürchtet, dass der Mikroschirm sich nicht sauber öffnen, sondern nur als verheddertes Knäuel zum Vorschein kommen würde – das hätte für ihn das Ende bedeutet –, aber jetzt zeigte sich, dass er sich grundlos gesorgt hatte. Ein kräftiger Stoß jagte durch seine Schultern und seine Brust, als der Fallschirm sein Gewicht auffing. Das Gurtzeug schnitt sich in sein Fleisch, aber das war ein geringer Preis dafür, den lautlosen Schützen zu entkommen. Eine plötzliche Thermikblase, die sich vom Fuß des steilen Abhangs gelöst hatte, trug ihn von der Kante der Festungsstadt weg und auf die unten liegenden Bauernhäuser zu. Euphorie durchströmte seinen Körper.
Es würde eine harte Landung werden, das war klar. Die Sinkgeschwindigkeit war zu hoch, und der Schirm flatterte viel zu sehr, aber er würde es überleben und entkommen können – nichts anderes zählte. Lex überlegte sich bereits die nächsten Schritte – ein Fahrzeug auftreiben, irgendwie an die Küste kommen und dann nichts wie weg von diesem Felsen –, da hob der Wind ihn erneut ein kleines Stückchen höher, sodass er die Kirchtürme und die Ziegeldächer von Mdina und Rabat sehen konnte.
Im höchsten Turm wurde das Sonnenlicht vom kleinen gläsernen Auge eines Zielfernrohrs reflektiert.
Einen Augenblick später schlug ein einzelnes stahlummanteltes 7,62-Millimeter-Projektil nur wenige Zentimeter von Lex’ Brustbein entfernt in seinen Körper ein. Es drehte sich mehrfach mit roher Gewalt um die eigene Achse, während es sich durch seinen Brustkorb bohrte. Im Lauf der wenigen Sekundenbruchteile, die das Geschoss brauchte, um vorne in Lex’ Brust einzudringen und auf seinem Rücken wieder ins Freie zu schießen, zerfetzte es Teile des Lungengewebes und rupturierte den Herzmuskel. Blut floss in die zerklüftete Leere, die die Kugel hinterlassen hatte, und Lex zuckte und verkrampfte sich, während sein Körper von einem Moment auf den anderen den Dienst versagte.
Lex starb, noch während er dem Erdboden entgegenschwebte. Als sein Leichnam schließlich zwischen ein paar Weinstöcken unten im Tal aufschlug, waren seine Kleider und der orangefarbene Fallschirm über und über mit dunkelrotem Blut verschmiert.
Ein Tourist deutete über die Zinnen und schrie laut auf. Andere reckten ihre Handys in die Höhe, um das Ereignis zu filmen, sodass Cat und Dog schnellstmöglich das Weite suchten, aus Angst, womöglich auf das Video irgendeines Vollidioten zu geraten.
»Zurück zum Treffpunkt!«, wies Dog an und trat von der Festungsmauer zurück. Er ging los und streifte Cat mit einem kaum wahrnehmbaren Seitenblick, als hätten sie nicht das Geringste miteinander zu tun. »Du nimmst den Hauptausgang. Ich das Westtor.«
»Verstanden«, erwiderte Cat, ohne die Lippen zu bewegen. Das Kehlkopfmikrofon spürte die halb geformten Wörter in ihrer Kehle und wandelte sie in ein akustisches Signal um. Das Vibrieren hinterließ ein leichtes Hautjucken, und sie unterdrückte den Drang, sich im Gesicht zu kratzen, sondern rückte stattdessen die Sonnenbrille auf ihrem schmalen Nasenrücken zurecht.
»Ich gehe jetzt zum Wagen«, erklärte Fox. Cat wandte den Blick unwillkürlich nach oben, auch wenn sie den hochgelegenen Standort des Scharfschützen von hier aus nicht sehen konnte. »Die Polizei ist schon am Ort des ersten Versuchs. Ich schlage vor, wir entscheiden uns für die zweite Rückzugsoption.«
Dog war der Kommandeur der Einheit, darum war es seine Entscheidung, aber sowohl er als auch Cat respektierten die Erfahrung des älteren Fox, darum fiel die Antwort genau so aus, wie sie es erwartet hatte. »Einverstanden.«
Sie kam an der Kathedrale vorbei und beschleunigte ihre Schritte. Ihr Kollege war bereits in einer Seitenstraße verschwunden. »Was ist mit der Zielperson?«
»Ich habe gesehen, wo er gelandet ist«, gab Dog zurück. »Wir müssen schnell sein, wenn wir als Erste dort sein wollen.«
»Ich musste das Gewehr zurücklassen«, gestand Fox.
»Hast du es gründlich abgewischt?«, wollte Dog wissen.
»Selbstverständlich.«
»Dann ist das kein Problem«, meinte Dog. »Rückzug fortsetzen.«
Als Cat das Mdina-Tor durchquerte, verlangsamte sie ihre Schritte und kaufte sich an einem Verkaufsstand eine Flasche Wasser, so wie viele der Touristen auch. Sie bezahlte, und dann kam der grüne Fiat, der ihnen zur Verfügung gestellt worden war, um die Ecke gebogen und hielt an. Cat ging auf den Wagen zu und setzte sich auf die Rückbank.
Fox nickte knapp und fuhr weiter. An der nächsten Kreuzung hielt er erneut an und ließ Dog einsteigen. Kaum hatten sie sich wieder in Bewegung gesetzt, kam ihnen ein silberner Streifenwagen mit blau-karierter Beschriftung entgegen und raste an ihnen vorbei. Sobald er hinter der nächsten Hügelspitze verschwunden war, gab Fox Gas und lenkte den Fiat Richtung Ta’Qali.
»Warum ist er nicht schon mit dem ersten Schuss ausgeschaltet worden?« Fox Stimme klang mürrisch. Weder Dog noch Cat machte er direkt einen Vorwurf, aber trotzdem starrte Dog zunächst aus dem Fenster und ließ sich durch nichts anmerken, dass er überhaupt zugehört hatte.
»Der Grieche und der Leibwächter waren die größere Gefahr«, sagte Cat nach kurzem Schweigen, während sie das Pflaster mit dem Kehlkopfmikro von ihrem Hals zupfte. »Sie waren bewaffnet. Wir mussten zuerst sie neutralisieren.« Es war immer ein merkwürdiges Gefühl, wieder normal zu sprechen, ohne das Kehlkopfmikro. Sie musste sich jedes Mal wieder bewusst machen, dass sie nicht mehr zu flüstern brauchte.
Fox wollte gerade etwas hinzufügen, da wandte Dog sich an ihn. »Fahr einfach«, sagte er. »Wenn wir das Objekt nicht in die Finger bekommen, dann müssen wir uns etwas anderes überlegen. Und das würde eine Verlängerung unserer Mission bedeuten.« Er warf Cat einen Blick zu. »Niemand von uns will schließlich länger hierbleiben als unbedingt nötig, oder?«
Cat schüttelte den Kopf und fing an, ihren Revolver nachzuladen. Sie klappte die Trommel auf, nahm die verbrauchten Hülsen heraus und schob neue Patronen in die Öffnungen. Womöglich gab es Zeugen am Ort des Aufschlags, und falls das der Fall war, dann mussten sie ebenfalls zum Schweigen gebracht werden.
Kapitel 2
Es hatte über Nacht kräftig geschneit, sodass die ersten, die zum Pont de la Flégère kamen, es kaum erwarten konnten, sich die Pisten hinunterzustürzen und den frischen Pulverschnee so lange wie möglich zu genießen. Auf der anderen Talseite erhob sich der mächtige Mont Blanc, während hier die Skifahrer und Snowboarder hinabjagten, bevor die Sonne hoch am strahlend blauen, wolkenlosen Himmel stand. Die dünne Luft war frisch und trocken. Es versprach, wieder einmal ein perfekter Tag in Chamonix zu werden.
Zu den Frühaufstehern gehörten auch ein Mann und eine Frau, die sich ein wenig abseits hielten und mit ihren schnellen CAPiTA-Snowboards am Rand der blauen Pisten nach steilen Abhängen und Rampen für ihre Sprünge und ihre Freestyle-Moves suchten. Der Mann war weiß, Ende dreißig, groß und hager. Er hatte wuscheliges, schmutzigblondes Haar und einen ziemlich zauseligen Bart, der ihn älter machte, als er glauben wollte. Gelegentlich, wenn er ein bisschen Luft unter das Brett bekam, stieß er einen lauten Juchzer aus, während unter seiner verspiegelten Skibrille fast ununterbrochen ein breites Grinsen zu sehen war. In regelmäßigen Abständen überschätzte er sich und landete kopfüber im Schnee, weil er verloren geglaubte Fähigkeiten entdeckt und ausprobiert hatte, weil er seine Grenzen austesten wollte. Seine Begleiterin war etwas vorsichtiger. Sie stammte aus Ostasien, war vielleicht zehn Jahre jünger als er und sehr zierlich. Ihr Körperbau, die blauen Strähnchen in den schwarzen Haaren, die unter ihrem kirschroten Helm hervorlugten, sowie ihr rundes Gesicht ließen sie fast wie einen Teenager wirken. Dazu trug auch der eine Nummer zu große dunkelrote Skianorak bei. Sie zog lässige, harmonisch verlaufende Linien in den Schnee und stürzte so gut wie nie.
Die Piste führte jetzt zu einer Seilbahnstation mit angeschlossener Bar und einer großen Terrasse, von der man einen herrlichen Blick ins Tal genoss.
»Wer zuerst da ist«, sagte sie mit einem herausfordernden Kopfnicken.
»Du glaubst, dass du mit mir …?« Er brachte die Frage nicht zu Ende. Seine Partnerin stieß sich unvermittelt ab und sauste an ihm vorbei, nicht ohne ihn mit einem kurzen Kick in ein kleines Schneegestöber zu hüllen. »Sehr witzig. Haha!«, rief er ihr nach und nahm die Verfolgung auf.
»Verlierer zahlt!«, flötete sie ihm über die Schulter hinweg zu, während sie seinen Fahrstil nachäffte und mit engen Bögen abwärtsschwang.
Er duckte sich in den Wind, der aus dem Tal heraufwehte, und verringerte den Abstand. Vor der Fassade der Bar flatterte eine Reihe Wimpel in der Brise, die die imaginäre Ziellinie bildete.
Am Eingang war gerade eine Gruppe dabei, die Skier abzulegen – ein elegantes Paar in teuren, pelzbesetzten Skianzügen, dazu eine Assistentin und drei bedrohlich wirkende, breitschultrige Männer in grauen Jacken. Einer der Breitschultrigen setzte sich von der Gruppe ab und stellte sich den beiden Snowboardern in den Weg.
Sie schienen ihn nicht zu bemerken, waren viel zu beschäftigt damit, auf den letzten hundert Metern ihres spontanen Wettrennens noch einen Vorsprung zu ergattern.
Der Mann nutzte seinen Gewichtsvorteil und zog an der Frau vorbei, nicht ohne ihr dabei spöttisch zuzuwinken.
»Du Schwein!«, sagte sie ohne jede Entrüstung.
Der Hang wurde etwas flacher, und der Mann drehte sich zu ihr um. »Und du bist …« Er wollte eigentlich eine schlechte Verliererin sagen, doch dann traf er unversehens auf einen Buckel, den er übersehen hatte, und noch bevor er reagieren konnte, hatte er das Gleichgewicht verloren und landete mit dem Gesicht voraus im Schnee. Er drehte sich ein paar Mal um die eigene Achse und richtete sich lachend auf. »Idiot!«
Da fiel der Schatten des Breitschultrigen auf ihn. Für einen Moment dachte er, dass der Kerl die Hand ausstrecken und ihm aufhelfen wollte, doch der Muskelprotz stand nur da und wartete ab, bis er sich von selbst aufgerappelt hatte.
»Vielen Dank, ich komm schon klar«, sagte der Snowboarder trocken.
Der Mann mit der grauen Jacke baute sich vor dem Eingang zur Gaststube auf. »Bar ist geschlossen«, sagte er mit einem deutlich hörbaren osteuropäischen Akzent.
»Echt?« Der Snowboarder blickte demonstrativ über die Schulter des anderen und sah, wie das elegante Paar sich an den besten Tisch auf der Terrasse setzte. Das Personal war bereits dabei, die wenigen anderen Gäste zu verscheuchen. »Sieht aber gar nicht so aus.« Er hörte, wie seine Begleiterin dicht hinter ihm zum Stehen kam.
»Bar«, wiederholte der Mann mit der grauen Jacke, »ist geschlossen.« Das letzte Wort sprach er betont langsam und deutlich aus, als wäre sein Gegenüber schwerhörig. Anschließend zog er, um seine Worte zu unterstreichen, mit dem Daumen den Reißverschluss seiner Jacke auf. Darunter war der geriffelte Griff einer Handfeuerwaffe zu erkennen, die in einem Gürtelhalfter steckte.
»Ja, ja, ist ja schon gut, Mann.« Der Snowboarder hob beide Hände. »Ganz ruhig.«
»Verschwinde«, sagte der Breitschultrige ohne erkennbare Regung. »Jetzt.«
Der Angesprochene schnappte sich sein Board und verzichtete auf weitere Worte. Die Frau tat es ihm gleich, und dann marschierten sie los.
»Das ist sie.« Marc Dane bemühte sich nicht länger, wie ein Kanadier zu klingen, sondern sprach wieder mit seinem normalen Londoner Akzent, während er sein Snowboard auf die Schulter hievte.
»Eindeutig.« Kara Wei, US-Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, nickte und rückte ihre Skibrille zurecht. »Ich habe ein paar schöne Schnappschüsse gemacht.« Im Rahmen der Brille steckte ein digitaler Bildprozessor. Jetzt tippte sie auf die Steuertaste am oberen Brillenrand. »Sieht ganz so aus, als hätte sie ihre neueste Eroberung mit hier hoch in die klare Bergluft gebracht.«
Marc drehte sich um und warf einen Blick auf die Bar. Der Breitschultrige sah ihnen hinterher. Inzwischen befand sich bis auf die Zielperson und ihr Gefolge niemand mehr in dem Lokal. »Was meinst du, was kostet es, so einen Laden um die Mittagszeit ganz für sich alleine zu haben?«
»Für die Reichen und Selbstsüchtigen ist das doch nichts weiter als Kleingeld«, erwiderte Kara nüchtern. »Aber wir, wir müssen arbeiten, um leben zu können.«
»Ja, stimmt«, seufzte Marc. »Vorhin gab es einen kurzen Moment, wo mir wieder eingefallen ist, wie sich Urlaub anfühlt.«
Kara zog eine Grimasse. »Oooch, du Armer. Na, komm, wir haben eine Straftat zu begehen.« Sie ließ ihr Snowboard auf den Schnee fallen und stieg in die Bindungen, ging in die Hocke und zog sie fest.
Marc glaubte, so etwas wie freudige Erwartung hinter ihren Brillengläsern zu erkennen. Er warf einen Blick auf die zerschrammte Cabot-Taucheruhr an seinem Handgelenk und konzentrierte sich auf die bevorstehende Mission. »Wenn alles so läuft wie immer, dann haben wir ungefähr drei Stunden, bevor die Limo sie an der Talstation in Empfang nimmt …« Er stellte sich auf sein Board und betrachtete die Seilstrecke, die durch den schneebedeckten Wald bis hinunter zur Talstation führte. »Wie wär’s mit einer schwarzen Piste?«
»Wer zuerst da ist«, entgegnete Kara und stieß sich tief geduckt ab.
Marc musste unwillkürlich grinsen, nahm die Verfolgung auf und lenkte sein Board in ihren Windschatten.
Die Abfahrt war ein kurzes Vergnügen, umgeben von verschwommenem Weiß und strahlendem Sonnenschein, dann spuckte der Berg sie in Les Praz de Chamonix am nördlichen Ende des Tals aus. Für Marc bildete die Schussfahrt durch die Evettes Flégère den Abschluss einer rasanten Hetzjagd über Schnee, Felsen und durch Wälder, die nur wenige Augenblicke zu dauern schien. Auf der Piste wurde die Zeit elastisch, ballte sich zu einem einzigen, lang anhaltenden Moment der Konzentration, während er dem Talgrund entgegenraste und dabei Dutzende Serpentinen und Pfade kreuzte. Dann war es vorbei, und nur sein Herz hämmerte immer noch heftig in seiner Brust. Die dichtere Luft fühlte sich seltsam schwer in seiner Lunge an, und er keuchte laut, während sein Körper sich allmählich auf die neuen Bedingungen einstellte.
Kara ließ ihn aus ihrer Wasserflasche trinken, während sie sich mit schnellen Schritten durch Seitenstraßen dem Zentrum von Chamonix näherten. Sie mieden die Hauptstraße, die um diese Tageszeit voller Touristen und verspäteter Ski- und Snowboardfahrer war. Auf der Rückseite eines gesichtslosen, zweigeschossigen Bürogebäudes, das sich hinter einem Hotelkomplex befand, warf Marc einen Blick auf seine Armbanduhr.
Das Bürogebäude war über eine Makleragentur schon vor Wochen angemietet, jedoch mit Absicht nicht bezogen worden. Marc und Kara waren vor ein paar Tagen mitten in der Nacht hier eingetroffen und hatten seither sehr darauf geachtet, dass das Gebäude auch weiterhin unbenutzt wirkte.
»Ich leg mal los«, sagte Kara und ging nach oben.
Marc streifte seine Snowboard-Kleidung ab und machte sich frisch, zog sich ein anderes T-Shirt über und schlüpfte in einen dunkelblauen Arbeitsoverall. Die Mechaniker in der Autowerkstatt ein kleines Stückchen weiter die Straße entlang trugen genau dasselbe Modell, und Marc hatte seinen Overall ausgiebig über den Asphalt hinter dem Bürogebäude geschleift. Jetzt wurde er von zahlreichen Kratzern geschmückt und besaß zudem ausreichend Ölflecken, sodass er glaubhaft gebraucht und zerschlissen wirkte.
Marc stellte sich ans Fenster und klappte vorsichtig das verblasste Zeitungspapier zurück, das auf der Fensterscheibe klebte. In hundert Metern Entfernung konnte er die Werkstatt sehen. Sie bestand aus mehreren niedrigen Hallen, die nicht direkt an der Straße standen, sondern ein kleines Stückchen nach hinten versetzt waren. Wie die meisten Häuser der Stadt besaßen auch die Werkstatthallen Giebeldächer, doch während die Chalets, Hotels und Geschäfte mit Holzschindeln gedeckt sowie mit Balkonen und Blumenkästen geschmückt waren, begnügte sich die Autowerkstatt mit Wellblech und nackten grauen Mauern. Am östlichen Ende des Grundstücks befanden sich einige Zapfsäulen und ein Ersatzteillager, aber das übrige Gelände war ölverschmierten Werkstätten und Montagegruben vorbehalten. Die sauberen Straßen, teuren Geschäfte und exklusiven Restaurants waren, auch wenn sie nur wenige Häuserblocks weiter südlich lagen, ganz weit entfernt.
Er musterte die offenen Werkstatthallen und entdeckte einen grünen Land Rover und eine schwarze Mercedes-C-Klasse, aber nirgendwo das eine Fahrzeug, das ihn hier interessierte. Seine Beine waren immer noch ein wenig steif nach der Schussfahrt ins Tal, und er ging im Kreis, um die Muskeln zu lockern und den Schmerz zu verscheuchen. Am liebsten hätte er noch einmal auf seine Uhr geschaut, aber Marc wusste, dass die Zeit auch nicht schneller verging, wenn er jede Sekunde zählte.
Er nahm die Treppe hinauf in das nackte, unmöblierte Zimmer im ersten Stock, wo Kara an einem Campingtisch saß und wie hypnotisiert auf den Bildschirm eines ursprünglich für militärische Zwecke konzipierten Laptops starrte. Schwarze Kabel schlängelten sich von dem Gerät zu einer transportablen Ladestation und zu einer Satellitenantenne, die wie ein aufgeklappter Regenschirm auf dem Fußboden stand. Wie im Erdgeschoss waren auch hier die Fenster mit vergilbten Seiten aus der Le Monde verhüllt.
Kara sah aus, als wäre sie in Gedanken weit weg. In ihrem Blick lag die fast roboterhafte Intensität, die sich bei Hackern oft beobachten lässt und die Marc aus eigener Erfahrung nur allzu gut kannte. Wenn man zu lange an einen Bildschirm gefesselt war, dann entwickelte man eine eigentümlich distanzierte Haltung gegenüber allem, was um einen herum vor sich ging. Die Welt verengte sich immer mehr, bis sich schließlich selbst Hände und Cursor ganz von selbst zu bewegen schienen.
Bis in die letzten Tiefen des Codes vorzudringen, sich im Gewirr der Befehle zu verlieren … es hatte Zeiten gegeben, da hatte Marc genau diese Beschäftigung als erholsam empfunden. Und ein Teil von ihm beneidete Kara darum, dass sie bei diesem Auftrag die Rolle der Unterstützerin innehatte. Früher wäre das sein Part gewesen.
Doch seither hatte sich vieles geändert. Einst war er als technischer Aufklärer für eine operative Einheit – ein OpTeam – des britischen Geheimdienstes tätig gewesen. Dieses Leben hatte er allerdings endgültig hinter sich gelassen, als das Schicksal ihn zunächst zum Fahnenflüchtigen gemacht und ihn schließlich komplett von dem Land und dem Nachrichtendienst, bei dem er ausgebildet worden war, abgeschnitten hatte. Dass er im Anschluss daran nicht vollkommen orientierungslos und sinnentleert durchs Leben getaumelt war, hatte er dem Eingreifen eines Dritten zu verdanken.
Ein Mann namens Ekko Solomon hatte ihm die Chance geboten, etwas von dem, was er verloren hatte, zurückzugewinnen, in die Welt zurückzukehren und sie ein kleines bisschen besser zu machen. Der geheimnisumwitterte afrikanische Milliardär war Besitzer eines großen, international tätigen Konzerns, der Rubicon-Gruppe. Innerhalb dieses Konzerns existierte eine kleine Abteilung, die sich auf private militärische und geheimdienstliche Dienstleistungen spezialisiert hatte. Marcs offizielle Berufsbezeichnung in den Büchern der Gesellschaft lautete »Sicherheitsberater«, aber dieser Begriff ließ natürlich einen gewaltigen Interpretationsspielraum zu.
Zu den Spezialaufgaben dieses privaten, geradezu militärischen Dienstleistungszweigs innerhalb des Rubicon-Konzerns gehörten Personenschutz, Geiselbefreiung und Informationssicherheit – zumindest nach außen. In Wirklichkeit gingen die Aufgaben der so genannten »Abteilung für Sonderaufgaben« weit über den Schutz und die Bewachung einiger weniger, wohlhabender Kunden hinaus.
Solomon hatte Rubicon strikt nach moralischen Grundsätzen ausgerichtet. Er hatte eine Mission, wollte mit seinem Reichtum Gutes bewirken, und zwar weltweit. Er war bereit, es auch mit Bedrohungen aufzunehmen, denen einzelne Staaten nichts entgegensetzen konnten oder wollten.
Kleine Taten mit großer Wirkung. Mit diesen Worten umschrieb der Gründer von Rubicon die Arbeit der »Abteilung für Sonderaufgaben«.
Es war der Kampf für eine gute Sache, und darum hatte Marc sich gerne angeschlossen. Er hatte sich geschworen, so lange dabeizubleiben, solange sich kein Grund fand, an Solomons Aufrichtigkeit zu zweifeln. In der Schattenwelt der Geheimdienste, Terrorzellen und nichtstaatlichen Akteure, wo die Grenze zwischen Loyalität und Wahrheit oftmals nur undeutlich zu erkennen war, kam ihm die Vorstellung, etwas zu tun, weil es ethisch und moralisch das Richtige war, altmodisch, fast schon naiv vor. Aber gleichzeitig transportierte sie auch eine Art von Anstand, eine Wahrheit, die Marc Dane nicht einfach ignorieren konnte.
»Noch fünf Minuten«, sagte Kara und riss ihn aus seinen Träumereien. Sie sah sich gerade die Aufnahmen aus diversen Verkehrsüberwachungskameras an. »Bist du bereit?«
»Ja.« Er richtete sich auf und ging zu einem anderen Tisch, auf dem seine Ausrüstung wartete.
»So eine lange Vorbereitungsphase, und dann zack, ist es mit einem Mal vorbei …«, sagte Kara unbestimmt. »Irgendwie ist das auch enttäuschend.«
»Sei froh, dass wir eine relativ ungefährliche Mission haben«, erwiderte Marc. »Das vereinfacht die Sache erheblich.«
»Hoffentlich. Aber andererseits … vielleicht traut Solomon uns die wirklich schwierigen Aufgaben nicht zu.«
Er sah sie an und wusste nicht genau, ob sie das ernst gemeint hatte oder nicht. Karas Stimmung konnte von einem Moment auf den anderen von freundlichem Grinsen in bitteren Sarkasmus umschlagen, darum war es oft nicht leicht, sie richtig zu verstehen. »Es ist bestimmt besser, wenn dir jede Schießerei erspart bleibt«, erwiderte Marc.
»Das würdest du zu Lucy nie sagen.« Sie hob kurz den Blick, bevor sie sich wieder dem Bildschirm zuwandte.
»Sie war bei den Special Forces, bevor sie zu Rubicon gekommen ist«, konterte Marc. Lucy Keyes, Scharfschützin und ehemalige Angehörige der Delta Force, war ebenfalls ein unersetzlicher Bestandteil von Solomons verdeckter Eingreiftruppe. Normalerweise arbeiteten sie und Marc eng zusammen, aber jetzt war die US-Amerikanerin gerade am anderen Ende des Erdballs mit einer eigenen Mission betraut. »Sie würde in einem Feuergefecht jedenfalls deutlich besser klarkommen als du oder ich, hab ich recht?«
»Stimmt natürlich«, erwiderte Kara. »So was wie das hier, das wär für deine Freundin bestimmt viel zu langweilig.«
Marc hielt inne und starrte sie wütend an, während ihm das Blut in die Wangen schoss. »Da ist absolut nichts dran.« Er betonte die einzelnen Wörter, um jedes Missverständnis auszuschließen. Marc empfand großen Respekt für Lucy und vertraute ihr blind, aber dass Kara mit ihrer Bemerkung noch etwas anderes angedeutet hatte, ging ihm eindeutig gegen den Strich. »Unsere Beziehung ist ausschließlich auf die professionelle Ebene beschränkt«, fügte er hinzu und hielt sich nicht länger mit der Frage auf, wieso er sich über Karas Bemerkung derart ärgerte.
»Ich werte ja gar nicht.« Sie beugte sich über die Tastatur und holte verschiedene Kamerabilder auf den Bildschirm. »Ich dachte bloß, dass … du und sie …« Sie ließ ein träges Achselzucken folgen, als würde sie das Interesse an dem Thema verlieren. »Ich meine, nachdem du praktisch aus dem MI6 geflohen bist …«
»Ich bin überhaupt nirgendwo geflohen.« Seine Stimme wurde jetzt schneidender. »Ich hatte schließlich keine große Wahl.«
Sie hörte seinen Tonfall, und sofort schlich sich ein Anflug von Bedauern auf ihre Miene. »Tut mir leid. Ich wollte damit überhaupt nichts andeuten.« Sie blickte ihn ausdruckslos an und wandte sich wieder ab. »Meine Schuld.«
»Falscher Zeitpunkt«, blaffte er zurück. Er unterdrückte seine aufkeimende Wut und konzentrierte sich wieder auf die vor ihm liegende Aufgabe. »Glaub ja nicht, das Ganze hier wäre bloß ein Spaziergang.«
Dann vervollständigte Marc seine Verkleidung mit einer abgegriffenen schwarzen Rollmütze und einem Namenschild aus Plastik, das aus dem kleinen 3-D-Drucker am hinteren Ende des Zimmers stammte. Ein aufklappbares Multifunktionswerkzeug wanderte in eine Ärmeltasche des Overalls und ein ausziehbarer ASP-Schlagstock in eine zweite. Marc warf noch einen Blick auf sein digitales Notizbuch – eine Rubicon-Spezialanfertigung – und steckte es in seine Oberschenkeltasche, zusammen mit einem Kabel. Jetzt brauchte er nur noch die schwarzen Handschuhe.
»Funk«, sagte Kara und warf ihm mit einer schnellen Bewegung ein winzig kleines Gerät zu. Er schnappte nach dem hautfarbenen, kugelförmigen Ding, das aussah wie ein unauffälliges Hörgerät, und steckte es sich in das linke Ohr.
»Okay.« Marc holte einmal tief Luft und versuchte, ein bisschen von dem aufsteigenden Adrenalin loszuwerden – vergeblich.
»Nervös?«, fragte sie ihn, ohne den Blick von ihrem Monitor zu nehmen.
»Nein.«
»Lügner.« Kara gab einen Befehl ein und starrte auf das Display. »Noch eine Minute. Er biegt jetzt in die Straße ein.«
Marc stellte sich noch einmal ans Fenster und spähte durch einen schmalen Riss im Papier nach draußen. Die mitternachtsblaue Limousine, die sich vom Ende der Straße her näherte, war unmöglich zu übersehen. Solche Fahrzeuge sah man normalerweise nur in den größten Städten Europas, weil die meisten Straßen auf dem alten Kontinent schlicht zu schmal waren. Einen solchen Wagen im Fuhrpark zu haben kam einer Botschaft gleich: Was kümmern mich die Missstände dieser Welt,solangeich mein Bedürfnis nach überbordendem Luxus stillen kann?
Jetzt, in diesem Augenblick, saßen in der Limousine keine Passagiere, was schon daran zu erkennen war, wie der Fahrer beim Abbiegen in den Werkstatthof über den Bordstein schrammte. Marc sah ein Rolltor nach oben fahren, damit der Wagen mit der Nase voran in die Halle rollen konnte. »Und das ist auch bestimmt das richtige Fahrzeug?«
Am Fenstersims war in einer nicht reflektierenden Hülle eine Kamera befestigt, und Marc hörte das Surren des kleinen Elektromotors, als das Objektiv ausfuhr. Kara verglich die hochauflösenden Bilder aus der Kamera mit den bereits gespeicherten Aufnahmen aus den Überwachungskameras.
»Dasselbe Kennzeichen. Achtundneunzig Prozent Übereinstimmung bei der Analyse der Fahrzeugmasse«, erwiderte sie in absolut sachlichem Tonfall. »Das ist Toussaints Wagen.«
»Okay.« Marc zog die Rollmütze tiefer in die Stirn und kratzte sich das bärtige Kinn. »Das bedeutet, grünes Licht. Vierzig Minuten insgesamt, das wäre optimal.«
»Viel Glück.« Kara starrte bereits wieder geistesabwesend auf ihren Monitor.
Marc verließ das Bürogebäude über die hintere Feuertreppe, klappte den Kragen seines Overalls nach oben und steuerte mit nach vorn gebeugtem Oberkörper die Autowerkstatt an.
»Funk-Check«, hörte er Karas Stimme in seinem linken Ohr und rückte den kleinen Empfänger ein wenig zurecht.
»Laut und deutlich«, erwiderte er.
»En francais!«, ermahnte sie ihn. »Du gibst dich schließlich als Einheimischer aus, schon vergessen?«
Marc reckte den Daumen in die Höhe, weil er wusste, dass die Kamera am Fenstersims die Geste erfassen würde. »D’accord.«
Der Zeitpunkt war gut gewählt. Die Hälfte der Angestellten war noch beim Mittagessen, und aus der Entfernung war Marc nicht von ihnen zu unterscheiden. Vielleicht hatte er ja viel zu tun und wollte einfach ein bisschen früher als seine Kollegen die Arbeit wieder aufnehmen. Alles in Ordnung, sagte er sich, und zwar weil er es inständig hoffte.
Ohne Aufmerksamkeit zu erregen, gelangte er über den Vorhof und huschte dann seitlich an den Werkstatthallen vorbei. Er wusste, dass es dort einen Notausgang gab. Vor zwei Nächten war er sehr vorsichtig über eine mit Glasscherben gespickte Mauer geklettert und hatte sich höchstpersönlich gründlich umgesehen. Das Ölfass stand immer noch dort, wo er es hingestellt hatte, nämlich so dicht an der Mauer, damit es ihm, falls etwas schiefgehen sollte, bei der Flucht behilflich sein konnte.
Aber sollte es dazu kommen, dann mussten sie natürlich die gesamte Operation abbrechen. Das Gelingen ihres Auftrags hing entscheidend davon ab, dass sie so wenig Spuren wie irgend möglich hinterließen. Für den Fall, dass sie von ihren Zielpersonen bemerkt wurden, hatten sie diverse Maßnahmen vorbereitet.
Marc hatte die Einzelheiten bereits vor ihrer Ankunft in Chamonix ausgearbeitet. Dann würden sie es aussehen lassen wie einen fehlgeschlagenen Diebstahlversuch, würden eine illegale Aktion mit einer anderen tarnen – aber er hoffte natürlich, dass es gar nicht so weit kam.
Er setzte seine Schritte sehr behutsam genau so, dass er von den Überwachungskameras auf dem Werkstattgelände nicht erfasst wurde. Marc hatte sich ihre jeweiligen Positionen genau eingeprägt, aber er durfte kein Risiko eingehen. Ein untersetzter Mann mit Vollbart stand drüben bei den Zapfsäulen und winkte Marc träge zu, ohne wirklich hinzusehen. Marc erwiderte die Geste und war, noch bevor sich daraus womöglich mehr entwickeln konnte, schon wieder aus dem Blickfeld des Mannes verschwunden. Die Notausgangstür ließ sich problemlos öffnen, und Marc schlüpfte ins Innere der Halle.
Hier sah alles genauso unspektakulär aus wie von außen. Der Besitzer hatte keine riesigen Leuchtreklamen, keine farbenprächtigen Plakate aufgehängt, um auf sein Geschäft hinzuweisen. Sein Ruf gründete in erster Linie auf Diskretion und Kompetenz, und genau deshalb waren seine Kunden bereit, ihn gut zu bezahlen.
Es war ziemlich dunkel in der Werkstatt, und es roch durchdringend nach Maschinenöl. Ein schwarzer Mercedes und ein Land Rover thronten auf Hebebühnen über den Montagegruben. Elektrische Leuchten erhellten die Unterböden, aber weit und breit war kein Mechaniker in Sicht.
Zwischen den Hebebühnen war die aufgeklappte Motorhaube des Zielfahrzeugs zu sehen, sodass Marc den Motor erkennen konnte. Selbst auf diese Entfernung waren die schützenden Stahlplatten rund um die Maschine nicht zu übersehen. Der Wagen war gepanzert und mit extrem belastbaren Stoßdämpfern, kugelsicheren Reifen und massivem Sicherheitsglas ausgestattet. So etwas bekam man normalerweise nur in Kriegsgebieten zu sehen, aber nicht in den französischen Alpen. Wer die Insassen dieses Wagens ernsthaft in Gefahr bringen wollte, der musste schon zur Panzerfaust greifen. Jetzt allerdings stand die hintere Tür auf der Fahrerseite offen, und im Innenraum bewegte sich etwas.
Marc ging in Deckung und wartete ab. Er tippte mit dem Finger zweimal auf seinen Ohrhörer, um Kara mitzuteilen, dass er den Wagen im Blickfeld hatte.
»Verstanden«, erwiderte sie. »Außerdem habe ich gerade gesehen, wie der Fahrer mit einem Angestellten ins Hauptgebäude gegangen ist.«
Nach einer Weile kam ein drahtiger Mann Mitte zwanzig, dessen Schädel kahl rasiert war, aus dem hinteren Wagenteil hervorgeklettert. Er hielt einen tragbaren Staubsauger und andere Putzutensilien in der Hand. Offensichtlich war er mit dem Innenraum fertig und wandte sich nun dem Motor zu. Eine zusätzliche Leuchte flammte auf und tauchte den Motorraum in gleißendes Licht. Der Mechaniker war für einen Moment geblendet, und das reichte Marc, um hinter dem Mercedes herum zu huschen und sich dann der Tür auf der Beifahrerseite der Limo zu nähern.
Er wartete den geeigneten Moment ab, und als der Mechaniker seine gesamte Aufmerksamkeit dem Motorraum widmete, öffnete er die Tür, stieg in den Fond und zog die Tür vorsichtig wieder zu.
»Ich bin drin«, flüsterte er. Geduckt und mit langsamen Bewegungen, um sein Körpergewicht möglichst gleichmäßig zu verteilen, rutschte Marc auf die Trennwand zwischen der Fahrerkabine und dem restlichen Innenraum zu. Die Blende war hochgefahren, und da der Wagen rundum getönte Scheiben besaß, konnte ihn von außen auch niemand sehen.
Neben einem Minikühlschrank mit einer gläsernen Tür, gefüllt mit teurem Veen-Mineralwasser und kleinen Dosen Beluga-Kaviar, entdeckte Marc eine Klappe, die sich durch einen leichten Druck öffnen ließ. Dahinter kam ein Elektronik-Port zum Vorschein, ein Hub, an dem die verschiedenen Schaltkreise für die Musikanlage, die Klimaanlage, die Beleuchtung und anderes zusammenliefen.
Marc ging es um dieses andere. Er steckte das mitgebrachte Datenkabel in den Mini-USB-Port, verband es mit seinem kompakten Tablet und fuhr ihn hoch.
Das Gerät analysierte selbständig den Systemaufbau der Limo und schickte dann ein Spionageprogramm auf die Reise. Innerhalb weniger Sekunden hatte es das eingebaute Satelliten-Navigationssystem ausfindig gemacht und begann, den nicht besonders großen Speicher zu durchforsten. Genau wie Marc erwartet hatte, war keine einzige Fahrtroute mehr darin zu finden. Der Fahrer nahm seine Aufgabe vermutlich ernst und löschte den Speicher nach jeder Fahrt. Doch ein Druck auf die LÖSCHEN-Taste allein war keineswegs ausreichend, um einen Computer dazu zu bewegen, sich seiner gespeicherten Daten zu entledigen. Der Großteil davon blieb auch weiterhin erhalten, und zwar so lange, bis sie tatsächlich von anderen Daten überschrieben wurden. Wenn man wusste, wo man suchen musste, dann ließen sich die »gelöschten« Daten problemlos wiederherstellen.
Auf dem Display des Tablets erschien ein Fortschrittsbalken, der sich langsam füllte, während das Spionageprogramm die Daten aus dem Navi kopierte. Zwei Minuten, schätzte Marc. Dann haben wir Toussaints komplette Reiseroute der letzten vier Wochen.
Madame Celeste Sophie Toussaint hatte sich für die Rubicon-Abteilung für Sonderaufgaben als äußerst schwieriges Zielobjekt erwiesen. Sie besaß ein ummauertes Anwesen vor den Toren von Annecy und ein zweites an der südfranzösischen Mittelmeerküste. Der Firmensitz des Medienkonzerns, der ihr als Alleinerbin in den Schoß gefallen war, befand sich in einem eleganten Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert, das mitten im historischen Zentrum von Lyon lag. Jedes dieser drei Gebäude wurde von hochmodernen Alarmanlagen und gut bezahlten, bewaffneten Wachen geschützt. Toussaint hatte dafür eine in Russland beheimatete Firma namens ALEPH engagiert, die paramilitärische Dienstleistungen anbot. Marc begegnete ihr nicht zum ersten Mal. Er hatte schon einmal mit einigen ALEPH-Söldnern die Klingen gekreuzt, an einem eiskalten Tag in einer menschenleeren Gegend in Polen, und er hatte nicht das Bedürfnis, noch einmal in deren Fadenkreuz zu geraten. Darum hatten sie nach etwas klandestineren Möglichkeiten gesucht, um sich die nötigen Informationen zu beschaffen.
Im Verlauf des vergangenen Jahres hatte Rubicon mithilfe verschiedener digitaler Quellen mehrere Zahlungseingänge von Briefkastenfirmen auf Toussaints Konten erfasst. Diese Briefkastenfirmen dienten mutmaßlich als Tarnung für unterschiedliche militante Gruppen in Mittel- und Westeuropa. Sie hatten noch keine Beweise, aber die Indizien legten zumindest nahe, dass Toussaint ihr weltumspannendes Netzwerk auch für einen schwunghaften Handel mit geheimen Informationen nutzte. Offen unterstützte sie zahlreiche nationalistische Gruppen, manipulierte Politiker und schürte Unruhe, wo immer es ging, auch mithilfe zweifelhafter Nachrichten und einseitiger Berichterstattung, aber noch nie war es gelungen, dieser Frau irgendetwas Illegales nachzuweisen. Toussaint stand im Verdacht, intensive Kontakte zu fanatischen Extremisten auf beiden Seiten des ideologischen Spektrums zu pflegen, aber bis heute war es Rubicon noch nicht gelungen, sie tatsächlich festzunageln. Ihre Fahrzeuge wurden, genau wie ihre Häuser, zweimal am Tag nach Abhörmikrofonen durchsucht. Sie mit einem Peilsender zu verfolgen war unmöglich, und die Firewalls, mit denen sie ihre Computer zu Hause und in ihren Büros vor ungebetenen Eindringlingen schützte, waren außerordentlich widerstandsfähig.
Letzten Endes hatte Rubicon sich eine alte, aber unwiderlegbare Weisheit zu eigen gemacht: Eine Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und das schwächste Glied in Celeste Sophie Toussaints Sicherheitskette, das war die Werkstatt, die während ihrer Aufenthalte in Chamonix mit der Wartung ihrer Fahrzeuge betraut war. Es war zwar unmöglich, die Elektronik von außen zu attackieren, aber mithilfe einer direkten Verbindung konnten sie sich alle Daten beschaffen, die sie brauchten. Und wenn sie einen Überblick über Toussaints Reiserouten bekommen konnten, dann würde sich, zusammen mit den Informationen über ihre Kunden, die Rubicon bereits in Händen hatte, ein klareres Bild ergeben. Toussaint stand in dem Ruf, Geschäfte am liebsten persönlich bei einer direkten Begegnung abzuschließen, und falls das bedeutete, dass sie sich in irgendwelchen entlegenen Gegenden Frankreichs mit Terroristen und Kriminellen getroffen hatte, dann würde das aus ihren Reisedaten hervorgehen. Und dann … würden entsprechende Schritte eingeleitet werden.
Über all das dachte Marc nach, während der Fortschrittsbalken sich weiter vorschob und der Mechaniker nur wenige Meter entfernt am Motor arbeitete.
Die französische Erbin eines Medienimperiums war mehr als eine skrupellose Opportunistin. Sie war Mitglied eines geheimen Zirkels, der sich das »Kombinat« nannte, einem Zusammenschluss aus einflussreichen Strippenziehern, Industriellen und Angehörigen des Geldadels, die alle ein gemeinsames Ziel vor Augen hatten: noch reicher und noch mächtiger zu werden. Das Kombinat war inmitten der Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs entstanden, wobei die Beteiligten mit Waffenverkäufen an beide Lager enorme Gewinne erwirtschaftet hatten. Zurzeit versuchten sie, den ewigen Krieg gegen den Terror zu manipulieren, indem sie die Brände, die in allen Teilen dieser verängstigten Welt loderten, zusätzlich anfachten, um anschließend die Früchte zu ernten.
Für einen kurzen Moment verlor Marc sich in seinen Erinnerungen. Die Taten des Kombinats waren der Grund dafür, dass er seinen jetzigen Weg eingeschlagen hatte. Diese Leute hatten den Tod seiner Kameraden aus dem OpTeam des MI6 angeordnet, weil Marcs Einheit kurz davor gewesen war, einen vom Kombinat unterstützten Terroranschlag zu verhindern. Nur deshalb waren eine Frau, die ihm sehr nahe gestanden hatte, seine Kollegen und seine Karriere beim britischen Geheimdienst in einem lodernden Feuerball aufgegangen.
Diese Leute mit ihrem Geld und ihrer Macht, die die Welt als ihr persönliches Spielfeld betrachteten, als Schachbrett, auf dem sie sich nach Lust und Laune austoben konnten, sie hatten die Lunte gezündet. Ein Jahr später war er sogar gezwungen gewesen, mit Operativkräften des Kombinats zusammenzuarbeiten, um eine verschwundene Massenvernichtungswaffe ausfindig zu machen. Dabei hatte er noch einmal aus nächster Nähe erfahren, wie skrupellos diese Leute vorgingen, was seiner Entschlossenheit, sie zu Fall zu bringen, einen neuerlichen Schub gegeben hatte.