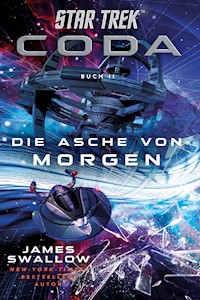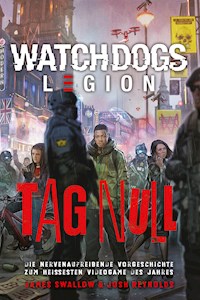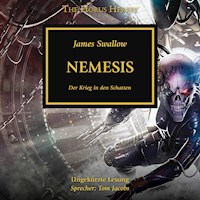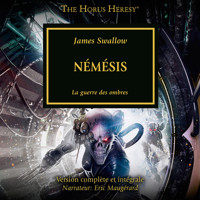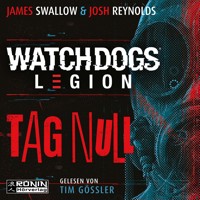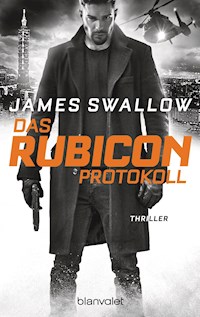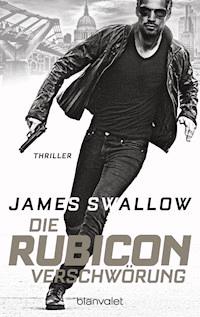9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marc Dane
- Sprache: Deutsch
»Die britische Antwort auf Jason Bourne.« Daily Mail
Eine skrupellose serbische Gang, die Geld mit gefälschten Atomwaffen macht. Ein in Ungnade gefallener russischer General, dem eine echte in die Hände fällt. Ein rachsüchtiger somalischer Warlord mit einer Mission, für die er die Welt in Schutt und Asche legen würde. Eine überforderte geheime Regierungsorganisation ohne die Mittel, ihn zu stoppen. Nur ein Mann sieht vorher, was auf die Welt zukommt: der britische Agent Marc Dane. Doch wird er in der Lage sein, die Katastrophe zu verhindern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Vor einem Jahr wurde auf das Team des britischen Agenten Marc Dane ein verheerender Anschlag verübt. Er, der einzige Überlebende, wurde zum Sündenbock gemacht und konnte erst nach einer Hetzjagd um die halbe Welt seine Unschuld beweisen und weitere terroristische Gräueltaten abwenden. Nun arbeitet Marc in Kroatien für die UN in der Abteilung für nukleare Sicherheit. Als er auf eine Spur der legendären Kurjak-Brüder stößt, die sich mit dem Verkauf gefälschter Atomwaffen in der Vergangenheit viele Feinde gemacht haben und vor Langem untergetaucht sind, weigert seine Chefin sich jedoch, ihm ein Team für einen Einsatz zur Verfügung zu stellen. Marc weiß, dass er nur diese eine Chance haben wird, die Brüder aufzuspüren, und macht sich im Alleingang auf zu einem Treffen der Kurjaks mit einem potenziellen Geschäftspartner. Er ahnt nicht, dass die Waffe, um die es diesmal geht, echt und hochgefährlich ist und dass das Treffen in einem Blutbad enden wird. Nun befindet sich eine legendäre russische »Geisterwaffe« – eine Atombombe – in den Händen eines skrupellosen Warlords, der für seine Mission die Welt in Schutt und Asche legen würde. Und Marc braucht erneut mächtige Verbündete, um die Katastrophe abzuwenden und sein eigenes Leben zu retten.
Autor
James Swallow wurde für seine Drehbücher unter anderem für einen BAFTA Award nominiert und hat zahlreiche erfolgreiche Video- und Hörspiele, Kurzgeschichten und Science-Fiction-Romane verfasst. Nach Die Rubicon-Verschwörung ist Die Rubicon-Mission sein zweiter Thriller um den britischen Agenten Marc Dane. James Swallow lebt und arbeitet in London.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
JAMES SWALLOW
DIE RUBICON-
MISSION
THRILLER
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Exile« bei Zaffre Publishing, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © James Swallow, 2017
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Bernd Stratthaus
Umschlaggestaltung © Johannes Frick unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock.com (© Netfalls Remy Musser)
AF · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-22604-6V002
www.blanvalet.de
Für meine Freunde,
ohne deren Unterstützung ich nie so weit gekommen wäre.
1
Eine eigentümliche Stille lag in der Luft, und es schien, als hätte die Nacht sich wie eine undurchdringliche Schicht über die flache, staubige Stadt gebreitet. Die Balkontüren waren nur halb geöffnet, sodass kaum etwas von der drückenden, blutwarmen Hitze des Tages aus der Villa gewichen war. Bei jeder Bewegung spürte Welldone Amadayo, wie das teure Hemd aus chinesischer Seide an seinem Rücken klebte. Die Temperatur war wie ein stetiger Trommelschlag der Angst und trieb ihm den Schweiß aus den Poren, während er mit seinen langen Fingern geistesabwesend über die tiefen Sorgenfalten in seinem Gesicht fuhr.
Auf dem Bildschirm an der Wand über seinem Schreibtisch war nur ein blaues Quadrat mit einem ununterbrochen um sich selbst kreisenden Pfeil zu sehen. Es zeigte an, dass seine Voice-over-IP-Software gerade eine Verbindung herstellte. Amadayo starrte in die kleine Digitalkamera, die am Bildschirm befestigt war, und beobachtete das träge Blinken der dunkelroten Leuchtdiode. Für einen kurzen Moment flackerte Panik in ihm auf, und er zupfte an seinem Hemd herum, versuchte, ein klein wenig lässiger zu wirken. Doch es dauerte nicht lange, bis er seine Bemühungen wieder einstellte und ein ungeduldiges Zischen ausstieß. Der Pfeil setzte unterdessen die endlose Jagd nach seinem eigenen Ende fort.
Amadayo überlegte, ob er sich setzen sollte, doch dann ließ er den Gedanken gleich wieder fallen. Er warf einen hastigen Blick auf die geschlossene Tür in seinem Rücken und wandte sich gleich wieder ab. Mit jeder Sekunde des Wartens wuchs seine Unruhe. Er spähte durch die Jalousien vor der Balkontür nach draußen, sah das gedämpfte Licht, das aus seinem Haus drang, ebenso wie das wässrige Glitzern des Swimmingpools, doch die Helligkeit verlor sich bei den hohen Mauern und den Akazien, die sein Anwesen umgaben.
Dahinter lag das Großstadtgewimmel von Mogadischu, wo die Lichter aus den Fenstern rot gedeckter Mietshäuser oder die Straßenlaternen mit ihren Natriumdampflampen einen Teppich aus orangefarbenen Lichtpunkten bildeten. Hätte er dort gestanden, hätte er vielleicht sogar den dunklen Streifen des Strands erkennen können, aber Amadayo zog sich in diesen Tagen immer öfter in seine eigenen vier Wände zurück. Und wenn jemand den Grund dafür wissen wollte, dann hatte er sich ein ganzes Arsenal an Lügen zurechtgelegt.
Schließlich beschloss er, das Hemd aufzuknöpfen, um durch und durch entspannt zu wirken. Er setzte sich auf seinen Stuhl und starrte in die Kamera, betrachtete sein Spiegelbild, das auf den dunklen Flächen des Bildschirms gut zu erkennen war, und probierte verschiedene Gesichtsausdrücke aus. Er hatte Erfahrung in solchen Dingen, sagte er sich. Es gab keinen Grund zur Sorge.
Der sich selbst jagende Pfeil verschwand, und die rot blinkende LED sprang auf Dauergrün. Dann tauchte ein weißer Mann auf dem Bildschirm auf. Er befand sich in einem großen Zimmer mit Wänden aus einem gelblichen, italienischen Stein. Die untergehende Sonne warf ihre Strahlen an die Mauern. »Mr. Amadayo«, sagte der Mann. »Ich grüße Sie.«
»Doktor Amadayo«, verbesserte Amadayo ihn automatisch. Die gerahmte Promotionsurkunde an seiner Wand hatte ihn ein stolzes Sümmchen gekostet, und er hatte sich angewöhnt, jeden Gesprächspartner darauf aufmerksam zu machen. »Mr. Brett. Es ist mir ein Vergnügen, wie immer.« Dazu setzte er ein routiniertes Lächeln auf.
Brett neigte den Kopf und blickte für einen kurzen Augenblick zur Seite, dann schaute er wieder in die Kamera. »Herr Dr. Amadayo, bitte verzeihen Sie, dass ich Sie um diese Uhrzeit noch stören muss, aber Sie werden sicherlich verstehen, dass meine Auftraggeber nicht länger warten können, um ihrer Besorgnis Ausdruck zu verleihen. Zumal Sie in den letzten Wochen sehr schwer erreichbar waren.« Brett sprach mit demselben Akzent wie die Radiosprecher des BBC World Service, den Amadayo in seiner Jugend immer gehört hatte – jedes Wort hatte genau die richtige Betonung, genau die richtige Länge und saß an genau der richtigen Stelle. Darüber hinaus wirkte sein Gesprächspartner seltsam seelenlos und maschinenhaft, was Amadayo als ausgesprochen beunruhigend empfand. Sein milchig-blasses Gesicht, die strohfarbenen Haare und die wässrig-blauen Augen ließen ihn irgendwie unwirklich erscheinen. Der Somalier fühlte sich an die Albinokinder erinnert, die er in Tansania einmal gesehen hatte. Ob man die Körperteile des Engländers nach dessen Tod wohl auch als Talismane verkaufen konnte?
Er nickte und blickte mit breitem Grinsen in die Kamera. »Ich bin derjenige, der um Verzeihung bitten muss!« Amadayo mischte eine Prise geheuchelter Zerknirschung in seine Stimme und schüttelte den Kopf. »Aber ich habe hier so unglaublich viel zu tun, verstehen Sie? Ich muss mich um die Belange so vieler Menschen kümmern, und alle wollen etwas von mir. Für alles andere fehlt mir dann die Zeit.«
»Genau deshalb haben wir Sie ja zu unserem Repräsentanten in Somalia gemacht. Aufgrund Ihrer Beziehungen«, erwiderte Brett. Amadayo sah sich zwar eher als gleichberechtigten Partner und nicht als Angestellten, aber er beschloss, vorerst nicht darauf einzugehen. »Allerdings sind wir etwas besorgt angesichts der Tatsache, dass es an konkreten Fortschritten mangelt.«
»Ach?« Amadayo zog eine Augenbraue in die Höhe. Er hielt zwar die Fassade der gelassenen Anteilnahme aufrecht, aber sein Herz raste. Sein Hemd klebte wie eine zweite Haut an seinem Rücken. »Ich habe alles getan, was das Kombinat von mir verlangt …«
»Bitte verwenden Sie diese Bezeichnung nie wieder«, herrschte Brett ihn an und verzog dabei das Gesicht.
Der Tonfall des Engländers machte Amadayo wütend, und er fuhr fort, während er seine Ängste mit zunehmendem Ärger übertünchte. »Wie lange schon können Sie sich hier, in meinem Land, auf meine Unterstützung verlassen? Ihre jüngsten Aktivitäten in Puntland und anderswo – wer hat dafür gesorgt, dass sie vollkommen reibungslos verlaufen sind?«
»Und für Ihre Vermittlungstätigkeit sind Sie auch großzügig entlohnt worden«, lautete die Erwiderung. »Das gut bewachte Anwesen, in dem Sie sich gerade aufhalten? Nur durch das Geld meiner Auftraggeber ist es Ihnen möglich, in solchem Luxus zu leben. Und in Sicherheit.«
In diesen Worten schwang eine unmissverständliche Drohung mit, aber Amadayo ging nicht darauf ein. Es wäre reine Zeitverschwendung gewesen. Dieser Mann saß auf der anderen Seite des Erdballs. Das, wovor Amadayo wirklich Angst hatte, befand sich in sehr viel unmittelbarerer Nähe.
Doch dann blickte Brett ihm direkt in die Augen, und es kam ihm so vor, als würde der bleiche Mann mitten in seine Gedanken greifen und diese Angst ans Tageslicht zerren. »Sie genießen ihr angenehmes Leben, Herr Doktor. Sie bezeichnen sich gerne als einen Mann, der jeden kennt, der in jeder Stadt und jedem Dorf Freunde hat. Aber stimmt das wirklich?« Er kam so nahe, dass sein Gesicht fast den gesamten Bildschirm ausfüllte. »Sie haben uns Stabilität versprochen. Das haben Sie meinen Auftraggebern ausdrücklich zugesagt, aber Sie haben Ihr Wort nicht gehalten.«
Amadayo blinzelte ein paarmal und suchte vergebens nach Worten.
Als Brett weitersprach, hatte sein kultivierter Akzent einen beißenden, anklagenden Unterton bekommen. »Sie wurden engagiert, weil Sie angeblich ein Mindestmaß an Stabilität in dieser Jauchegrube namens Somalia aufrechterhalten konnten. Aber trotz all Ihrer Versprechen, obwohl angeblich so viele Menschen tun, was Sie wollen, sind Terrorismus und Piraterie erneut auf dem Vormarsch. Wie ist das möglich, wo Sie doch so unermüdlich für uns arbeiten?«
»Ich …« Amadayo holte tief Luft und legte sich eine Schimpftirade zurecht, die es in sich hatte. Doch noch bevor er den bleichen Ausländer damit bombardieren konnte, hörte er ganz in der Nähe ein lautes Knattern. Schüsse.
Er sprang auf und war mit zwei schnellen Schritten bei der Balkontür, gerade noch rechtzeitig, um den lauten Knall zu hören, der vom Haupttor herüberdröhnte. Zögerlich lehnte Amadayo sich über die Brüstung und sah, dass sich am Ende der staubigen Einfahrt etwas bewegte. Eine Handvoll Wachleute waren bereits im Sprint dorthin unterwegs.
Unten sah er einen schlaksigen Wachmann mit einer Kalaschnikow misstrauisch um den zwei Stockwerke tiefer liegenden Swimmingpool streichen. Amadayo rief ihm im Benadir-Dialekt der Einheimischen zu: »He! Du da! Was ist denn da los?«
Der Wachmann blieb stehen und zuckte mit den Schultern. »Ich weiß auch nicht, Herr Doktor. Da ist jemand am Tor, aber ich weiß nicht …« Ein leises Knacken unterbrach ihn mitten im Satz, dann hüllte dunkelroter Sprühnebel seinen Kopf ein, während die eine Hälfte seines Gesichts einfach abgerissen wurde. Der Wachmann taumelte und stürzte in den Pool. Blut lief über die schmuddeligen Fliesen und färbte das Wasser rot.
Noch mehr Schüsse ertönten. Als Amadayo sich vom Anblick des Toten losreißen konnte, sah er, wie ein Viehtransporter das Haupttor rammte und zertrümmerte. Gelbes Mündungsfeuer flackerte entlang der Akazienallee auf. Amadayo zuckte zusammen, duckte sich und flüchtete in sein Zimmer.
»Was war denn das für ein Lärm?«, erkundigte sich Brett gelangweilt.
Amadayo trat an eine Kommode, riss eine Schublade auf und zog unter den Papieren eine alte Tokarev-Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg hervor. Mit beiden Händen umklammerte er die Waffe und machte auf der Stelle kehrt, um wütend in die kleine Kamera zu starren. »Waren Sie das?« Er marschierte auf den Bildschirm zu. Zu schade, dass das Ding kein Fenster war, durch das er eine Kugel hätte jagen können. »Haben Sie die geschickt?«
»Wen denn geschickt?« Der Engländer wirkte vollkommen ruhig. Er saß da wie ein unbeteiligter Zuschauer im Theater, verfolgte in aller Ruhe ein Drama, das ihn nicht das Geringste anzugehen schien.
Automatisches Gewehrfeuer ratterte. Kugeln schlugen in der steinernen Brüstung ein und ließen die hölzerne Balkontür splittern. Amadayo stieß einen lauten Schrei aus, dann rannte er quer durch das Zimmer und riss eine Klappe im Fußboden auf. In der Luke befand sich ein Safe, und darin lag eine Tasche, die mehrere Goldbarren, ein Dollarbündel sowie gefälschte Ausweispapiere enthielt. Amadayo starrte die Tasche an. Er wusste genau, was es bedeutete, wenn er sie jetzt in die Hand nahm: nichts anderes als das Eingeständnis der Niederlage, wie ein Pilot, der den Schleudersitz auslöst, kurz bevor seine Maschine an einem Berghang zerschellt.
Die Schüsse verhallten, und dann vernahm Amadayo eine tiefe, raue Männerstimme, ohne jedoch die einzelnen Worte verstehen zu können. Er hielt den Atem an und lauschte.
Nachdem das Tor aufgebrochen worden war und die ersten Schusswechsel geendet hatten, legte sich eine gefährlich aufgeladene Stille über das Anwesen. Amadayos Wachmannschaft bestand überwiegend aus ehemaligen jemenitischen Soldaten, die vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat geflüchtet waren und auf der anderen Seite des Golfs von Aden ein besseres Leben zu finden gehofft hatten. Aus Sicht des Doktors waren sie im Vergleich zu den Einheimischen eindeutig die bessere Wahl, zum einen, weil sie ausgebildete Soldaten waren, zum anderen, weil sie nicht in das weit verzweigte Netz verfeindeter Clans mit all den Rivalitäten verstrickt waren, die für seine somalischen Landsleute zum Alltag gehörten. Sie konnten ihn vor den Verbrechern beschützen, denen er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in die Quere gekommen war, aber auch vor den militanten Kriegern der al-Shabaab-Miliz, die ihn für einen gottlosen Ungläubigen hielten. Was er bei seinen Überlegungen jedoch nicht berücksichtigt hatte, war die Tatsache, dass diese Männer Überlebende waren. Sie wussten genau, wann das Blatt sich zu ihren Ungunsten gewendet hatte.
Die Wachen gingen hinter Pflanzenkübeln und niedrigen Steinmauern in Deckung und wogen ihre Chancen ab. Schon während des ersten Schusswechsels war die Hälfte von ihnen ums Leben gekommen.
Der Viehtransporter, der das Tor gerammt hatte, setzte zurück. Dutzende Bewaffnete strömten auf das Grundstück. Sie hielten die gleichen zerschrammten, schlachterprobten Kalaschnikows in der Hand wie Amadayos Wachen, ergänzt von ein, zwei heruntergekommenen Panzerfäusten und Maschinengewehren mit sperrigen Munitionskästen. Auf den ersten Blick ähnelten die Männer den Banden, die plündernd durch die Provinzen des Landes zogen, in denen Gesetzlosigkeit herrschte, oder den Burcad Badeed, den Piraten außerhalb der Stadt. Doch im Gegensatz zu diesem Gesindel legten sie zumindest einen Hauch von Disziplin an den Tag. Die jemenitischen Wachen hatten mit wildem Geschrei und unkontrollierten Schüssen gerechnet, aber nicht mit einem beherrscht und methodisch vorgehenden Gegner.
Die Reihen der Eindringlinge teilten sich vor ihrem Anführer. Er war sehr groß und sehr muskulös, ein Straßenkämpfer mit einer mehrfach gebrochenen Nase und einem Gesicht, das wie poliertes Teakholz glänzte. Eine halbkreisförmige Narbe zog sich von seinem rechten Mundwinkel über die Wange nach oben und endete oberhalb der rechten Augenbraue. Es sah aus, als würde er ununterbrochen die Augen zusammenkneifen. Außerdem war sein rechtes Auge irgendwie beschädigt, jedenfalls war die Pupille dauerhaft geöffnet und schwarz wie das Auge eines Hais. Mit langsamen Schritten kam er die Einfahrt entlang. In seiner Hand baumelte eine Desert Eagle, eine schwere halbautomatische Waffe aus massivem Eisen. Schließlich hatte er eine Stelle gefunden, wo er von allen Seiten gut zu sehen war, und blieb stehen.
Er holte tief Luft und fuchtelte mit seiner massigen Pistole herum. »Seht mich an«, rief er. Ein paar Köpfe hoben sich unsicher für einen Moment aus der Deckung und waren genauso schnell wieder verschwunden. »Wer weiß nicht, wer ich bin?« Er blickte sich um, wartete auf eine Antwort. »Fragt diejenigen, die euch begleiten, falls ihr es nicht wisst.« Er steckte die Pistole in das Lederhalfter, das sich über seiner Brust spannte. »Wollt ihr euch wirklich gegen mich stellen? Ist euch klar, was das bedeuten würde?«
In dreißig Meter Entfernung blickte der Bruder des jungen Mannes, der jetzt im pinkfarbenen Wasser von Amadayos Swimmingpool trieb, über den Lauf seiner Kalaschnikow hinweg. Er wusste, wer dieser hünenhafte Mann war.
Abur Ramaas.
Er wusste, wer er war und kannte die Gerüchte über ihn, doch jetzt, in diesem Augenblick, wurde er von der Trauer beherrscht. Der Bruder des toten Wachmanns stützte den Lauf seiner Waffe auf eine Pflanzenvase aus Beton, nahm die Brust des anderen genau ins Visier und biss die Zähne aufeinander. Dann durchbrach ein Schuss aus seiner schlecht instand gehaltenen Waffe die Stille und verfehlte ihr Ziel. Ramaas hörte, wie die Kugel laut an ihm vorbeizischte, und blickte ihr mit missbilligender Miene nach.
Der nächste Schuss erfolgte von einem seiner Männer, der auf der Außenmauer des Anwesens postiert war. Er hielt ein schlankes Dragunov-Scharfschützengewehr in der Hand. Die Waffe keuchte einmal, dann war der Wachmann mit seinem Bruder vereint.
Ramaas seufzte. »Sonst noch jemand?«
Langsam wurden Hände in die Luft gereckt, landeten Waffen klappernd auf dem Boden.
»Erschießen wir sie?« Guhaad wollte keinen übereifrigen Eindruck machen, aber auf Ramaas wirkte der andere immer wie ein ausgehungerter Hund, der ständig an seiner Kette zerrte, immer Blut lecken wollte.
Er schüttelte den Kopf. »Nehmt ihnen die Waffen ab und lasst sie laufen. Das ist eine gute Lektion für alle anderen.« Ramaas verschwieg, dass Dutzende Leichen auf dem gescheckten Rasen der Villa nur die falschen Leute aufgeschreckt hätten. Eine Handvoll Toter konnte man in Mogadischu im Dunkel der Nacht noch übersehen, aber ein Massaker an einem Dutzend entwaffneter Soldaten … das hätte die Männer, die vorgaben, diese zersplitterte Stadt zu regieren, womöglich zum Handeln gezwungen. Sie hätten sich genötigt gesehen, sichtbare Maßnahmen zu ergreifen, und das lag nicht in Ramaas’ Interesse. Er wollte, dass sie so lange zufrieden und selbstgefällig blieben, bis er sie eigenhändig in ihren Betten erstach.
Guhaad verzog das Gesicht zu einer Grimasse und entblößte dabei seine Zähne. Das Khat, das er in übermäßigen Mengen kaute, hatte zahlreiche orangefarbene Flecken darauf hinterlassen. Ramaas machte sich schon lange nichts mehr aus den berauschenden Pflanzenblättern, aber sein Stellvertreter konsumierte das Zeug immer noch genauso gerne wie die jüngeren Banditen. Dadurch blieb er lange wach und aufmerksam und konnte ganze Nächte durchmachen, ohne zu ermüden. Aber Ramaas hatte Nachsicht mit ihm. Guhaad war schließlich sein Bluthund. Er hörte auf sein Kommando, konnte von einem Augenblick auf den anderen brutal und gewalttätig werden. Guhaad war der Schläger, mit dem Ramaas seine Widersacher in Grund und Boden rammte. Das Einzige, was ihm fehlte, war die Fähigkeit, weiter als bis zum nächsten Tag zu denken.
»Keine Armee in Sicht«, sagte eine andere Stimme. Sie gehörte Ramaas’ zweiter Waffe, dem Scharfschützen. Sein Name lautete Zayd, und er war die feine Klinge, während Guhaad den Vorschlaghammer verkörperte. Die beiden sahen einander so ähnlich, dass sie auch Brüder hätten sein können – sie hatten die gleichen langen Arme und Beine und stammten beide aus dem Süden. Andererseits konnte man schon an ihrer Haltung ihre durch und durch gegensätzlichen Charaktere erkennen. Während Zayd den Eindruck eines raffinierten und kaltblütigen Menschen erweckte, wirkte Guhaad wie eine wandelnde Zeitbombe.
Ramaas nickte. »Sie werden nicht kommen.« Er wies mit einer Kopfbewegung auf die weit geöffneten, unbewachten Türen des Haupthauses. »Er ruft sie gerade an.« Er schüttelte den Kopf. »Sie werden nicht kommen«, wiederholte er.
Amadayo klappte sein Handy zu und zerquetschte es fast mit seiner Faust. Die Männer in der Regionalregierung, die ihm einen Gefallen schuldig waren, waren urplötzlich nicht erreichbar, als wären sie alle auf einmal von einer seltsamen Krankheit außer Gefecht gesetzt worden. Mit einem Mal war sein Name etwas Unanständiges, ein Wort, das niemand in den Mund nehmen wollte.
Wie konnte das geschehen? Er warf das Handy weg und griff erneut nach seiner Pistole. »Ramaas. Der Pirat ist in mein Haus eingedrungen.« Amadayo sprach die Worte laut aus, verankerte die grässliche Wahrheit damit in der Realität. »Er ist gekommen, um mich zu töten.«
»Ich denke, damit dürften wir am Ende unserer Arbeitsbeziehung angelangt sein«, sagte Brett und streckte die Hand nach einem Schalter außerhalb des Monitorbildes aus.
»Nein!« Amadayo hatte die Augen vor Panik weit aufgerissen. »Sie glauben, dass ich keine Ergebnisse liefern kann? Ich werde es Ihnen beweisen!« Er fuchtelte mit der Pistole herum. »Sie werden schon sehen!«
Vor dem Zimmer knarrten Dielenbretter unter schweren Stiefeln, und Amadayo beschloss zu handeln, anstatt weiter zu streiten. Lauthals fluchend jagte er das ganze Magazin der Tokarev in die Tür. Er drückte ab, so schnell er nur konnte, die Kugeln durchschlugen das Holz … es war der verzweifelte Versuch, alle diejenigen zu töten, die sich auf der anderen Seite befanden.
Ohne Vorwarnung verharrte der Verschluss der Pistole regungslos aufgeklappt. Amadayo starrte die Waffe in seiner Hand an. Das Magazin war leer. Messinghülsen lagen verstreut zu seinen Füßen, und Pulverdampf umhüllte den Lauf.
Die durchlöcherte Tür flog auf, fiel dabei halb aus den Angeln, und dann füllte Ramaas die Öffnung aus. Amadayo wich zurück, doch der groß gewachsene, kräftige Mann brauchte nur einen einzigen Schritt, dann stand er so dicht vor seinem Gegenüber, dass er ihn mit einem Rückhandschlag entwaffnen konnte. Die Tokarev landete auf dem Fußboden.
»Du hast dich immer respektlos mir gegenüber verhalten«, knurrte Ramaas, und seine Worte klangen wie das leise Fauchen eines Leoparden.
Amadayo sammelte zur Erwiderung bereits Speichel in seinem Mund, doch nachdem er in das tote Auge des anderen geblickt hatte, überlegte er es sich noch einmal und schluckte lieber.
»Du bist selbst schuld«, sagte Ramaas. »Du hättest das Land gemeinsam mit deiner Frau und deiner Tochter verlassen sollen.«
»Meine …?« Amadayos Knie wurden weich wie Gummi, und er musste sich an einer Stuhllehne festhalten, um nicht umzukippen. »Was hast du mit ihnen gemacht?«
Ramaas ging nicht auf seine Frage ein. »Alle hassen dich«, fuhr er fort, »weil du ein Schakal bist, den man nicht einfach ohne Weiteres töten kann, weil du dich unentbehrlich gemacht hast.« Er schüttelte den Kopf. »Aber nicht mehr lange.« Er warf einen Blick auf den Bildschirm mit der Kamera, als würde er das alles jetzt erst wahrnehmen, dann wandte er sich wieder seiner Beute zu. »Ich habe gehört, wie du den anderen Schwächlingen etwas von Stabilität und Gemeinschaft erzählt hast. Aber das sind nur Worte wie die Ketten, die ihr den Menschen um den Hals legt.«
Amadayo blinzelte sich den Angstschweiß aus den Augen. Seit etlichen Monaten schon unterdrückte er Informationen über Ramaas’ Aktivitäten in Somalia, schmierte und bestach alle möglichen Leute, nur damit nicht allzu öffentlich darüber gesprochen wurde, während er gleichzeitig vergeblich nach einer Möglichkeit suchte, ihn gefügig zu machen. Die ganze Zeit über hatte er sich vor den Konsequenzen gefürchtet, falls offensichtlich würde, dass er längst nicht mehr alles im Griff hatte.
Der zerrüttete Zustand des somalischen Staates war für Welldone Amadayo Chance und Bürde zugleich. Er hatte jedenfalls jede Gelegenheit genutzt, um sich bei Regierungspolitikern und reichen Investoren aus dem Ausland einzuschmeicheln, die selbst jetzt noch darüber spekulierten, wie sich die bislang unangetasteten Öl- und Gasvorräte des Landes am besten ausbeuten ließen. Aber Ramaas war eine ernsthafte Bedrohung für all das geworden.
Zunächst war er nichts weiter als ein winziger Punkt auf Amadayos Radar gewesen, einer von vielen räuberischen Kriegsfürsten in einem Volk voller Schmuggler und Piraten. Diese Einschätzung war sein größter Fehler überhaupt gewesen. Tag für Tag erfuhr Amadayo von neuen Allianzen zwischen Ramaas’ Räuberbande und den verfeindeten Clans in Puntland, Galmudug und anderswo. Und sogar die skrupellosen Islamisten des al-Shabaab hatten angeblich ein Abkommen mit ihm geschlossen. Er untergrub damit Amadayos jahrelange, mühsame Arbeit. Kein einziger der Männer, die er losgeschickt hatte, um Ramaas zu töten, war je zurückgekehrt. Die meisten, so fürchtete er, hatten die Seiten gewechselt und dem Kriegsfürsten die Treue geschworen – Somalier hatten eine Schwäche für Macht.
Während Amadayo in Ramaas’ vernarbtem Gesicht nach einer Spur von Menschlichkeit suchte, wurde ihm klar, dass der Kriegsfürst ihn voll und ganz in der Hand hatte.
»Die Ältesten sind voller Abscheu für dich«, sagte Ramaas jetzt. »In Haradheere verspotten sie dich. Sie sagen, du bist wie eine Frau, die sich zu jedem Mann legt – die größte Dhillo in ganz Mogadischu.« Er stieß ihm seinen dicken Finger gegen die Brust und nickte in die Kamera. »Ein Schoßhündchen der Gaal.«
»Ich bin keine Hure!« Amadayo nahm allen Widerspruchsgeist zusammen, den er aufbringen konnte, doch der Ausbruch ließ ihn nur noch kraftloser werden, und er fiel in sich zusammen.
Ramaas sah es – ein Jäger, der wusste, dass seine Beute aufgegeben hatte – und nickte. »Es wird Zeit, dass du verschwindest.«
War das etwa ein Angebot? Amadayo machte einen unsicheren Schritt in Richtung Tür, wo ihm jedoch ein Mann in einem leuchtend roten Fußballtrikot mit wütendem Gesicht in den Weg trat.
»Du hast Glück gehabt«, sagte Ramaas, »dass du es so weit gebracht hast.« Er ließ den Blick durch das Zimmer schweifen. »Mal sehen, ob das Glück dir immer noch hold ist.« Der Kriegsfürst kramte in einer seiner Taschen herum und holte drei abgewetzte, zerknickte Spielkarten heraus. Er zeigte sie Amadayo: Pik-Bube, Kreuz-Bube und Herz-Dame. »Sie musst du finden.«
Amadayo kannte das Spiel, und er wusste auch, dass es ein Trick war, aber Ramaas legte die Karten bereits auf den Tisch und schob sie mit einer Geschmeidigkeit hin und her, die man seinen schwerfälligen Boxerhänden niemals zugetraut hätte. Als er fertig war, trat er einen Schritt zurück und wartete ab.
Dreiunddreißig Prozent Chance, dachte Amadayo. Er hatte keine andere Wahl, als mitzuspielen. Also tippte er die mittlere Karte an. Der Schläger mit dem Fußballtrikot schnaubte verächtlich.
Ramaas nickte nachsichtig und signalisierte Amadayo, dass er die Karte umdrehen durfte. Als er das blasse Gesicht des Pik-Buben sah, fühlte er sich unwillkürlich an Bretts einstudierte Posen erinnert.
»Na, dann komm mal mit, Herr Doktor. Ich will dir etwas zeigen.« Ein Lächeln umspielte Ramaas’ Lippen, und er stieß Amadayo in Richtung Balkon. Nur zögerlich fügte dieser sich. Hastig ließ er den Blick in alle Richtungen huschen, suchte nach Fluchtmöglichkeiten. In den unteren Stockwerken hatten die Männer des Kriegsfürsten bereits angefangen, das Haus zu plündern, und schleppten alles nach draußen, was ihnen irgendwie wertvoll erschien. Amadayo unterdrückte ein angstvolles Stöhnen.
Jetzt landete eine schwere Hand auf seiner Schulter. »Siehst du das?« Ramaas deutete über die Stadt. »Sie hat noch nie dir gehört, obwohl du es geglaubt hast. Aber das war dumm von dir.« Er hielt kurz inne. »Glaubst du an einen Gott? Glaubst du, dass er dir gnädig ist?« Amadayo wusste nicht, was er darauf erwidern sollte, aber er hatte den Verdacht, dass Ramaas die Antwort auf seine Frage bereits kannte.
»Bruder, bitte«, flüsterte Amadayo flehend. »Wirst du mich gehen lassen?«
»Nein.« Ramaas versetzte ihm einen brutalen Stoß und umklammerte mit einer Hand Amadayos Hals, drückte den Daumen in das weiche Fleisch an seiner Kehle und schnürte ihm den Atem ab.
Amadayo taumelte rückwärts gegen die durchlöcherte Balustrade, doch Ramaas hielt den Druck so lange aufrecht, bis Amadayo mit dem gesamten Oberkörper über dem Abgrund hing. Von Todesangst übermannt riss er die Arme nach oben, schlug um sich, kratzte und erkannte, dass sein Ende unmittelbar bevorstand.
Ramaas packte Amadayo am Gürtel, um einen besseren Hebel zu haben, und stieß ihn über die Balustrade. Amadayo wirbelte durch die Luft und landete auf den Fliesen, die den trüben Swimmingpool umgaben. Knochen splitterten. Der Schmerz machte ihn blind und taub. Rund um seinen Körper bildete sich eine Blutlache und durchnässte sein seidenes Hemd.
»Boss.« Zayd warf einen Blick auf den zuckenden Leib und dann nach oben zum Balkon, wo Ramaas sich gerade den Schweiß von den Händen wischte. Er zeigte auf Amadayo. »Er lebt noch.«
»Oh.« Fast beiläufig zog Ramaas die Desert Eagle aus dem Halfter und jagte dem Sterbenden vier Kugeln in den Leib. Die Schüsse aus der großkalibrigen Pistole hallten wie Donnerschläge über das Anwesen, und dann war die Akte Welldone Amadayo endgültig geschlossen. »Komm rauf«, sagte der Kriegsfürst.
Zayd neigte seinen dünnen Hals, warf sich das Gewehr über die Schulter und machte sich auf den Weg. Mit ausdrucksloser Miene betrachtete er die teuren Möbel und die knallbunten Gemälde an den Wänden. Auf jedem Quadratmeter in diesem Haus türmte sich schwülstiger, kitschiger Müll. Zayd wandte den Blick ab – Amadayos Villa war voller hohler Dinge, an denen nur reiche Narren Gefallen finden konnten. Sie waren genauso wertlos, wie Amadayo selbst es gewesen war. Hier gab es nichts, was durch ehrliche Arbeit verdient worden war. Vielmehr waren es die Früchte der Heimtücke und der Lüge.
Die anderen Banditen nahmen mittlerweile das ganze Haus auseinander. Alles, was zu Geld gemacht werden konnte, würde der Gruppe zugutekommen. Und den Rest würden sie den Leuten überlassen, die sich bereits draußen vor den Toren sammelten – denen, die gezwungen gewesen waren, ihr Leben im Schatten von Amadayos unverschämtem Reichtum zu fristen. Sollten sie damit machen, was sie wollten. Zayd schob sich an einem Mann vorbei, der gerade mit einem ganzen Arm voller farbenprächtiger Frauenkleider die Treppe herunterkam. Dann suchte er das Büro des toten Politikers auf.
Beim Betreten sah er, wie Guhaad den Inhalt einer Tasche auf den Fußboden kippte. Kleine Goldbarren plumpsten auf den dicken Teppich, und Guhaad starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an. Zayd beachtete ihn nicht weiter und wandte seinen Blick Ramaas zu, der vor einem Fernseher stand und nach einer faustgroßen Plastikkugel griff, die daran befestigt war.
Er zog die Kugel mit einem Ruck aus ihrer Halterung. Es knackte, und dann sah man die Kabel, die das kleine Gerät mit dem Bildschirm verbanden. »Hat Ihnen die Show gefallen?«, fragte er.
Der gut gekleidete Ausländer auf dem Bildschirm neigte den Kopf zur Seite wie ein neugieriger Hund. »Es sieht ganz so aus, als hätten Sie gerade ein gemeinsames Problem beseitigt. Hätten Sie möglicherweise Interesse an dem Posten? Er ist soeben frei geworden.«
Ramaas ließ ein heiseres Kichern hören und warf Guhaad einen Blick zu, worauf dieser, etwas verspätet, kurz und rau auflachte. Zayds Miene blieb vollkommen regungslos. Es gab nicht viel, was ihn amüsierte, und ein bleichgesichtiger Gaal, der mit ihnen sprach, als hielte er sie für ausgemachte Dummköpfe, gehörte ganz gewiss nicht dazu.
»Mittelsmann«, sagte Ramaas zu dem Weißen. »Geh und sag deinen Herren, dass ich jetzt das Kommando hier habe.« Anschließend riss er mit einer einzigen Handbewegung die Kamerakabel aus der Wand und warf sie auf den Schreibtisch. Der Bildschirm flackerte und wurde schwarz.
Zayd stupste die Kamera mit dem Finger an, um sich zu versichern, dass sie wirklich tot war. Daneben sah er die Spielkarten des Kriegsfürsten liegen. Er drehte die beiden noch verdeckten Karten um und brachte zwei identische Buben zum Vorschein. »Amadayo hätte niemals spielen dürfen«, bemerkte er und reichte dem Kriegsfürsten die Karten.
»Wohl wahr«, erwiderte Ramaas. »Die Gier verleitet den Menschen dazu, seine Chancen zu überschätzen. Er wusste, dass er im Nachteil war, und trotzdem hat er gespielt. Erkennst du die Arroganz, die darin liegt? Bis zum Schluss hat Amadayo geglaubt, dass die Gesetze dieser Welt für ihn nicht gelten.«
»Was soll ich für Euch tun?«, sagte Zayd.
Ramaas betrachtete den Computer auf Amadayos Schreibtisch. Sie hatten Männer, die sich mit solchen Dingen auskannten. Sie würden dieses Gerät in die Hände bekommen, so wie die Beute aus dem Haus unter den Gesetzlosen aufgeteilt werden würde. Ramaas musterte Zayd von Kopf bis Fuß. »Du bist nicht größer als der verstorbene Doktor. Er war immer sehr gut gekleidet. Geh und such dir ein paar Sachen aus. Alles, was dir gefällt.«
»Warum?«
»Weil du eine sehr bedeutende Reise antreten wirst.« Er wies mit einer Kopfbewegung auf den Bildschirm. »Es gibt noch mehr zu tun.« Dann beugte Ramaas sich nach vorne und sprach leise weiter. »Es gibt nur einen, der das für mich tun kann, Bruder, und das bist du.« Der Rest blieb ungesagt, aber es war nicht das erste Mal, dass Zayd die Flagge des Kriegsfürsten tragen durfte. Es gab nicht viele, denen Ramaas eine solche Ehre zuteil werden ließ.
Am anderen Ende des Zimmers ertönte lautes Krachen und Splittern, als Guhaad mit vollem Körpereinsatz ein Holzregal beiseite wuchtete. Dahinter kam ein Geheimfach zum Vorschein. Guhaad brach das Schloss mit seinem Gewehrkolben auf und schob die Klappe beiseite. »Boss, seht Euch das an!«
Ramaas fasste in die Vertiefung und brachte ein in Plastik verpacktes Bündel zum Vorschein, amerikanische Dollarnoten, alles große Scheine. Er nickte. »Räum es aus. Amadayo erweist sich im Tod noch als großzügiger Spender.« Zayd sah, wie er Guhaad die Hand auf die Schulter legte. »Kann ich mich darauf verlassen, dass du hier nach dem Rechten siehst, solange wir weg sind?«
»Wir?« Guhaad warf Zayd einen Blick zu, der Verwirrung und Verärgerung ausdrückte. Die Vorstellung, ausgeschlossen zu sein, behagte ihm ganz und gar nicht.
Ramaas schüttelte bereits den Kopf. »Während meiner Abwesenheit benötige ich deine starke Hand hier vor Ort.« Wie er es immer wieder schaffte, die Launen des Muskelprotzes einzufangen, blieb dem Scharfschützen ein ewiges Rätsel. »Zayd hat eine Mission, genau wie ich auch. Es geht um bedeutende Dinge, Bruder. Ich hätte euch beide heute alleine hierher schicken können, aber das habe ich nicht getan. Ich bin hier, und weißt du auch, warum?«
»Manche Dinge müssen persönlich erledigt werden«, antwortete Guhaad, weil er sich an bereits Gelerntes erinnerte. »Ein Mann muss sich bei seinen Taten sehen lassen.« Da kam ihm ein Gedanke. »Deshalb habt Ihr die Jemeniten leben lassen. Damit sie von Euren Taten erzählen können.«
Ramaas nickte. »Alle Menschen sollten nach bestimmten Regeln leben. Nach Grundsätzen.« Er ließ Guhaads Schulter los und entfernte sich. Dabei betrachtete er das Geldbündel von allen Seiten. »Einige wenige Dinge müssen noch getan werden. Es gibt Fesseln, die uns niederhalten, und sie müssen durchtrennt werden.«
»Und dann?«, wollte Zayd wissen. Normalerweise dachte er nicht einmal im Traum daran, Ramaas’ Anweisungen zu hinterfragen, aber in diesem Fall wollte er es wissen. Tag für Tag kamen sie einem Ziel näher, das nur Ramaas klar und deutlich vor Augen hatte.
»Waaq wird uns leiten.« Der Kriegsfürst gebrauchte in seiner Antwort das kuschitische Wort für Gott. Zayd hatte nicht viel für Religion übrig, aber das behielt er lieber für sich. Schließlich wollte er seine muslimischen Brüder nicht beleidigen. Ramaas wiederum hing dem alten Volksglauben der Oromo an, und niemand hatte den Mut, ihn deswegen zu kritisieren. Zayd hatte ihn schon mehr als einmal von Missionen und Pflichten sprechen hören. Ramaas konnte sehr überzeugend sein, wenn er wollte, aber er konnte auch von einem Augenblick auf den anderen außerordentlich furchterregend werden.
»Wir sind der Wandel«, fügte er mit solcher Überzeugung hinzu, dass seine Wunschvorstellungen beinahe schon Gewissheit zu sein schienen. »Wir sind der Orkan, der über unsere Nation hinwegfegen wird, das könnt ihr mir glauben.« Dann lächelte er und hielt ihnen das dicke Geldbündel vor die Nase. »Aber damit es so weit kommt, brauchen wir noch mehr davon.«
2
»Also ich finde die P-90 besser.« Jürgen Goss hob die Hände, als hielte er die belgische Maschinenpistole tatsächlich im Anschlag. Er richtete seine imaginäre Waffe quer durch das viel zu kleine und viel zu schlecht beleuchtete Büro auf einen ebenfalls imaginären Gegner. »Zack, zack! Direkt nebeneinander!« Er ließ sich gegen die Lehne sinken, sodass der Schreibtischstuhl bedenklich knarrte, und kicherte leise. »Und dann noch dieses coole, durchsichtige Magazin. Da siehst du genau, wie die Patronen eine nach der anderen …«
»Für den Nahkampf völlig in Ordnung, zugegeben.« Marc Dane hockte auf der Kante von Goss’ ziemlich unordentlichem Schreibtisch und zuckte mit den Schultern. »Aber mir wäre etwas mit mehr Durchschlagskraft lieber.«
»Ein Sturmgewehr?«
Dane nickte. »Eine SCAR-L mit 5,56-Millimeter-NATO-Geschossen und extra großem Magazin. Dazu die ACOG-Zieloptik und ein Lasermarkierer. Ich steh auf Laser.«
»Lässt sich aber nicht so schnell nachladen«, bemerkte Goss und rutschte ein Stückchen nach vorne. Der Österreicher war ziemlich dick und versuchte zu ignorieren, dass er sich in dem viel zu schmalen Schreibtischstuhl fühlte, als hätte er einen Schwimmring um die Hüften. Aber er hatte auch keine Lust mehr, bei der Beschaffungsstelle ständig neue Möbel zu beantragen.
»Wenn du das Ziel gleich beim ersten Mal triffst, musst du auch nicht nachladen, oder?«, erwiderte Dane. »Weißt du, wo dein Problem liegt?«
»Du sagst es mir bestimmt gleich.« Goss seufzte.
Der Engländer tat so, als würde er mit einem Gartenschlauch seinen Rasen sprengen. »Viel zu viel Aufwand für viel zu wenig Ertrag.«
»Wenn genügend Blei in der Luft ist, muss irgendjemand dran glauben.«
»Ja, genau!«, erwiderte Dane. »Deine Teamkameraden, wenn wir so blöd sind und uns in deine Schusslinie verirren.«
Goss verdrehte die Augen. »Das musst du mir jedes Mal wieder aufs Butterbrot schmieren, stimmt’s?« Anfang des Monats hatten sie bei einem Onlineturnier eine schmachvolle Niederlage gegen vier ziemlich unverschämte Schüler aus Texas hinnehmen müssen, nachdem Jürgens mangelhafte Disziplin an der Waffe zu einem klassischen Fall von Eigenfeuer geführt und das Match beendet hatte. »Mit einer richtigen Waffe könnte ich bestimmt viel besser umgehen.«
Da legte sich ein Schatten auf Danes Miene. »Das ist bloß viel weniger spaßig, als du denkst.«
Goss ging nicht weiter darauf ein. Der Engländer benahm sich manchmal ziemlich eigenartig. In der Regel war er ein gutmütiger und fleißiger Kerl, sogar was diesen ganzen nervtötenden Bürokram anging, und eigentlich immer zu einem Späßchen bereit – nur manchmal eben nicht. Dann schlug seine Stimmung um, als würde eine Wolke sich vor die Sonne schieben, und er wurde düster und unzugänglich.
Dane war, genau wie sein Kollege, Mitte dreißig, aber damit war auch schon das Ende der Gemeinsamkeiten erreicht. Goss hatte einen zerzausten Schopf aus fettigen schwarzen Haaren über einer hohen Stirn und dazu ein Gesicht, das besser zu einem Schuljungen als zu einem erwachsenen Mann gepasst hätte. Danes kurzes schmutzig-blondes Haar und seine Bartstoppeln hingegen bildeten den Rahmen für verwegene Gesichtszüge mit einem viel zu ernsten Ausdruck. Goss saß, wenn er ehrlich zu sich selber war, viel zu lange am Schreibtisch und machte viel zu wenig Sport, sodass sein Körper immer mehr Speck ansetzte. Dane hingegen wirkte hager und bestand überwiegend aus Sehnen und Muskeln.
Goss wusste nicht viel über den Mann, der erst vor Kurzem zu der Untersuchungskommission der Vereinten Nationen in Kroatien gestoßen war, aber er hatte ein paar Gerüchte gehört. Angeblich hatte er den britischen Geheimdienst unter eher unglücklichen Umständen verlassen. Allerdings hatte Goss nie nachgefragt. Nach seiner Erfahrung galten persönliche Fragen bei Engländern allgemein als sehr unhöflich.
Er beschloss, das Thema zu wechseln. »Kommst du nach der Arbeit noch mit auf ein Bier?«
»Nööh. Heute spielen die Weißen gegen Dynamo Zagreb.« Die Weißen, das war der Spitzname des Teams von Hajduk Split. »Dann sind die Kneipen voll mit Fußballfans, und du weißt ja, was das bedeutet.«
»Aber die Kroaten verwüsten nicht jedes Mal das Lokal, wenn ihre Mannschaft verliert, anders als eure Hooligans«, erwiderte Goss und wies mit einer Handbewegung auf die umgebenden Wände. »Wir sind hier in Split, nicht in London. Schon vergessen? Das ist eine kultivierte Stadt.«
»Halt bloß die Klappe.« Dane quittierte die sanfte Spitze seines Kollegen mit einem kurzen Lächeln. Goss hatte schnell herausgefunden, dass der Engländer Heimweh hatte, und zog ihn immer wieder gerne damit auf.
»Was haben Sie da gerade gesagt?« Die raue Stimme und der gebieterische Tonfall ließen beide Männer aufblicken. Sie drehten sich um und starrten zu der Nische hinüber, in der Goss’ über alles geliebte Espressomaschine stand.
Die Stimmung des Österreichers sackte schlagartig in den Keller. Gedrungen und quadratschädelig spielte dort der Polizeiinspektor Franko Horvat mit einer schalenförmigen Kaffeetasse herum. Dabei starrte er die beiden anderen Männer durchdringend an.
Horvat hatte die unangenehme Eigenschaft, sich jedes Mal still und heimlich anzuschleichen. Er trug ein graues Sportsakko und eine Hose, die seit zwei Jahrzehnten aus der Mode war. Außerdem schien er ununterbrochen gereizt zu sein und einen Streit vom Zaun brechen zu wollen. Was ihm für gewöhnlich auch gelang.
Jetzt schwenkte er seine Tasse in Goss’ Richtung. »Was war das gerade? Ich stamme aus Split! Wollen Sie mich etwa beleidigen?« Der Atem des Polizeibeamten roch nach kaltem Rauch.
»Er hat einen Witz gemacht«, erwiderte Dane. »Das ist österreichischer Humor, ned wooaa?!« Die letzten Worte waren eine miserable Imitation von Goss’ Akzent und erzielten genau die gewünschte ablenkende Wirkung.
Goss blinzelte und war erleichtert, dass sein Kollege ihm zur Seite gesprungen war. Er empfand Horvat und die meisten anderen kroatischen Polizisten als bedrohlich, und es ärgerte ihn immer wieder aufs Neue, dass sie im selben Gebäude wie sie untergebracht waren. Als Jürgen Goss sich bei den Vereinten Nationen beworben hatte, hatte er auf ein glitzerndes Gebäude aus Glas und Stahl in Wien oder New York gehofft. Stattdessen musste er seine Arbeit jetzt in einer trostlosen Polizeiwache in Split verrichten.
»Wie funktioniert das gleich noch mal?« Horvat hantierte an der Espressomaschine herum und drückte sinnlos auf alle möglichen Tasten. Goss sprang auf, weil er Angst hatte, dass Horvat gleich etwas kaputt machen könnte.
»Lassen Sie mich das machen«, sagte er.
Horvat drückte ihm seine Tasse in die Hand und lächelte siegessicher. »Gern. Sie können das. Wie eine gute Hausfrau.«
Dane wies mit dem Zeigefinger nach oben. »Sie haben in Ihrem Stock doch auch eine Kaffeemaschine. Und trotzdem kommen Sie ständig hier runter. Wieso eigentlich?«
»Sie ist kaputt.« Horvat gab sich nicht einmal die Mühe, seine Lüge einigermaßen glaubhaft zu verpacken. Goss vermutete, dass der Polizist einerseits zu geizig war, um für seinen Kaffee zu bezahlen, und zum anderen die UN-Untersuchungskommission immer wieder daran erinnern wollte, in wessen Zuständigkeitsbereich sie sich eigentlich befanden. Er musterte Dane mit spöttischem Blick. »Na? Heute schon ein paar Bomben entdeckt?«
»Und Sie? Heute schon ein paar Kumpels verhaftet?«, gab Dane zurück. Es wurde viel darüber spekuliert, dass Horvat seine Dauerstellung bei der Policija eher seinen Beziehungen ins kriminelle Milieu als denen in die Strafverfolgungsbehörden zu verdanken hatte. Er war einfach so aalglatt, dass absolut nichts Verwertbares an ihm hängen zu bleiben schien. Aber er verstand, was die Bemerkung des Engländers zu bedeuten hatte, und sein breites Grinsen verschwand augenblicklich.
»Mislite da ste pametni.« Ganz egal, was Horvat gerade gesagt hatte, Goss war sich sicher, dass es eine Beleidigung gewesen war. »Sie müssten mal nach oben kommen«, fügte Horvat dann unter leisem Schnauben hinzu, während seine kleinen Augen sich zu Schlitzen verengten. »Da würden Sie zur Abwechslung mal richtige Polizeiarbeit zu sehen bekommen.« Er klopfte sich auf die Brust. »Dort, wo ein wichtiger Mann seinen Dienst verrichtet.« Er zeigte mit seinem nikotingelben Zeigefinger auf die Wand mit der großen Karte des Adriatischen Meeres und der umgebenden Länder. Die Karte war übersät mit Stecknadeln und angeklebten Datenblättern. »Nicht das da.«
Auf dem Rahmen über der Karte war die genaue Bezeichnung der Untersuchungskommission zu lesen: Abteilung für Nukleare Sicherheit (NSNS, Operative Einheit Nr. 7) – Internationale Atomenergiebehörde. Darunter war ein Logo zu erkennen, das einen Atomkern mit Elektronenkreisbahnen zeigte, der von zwei Olivenzweigen umschlossen wurde.
Horvats verächtlicher Kommentar über ihre Arbeit machte Goss stinkwütend, aber was sollte man von diesem Typen anderes erwarten? Horvats Vorstellung von Polizeiarbeit bestand darin, Verdächtige die Treppe hinunterzuschubsen, Bestechungsgelder anzunehmen und alle möglichen Verbrechen irgendwelchen Einwanderern in die Schuhe zu schieben. Die Vorstellung, dass es auch um akute Bedrohungen für die ganze Welt gehen konnte, überstieg seinen Horizont.
Goss hatte einmal versucht, ihm zu erklären, was die Abteilung für Nukleare Sicherheit eigentlich in Kroatien wollte. Hier trafen mehrere Schmuggelrouten aus der ehemaligen Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten zusammen. Dadurch war das Land zu einer Durchgangsstation, einem Tor zur Welt für den illegalen Handel geworden, der hier genauso florierte wie der legale auch. Ein Großteil dieser illegalen Handelsgüter waren Waffen aus den Beständen, die die UdSSR während des Kalten Krieges angehäuft hatte – und zwar weit mehr als nur Gewehre und Munition. Angereichertes Uran, Plutoniumbrennstäbe aus schnellen Brütern, nukleare Abfälle, alle möglichen spaltbaren Materialien … es war ein komplettes Bestiarium des radioaktiven Horrors, das ohne Weiteres dazu verwendet werden konnte, eine schmutzige Bombe oder gar einen funktionsfähigen Atomsprengkörper herzustellen.
Die Operative Einheit Nr. 7 war eine von vielen NSNS-Kommissionen auf der ganzen Welt, die den Handel mit nuklearen Technologien und Materialien überwachen sollte, ununterbrochen Informationen sammelte und ihre Arbeit mit den UN-Mitgliedsstaaten koordinierte, immer mit dem Ziel, die gefährlichsten Waffen, die die Menschheit je ersonnen hatte, unter Verschluss zu halten. Aber alles, was Franko Horvat wahrnahm, waren ein Haufen Ausländer auf seinem Territorium, die nichts Besseres zu tun hatten, als ihm in die Quere zu kommen und wertvolle Ressourcen für sich zu beanspruchen, ohne dass etwas Nennenswertes dabei herauskam.
Goss schenkte ihm einen großzügigen Schluck einer kräftigen Arabicamischung in einen Plastikbecher – er hatte bereits schmerzlich erfahren müssen, dass Horvat eine »geborgte« Tasse nie wieder zurückbrachte. »Hier.« Und jetzt hau ab. Der zweite Teil des Satzes hing unausgesprochen in der Luft.
Horvat nippte an seinem Kaffee und wandte sich bereits zum Gehen, doch eine letzte Spitze konnte er sich nicht verkneifen. »Sie sollten wieder nach Hause gehen«, sagte er zu Dane. »Zurück nach Englisch-Land. Sie sind hier eine völlige Zeitverschwendung.«
»Bitte, sag, dass du in den Becher gespuckt hast«, fuhr Dane Goss an, sobald Horvat außer Hörweite war. »Wieso redest du überhaupt mit dem Kerl?«
Goss runzelte die Stirn und ärgerte sich selbst darüber, dass er den Polizeibeamten einfach nicht loswurde. Aber einen Tag nach seinem letzten Versuch war sein kleiner Fiat 500 aufgebrochen worden, und Horvat hatte ihm mit größtem Vergnügen einen Vortrag über die unangenehmen Folgen von »unfreundlichem Benehmen« gehalten.
»Weil es einfacher ist, als sich mit ihm zu streiten«, sagte er.
»Nach allem, was ich gehört habe, hat er seine gesamte beschissene Karriere auf diesem Prinzip aufgebaut.« Kopfschüttelnd blickte Dane zur Tür. »Ich hasse solche Typen. Die gehen mir tierisch auf den Sack.«
Goss merkte, dass Horvats abschließende Beleidigung den Engländer viel mehr ärgerte als ihn selbst. Aber warum? Es gab noch andere Gerüchte über Marc Dane und den Grund, aus dem er für die NSNS arbeitete. Er durfte nicht mehr nach Hause zurück. Er war an einem katastrophalen Zwischenfall beteiligt. Er war vom MI6 unehrenhaft entlassen worden. Goss fragte sich unwillkürlich, welches dieser Gerüchte wohl der Wahrheit am nächsten kam.
»Hast du die Notizen, um die ich dich gebeten hatte?« Danes Stimme klang jetzt wieder ganz sachlich. Er war ja aus einem bestimmten Grund zu Goss gekommen.
Dieser nickte und nahm einen Aktenordner von einem Stapel mit mehreren Untersuchungsberichten. Dane klappte den Ordner auf und runzelte die Stirn, als er den Brief mit dem Wappen der Royal Canadian Mounted Police sah. Das, was er da las, war ganz eindeutig nicht das, was er erwartet hatte. »Genau wie du gesagt hast«, meinte Goss. »Es gibt zwar ein paar verdächtige Verbindungen zum organisierten Verbrechen in Quebec, aber nichts, was ein Eingreifen rechtfertigen würde.«
Dane atmete einmal scharf aus. »Noch mehr Daten. Keine Schlussfolgerungen, bloß immer noch mehr Daten.« Er rang sich ein Lächeln ab. »Danke, Jürgen. Ich weiß deine Mühe wirklich zu schätzen.« Der Engländer warf einen Blick auf die Taucheruhr an seinem Handgelenk – eine Cabot – und sprang auf. »Ah. Ich muss los. Besprechung.«
»Viel Spaß«, erwiderte Goss müde. »Ich muss hier erst noch fertig werden.«
»Dieses Mal wird die Schrader mir ganz bestimmt zuhören. Aller guten Dinge sind vier«, sagte Dane, aber sein Tonfall verriet, dass er genau das Gegenteil meinte.
Die Besprechung hatte bereits angefangen, als Marc möglichst unauffällig in die hinterste Reihe huschte. Trotzdem fing er sich einen vorwurfsvollen Blick von dem Mann am Rednerpult ein. Maarten de Wit war der stellvertretende Leiter der Operativen Einheit Nr. 7, ein groß gewachsener Holländer mit kahl rasiertem Schädel, Hundeblick und einer leisen, monotonen Stimme. Er ließ den Blick über das halbe Dutzend im Raum schweifen und runzelte die Stirn.
Auf der Leinwand hinter ihm war eine Powerpoint-Präsentation im Gang. Der Beamer zeigte gerade das Bild eines Sattelzugs, und aus den Polizeiuniformen am Rand schloss Marc, dass der Sattelzug bei einer Straßenkontrolle aufgefallen war.
»In diesem Fall haben wir Glück gehabt«, erklärte de Wit gerade. »Reiner Zufall. Die Grenzschützer waren eigentlich auf der Suche nach illegalen Migranten.« Er drückte eine Taste auf seinem Pult und holte das nächste Bild vom Innenraum des Aufliegers auf den Schirm. Darauf waren zwölf Ölfässer zu erkennen. Jedes war mit einer dicken Plastikplane umwickelt. »Kontaminierte Schlacke mit extrem hohen Cadmium- und Cäsiumwerten. Der Fahrer sitzt in Haft, aber wie üblich sind sämtliche Papiere gefälscht. Wir können keine Verbindung zu den Auftraggebern herstellen.«
»Was war das Ziel der Fahrt?« Die Frage kam von einem der einheimischen Verbindungsbeamten auf den vorderen Plätzen.
»Er wollte die Ladung eigentlich an ein Frachtschiff übergeben. Wir wissen, dass das nicht die einzige Fuhre war, und wollen den Fahrer ausführlich befragen.«
»Also gut.« Eine ernst wirkende Frau in dunklem Anzug erhob sich von ihrem Stuhl in der ersten Reihe, signalisierte de Wit mit einer Handbewegung, dass er Platz nehmen solle, und stellte sich selbst hinter das Pult. Gesa Schrader war Ende vierzig, kurz angebunden und als Chefermittlerin der NSNS-Einheit Marcs Vorgesetzte.
Schrader hatte früher eine hohe Stelle im Bundeskriminalamt bekleidet und war, soweit Marc es beurteilen konnte, die Verkörperung der Sachlichkeit. Er war jetzt seit etlichen Monaten hier für die NSNS im Einsatz, aber noch nie hatte er bei dieser Frau auch nur einen Hauch von Emotion feststellen können.
»Wir schaffen es einfach nicht, diese Schmuggelroute dichtzumachen. Sobald wir ihnen an einer Stelle den Weg abschneiden, suchen sie sich einen anderen.« Schrader ließ den Blick über ihre Mitarbeiter schweifen. »Ich habe die Schnauze voll davon, dass wir der Zentrale in Wien immer nur kleine Fische liefern können. Konzentration, meine Damen und Herren. Wir werden diesem Atommüllschmuggel einen Riegel vorschieben, und zwar zielgerichtet und schnell.« Sie holte Luft und presste die Lippen aufeinander. »Wir alle wissen, weshalb wir hier sind, denn unser Name ist Programm: Abteilung für Nukleare Sicherheit.« Schrader nickte. »Das bedeutet, dass jeder Tropfen Reaktorflüssigkeit, der uns vor die Füße fällt, jeder Umweltverschmutzer, der glaubt, er könnte das Gesetz umgehen, jeder Giftverklapper und jeder Atommüllschmuggler für uns ein Zielobjekt sind.« Sie zeigte auf die Leinwand. »Das verseuchte Material kommt aus Zentral- und Nordasien und dann über den Balkan in diese Region, aber über den Bestimmungsort wissen wir bislang immer noch nichts. Nur, dass das Zeug, ganz egal, wo es landet, Tod und Verderben bringt. Aber wir werden dafür sorgen, dass das aufhört. Dass dieser Müll gefahrlos entsorgt wird. Vorschriftsmäßig.« Schrader trat einen Schritt beiseite und gab damit zu erkennen, dass sie zum Schluss kommen wollte. »Ich habe mit Europol Kontakt aufgenommen und mit unseren Freunden in den oberen Rängen der Policija gesprochen. Sie haben uns ihre volle Unterstützung zugesagt. Dieser Fang könnte der Durchbruch sein, auf den wir schon so lange warten. Ich möchte, dass Sie alle Ihr absolut Bestes geben. Nur dann haben wir eine Chance.«
De Wit stand auf und hob die Hände. »Heute Nachmittag sind die neuen Dienstpläne mitsamt den angepassten Arbeitsaufträgen fertig. Jeder bekommt eine Reihe von Anhaltspunkten und Hinweisen, die dann abzuarbeiten sind.«
Marc spürte, wie seine Laune in den Keller sackte. Beinahe hätte er sich zu Wort gemeldet, überlegte es sich aber anders. Trotzdem hatte Schrader es bemerkt. »Sie haben noch eine Frage, Dane?«
Ihr Tonfall machte eindeutig klar, dass es das Beste gewesen wäre, wenn er einfach den Kopf geschüttelt und Nein, Madam gesagt hätte, wie es sich für einen braven Beamten gehörte. Aber dann musste er an den Aufwand denken, den er im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen bereits betrieben hatte, und konnte nicht anders: »Was wird aus unseren aktuellen Fällen?«
»Stand jetzt«, erwiderte de Wit, »ist diese illegale Schiffsroute unser aktueller Fall.«
»Hören Sie, ich verstehe absolut, wie wichtig das Ganze ist, aber ich würde meine aktuellen Ermittlungen nur äußerst ungern schleifen lassen. Ich habe da ein paar … vielversprechende Hinweise bekommen.« Marc konnte beinahe hören, wie gewisse Leute im Raum die Augen verdrehten.
»Ich dachte, Ihre Ermittlungen steckten fest«, schaltete Schrader sich ein und bedeutete den anderen mit einer Handbewegung, dass die Sitzung beendet war. »Die Kurjaks haben sich jedenfalls schon seit einiger Zeit nicht mehr in der Gegend blicken lassen.«
Marc schüttelte den Kopf und blieb standhaft, während die übrige Einheit den Raum verließ. »Die Kurjaks sind nach wie vor aktiv. Und das bedeutet, dass sie eine ernst zu nehmende Gefahr darstellen.« Er wählte seine Worte mit Bedacht.
Ursprünglich hatten die Gebrüder Kurjak eine kleine serbische Bande innerhalb der Bratva, also des ausgedehnten osteuropäischen Netzwerks der sogenannten russischen Mafia, gebildet. In den Neunzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts hatten sie sich dann als Schmuggler und Geldwäscher einen Namen gemacht. Nach dem Golfkrieg waren sie zum ersten Mal auf dem Radar der Internationalen Atomenergiebehörde aufgetaucht. Vertreter der Bande hatten auf dem Schwarzmarkt nukleares Material angeboten, das angeblich aus geheimen irakischen Waffenlaboren stammte. Sie hatten einen lukrativen Handel mit rotem Quecksilber betrieben, einem sehr seltenen Reaktionsbeschleuniger, der extrem schwer herzustellen war, der jedoch, richtig angewandt, selbst aus der kleinsten und primitivsten Atombombe eine grausame Massenvernichtungswaffe machte. Zahllose militante Gruppen, Terroristen und Rebellen rissen sich darum, diesen Stoff irgendwie in die Finger zu bekommen, weil sie glaubten, dass sie damit einer Bombe, vor der die Welt erzittern würde, einen Schritt näher kommen könnten.
Die ganze Sache hatte nur einen kleinen Schönheitsfehler. Sie war eine Lüge.
Rotes Quecksilber war ein reines Fantasieprodukt. Die angeblich existierenden Proben waren mithilfe dunkelroter Flüssigkeit und radioaktiver Bauteile aus alten Röntgengeräten einfach zusammengepanscht worden. Es gab diese Verbindung schlichtweg nicht und auch nichts anderes, was über die unglaublichen Fähigkeiten verfügte, die die Verkäufer des sagenhaften Stoffes ihrer Ware zuschrieben. Doch die Kurjaks waren außergewöhnlich gute Lügner und hatten mit ihrem Betrug eine Menge Geld gemacht – und zwar nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Schließlich gab es jede Menge Terrororganisationen, die ganz versessen darauf waren, die Welt mit einer Massenvernichtungswaffe in Angst und Schrecken zu versetzen.
Marc musste zugeben, dass er in einer winzigen Ecke seines Herzens sogar so etwas wie zähneknirschende Anerkennung für die Serben empfand. Wer Leute wie al-Qaida oder den Leuchtenden Pfad austricksen wollte, der musste außergewöhnlich gierig und unfassbar verwegen sein.
Natürlich standen die Kurjaks aufgrund dieser Aktivitäten auf zahlreichen Todeslisten. Darum waren sie ständig in Bewegung, blieben nie länger als wenige Tage an einem Ort und hinterließen so gut wie keine Spuren. Dabei waren sie ein fortwährender Stachel im Fleisch der Internationalen Atomenergiebehörde und der NSNS. Mit ihrer gefälschten Schmuggelware und den nebulösen Gerüchten, die sie zusätzlich verbreiteten, behinderten sie die Suche nach echten Atomwaffen aus den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes erheblich. Nur ihnen war es zu verdanken, dass die Operative Einheit Nr. 7 wertvolle Arbeitszeit darauf verwenden musste, die falschen Spuren von echten zu unterscheiden.
Marc Dane war ihnen schon seit geraumer Zeit auf den Fersen und kam ihnen immer näher, da war er sich sicher. Die Analyse von Verhaltensmustern war schon immer eine seiner größten Stärken gewesen, und so hatte er die Bewegungen der serbischen Bande Stück für Stück verfolgt und ein System erkannt. Sie zogen immer an der Adriaküste entlang, im Winter weiter nach Süden, der Wärme entgegen, im Frühjahr dann wieder weiter in den Norden. Im Augenblick waren sie seiner Vermutung nach in Kroatien untergetaucht, vielleicht sogar hier in Split. Das Problem war nur, dass seine Kollegen seine Einschätzung nicht teilten.
De Wit deutete an, dass Europol gewillt war, die Kurjaks sich selbst zu überlassen. Irgendwann würde ihre Vergangenheit sie ohnehin einholen. Irgendwann würde eine der Terrororganisationen, die sie übers Ohr gehauen hatten, sich revanchieren. »Solche Dinge regeln sich üblicherweise von selbst«, behauptete de Wit.
Marc war anderer Meinung. »Auch ein blindes Huhn findet ab und zu ein Korn.« Das Sprichwort brachte ihm außer verwirrten Blicken nichts ein. Er seufzte und fuhr fort: »Ich weiß, dass Wien den Kurjaks in Bezug auf das NSNS-Mandat nicht die größte Bedeutung beimisst …«
»Und das ist noch sehr milde ausgedrückt«, warf de Wit ein.
»Aber ich sehe das anders. Bei diesen Mengen an militärischer Ausrüstung, die diese Typen verschieben, bei all den Gewehren und der Munition? Dazu noch ihre Beziehungen zu allen möglichen Leuten aus der ehemaligen Sowjetunion? Das sind ja keine Hirngespinste. Wir sollten uns weniger damit beschäftigen, wer sie sind, als vielmehr damit, wen sie alles kennen.«
Schrader runzelte die Stirn. »Dane, Sie müssten mittlerweile doch kapiert haben, dass wir hier bei der NSNS die Dinge ein wenig anders anpacken, als Sie es vielleicht vom britischen Geheimdienst her gewohnt sind.«
»Das ist nicht …«
Sie redete einfach weiter. »Dass Sie überhaupt hier sind, haben andere entschieden.« Für einen kurzen Moment flackerte der Ärger erneut über ihr Gesicht. Schrader hatte schon in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass Marc nicht ihr Wunschkandidat für die Operative Einheit Nr. 7 gewesen war. »Ihre analytischen Fähigkeiten haben sich als sehr hilfreich erwiesen, und Sie haben uns damit weitergeholfen. Aber was Ihnen immer noch abgeht, ist die Bereitschaft, sich als Mitglied eines Teams zu begreifen. Sie haben zu lange alleine gearbeitet.«
Marc warf de Wit einen schnellen Blick zu, hoffte auf ein wenig Unterstützung, aber der andere verzog keine Miene.
»Ich muss Sie doch nicht daran erinnern, was wir für eine Organisation sind«, fuhr Schrader fort. »Wir sind nicht bewaffnet und treten auch keine Türen ein. Wir sammeln und vergleichen Informationen. Wir arbeiten mit den Polizeidienststellen und Strafverfolgungsbehörden der jeweiligen Länder zusammen. Wir suchen undichte Stellen und schließen sie.« Sie tippte mit ihrem langen, elegant manikürten Zeigefinger auf den Ordner, den Marc in der Hand hielt. »Aber vor allem sind wir dafür verantwortlich, die Bewohner und die Umwelt dieses Planeten zu schützen. Das bedeutet, dass ich klare, eindeutige Bedrohungen brauche, etwas Greifbares. Denn nur dagegen kann ich auch etwas unternehmen. Mit irgendwelchen Betrügern, die eventuell etwas im Schilde führen könnten, kann ich absolut nichts anfangen.«
Es dauerte eine Weile, bis Marc sich zu einem zögerlichen Nicken durchgerungen hatte.
»Beim nächsten Mal ein bisschen unauffälliger«, sagte der andere Mann. »Sonst kannst du dir auch gleich ein Schild um den Hals hängen, mit dem du deine nächste Aktion ankündigst.«
»Ich werd’s versuchen …«
Marcs Angreifer ließ ihm keine Zeit, den Satz zu Ende zu bringen. Mit einem lauten Schrei auf den Lippen stürmte er los. Der Schlag sollte seine Kehle treffen, und Marc sah aus dem Augenwinkel einen verschwommenen schwarzen Knüppel auf sich zufliegen.
All seine Instinkte brüllten ihn an, sich zurückfallen zu lassen, den Abstand zu vergrößern, aber er machte genau das Gegenteil. Er riss den rechten Arm nach oben, stürmte in die Angriffsbewegung seines Gegners hinein, rammte ihm den Unterarm gegen das Schlüsselbein, den Ellbogen gegen das Brustbein, die Faust seitlich an den Hals. Dann drehte er sich zur Seite, stemmte sich mit vollem Gewicht gegen den Angreifer und hielt ihn auf, noch bevor er seinen Schlag ausführen konnte.
Gut möglich, dass er gleich von dem Schlagstock getroffen wurde, falls der andere sich schnell genug von seiner Attacke erholte, aber dieses Risiko ging er ein. Seine schlechte Laune hatte die Oberhand über sein Urteilsvermögen gewonnen. Nun bearbeitete er mit der anderen Faust den Schädel seines Angreifers und brachte ihn dadurch aus der Balance.
Eine Sekunde lang sah es so aus, als hätte er es tatsächlich geschafft, das Blatt zu wenden, jedenfalls kam sein Gegenüber ins Straucheln. Doch der Schlagstock war immer noch im Spiel, und Marc erkannte zu spät, dass er durch seine Attacke eine Flanke geöffnet hatte. Mit voller Wucht landete der kurze Knüppel auf seinem Brustkorb und trieb ihm die Luft aus der Lunge.
Dieser eine Schlag reichte aus, um all seine zielgerichtete, wütende Konzentration hinwegzufegen. Der Angreifer holte bereits ein zweites Mal aus, und Marc war viel zu langsam, um den Treffer zu vermeiden. Die Welt begann sich um ihn zu drehen, und er landete mit einem lauten Knall auf der dicken Schaumstoffmatratze.
Die hellen Leuchtstoffröhren an der Decke blendeten ihn. Er musste blinzeln und schluckte den Ärger über seinen Fehler herunter. Jetzt schob sich ein freundliches, ovales Gesicht in den Vordergrund und verzog sich zu einem sardonischen Grinsen. »Du weißt, was du falsch gemacht hast.«
Eine Hand in einem fingerlosen Trainingshandschuh kam auf ihn zu, und Marc ergriff sie und ließ sich auf die Füße ziehen. »Ja.«
Luka Pavic warf den Gummiknüppel von der Matte und musterte Marc abschätzend. »Du lässt die Linke nicht mehr fallen, und das ist ein Fortschritt.« Er deutete auf Marcs Unterarm, wo ein Streifschuss eine Narbe hinterlassen hatte. »Aber was war da los? Eindeutig die falsche Entscheidung.« Er ließ den Kopf kreisen und schien trotz der zahlreichen Treffer, die er hatte einstecken müssen, keinerlei Schmerzen zu haben.
»Stimmt«, pflichtete Marc ihm bei und schüttelte seine Enttäuschung ab. »Tut mir leid. Ich bin mit den Gedanken woanders.«
Pavic ließ die Arme sinken. »Ach so. Schrader hat abgelehnt.« Seine freundliche Miene bekam einen niedergeschlagenen Zug. Er war einfühlsam, und das mochte Marc an ihm. Es war eine Eigenschaft, die ihn zu einem guten Polizisten machte, die aber auch bedeutete, dass er den Dingen manchmal sehr viel schneller auf den Grund kam, als es gut für ihn war.
»Die Ermittlungen sind nicht eingestellt«, erwiderte Marc und ließ die Schultern kreisen. »Aber sie treten auf der Stelle.«