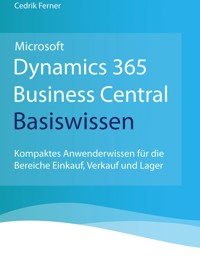Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schicksal von Araquest
- Sprache: Deutsch
Emiron kann es nicht fassen: Jahrelang durchstreift er mit seinem Meister die Länder von Araquest und jetzt, fast am Ende seiner Ausbildung zum Nomendi, soll sich auf einmal alles für ihn ändern. Nicht nur, dass die Elfen alarmiert den Süden verlassen, auch trachtet ihm ein unbekanntes Wesen nach dem Leben. Am Ende stellt sich ihm eine folgenschwere Entscheidung, die das Schicksal von ganz Araquest bestimmen wird...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Emiron kann es nicht fassen: Jahrelang durchstreift er mit seinem Meister die Länder von Araquest und jetzt, fast am Ende seiner Ausbildung zum Nomendi, soll sich auf einmal alles für ihn ändern. Nicht nur, dass die Elfen alarmiert den Süden verlassen, auch trachtet ihm ein unbekanntes Wesen nach dem Leben.
Am Ende stellt sich ihm eine folgenschwere Entscheidung, die das Schicksal von ganz Araquest bestimmen wird…
Der Autor
Cedrik Ferner wurde 1990 im Ruhrgebiet geboren und verschlang schon als Kind Geschichten, wie andere ihre Süßigkeiten. Mit der Veröffentlichung seines ersten Romans Dunkle Schatten erfüllte er sich selbst einen großen Traum. Weitere Bücher werden noch folgen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Vorwort
Manch einer wird sich jetzt sicher fragen, warum Autoren so oft zu einem Vorwort neigen. Die wohl am weitesten verbreitete Meinung ist, dass es sich bei einem Vorwort nur um nervtötendes Blabla handelt, das mit der eigentlichen Geschichte nichts – oder nur wenig – zu tun hat. An sich stimmt das ja auch. Aber auch wenn es manchmal recht steif und langweilig sein mag, gehört es doch zu einem Buch dazu. Schließlich räumt es dem Autor Platz ein, um sich ein wenig auszutoben und seine Gedanken über die Entstehung des Buches mitzuteilen. Jetzt könnte man fragen: Und wer will das bitte wissen? Nun, bis vor wenigen Monaten – ja, Monaten! – der Autor selbst. Hä? Wurde dieses Buch nicht von dem Autor selbst verfasst und sollte er also nicht auch wissen, was in seinem Vorwort steht?
Dieses Buch ist ein wenig – tja, speziell, wenn man es so nennen darf. In diesem Fall wendet sich nämlich nicht der Autor an seine Leser. Nicht, weil er keine Lust dazu hätte oder nicht weiß, was er schreiben soll, sondern weil ihm mein Vorwort besser gefiel. Warum? Nun, er wusste von den Gegebenheiten des Drucks dieses Buches zuerst nichts – zumindest so lange nicht, bis er es das erste Mal in den Händen hielt. Und da hatte ich dieses Vorwort bereits einmal so ähnlich verfasst. Hier ergreife ich an seiner statt das Wort, und wie ihr sicher bemerkt habt, verzichte ich hier auf die »nötige« Form. Es liest sich meiner Meinung nach ohne einfach besser.
Wer ich bin, dass ich mir solche Freiheiten erlauben kann? Nun, ich habe dieses Buch für ihn erstmals rezensiert, anschließend ein wenig korrigiert, das Cover entworfen, die Karte gestaltet, dieses Vorwort geschrieben und, nicht zu vergessen, das erste Exemplar des Buches drucken lassen – also eigentlich fast alles. Aber auch nur fast. Schließlich ist es ja noch sein Buch und nicht meines. Da er nicht auf das Vorwort verzichten wollte, sollte ich statt seiner das Wort ergreifen.
Ich könnte euch jetzt viel erzählen. Wie viel Zeit, Muße und Gedankengut in dieses Werk geflossen sind, was es ihm bedeutet und so weiter, aber das tut ja irgendwie schon jeder Verfasser. Es wird mal Zeit für etwas anderes. Deswegen werde ich nichts über seine Gedanken sagen. Ja richtig, es kommen an dieser Stelle keine Gedanken zur Erstellung dieses Werkes. Allerdings werde ich meine Gedanken kurz darlegen, die mit der Entstehung dieses Buches aufkamen.
Er wusste nicht, ob er es veröffentlichen sollte oder nicht – ein typischer Selbstkritiker eben. Ich wollte ihn irgendwie dazu bringen, sich für eines von beiden zu entscheiden, was mir, wie man sieht, gelungen ist. Allerdings wusste ich damals noch nicht, wie ich ihn dazu bringen kann, bis mir die Idee mit dem Buchdruck einfiel. Es sollte ein kleines Geschenk werden, als kleine Hilfestellung zur Entscheidungsfindung, frei nach der Frage: Was will ich eigentlich?
Es ist was anderes, sein fertiges Werk in den Händen zu halten, als nur theoretisch davon zu sprechen. (Die Buchschreiber unter euch werden sicher wissen, was ich damit meine.) Was draus geworden ist, seht – oder besser lest – ihr hier. So viel aber an dieser Stelle dazu.
Mein Dank gilt vor allem Frau Martina Takacs (www.dualect.de). Sie hat keine Mühen gescheut, mir – über einen ganzen Monat hinweg! – viele hilfreiche Tipps zu geben, wie man das Buch verbessern könnte. Und nun? Nun möchte ich euch nicht weiter vom Lesen abhalten.
Suche nicht die großen Worte, eine kleine Geste genügt.
– Phil Bosmans
In diesem Sinne – viel Spaß! Und mal ehrlich, das Vorwort zu lesen, war doch gar nicht so schlimm, oder? Obwohl ich zugeben muss, dass ich selbst kein Freund davon bin. Das ist aber wieder eine andere Geschichte …
Eure Nadine Ferner
Prolog
Die Schatten wurden länger und dunkler. Ein kühler Windhauch jagte durch die engen Gassen. Eldrit rannte mit bebendem Herzen an heruntergekommenen Fassaden vorbei. Aus einzelnen Fenstern züngelten rote Flammen. Vom Grauen gepackt wagte er nicht, sich umzusehen. Überall auf den Straßen lagen Tote, deren leere Augen an den dunkler werdenden Himmel starrten. Ein süßlicher, fauliger Geruch nach Verwesung und Tod drang ihm in die Nase, was ihn dazu bewegte, noch schneller zu laufen. Sein Haar war bereits schweißnass und klebte ihm auf der Stirn. Er wusste, dass sein Leben hier ein jähes Ende finden konnte, doch sein Ziel musste er dennoch erreichen, bevor alles zu spät war. Er musste raus aus diesem Dorf, zurück nach Lothinar, um Hilfe zu holen. Seine Hände zitterten. Es war, als wäre er in einem Albtraum gefangen, einem Traum, den er nie zu träumen gewagt hätte. Die Welt musste erfahren, was im Süden vor sich ging, und er war der Einzige, der übrig geblieben war, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wo war bloß der Weg, der aus dem Dorf führte?
Er bog in eine kleine Seitengasse ein. Auch hier nahm er den abscheulichen Geruch wahr, während er weiterhetzte und gleichzeitig gegen das Schwindelgefühl und die nahende Ohnmacht ankämpfte. Das Schwert stieß ihm beim Laufen immer wieder gegen das Bein und der Umhang umwehte ihn. Die untergehende Sonne verschluckte die ersten Schatten. Eldrit nahm alle Kräfte zusammen und murmelte ein paar Worte. Jetzt strahlten seine Augen in einem grünen Licht.
Er erreichte das Ende der Gasse so plötzlich, dass er Zeit brauchte, um sich neu zu orientieren. Am Rand einer breiten, gepflasterten Straße standen einzelne kleine Handelshäuser nahe beieinander. Im selben Moment entdeckte er etwas, das ihn mit Grauen erfüllte. Die Straße führte zum Marktplatz, und von Weitem erkannte er, dass sich dort einige dunkle Gestalten in einem aufkommenden dünnen Nebel bewegten. Er spürte, wie sein Körper sich gegen seinen Willen wehrte, spürte, wie ihm die Beine zitterten und die Brust schmerzte. Doch er wusste, er durfte nicht stehen bleiben – nicht jetzt, nicht hier. Nun hatte er die Möglichkeit, dem Grauen selbst entgegenzutreten, bevor es ihn finden und verschlingen würde, und allem ein Ende zu bereiten, bevor es zu spät war.
Er rannte in Richtung Marktplatz und lauschte auf Geräusche, konnte jedoch keinen laut wahrnehmen. Einzig die Stille des unausweichlichen Todes umgab ihn wie ein übler Fluch, der nach ihm tastete. Keuchend kam er den dunklen Wesen näher. Sein Körper schrie nach Ruhe und Erlösung, die Augen drohten, ihm den Dienst zu verweigern. Ein Zustand der Benommenheit erfasste ihn, und alles war verschattet und undeutlich. Weißer Nebel stieg kalt und undurchdringlich vor ihm auf. Er packte fest den Griff des Schwertes an seinem Gürtel, spürte Hoffnungslosigkeit nahen, als er erkannte, welche Gestalten dort auf dem Platz standen. Es waren Dorfbewohner, die ihn aus leeren, toten Augen anstarrten.
Mit zitternder Hand zog er das Schwert aus der Scheide und hob es, bereit zum letzten Kampf. Nun gab es kein Entkommen mehr. Dies war das Ende seiner Geschichte.
Eine andere Gestalt in der Mitte drehte sich zu ihm um, und ihn überkam eine Furcht, die er nie zuvor verspürt hatte. Er sah rot funkelnde Augen und lange, spitz zulaufende Ohren. Mit einem breiten Grinsen blickte das Wesen ihm direkt ins Gesicht. Eldrit stolperte und fiel auf die Knie. Kalte Schauer liefen ihm über den Rücken und das Schwert entglitt ihm. Mit letzter Kraft stammelte er, ungläubig, mehr an sich selbst als an das Wesen gerichtet: »Das kann nicht sein.« Er wusste, dies bedeutete das Ende jeder Hoffnung. Ihm wurde schwarz vor Augen.
I
Die alten Bäume des Lendamwaldes schufen mit ihren dichten Laubkronen ein großes Sonnendach, das einen angenehmen Schatten warf. Zwei Reiter bewegten sich, der alten Waldstraße folgend, nebeneinander. Beide trugen Umhänge derselben Art aus braungrünem Stoff, die ihre Rüstung und die Waffen verbargen. Wäre jemand auf die Reiter aufmerksam geworden, hätte er nicht erkannt, wer sie wirklich waren.
»Es ist nicht mehr weit, Emiron. Gleich wird die Stadt in Sicht kommen.«
»Meint Ihr, es wird Probleme geben?«
»Für jedes Problem auf Erden gibt es eine Lösung. Vertrau dir selbst, dann wirst du sie stets finden.«
Emiron mochte Amils Sprüche. Sie waren fast immer klug und lehrreich, und meist kam alles, wie er es vorhergesagt hatte. Er konnte jede Lage zuverlässig einschätzen und behielt auch in scheinbar ausweglosen Situationen immer die Oberhand. Amil war nun schon seit neun Jahren sein Lehrmeister, und sie hatten sich immer aufeinander verlassen können. Schon damals, als Amil ihm als Meister zugewiesen worden war, hatte er eine große Verbundenheit zu ihm gespürt. Und stolz war er gewesen, denn es gab unter allen Nomendi – den Leuten vom altehrwürdigen Volk aus dem Norden – nur wenige, die mit ihm vergleichbar waren. Er war hochgewachsen und noch immer gut durchtrainiert. Seiner ruhigen Art zum Trotz machte seine Statur jedem schnell klar, dass er sich gut zur Wehr setzen konnte, wenn es darauf ankam.
Emiron hielt sich zwar auch für muskulös, wusste aber, dass er noch eine gehörige Portion Schlaksigkeit an sich hatte. Gedankenverloren war er hinter Amil zurückgefallen, der jetzt den Schritt seines Pferdes verlangsamte und sich zu ihm umdrehte. Auch Emiron zügelte sein Tier und schaute fragend in das ernste Gesicht des Meisters, das kaum Spuren seines wahren Alters zeigte. Allein ein paar graue Strähnen durchzogen sein dunkles Haar.
»Wir sind fast am Ziel«, sagte Amil. »Die Tore Enhors werden gleich in Sicht kommen. Ich weiß nicht, was genau uns in der Stadt erwartet, sei also wachsam.« Er zog sich die Kapuze des Umhangs über, sodass sein Gesicht fast vollständig verdeckt war, stieg mit einem eleganten Schwung vom Pferd und nahm die Zügel fest in die rechte Hand.
Emiron tat es ihm gleich, und beide gingen zu Fuß, die Pferde mit sich führend, weiter. So musste man sie für zwei einfache Reisende halten, die müde von einem langen Ritt eine Unterkunft in der Stadt suchten.
Der Wald lichtete sich, und die warme Julisonne schien auf ihre Gesichter. Von Weitem konnte Emiron jetzt die Stadtmauer von Enhor erkennen. Sie war aus großen grauen Steinen erbaut, die Feinde gleichzeitig beeindrucken und abwehren sollten.
Sie erreichten eine Biegung und konnten sehen, dass ihr Weg sie direkt zu einem schweren Holztor führte, das in die dicke Mauer eingelassen war. Zwischen dem Wald und der Stadtmauer erstreckte sich eine weite Graslandschaft. Bei den wenigen Bauernhäusern im Schatten der Mauer ging es geschäftig zu. Manche Bauern befuhren mit ihren Karren den Weg, andere, die vielleicht kein Fuhrwerk besaßen, schleppten ihre Waren selbst Richtung Stadt. Auf den Gesichtern spiegelten sich beim Anblick der beiden Reisenden sowohl Anspannung als auch Furcht. Auch einige Menschen in Rüstung – augenscheinlich Krieger und Stadtwachen – waren auf dem Weg zum Stadttor.
Als sie sich der Stadt näherten, deutete Emiron verhalten auf das Tor. »Es wird bewacht. Jedoch verstehe ich nicht, warum uns die Menschen hier mit einer solchen Abneigung betrachten.«
»Wahrscheinlich geht auch hier schon die Angst vor Fremden um. Ich habe das befürchtet. Versuch, den Augenkontakt zu vermeiden, und benimm dich ganz natürlich.«
Beide achteten darauf, ihr Tempo beizubehalten. Die Wachen am Tor sollten nicht denken, sie fürchteten sich oder hätten etwas zu verbergen.
»Egal, was passiert, es werden keine Waffen eingesetzt. Jedes Aufsehen ist zu vermeiden«, sagte Amil mit Nachdruck, kurz bevor sie das Tor erreichten. »Die Wachposten übernehme ich, halt du dich zurück«, ergänzte er mit leiser Stimme.
Emiron nickte leicht und achtete darauf, dass sein Umhang Rüstung und Schwert vollkommen verdeckte. Er hätte nichts dagegen gehabt, seine Kampfkünste anzuwenden, allerdings wäre es hier wirklich unklug gewesen – und vor allem unnütz. Aufsehen in der Stadt führte zu weiteren Schwierigkeiten und gefährdete die ihnen zugeteilte Aufgabe. Und das war das Einzige, was zählte, dass sie ihren Auftrag so gut wie möglich erledigten. Emiron war stolz darauf, dass er Amil in dieser heiklen Angelegenheit begleiten durfte, denn es ging um etwas wirklich Wichtiges.
Er dachte daran zurück, wie er vor einigen Tagen in der Kaiserstadt Valinar vom Kaiser selbst mit seinem Meister ausgeschickt worden war, um Informationen zu einer seltsamen Krankheit in den südlichen Teilen Tralessas zu sammeln. Dort, so hieß es, würden ganze Bauernschaften und Dörfer dem Tod zum Opfer fallen. Zudem bestand Grund zu der Annahme, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis Enhor selbst betroffen wäre. Nun waren sie unterwegs zum Fürsten der Stadt, um ihn vor dem nahenden Unheil zu warnen und von ihm nach Möglichkeit weitere Hinweise einzuholen.
Es würde nicht einfach sein, das wusste er. Der Fürst von Enhor war bekannt dafür, seinen Willen auch gegen Widerstände durchzusetzen, aber mit Amil an seiner Seite war er guter Dinge. Es erfüllte ihn mit Freude und Stolz, dass sein Meister ihm vertraute, und er würde ihn nicht enttäuschen.
Am Tor angekommen bedeuteten ihnen die Wachposten, stehen zu bleiben. Die Wachen hatten alle ein leichtes Kettenhemd an und trugen einen Speer in der Rechten. Zudem hatte jeder von ihnen ein langes Schwert am Gürtel, das jedoch eher alt und abgenutzt als bedrohlich aussah. Amil hatte leicht gebeugt vor dem ersten Wachmann auf der rechten Torseite angehalten, sodass er müde und wie ein alter Reisender auf der Suche nach einer Unterkunft wirkte.
Der Wächter musterte sie gelangweilt. Seine dunklen, verfilzten Haare, das vernarbte Gesicht und die breiten Schultern sprachen für sich. »Wer seid Ihr? Was wollt Ihr in Enhor?«, schnaubte er.
Amil, der sich davon augenscheinlich nicht beeindrucken ließ, setzte ein harmloses Lächeln auf. »Mein Name ist Amil, und dies ist mein Gefährte Emiron.« Er deutete mit einem Kopfnicken auf ihn. »Wir sind Reisende und suchen eine warme Unterkunft. Es heißt, Enhor sei eine einladende Stadt für jedes wandernde Volk.« Beim Sprechen veränderte sich seine Stimme. Sie klang weder monoton noch besonders betonend, sondern wie eine fremde Art von Musik. Auch seine Augen verwandelten sich. Ihr trübes Grün wurde leuchtend, ja strahlte fast. Es war ein tiefes und magisches Funkeln, so als bewege sich etwas in ihnen.
Emiron wusste, dass sein Lehrmeister Magie einsetzte. Der Wachmann war für einen Augenblick wie erstarrt, unfähig, sich zu rühren. Gerade als Emiron schon fürchtete, dass die Willenskraft des Mannes zu groß wäre und er sich gegen Amils Magie würde behaupten können, nickte er und ließ sie passieren.
Die Stadt Enhor war in den alten Zeiten während der Herrschaft des Reiches Duhn am Fluss Eneis von Menschen gebaut worden. Im Zentrum des Königreichs Tralessa gelegen, diente sie seit jeher als einer der wichtigsten Handelspunkte. Von hier aus wurden Waren aus fast allen Königreichen von Araquest gehandelt und im ganzen Reich und darüber hinaus verteilt. Die Stadt bestand aus mehreren Teilen: der Altstadt im Südosten, der Hafenanlage im Osten, dem zentral gelegenen Marktplatz, der Festungsanlage im Norden und dem großen Wohn– und Handelsgebiet im Westen und Nordosten. Der Stadtteil, der älter als jeder andere Teil Enhors war, bestand aus Lehm– und Holzhäusern, deren Dächer zumeist mit Stroh abgedeckt waren. Enge, dunkle Gassen, die der Gegend einen tristen Eindruck verliehen, kerbten den Ortsteil ein. Weiter im Norden lag der Hafen Enhors, dessen Hafenbecken in den nahen Fluss Eneis mündete. Hier lagen einige Handelsschiffe der Menschen vor Anker, aber auch welche aus den Elfen– und Zwergenreichen. Viele Waren verschiedenster Art wurden hier täglich be- und entladen, darunter Wein aus dem sonnigen Osten, Schmuck, Wertstücke und Gestein aus den Zwergenbergen Dahn und Arxon, aber auch Nahrung aus allen Teilen der Welt. Um die gesamte Hafenanlage und die Stadt erhob sich schützend die große Stadtmauer aus grauem Stein, die sich vom Hafenbecken bis zur Flussmündung im Osten erstreckte. Betrat man Enhor durch das südliche Stadttor, das eigentliche Haupttor, so stand man auf einer gepflasterten, breiten Straße, die direkt zum zentralen Marktplatz der Stadt führte.
Emiron trat mit Amil durch das südliche Tor auf die gepflasterte Hauptstraße, die ins Stadtzentrum führte. Sie hielten ihre Pferde an den Zügeln, denn bei der großen Menschenmenge konnte man kaum reiten. Zudem vermieden sie so unnötige Aufmerksamkeit.
Viel mehr Soldaten als nötig befanden sich auf der Straße. Emiron sah sich um und entdeckte rechts viele kleine Gassen, die in den alten Teil Enhors führten. Zu seiner Linken standen große Handels- und Wohnhäuser aus Holz und Stein nahe beieinander und schienen auf die Passanten herabzusehen. Ihre geschlossenen kleinen Fenster wirkten wie Augen, die das Geschehen auf der Straße gelangweilt beobachteten.
»Ich war noch nie in dieser Stadt, hörte aber allerlei Dinge über den hier gehandelten Reichtum«, bemerkte Emiron. Sein Pferd wieherte leise, als er etwas fester an den Zügeln zog. Einige Händler schauten ihn im Vorbeigehen kurz an, liefen aber dann gleichgültig weiter.
»Dies ist wohl eine der wichtigsten Handelsstädte des Landes – oder sogar des gesamten Kaiserreiches.« Amil sah Emiron nicht an, als er sprach, sondern ließ den Blick prüfend über den Weg gleiten. »Das wiederum ist wohl mit ein Grund, warum die früher in dieser Stadt regierenden Fürsten stets besondere Privilegien innehatten. Manch einer meint sogar, der Fürst von Enhor sei dem König des Reiches Tralessa gleichgestellt.« Er zog an den Zügeln, und sein Pferd folgte ihm in die angegebene Richtung – in eine kleine Gasse, die zur Altstadt führte. Nachdenklich fügte er hinzu: »Natürlich sind solche Behauptungen immer gefährlich. Schon vor langer Zeit gab es einen Fürsten, der die Macht des Königs anzweifelte. Doch diese Geschichte ging für ihn nicht ganz so gut aus.«
Amil bog nun nach rechts in eine noch engere Gasse ein. Die Häuser standen hier näher beieinander, und ein übler Geruch wehte Emiron in die Nase. Eine Katze sprang, von ihnen aufgescheucht, fauchend davon.
»Wohin genau gehen wir, Meister? Müssen wir nicht sofort zum Fürsten der Stadt?«
Emiron wusste natürlich, dass Amil einen Plan hatte. Er hatte immer einen. Es war ihm jedoch zur Gewohnheit geworden, zu fragen.
»Ich hoffe darauf, jemanden zu treffen, der uns in unserer Sache weiterhilft. Außerdem sind dir sicher die vielen Soldaten aufgefallen. Recht ungewöhnlich, wenn du mich fragst, selbst für diese große Stadt.«
»Dann denkt Ihr, dass der Fürst sein geplantes Vorhaben durchführen wird?«
»Genau das ist mein Gedanke. Mir scheint, wir kommen gerade noch rechtzeitig.«
Die Gasse tat sich zwischen zwei brüchigen Ziegelmauern auf und führte auf einen kleinen Platz, der von vielen schäbigen Bauten umschlossen wurde. In seiner Mitte stand ein alter, reich verzierter Brunnen mit der Statue eines unbekannten Kriegers darin. Überall mündeten weitere Gassen auf den Platz, auf dem einige Stände aufgebaut waren und Menschen lautstark ihren Handel abwickelten.
Ihnen gegenüber auf der anderen Seite des Platzes stand ein schäbiges altes, aus Holz und Lehm erbautes Gasthaus. Es sah aus, als würde es jeden Moment in sich zusammenfallen. Ein abgenutztes und kaum mehr lesbares Schild schwang über der Tür, auf dem stand: »Gasthaus Graubräu«.
Sie führten ihre Pferde über den Platz zu der Gaststätte. Emiron folgte seinem Meister zu den Stallungen, die noch schäbiger aussahen als das Haus. Hier herrschte gähnende Leere. Offensichtlich kamen nur selten Lasttiere hier vorbei. Als er mit Amil die Stallungen betrat, kroch ihm ein schrecklicher Geruch von altem Pferdemist in die Nase. Ein Junge kam aus einer dunklen Ecke hervor und schritt selbstbewusst auf sie zu. Sein blondes, struppiges Haar erinnerte an Stroh. Er war wohl nicht älter als elf Jahre, versuchte aber, eine gewichtige Miene aufzusetzen, als er sprach: »Ich bin Preston und bin hier der Stalljunge. Was kann ich für Euch tun? Wollt Ihr Eure Pferde hierlassen?«
Emiron wunderte sich, dass ein Junge in diesem Alter sich in so einer Gegend um die Stallungen kümmerte. Amil sah nicht verwundert aus. Als er antwortete, war seine Stimme freundlich, aber bestimmt.
»Wir sind Reisende aus dem Norden. Unsere Tiere haben einen langen Weg hinter sich. Gib ihnen Unterkunft und frisches Futter.« Sein Blick blieb auf die Augen des Jungen gerichtet, und für einen kurzen Moment sah Emiron eine Mischung aus Neugier und Interesse in Amils Gesicht aufflackern, jedoch wusste er es gekonnt zu verbergen, sodass der Junge sicher nichts davon mitbekam. Preston nahm die Zügel der großen Pferde entgegen und wollte die Tiere gerade zum Stall führen, als Amil erneut sprach: »Sag, mein Junge, möchtest du dir ein paar Münzen zusätzlich verdienen?«
Der Blondschopf horchte auf. »Was müsste ich denn dafür tun?«
Amil zog sich die Kapuze vom Kopf. Sein wettergegerbtes Gesicht offenbarte ein Lächeln. Als er sprach, senkte er die Stimme zu einem Flüstern, wie um sicherzugehen, dass nur Preston und Emiron ihn hören konnten. »Bring unsere Pferde im Morgengrauen gesattelt zu den Grabhügeln am Rande des Waldes vor der Stadt. Wir werden dich dort treffen, ehe die ersten Sonnenstrahlen die Gipfel der nahen Bäume erreichen.«
»Und warum nehmt Ihr Eure Pferde nicht selbst wieder mit, wenn Ihr aufbrecht?«
Emiron spürte die Neugier des Jungen fast körperlich und musste lächeln.
»Wir werden unsere Gründe haben, meinst du nicht?«, gab Amil gemessen zurück.
»Gut, dann gebt mir jetzt das Geld.«
Emiron fand es etwas frech von dem Jungen, gleich Geld zu verlangen, doch Amil schien keinen Grund zu sehen, ihm die versprochenen Münzen zu verweigern, denn er zog sogleich einen kleinen Geldbeutel aus dunklem Leder aus einer der tiefen Taschen seines Umhangs. »Zwei Silberlinge bekommst du jetzt und vier weitere morgen, wenn du mit unseren Tieren zu uns stößt.«
Der Junge schaute staunend auf die Münzen in Amils Hand. Was er auch erwartet hatte, das war es mit Sicherheit nicht gewesen. »D…d…danke, Herr«, stammelte er und griff vorsichtig nach den Silberstücken, als könnten sie jeden Augenblick wieder verschwinden.
Emiron fiel auf, wie überwältigt der Junge von der Menge des Geldes war, aber sicher hatte er in seinem Alter und dieser Heimat hier noch nie so viel Geld auf einmal gesehen. Er zweifelte nicht daran, dass es hier Diebe gab, die sich darauf spezialisiert hatten, Reisende um ihr Hab und Gut zu erleichtern. Dem Jungen traute er so etwas aber nicht zu, dafür wirkte er – Emiron fand kein anderes Wort dafür – zu ehrlich. Allerdings sah er selbst nicht oft so viel Silber in der eigenen Hand.
»Ihr könnt Euch auf mich verlassen. Morgen früh warte ich am Rande des Waldes auf Euch«, sagte der Junge würdevoll. Er schloss schnell die Hand um die Münzen, nahm die Pferde und führte sie in den hinteren Stall.
Emiron und Amil verließen die Stallungen und wandten sich zum Gasthaus. Noch einmal stellten sie sicher, dass Rüstung und Waffen von den Umhängen verborgen wurden, bevor sie die Schenke betraten.
Im Innenraum war alles aus dunklem Holz gearbeitet und vermittelte mit einigen ausgedienten Bänken und stark abgenutzten Tischen einen heruntergekommenen, fast schon maroden Eindruck. Kerzen beleuchteten die Tische nur spärlich, aber in der rechten Ecke brannte ein kleines Feuer im Kamin, das etwas Helligkeit in den Raum brachte. Von außen dagegen drang nur wenig Licht ein, denn die Fenster waren von einer Schmutzschicht überzogen. Einige dunkle Gestalten saßen an den Tischen und sprachen im Flüsterton miteinander. Ein Geruch von Pfeifenkraut und Schmutz durchzog den Raum. An der gegenüberliegenden Wand stand hinter der Theke der Wirt, ein dicker Mann, der aufschaute, als sie die Tür hinter sich schlossen.
Emiron drangen plötzlich laute Stimmen an die Ohren. In der Nähe stritten sich vier dunkel gekleidete Gestalten darüber, ob sie bleiben oder die Stadt verlassen sollten, da eine seltsame Krankheit sich offenbar in Richtung der Stadt ausbreitete. Weitere Gäste mischten sich in den Streit ein. Einige hatten vor, die Stadt zu verlassen, andere wollten die Meinung des Fürsten abwarten, bevor sie handelten.
Amil ging direkt zum Wirt und bestellte zwei Getränke. Dann gab er Emiron ein Zeichen, und sie setzen sich in die dunkelste Ecke des Raumes. Es dauerte nicht lange, und der Wirt kam zu ihnen und stellte, ohne ein Wort zu sagen, zwei gewaltige Krüge mit Met auf den unsauberen Tisch. Amil bezahlte und trank einen großen Schluck aus seinem Krug. Emiron zog, als der Wirt gegangen war, die Kapuze vom Kopf. Hier war es so dunkel, dass sie ohnehin kaum einen Unterschied machte.
Er ordnete seine Haare mit der Hand. Sie waren nichts Besonderes, einfach nussbraun und schulterlang, aber auch er hatte helle, grüne Augen, die manch einem auffielen. Alle Nachkommen des altertümlichen nördlichen Geschlechts hatten sie. Wissende konnten einen Nomendi daran schnell erkennen. Allerdings gab es nur noch wenige von ihnen, sodass ihre Existenz mancherorts sogar angezweifelt wurde, denn nichts sonst unterschied sie äußerlich von gewöhnlichen Menschen.
Ihre Anwesenheit interessierte nach wie vor niemanden – und das war gut so. Nomendi waren nicht überall willkommene Gäste, das wusste Emiron nur allzu gut. Die Menschen, die noch von ihnen Kenntnis hatten, betrachteten das alte Volk oft mit Argwohn und Misstrauen. In manchen Regionen hieß es sogar, dass es Unglück bringe, einen Nomendi zu Gesicht zu bekommen. Das war natürlich Unsinn. Er wusste, es lag daran, dass ihr Volk mehr und mehr in Vergessenheit geriet und die Menschen einander selbst erdachte Geschichten erzählten. Meist wurden sie reich ausgeschmückt und beschrieben ein falsches Bild der Nomendi. Gern hätte Emiron in den alten, längst vergangenen Zeiten gelebt. Damals war das nordische Volk noch zahlreich, und Menschen, Elfen und sogar Zwerge sangen Lieder über die vielen Heldentaten der Nomendi, über die Kraft und Stärke des Königreiches Duhn und seine Magiekundigen. Er selbst kannte nur einige dieser fast vergessenen Lieder aus alter Zeit. Manche von ihnen wurden auch heute noch in der Stadt Lothinar, der Heimat der Nomendi gesungen, etwa von dem Nomendi Aromun, der einen Drachen nur mit dem Schwert bewaffnet allein im Kampf besiegte.
Am Nebentisch, etwa vier Schritte von ihnen entfernt, plärrte ein alter Mann, der schon ausgiebig vom Met gekostet hatte, etwas in seinen dichten weißen Bart, den Krug in der Hand schwenkend. Emiron erkannte die Worte. Sie gehörten zu einem altbekannten Lied, das er schon öfter in verschiedenen Wirtshäusern im Norden gehört hatte:
Ein Met, ein Wein, ein gutes Bier,
Ein’n großen Schluck nehm ich von dir.
Halt das nicht mal für vermessen,
Denn kein Geld hab ich fürs Essen.
Trinke viel und trinke gut,
Ja, das macht mir großen Mut.
Darum sag ich: Gebet mir
Met, Wein, Bier, dann trink ich hier.
Bei dem Wort Schluck und Mut hickste der Alte laut und verschüttete dabei einiges auf dem Tisch.
Ohne Vorwarnung hob plötzlich Amil die rechte Hand wie zum Gruß in die dunstige Luft. Emiron folgte seinem Blick in die Schenke und erkannte eine kleine Person, die aus einer anderen Ecke des Raumes auf sie zukam. Als sie sich gegenüber von Amil an ihren Tisch setzte, erkannte Emiron einen Elfen, der in einen schmutzigen grauen Umhang gehüllt war. Er hatte dichtes schwarzes Haar und spitz zulaufende Ohren, die sein längliches Gesicht noch schmaler aussehen ließen. Das Kerzenlicht spiegelte sich hell in seinen grauen Augen wider. Er sah nicht so jung aus, wie Emiron es von Elfen gewohnt war. Elfen, das wusste er, waren unsterblich. Einzig schwere Wunden und seelische Schmerzen konnten sie in den Tod führen.
»Guten Tag, Celborn. Lange nicht gesehen«, sagte Amil leise, sodass nur der Elf und Emiron ihn verstehen konnten.
»Guten Tag, Amil, du Wanderer des Nordens. Ich erwartete dich schon vor einigen Tagen in Enhor. Eine tückische Zeit ist das gerade.« Die Worte des Elfen waren klar artikuliert und seine Stimme erinnerte Emiron an die eines älteren Kindes. »Im Süden ziehen viele Orks durchs Land, auch tötet eine unbekannte Seuche Bauern und Vieh und löscht ganze Dörfer aus. Überhaupt habe ich Neuigkeiten für dich, die dir nicht gefallen werden. – Wer ist eigentlich dein schweigsamer Gefährte?« Celborn schaute Emiron fragend ins Gesicht.
»Das ist mein derzeitiger Schüler Emiron.«
»Da hast du aber Glück. So einen Lehrmeister wie Amil haben nur wenige je bekommen oder verdient.« Emiron nickte zustimmend, und der Elf wandte sich wieder an Amil. »Gerüchte vom nahenden Tod gehen in Enhor um. Nicht weit von hier, nahe der Flussmündung, gab es erste Todesopfer der Seuche. Auch ganze Viehherden wurden ausgelöscht und verfaulen in der Sonne. So heißt es jedenfalls.«
»Dann ist es bereits schlimmer, als ich annahm«, sagte Amil ernst. Er schaute dem Elfen direkt in die Augen, und Emiron kam es vor, als überlegte er angestrengt.
»Seit einiger Zeit ist es Schiffen aus dem Süden verboten, im Hafen anzulegen«, sagte der Elf. »Reisende werden ausgiebig kontrolliert, bevor sie die Stadt betreten dürfen, als könnte man eine Krankheit dadurch aufhalten. Die Wachen an allen Toren wurden verstärkt.«
»Das haben wir bei unserer Ankunft erlebt«, sagte Amil und sein nachdenklicher Blick verschwand. »Mich interessiert, was die Ursache für die Unruhen im Süden ist und was der Fürst derzeitig plant. Wie kann es sein, dass sich eine große Anzahl von Orks in diesem Land frei bewegen kann?«
Emiron hörte dem Gespräch aufmerksam zu. Die Orks im Süden beunruhigten ihn sehr. Sie waren scheußliche Kreaturen, etwas kleiner als Menschen, aber sehr stark. Dass es auf einmal so viele von ihnen gab, ließ nichts Gutes ahnen.
Der Elf sah sich misstrauisch im düsteren Schankraum um, ehe er wieder zu sprechen begann. »Sie wurden gesehen – weit im Süden, in der Nähe von Duhntal.«
»Unmöglich!«, erwiderte Amil und schaute den Elfen dabei ungläubig an.
»Und doch ist es so«, sagte der Elf mit einem leichten Zittern in der Stimme. »Zwei Wanderer aus meinem Volk waren vor einigen Monden im Süden nahe der verfluchten Stadt Duhn unterwegs. Sie kamen vor wenigen Wochen bei Nacht in Enhor an und blieben nur kurz, ehe sie weiter nach Norden zogen. Sie berichteten mir von den Orks in den südlichen Bergen und von einem Schatten, der sich von den südlichen Gebirgen nach Norden erstreckt. In der Nähe dieser Berge fingen sie einen Ork, der ihnen von merkwürdigen Gestalten berichtete. Was mit ihm passiert ist, muss ich Euch sicherlich nicht sagen. Noch bevor die ersten Gerüchte über die Seuche nach Norden drangen, kamen sie nach Enhor.«
Der Elf machte eine kurze Pause und Emiron trank einen großen Schluck aus seinem Krug. »Was wäre, wenn sie dahinterstecken?«, fragte er.
Bei dem Wort sie geschah etwas mit dem Elfen. Seine Augen blickten unstet nach links und rechts, als sähe er in den Augenwinkeln eine aufkommende Bedrohung. Seine Hände, die locker verschränkt auf dem Tisch gelegen hatten, griffen fester zu und zitterten leicht. Emiron kam es vor, als kämpfte Celborn gegen eine aufkommende Furcht, was für einen Elfen sehr ungewöhnlich war. Noch nie hatte er erlebt, dass einer von ihnen seine Angst offen zeigte.
»Das ist nicht möglich«, wiederholte Amil, und doch klang es etwas zögerlich. »Niemand aus diesem Volk weilt noch auf Erden. Schon vor ewigen Zeiten wurden alle vernichtet. Die Ruhelosen in Duhn zeugen noch heute als Mahnung davon. Vielleicht haben deine Freunde ja sie gemeint.«
»Oh nein, Amil. Die Ruhelosen können die Stadt Duhn nicht verlassen. Jene Wesen, die ich meine, bewegten sich nicht in der alten Königsstadt, sondern weit von ihr entfernt im Süden.«
»Also gut«, gab Amil mit schwerer Stimme nach. »Was genau wird der Fürst nun tun, da im Süden die Bauern sterben und eine Seuche sich seiner Stadt nähert? Will er immer noch seinen irrsinnigen Plan in die Tat umsetzen?«
»So ist es«, antwortete der Elf leise. »Seit Tagen sammeln sich Krieger aus der Umgebung in der Stadt. Wir wenigen Elfen und auch einige Handel treibende Zwerge aus dem Westen verlassen mit den Schiffen vom Hafen aus oder zu Fuß diese Gegend. Keiner möchte in diese Sache der Menschen hineingezogen werden. Außerdem droht die Gefahr der Seuche, der niemand begegnen möchte.« Und etwas leiser fügte er hinzu: »Es wäre auch für euch beide besser, die Stadt schnellstmöglich zu verlassen. Noch heute Abend bei Sonnenuntergang wird der Fürst auf dem großen Platz sprechen. Was er zu sagen hat, könnt ihr euch sicher schon denken. Ich für meinen Teil werde nicht länger in dieser verfluchten Menschenstadt verweilen.« Er erhob sich und nickte Amil freundschaftlich zu. »Und wenn ich euch noch etwas raten darf – geht, so lange ihr die Möglichkeit dazu habt. Der Fürst hat mit Sicherheit kein Interesse daran, dass Nomendi sich in seiner Stadt aufhalten«, sagte er und kehrte in die Dunkelheit der Ecke zurück, aus der er gekommen war.
Amil seufzte schwer, nahm einen letzten kräftigen Schluck aus seinem Krug und wandte sich Emiron zu. »Du hast Celborn gehört. Wenn der Fürst noch heute auf dem Platz sprechen will, ändert das an unserer Aufgabe zwar nicht maßgeblich etwas, es spricht jedoch dafür, sich damit zu sputen. Gehen wir also hin.« Er machte Anstalten, sich zu erheben.
Aber Emiron hatte so vieles gehört, dass die Fragen nur so aus ihm herausplatzten. »Meister, was meinte er mit sie? Woher kennt Ihr diesen Elfen eigentlich? Es kommt mir seltsam vor, dass er sich in solch einem Gasthaus aufhält.«
Amil sah ihn an. Ein kleines Lächeln spielte um seine Lippen, jedoch blieb sein Blick ernst. »Oft trifft man Dinge an Orten an, wo man sie am wenigsten vermutet«, antwortete er ruhig. »Doch genug davon. Es ist gefährlich, hier darüber zu sprechen. Lass uns zur Versammlung gehen, bevor die besten Plätze vergeben sind. Behalte deine Fragen einstweilen für dich. Du wirst die Antworten schon noch erhalten.«
Sie standen auf und verließen den Schankraum. Emiron verstand, dass Amil ihm sicher einiges erklären wollte, die Zeit aber jetzt dafür nicht reichte. Er mochte es zwar nicht, wenn er ihn immer noch wie ein Kind behandelte, das die wichtigen Dinge nicht versteht, erhob aber aus Respekt keine Einwände. Er würde ihm seine Fragen schon noch beantworten müssen.
Sie gingen an den Stallungen vorbei auf eine der engen Gassen zu, von wo sie gekommen waren. Die wenigen Verkaufsstände waren fast alle verschwunden. Emiron vermutete, dass die Besitzer sich ebenfalls zum großen Platz im Zentrum der Stadt begeben hatten. In den Gassen war es schmutzig und eng. So selbstsicher, wie sein Meister voranging, stand es für Emiron fest, dass er schon oft hier gewesen war. Sie kamen bald auf die große gepflasterte Straße zurück, auf der jetzt wenige Menschen anzutreffen waren. Zwerge oder Elfen sah er nicht mehr.
Amil gab ihm ein Zeichen, und sie zogen ihre Kapuzen wieder tief übers Gesicht. Schnellen Fußes schritten sie die Straße entlang. Der Weg wurde breiter und mündete in einen großen Platz. In seiner gepflasterten Mitte erhob sich eine mächtige Eiche, deren dichtes grünes Blätterdach einen schattigen Fleck auf den gepflasterten Platz warf. Der Stamm war von einer kleinen Mauer eingefasst, die auch als Sitzfläche diente. Um den großen Versammlungsort herum standen einige modernere Fachwerkhäuser. Viele Schilder schwangen dort über den Türen. Emiron sah das Gasthaus »Zum lachenden Schwein«, und ein besonders großes Schild verkündete, dass die beste Schmiede die von »Ratichlen« sei und man nirgends sonst so gute Schwerter, Messer und Äxte bekäme. Etwas weiter vorne befand sich ein Podium aus Holz, das die große Menschenmenge ringsum überragte. Es gehörte nicht recht hierher und wirkte übereilt erbaut. Hunderte, vielleicht sogar mehr als tausend Menschen waren bereits auf dem Platz versammelt. Unter ihnen konnte er viele Soldaten ausmachen, aber auch Bauern, die – mit einfachem Werkzeug wie Mistgabeln und Sicheln bewaffnet – erwartungsvoll zum Podium schauten. Händler sah er nicht und auch keine Zwerge oder Elfen. Bei einem zweiten Blick zu den nahen Häusern erkannte er, dass sämtliche Läden geschlossen hatten. Offenbar ging das handelnde Volk von dem öffentlichen Platz fort oder hatte sich der Menschenmasse angeschlossen.
Unmittelbar hinter dem Versammlungsort führte die gepflasterte Straße zu einem Festungshügel. Dieser überragte das übrige Stadtgebiet und war deswegen schon aus einiger Entfernung gut zu erkennen. Die Festung auf der Kuppe war aus massivem, dunklem Stein erbaut. Von hier aus regierte der Fürst von Enhor über das Treiben und den Handel der Stadt.