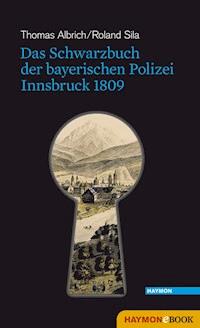
Das Schwarzbuch der bayerischen Polizei E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im November 1809 verfasst die bayerische Polizei ein Schwarzbuch, in dem sie die wichtigsten Haupt- und Nebenfiguren des Tiroler Aufstandes in kurzen Charakterporträts vorstellt: "Character-Züge von den vorzüglichsten Männern, die während der Insurrektion in Innsbruck gehandelt haben". Das Schwarzbuch eröffnet ebenso bemerkenswerte wie irritierende Einblicke, wie die Tiroler Aufständischen durch die bayerische Polizei beurteilt wurden. So scheinen etwa Andreas Hofer und andere Leitgestalten des Volksaufstandes wie Pater Haspinger nicht an den vordersten Stellen des Schwarzbuches auf, Josef Speckbacher wird überhaupt nicht erwähnt. Die Hauptfeinde sahen die Bayern offenbar nicht in den heutigen Helden des Aufstandes von 1809, sondern in den offiziellen Vertretern der österreichischen Monarchie - Offizieren und Beamten - sowie in den Vertretern der Kirche. Diese erste, mit einem ausführlichen biografischen Kommentar erweiterte Edition des Schwarzbuches bildet so eine überraschende und aufschlussreiche Ergänzung der Auseinandersetzung mit den Ereignissen des Jahres 1809 aus einem authentischen Blickwinkel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Albrich/Roland Sila
Das Schwarzbuchder bayerischenPolizeiInnsbruck 1809
© 2010HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7723-1
Umschlag- und Buchgestaltung:Kurt Höretzeder, Büro für Grafische Gestaltung, Scheffau/TirolMitarbeit: Ines GrausCoverfoto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, FB 1673/1, kolorierter Kupferstich, 1786
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
Inhaltsverzeichnis
1.
Das Schwarzbuch der bayerischen Polizei in Innsbruck 1809
ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTE
INHALTLICHES ZUM SCHWARZBUCH
2.
Der Aufstand aus bayerischer Sicht: Innsbruck und Tirol im Frühjahr 1809
3.
Der Weg zur Tiroler Niederlage: Mai bis November 1809
4.
Character-Züge von den vorzüglichsten Männern, die während der Insurrektion in Innsbruck gehandelt haben
5.
Biografischer Anhang
6.
Anhang
PERSONENREGISTER
ORTSREGISTER
BIBLIOGRAFIE
BILDNACHWEIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AUTOREN
1.
Das Schwarzbuch der bayerischen Polizei in Innsbruck 1809
„Die baierische Polizei in Innsbruck hat es sich während der Wirren in Tirol zu Anfang dieses Jahrhunderts, angelegen sein lassen, sich wenn sie es auch nicht immer verständlich1 gekonnt hat, so doch durch charakteristische Schilderungen mit den hervorragendsten2 Männern, die bei der Erhebung Tirols3 waren, bekannt4 zu machen. Sie hat sich zu ihrem Privatgeb[rauch] ein Schwarzbuch angelegt.5
Es läßt sich einem solchen Documente nicht das Interesse für die Geschichte der damaligen Zeit absprechen & aus diesem Grunde haben wir uns von dem in der kgl. Hofbibliothek in München hinterlegten Originale eine getreue Abschrift verschafft u. veröffentlichen es nun. – Wir dürfen wohl nicht fürchten die6 Nachkommen oder Verwandten der in diesem Schwarzbuche geschilderten Persönlichkeiten7 durch diese Veröffentlichung zu verletzen, hier erscheinen sie ja nur in dem Lichte, in dem sie durch die Brillen der damaligen baierischen Polizei8 gesehen wurden.9“10
Aus diesen Anmerkungen lässt sich schließen, dass geplant war, das Schwarzbuch um 1850 in gedruckter Form einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, ein Unterfangen, das allerdings erst mit der hier vorliegenden Publikation umgesetzt wird. Es bleibt aber unklar, wer die Abschrift in Auftrag gegeben hat. Das, was hier jener unbekannte Schreiber festgestellt hat, der zum ersten Mal das Schwarzbuch edieren bzw. drucken wollte, gilt prinzipiell auch für den vorliegenden Band.
ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTE
Das Schwarzbuch ist in drei verschiedenen Varianten nachweisbar. Ein Exemplar dieser Handschrift, auf das sich auch die spätere Geschichtsschreibung bezieht, findet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek in München11, der ehemaligen königlichen Hofbibliothek des Königs von Bayern. Im Jahr 1866 wird diese Handschrift erstmals in einem gedruckten Bibliothekskatalog nachgewiesen12. Dort wird sie wie folgt beschrieben: „Charakterzüge von den (102) vorzüglichsten Männern, welche während der Insurrection in Innsbruck (1809) gehandelt haben. (Eine Art schwarzes Buch über die Tiroler Patrioten.)“. Der schmale Band, der 19 Blätter umfasst, beinhaltet mit großer Wahrscheinlichkeit eine Reinschrift des Schwarzbuches, jedenfalls sind keine Durchstreichungen bzw. Anmerkungen im Text zu finden. Die Transkription im vorliegenden Band bezieht sich auf diese Fassung des Schwarzbuches. Es fehlen allerdings Hinweise, wer der Schreiber (oder die Schreiber) des Textes war. Es ist auch kein Vermerk vorhanden, wann die Handschrift in die Hofbibliothek integriert wurde.
Die zweite Fassung, die sich ebenfalls in München befindet, wird im Staatsarchiv München verwahrt.13 Sie ist mit einem Umschlag versehen, der mit „Acta des Ministeriums des Koeniglichen Hauses und des Auessern“ betitelt ist. Handschriftlich hinzugefügt sind die Anmerkungen „General-Commissariat des Innkreises. Tyroler Insurrection“ und „Charakter-Züge der vorzüglichsten Tyroler Insurgenten“.
Hier könnte es sich sogar um eine etwas ältere Fassung handeln, zumindest sind die letzten zwei Biografien von anderer Hand geschrieben. Es finden sich leichte Abweichungen zu unserer Vorlage, allerdings nur in sprachlicher, nicht in inhaltlicher Hinsicht. Auch hier dürfte es sich um eine Reinschrift handeln, da kaum Durchstreichungen oder zusätzliche Anmerkungen zu finden sind. Über die Herkunft des Manuskripts oder dessen Verfasser liefert auch diese Handschrift keine Informationen, außer, dass sie vom Generalkommissariat des Innkreises in Innsbruck stammt.
Zusammengestellt wurde das Schwarzbuch jedenfalls unmittelbar nach dem letzten Gefecht am Bergisel am 1. November 1809.
Die jüngste der drei Handschriften, die auch Anstoß für die Entstehung des nunmehr vorliegenden Buches war, befindet sich in der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum14. Es handelt sich um eine Abschrift des Exemplars der Bayerischen Staatsbibliothek. Sie ist eingebunden in einen Kodex, der auf dem Umschlag den Titel „Die Geschichte der Erhebung Tirols in den Jahren 1809 und 1813“ in goldener Farbe eingeprägt trägt. Der Band wurde im Jahr 1885 dem Ferdinandeum zum Geschenk gemacht, und zwar vom Innsbrucker Verleger Anton Schumacher (1832–1918), der die Übergabe mit folgendem Brief begleitete:
„An die verehrliche Vorstehung des Museums Ferdinandeum hier.
Hiermit übergebe ich derselben meine Sammlung von Documenten zur Geschichte Tirols in der Zeit Napoleon’s I. Dieselbe besteht aus 4 Bänden mit N: 1 bis 4 und 4 Cartons mit N: 5 bis 8 bezeichnet zum Eigenthum, mit der Beschränkung jedoch, daß wenn sich der ursprüngliche Eigenthümer der Bände II, III, IV dereinst melden sollte, – dieselben liegen schon bei 15 Jahren bei mir, ohne daß irgend Jemand bis jetzt einen Anspruch auf dieselben erhoben hätte, – sie ihm nicht vorenthalten werden dürfen.
Innsbruck 16. September 1885
Ergebenst
Ant. Schumacher“15
Jener Band, der die Innsbrucker Abschrift des Schwarzbuches beinhaltet, dürfte der erste Band der Schenkung sein. Er befand sich also im Privatbesitz Schumachers, der ein Enkel des Innsbrucker Bürgermeisters von 1809, Casimir Schumacher, war. Dieser Casimir Schumacher ist im Schwarzbuch auch beschrieben.
Es liegt nun die Vermutung nahe, dass die Dokumente dieses Sammelbandes zum größten Teil von Casimir Schumacher zusammengetragen wurden. Zum einen hatte er als Zeitzeuge Zugang zu den Schriften, zum anderen sind auch Dokumente aus der Hand von Casimir Schumacher, so eine Rechnungslegung16 oder seine Anträge zur Feststellung seiner Schuldlosigkeit bei den bayerischen Behörden17, im Original vorhanden. Der Großteil der Dokumente stammt aus jener Zeit, als Schumacher Bürgermeister der Stadt war, so Originalbelege von Hormayr, Morandell und anderen Freiheitskämpfern. Allerdings dürfte der Band erst später angelegt worden sein. Dafür spricht als erstes die Bindung, die eine Zuordnung auf Mitte des 19. Jahrhunderts erlaubt. Auch sind Abschriften von Originaldokumenten vorhanden, die im Ferdinandeum verwahrt werden, das erst 1823 gegründet wurde.
Zu guter Letzt spricht auch die Abschrift des Schwarzbuches dafür, denn sowohl von der Schrift als auch von der zeitlichen Zuordnung wurde diese Kopie frühestens um 1850, also beinahe 40 Jahre nach dem Tod Casimir Schumachers angelegt.
Obwohl man den ersten Versuch einer Edition vor 150 Jahren aufgegeben hatte, wurde in der Vergangenheit immer wieder auf das Manuskript Bezug genommen, und Teile daraus wurden auch verschiedentlich publiziert. So wurden etwa 1932 in der Neuesten Zeitung acht Biografien abgedruckt18. Interessant ist die Auslassung der Person Hofers, die so begründet wurde: „Der Kuriosität halber seien im nachfolgenden einige Beispiele daraus im Wortlaute angeführt, und zwar mit Ausschluß Hofers, dessen Bild, auch aus feindlicher, gehässiger Feder entworfen, doch zu bekannt ist, um hier nochmals wiederholt zu werden.“19
Ausführlicher widmete sich 1969 der ehemalige Kustos der Bibliothek des Ferdinandeums Otto Kostenzer20 in einem Beitrag in der Tiroler Kulturzeitschrift Das Fenster dem Schwarzbuch. Auch hier wurden nur ausgewählte Biografien wiedergegeben, allerdings konnte Paul Flora gewonnen werden, die Biografien mit Zeichnungen zu versehen. Zwei Jahre später zeugten durch Franz-Heinz Hye21 publizierte Auszüge oder zuletzt durch Andreas Oberhofer22 von der Kenntnis des Schwarzbuchs.
INHALTLICHES ZUM SCHWARZBUCH
Worum handelt es sich nun bei diesem Schwarzbuch? Es ist eine wahrscheinlich Anfang November 1809, unmittelbar nach Ende der Kämpfe in Nordtirol geschriebene und von Nummer 1 bis Nummer 102 durchnummerierte Auflistung von biografischen Einträgen von unterschiedlicher Länge und Qualität zu den aus Sicht der bayerischen Polizei in Innsbruck wichtigsten Tiroler Aufständischen. Bei einigen Männern gibt es im Verlauf des Textes noch Ergänzungen zum ursprünglichen Eintrag. Die Einträge können bösartig oder harmlos sein, sie können echte biografische Informationen enthalten oder reine Pamphlete und Denunziationen sein. Das bewog z. B. ganz offensichtlich den Autor des oben erwähnten Berichts in der Neuesten Zeitung im Jahre 1932 die Biografie Hofers nicht zu zitieren, um dem Ansehen des Tiroler Volkshelden nicht zu schaden.
Bei der Lektüre des Originalmanuskripts mit dem Titel „Character-Züge von den vorzüglichsten Männern, die während der Insurrektion in Innsbruck gehandelt haben“ fallen sofort einige Besonderheiten auf, und es stellen sich auch Fragen, die mit dem derzeit vorliegenden historischen Quellenmaterial leider nicht beantwortet werden können. Zum einen: Wer genau hat das Manuskript verfasst? Und zum anderen: Warum sind die Leute in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie aufgeführt sind? Während die erste Frage, wie bereits erwähnt, im Detail unbeantwortet bleiben muss, außer, dass es die bayerische Polizei in Innsbruck war, wird die Sicht auf die zweite Frage nach genauerer Analyse schon klarer. Konkret geht es um die Frage, warum der Tiroler Volksheld Andreas Hofer erst an Position acht aufscheint, während vor ihm an erster Stelle General Johann Gabriel Marquis v. Chasteler de Courcelles, an zweiter Stelle Generalmajor Ignaz Freiherr von Buol zu Bernberg, an dritter Stelle der Schlanderer Major Martin Rochus Teimer, an vierter Stelle Paul Freiherr von Taxis-Bordogna-Valnigra, der Vorpostenkommandant von Innsbruck, an fünfter Stelle der kaiserliche Intendant Joseph Freiherr v. Hormayr zu Hortenburg, an sechster Stelle Anton Leopold von Roschmann und an siebter Stelle der Bozner Diplomat Karl Anton von Menz genannt werden. Diese Reihenfolge bringt die Grundeinstellung der Bayern zum Ausdruck: vier Offiziere und drei österreichische Beamte an der Spitze des Aufstands signalisieren noch „Normalität“ im Krieg. Als der Waffenstillstand von Znaim geschlossen wird, ziehen die meisten Österreicher Ende Juli 1809 aus Tirol ab. Nun erst schlägt die Stunde des Rebellenführers Andreas Hofer! Unter seinem Kommando schlagen die Tiroler die Bayern und Franzosen im dritten Gefecht am Bergisel am 13. August 1809. Nun ist Hofer der Chef der „echten“ Aufständischen, von Österreich verlassen und in den Augen der bayerischen Gegner ein Usurpator.
Die Natur des Kampfes aus der Sicht der Bayern wird durch die folgenden Einträge überdeutlich: Die rückständige Kirche hetzt die Leute gegen die sich selbst als aufgeklärt einschätzenden Bayern auf. Nach Andreas Hofer listen die Bayern von Nummer neun bis Nummer 36 nur Welt- und Ordenspriester auf, wobei hierarchisch der Dekan von Innsbruck, der Abt von Wilten, der Abt von Stams, der Kapuzinerprovinzial, der Kapuzinersuperior, der Servitenprovinzial usw. an der Spitze, gewöhnliche Ordens- und Weltpriester anschließend aufgeführt werden.
Nach drei weiteren Militärs wird mit der Nummer 40 der hohe Innsbrucker Beamte Josef Anton von Stadler genannt, der als erster Berater Hofers und als „eine von den thädigsten Triebfedern der Insurrektion“ eingeschätzt wird. Er führt eine Reihe von weiteren Beamten an, und erst mit der Nummer 47 kommt mit Johann Georg Käßbacher ein Wirt, Kornhändler und Bäckermeister – der erste Mann aus dem Volke! Die weiteren Männer bis zur Nummer 64 sind eine Mischung aus Universitätsprofessoren, hohen Beamten, Kanzlisten sowie einigen echten Aktivisten wie Bauern und Wirte aus Hötting – so Vater und Sohn Joseph sowie Wolfgang Natterer, der Bärenwirt Johann Dollinger und zwei der „Bauernkönige“ Andreas Hofers, Joseph Eller und Franz Josef Huter.
Danach folgt ein „Nachtrag. Zu den Charakter-Zügen derjenigen Männer, die die Insurrektion entweder gebilliget oder belobt, oder geleitet und unterhalten haben“, der die sehr gemischten Biografien von Nummer 65 bis 102 umfasst.
Schaut man sich das Geburtsjahr der führenden Aufständischen an, so reicht dieses von den 1730er Jahren (fünf Personen) bis in die 1780er Jahre (vier Personen). Der älteste ist der 1734 geborene Gubernialrat Josef Egid von Trentinaglia, der jüngste ist der Höttinger Joseph Natterer, geboren 1782. Während die Geburtsjahrzehnte der 1740er, 1750er und 1760er mit 13 bis 17 Personen ziemlich gleichmäßig vertreten sind, ist die größte Zahl der führenden Aufständischen, nämlich 25 Personen, in den 1770er Jahren geboren, also zwischen 30 und 39 Jahre alt.23
Die berufliche Herkunft der Männer ist aufschlussreich: 47 sind Beamte bzw. im öffentlichen Dienst Angestellte, 34 Ordenspriester, 14 Weltpriester, zehn Wirte, sieben Militärs, sechs Professoren, aber nur fünf Bauern!24 Von einem „Bauernaufstand“ kann also schwer die Rede sein, zumindest nicht an der Spitze der Aufständischen.
Bei der regionalen Herkunft ist das Bild eindeutig: 52 der 102 Personen stammen aus Nordtirol, die Mehrheit aus Innsbruck. Südtiroler sind 19 verzeichnet, dazu kommen je zwei aus dem Trentino, aus Salzburg und Vorarlberg sowie je einer aus Kärnten, aus Baden in Deutschland, aus Hessen, aus dem Elsaß und aus Lothringen. Bei 20 Männern konnte die Herkunft nicht eindeutig festgestellt werden. Wo die Herren den Bayern aufgefallen sind, ist ebenso eindeutig: in Innsbruck. Nur wenige der 102 Personen sind in der näheren Umgebung von Innsbruck oder in einem anderen Landesteil Tirols im Zuge des Aufstands in Erscheinung getreten.
Zur Edition: eingebaut in den Originaltext sind einerseits Hinweise auf jene Personen, die zwischen Nr. 1 und Nr. 102 im Schwarzbuch aufscheinen (vgl. Nr. xx), andererseits werden alle anderen erwähnten Personen mit fortlaufenden Nummern zwischen 1 und 63 bezeichnet, deren Kurzbiografie im „Biografischen Anhang“ unter der jeweiligen Nummer zu finden ist.
1Durchgestrichen: dadurch.
2Durchgestrichen: Persönlichkeiten.
3Durchgestrichen: thätig.
4Durchgestrichen: -schaften.
5Durchgestrichen: die Herren sich ein Schwarzbuch angelegt, in dem sie diese Männer in dem Lichte malt ihrer Geschichte sowie in dem sie sie durch ihre Brillen erschienen an sind, sie hat sie angeschwärzt.
6Durchgestrichen: Familien oder.
7Durchgestrichen: zu verletzen.
8Durchgestrichen: durch ihre Brillen.
9Durchgestrichen: hat, und ein Tadl von der Seite kann wohl als das vollgiltigste Lob gelten.
10Es folgen Anmerkungen in anderer Schrift und Bleistift, die leider nicht lesbar sind.
11STABI, Cgm. 5031. Wir danken Dr. Brigitte Gullath von der Staatsbibliothek für ihre unbürokratische Hilfe während der Entstehung dieses Buches.
12Schmeller 1866, 517.
13STAM, MA 7390. Herzlichen Dank an Archivdirektor Dr. Rainer Braun vom Staatsarchiv München, der uns kurz vor Drucklegung noch Kopien des Originals anfertigte und zukommen ließ.
14TLMF, FB 3704/188.
15TLMF, M.A. 1885/324.
16TLMF, FB 3704/136.
17TLMF, FB 3704/148, 149.
18Neueste Zeitung 1932, Nr. 168, 5.
19Ebd., 5.
20Kostenzer 1969, 328–343.
21Hye 1971, 20.
22Oberhofer 2008/2, 62.
23Von 14 ist kein Geburtsdatum eruierbar.
24Insgesamt handelt es sich um 165 Männer, die an irgendeiner Stelle des Schwarzbuchs genannt werden.
2.
Der Aufstand aus bayerischer Sicht: Innsbruck und Tirol im Frühjahr 1809
Am 20. Oktober 1809 schrieb der ehemalige Generalkommissär des Innkreises, Maximilian Graf von Lodron25, seinen langen Bericht „Ueber den Aufruhr in Tirol im April 1809“ an seinen König Maximilian I. Josef von Bayern, der auch von Kreiskanzlei-Direktor Arnold von Mieg26 und Kreisrat Christof Jakob von Heffels27 unterschrieben war. Der folgende Abschnitt ist eine Zusammenfassung dieses Berichts, der im März 1809 beginnt und Ende April endet, und die Lage aus Sicht des höchsten bayerischen Beamten im heutigen Nordtirol und im Vinschgau darstellt.
Ehe noch der bayerische Kreiskanzlei-Direktor Arnold v. Mieg mit der königlichen Entschließung in Innsbruck eintraf, hatten sich schon die unangenehmen Vorfälle in Axams und im Tal von Navis im Landgerichte Innsbruck ereignet. Das waren die ersten Versuche des Volkes, sich den königlichen Truppen bewaffnet zu widersetzen und es zeigte sich, dass der Geist der Meuterei und des Widerstandes bereits in den beiden Landgerichten Innsbruck und Telfs Wurzel gefasst hatte, dass es den Empörern leicht war, sich in abgelegenen Tälern zu jeder sträflichen Unternehmung zu versammeln, sich danach über unwegsame Gebirgsrücken wieder zu zerstreuen und dadurch der verdienten Strafe zu entgehen. Weiters zeigte sich, dass bei den außerordentlichen Vorteilen, welche die Empörer aus der topographischen Beschaffenheit des Landes und der genauen Kenntnis der Lokalitäten zogen, das wenige im Kreise befindliche königliche Militär einer größeren aufrührerischen Macht nur mit äußerster Mühe würde widerstehen können. Überhaupt ließen diese Vorgänge bei der bayerischen Obrigkeit einen höchst gefährlichen Eindruck zurück.
Nach den sträflichen Auftritten in Axams und im Naviser-Tale war im Geiste der Einwohner der Stadt und der Gegend um Innsbruck eine auffallende Veränderung zu bemerken. Hatte sich bis dahin die Abneigung gegen die Regierung nur in engeren vertrauteren Kreisen zu äußern gewagt, so brach sie nun in laute Schmähungen aus. Die höheren Stände gingen dem Volke mit ihrem Beispiele voran. Es vereinigten sich die unterschiedlichsten Äußerungen über die nahe Befreiung durch die österreichischen Truppen sowie prahlerische Schilderungen von den unwiderstehlichen Rüstungen des österreichischen Hofes, die von Mund zu Mund gingen. Die mit allerhöchster Erlaubnis des bayerischen Königs auf Urlaub im Lande anwesenden österreichischen Offiziere trugen ihr Möglichstes zur Verbreitung dieser Gerüchte bei. Männer aus der Klasse der ersten Staatsbeamten hatten kein Bedenken, die anstößigsten Briefe, die sie in gleichem Sinne von ihren Verwandten in Österreich erhielten, allenthalben zirkulieren zu lassen oder diese in ihren Häusern versammelten Zirkeln vorzulesen. Es geschahen Wetten über die Zeit des Einmarsches der österreichischen Truppen. Nur dem königlichen Generalkommissariate, der Polizeidirektion und einigen als treue Untertanen des Königs vom Publikum angesehenen Altbayern wurden alle diese Nachrichten auf das sorgfältigste verborgen.
Das Generalkommissariat war durch eine verlässliche Privatkorrespondenz benachrichtigt, wie Lodron schrieb, dass
„der berüchtigte B. Hormayr zum österreichischen Hofkommissär in Tirol bestimmt, und bereits von Wien zur Armee abgegangen war. Die der Konskription entflohenen jungen Purschen hatten überall laut angekündigt, daß sie in wenigen Wochen vom Kaiser Franz28 und dem Erzherzog Johann29 angeführt, in ihre Heimath zurückkehren, und die Baiern verjagen würden: – ‚Die baierische Herrschaft wird nicht lange mehr dauern‘ – ‚Es wird bald ein anderer Wind im Lande wehen‘ – ‚nächstens wird ein großer Schlag von Außen geschlagen‘ – u.s.w. waren Aeußerungen, die in den letzten Tagen des März und im Anfang April sehr häufig – und meistens von öffentlichen Beamten oder andern angesehenen Personen geschahen – Das gemeine Volk sang Gaßenlieder, in welchen ‚schwarz und gelb, und gelb und schwarz‘ – und ‚das schwarzgelbe Farberl‘ als Refrain vorkamen.“
Das königliche Generalkommissariat sah sich durch alle diese Umstände nicht nur zur äußersten Aufmerksamkeit auf alle militärische Bewegungen und Rüstungen an der Grenze verpflichtet, sondern es versuchte auch dem Faden der Konspiration im Inland und den Wegen nachzuspüren, durch welche die verräterischen Verbindungen mit dem Feinde unterhalten wurden. Zu diesem Zwecke setzte es sich nicht nur mit den königlichen Generalkommissariaten der übrigen südlichen und östlichen Kreise, wo es übrigens mit Ausnahme des durch militärische Gewalt verdrängten Aufstandes in Fleims nirgends zu Tätlichkeiten gekommen war, in Verbindung und bot alles auf, um die ihm untergeordneten Landgerichte und sonstigen Polizei- und Grenzbehörden zur tätigsten Wachsamkeit anzuspornen.
Nach den Erfahrungen, die das königliche Generalkommissariat erst nach dem allgemeinen Ausbruche der Empörung gemacht hat, scheint der Haupt-Impuls zur Revolutionierung des Innkreises vom Vinschgau und Oberinntal ausgegangen zu sein. Leider besaß die Regierung gerade in diesem in mancher Hinsicht wichtigen und gefährlichen Teil des Landes nicht einen einzigen verlässlichen Beamten.
Der Kreiskanzlei-Direktor Arnold v. Mieg nahm bei seiner Rückreise aus München in der zweiten Hälfte des März absichtlich den Weg über Kufstein, um sich mit den königlichen Landrichtern des Unterinntals über die Stimmung der Untertanen ausführlicher zu besprechen. Alle stimmten darin über ein, dass die Kreisbewohner bereit wären, eine in das Land vordringende österreichische Armee mit bewaffneter Hand zu unterstützen. Doch glaubten diese Landrichter damals noch nicht, dass die Empörung der Bevölkerung sogar einer österreichischen Okkupation zuvorkommen würde.
Die königliche Verordnung bezüglich der Aufbewahrung der Waffen des Bürgermilitärs wurde im ganzen Kreise mit großem Unmut aufgenommen. In Innsbruck schrie man laut, dies sei der erste Schritt zur Entwaffnung der Nation, welche die Regierung beabsichtige, und es kostete Mühe, einem unangenehmen Auftritte vorzubeugen.
In dieser Lage befand sich der Innkreis, als man erstmals von ernstlichen Bewegungen österreichischer Truppen an den Grenzen und von Anstalten zum Empfange einer ansehnlichen Truppenzahl zuverlässigere Nachricht erhielt. Generalkommissär Lodron:
„Der glühende Zunder des Aufruhrs lag durch das ganze Land verbreitet: es bedurfte nur des leichtesten Hauches, um ihn zur alles verzehrenden Flamme anzufachen. Das Generalkommissariat verbarg Eurer Königlichen Majestät das schmerzliche Gefühl über die traurige Lähmung nicht, in der es sich aus Mangel einer exekutiven Macht befand. Alle Mittel, welche zu Verhütung der befürchteten Krise in seiner Macht standen, wurden einverständlich mit den Generalkommissariaten des Eisack- und Etsch-Kreises ergriffen, und standhaft angewandt. Allein das Kräftigste – eine hinlängliche Truppenzahl – war nicht vorhanden, und bloße Ermahnungen vermochten auf das schon aufgewiegelte Volk um so weniger wirken, da ihm wohl bekannt war, daß den Befehlen der nötige Nachdruck nicht gegeben werden konnte. So war das Generalkommissariat bei den gefährlichsten und schändlichsten Auftritten in die Kategorie eines bloßen Beobachters herabgesetzt, und musste ruhig zusehen, wie der Übermut der Übelgesinnten täglich stieg, die Verbrechen sich häuften, das Ansehen der Gesetze verschwand, und die fürchterlichste Anarchie mit Riesenschritten herannahte.“
Das königliche Generalkommando in Innsbruck stellte unter dem 31. März 1809 das Ansinnen, dass – um dem Volke die Mittel zum bewaffneten Aufstande zu entziehen –, die Pulverstampfen in allen im Kreise befindlichen Pulvermühlen ausgehoben und in gerichtliche Verwahrung gebracht werden mögen. Das Generalkommissariat durfte es jedoch – so gerne es dem Wunsche des Generalkommandos entsprochen hätte – bei der bereits so hoch gestiegenen Gärung unmöglich wagen, eine Maßregel durch bloße Zivilgewalt vollbringen zu lassen. Es konnte die Verantwortung bezüglich der möglichen Folgen umso weniger auf sich nehmen, als einem bei der Ausführung entstandenem Aufstande die nötige Militärgewalt schwerlich hätte entgegen gesetzt werden können. Es musste demnach der Wunsch des königlichen Generalkommandos wenigstens im Innkreise unerfüllt bleiben: Dagegen vereinigte sich das Generalkommissariat mit der Militärbehörde, um aufs dringendste eine entsprechende Vermehrung der Truppenzahl zu erbitten. Erfolgte nämlich diese notwendige Verstärkung der in allen drei südlichen Kreisen – das war ganz Tirol – nur aus fünf Bataillonen, zwei Escadrons und einer Batterie bestehenden Militärmacht nicht, so war das Schicksal des Landes bei einem wirklichem Ausbruch des Krieges entschieden. Nach den von allen Seiten gegen sie geäußerten Drohungen mussten sich die nach Tirol versetzten königlichen altbayerischen Beamten als Opfer betrachten, welche im glücklichsten Falle nur ihr Leben und den kleinsten Teil ihres Eigentums zu retten hoffen durften.
Alle Beamten blieben auf ihren Stellen, und das königliche Generalkommissariat traf für den als ganz gewiss zu erwartenden Fall der feindlichen Okkupation die notwendigen Verfügungen. Aus dem königlichen Archiv in Innsbruck und aus der Registratur wurden die wichtigsten Dokumente und Akten, insbesondere auch alle die Grenzverhältnisse gegen Österreich betreffenden Urkunden und Berichte ausgeschieden und mit den Militärdepots nach Kempten abgeführt. Die Abrechnung über die Marsch-Konkurrenzgelder wurde auf das schleunigste betrieben. Von den eingegangenen Steuergeldern wurden Abzahlungen an die königliche Finanzdirektion gemacht, und diese jedes Mal aufs schleunigste schriftlich oder mündlich von allen Grenzzwischenfällen in Kenntnis gesetzt. Dass auch diese königliche Behörde von der dringenden Gefahr überzeugt gewesen ist, beweist die von ihr im ersten Drittel des April verfügte Quartals-Zahlung der Besoldungen an die königlichen Staatsdiener. Das Generalkommissariat war vor allem bemüht, die angeordnete Stellung der Militärpferde, welche auch zu voller Zufriedenheit der Militärbehörde beendet wurde, und die Herbeischaffung eines stets disponiblen Vorrats von Brot und Fourage auf vier Tage zu betreiben, welche das königliche Generalkommando für notwendig hielt, um für den Fall, wo neben den äußeren Feinden auch innere zu bekämpfen wären, die Truppen auf ihrem Marsche keinem Mangel auszusetzen. Auch dieser Vorrat kam noch, und zwar mit einer so großen Bereitwilligkeit von Seite der Tiroler Untertanen zusammen, dass man sich des Verdachts nicht enthalten konnte, sie seien sicher, dass sie sich des Gelieferten in Kürze wieder bemächtigen könnten.
Noch war die sehnlichst erwartete bayerische Truppenverstärkung nicht eingetroffen, sondern nur der Durchmarsch einiger provisorischer Regimenter aus Italien zur großen Armee auf Mitte April angekündigt, und man sah schon täglich dem Einrücken der bereits an allen Hauptgrenzpunkten versammelten österreichischen Truppen, von welchen die freie Passage über die Grenze bereits gesperrt worden war, entgegen.
Am 10. April 1809, einem Sonntag, hatten sich viele Landbewohner und darunter auch viele junge Männer in der Stadt Innsbruck eingefunden. Dieser letztere Umstand bestätigte die von den Landgerichten eingegangenen Anzeigen, dass seit kurzem die ins Ausland oder in die Hochgebirge geflüchteten Bauernburschen in Menge zurückkämen. Der ganze Tag verging jedoch ruhig und das Landvolk kehrte am Abend ohne die mindeste Spur von Ausgelassenheit oder besonderer Spannung in die Dörfer zurück. Es war die Windstille, die dem drohenden Gewitter vorhergeht.
Schon seit einigen Tagen hatte das Generalkommissariat von Proklamationen des Erzherzogs Johann an die Tiroler sprechen gehört, welche im Lande zirkulieren sollten, jedoch waren alle Bemühungen, sich eine dieser Proklamationen zu verschaffen, fruchtlos geblieben.
Am 11. April 1809 gleich nach Mitternacht erfolgten plötzlich mehrere Flintenschüsse auf die beim Pulverturme im Westen von Innsbruck befindlichen äußersten bayerischen Militärposten. Sie wiederholten sich immer häufiger, und bei Anbruch des Tags bemerkten die unterdessen verstärkten Posten und ausgesandten Patrouillen auf den Anhöhen des rechten Innufers sich sammelnde Haufen bewaffneter Bauern. Um 6 Uhr morgens erschien der königliche Oberst des 11. Linien-Infanterie-Regiments Oberst Karl Freiherr von Ditfurth30 beim Generalkommissär und erklärte, dass das Generalkommando schon am Abend des vorigen Tages durch Estaffette von einem am 9. April auf die königlichen Detachments im Innerpustertale geschehenen Angriff benachrichtiget worden sei, dass es noch in der Nacht seine Befehle nach Brixen abgehen ließ und so eben einen zweiten Eilboten mit dem Befehle an den dort kommandierenden Stabs-Offizier zur schleunigen Konzentrierung bei Innsbruck gesendet habe. Er drang darauf, die so eben ausrückende Garnison von Seite der Zivilgewalt durch alle dienlichen Mittel zu unterstützen.
Beinahe zu derselben Stunde fielen dem königlichen Polizeikommissär Josef von Schubert31 in Innsbruck zwei Exemplare der von dem österreichischen Hofe an die Tiroler gerichteten empörenden und schändlichen Proklamationen in die Hände. Das Polizeikommissariat fand dieselben beim Leiter der königlichen Finanzdirektion Penz, und man erfuhr, dass dergleichen schon einige Tage vorher bei dem pensionierten Taxator Joas32, dem Stempelamts-Kontrolleur Kapferer33, und dem Exprofessor und Konvential zu Wilten, Röggl34, gesehen worden seien. Es existierten





























